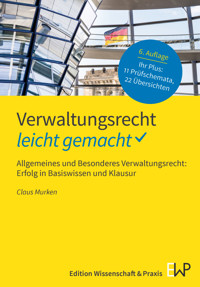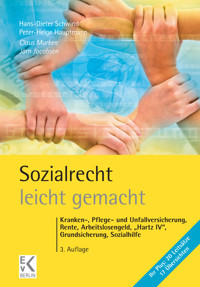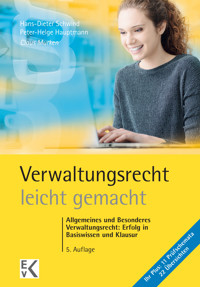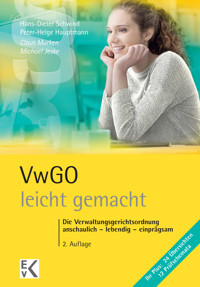
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Wissenschaft & Praxis
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ein erstaunlich umfassendes Taschenbuch. Hier vermitteln zwei erfahrene Rechtsanwälte das Verwaltungsprozessrecht mit seinen interessanten Facetten. Verständlich und lebendig bringt das Team die Themen auf den Punkt. Aus dem Inhalt:
– Zulässigkeit
– Verfahren
– Alle Klagearten
– Rechtsweg
– Vorläufiger Rechtsschutz
Das Buch überzeugt durch klare Sprache und zweckmäßige Strukturierung. Zahlreiche Beispielsfälle erleichtern Verständnis und Umsetzung. Unerlässlich für Prüfung und Praxis.
Ihr Plus: 24 Übersichten und 12 Prüfschemata.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
★★
leicht gemacht®... Fachwissen aus Taschenbüchern
▇Die Gelbe Serie: Recht
▇Die Blaue Serie: Steuer und Rechnungswesen
[1]
GELBE SERIE leicht gemacht®
Herausgeber: Professor Dr. Hans-Dieter Schwind Richter Dr. Peter-Helge Hauptmann
VwGO
leicht gemacht
Die Verwaltungsgerichtsordnung anschaulich - lebendig - einprägsam
2. überarbeitete Auflage
von
Claus Murken
Rechtsanwalt
Michael Jeske
Rechtsanwalt
Ewald v. Kleist Verlag, Berlin
[2]
Besuchen Sie uns im Internet:www.leicht-gemacht.de
Autoren und Verlag freuen sich über Ihre Anregungen
Umwelthinweis: Dieses Buchwurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedrucktGestaltung: Michael Haas, Joachim Ramminger, BerlinDruck & Verarbeitung: Druckerei Siepmann GmbH, Hamburgleicht gemacht® ist ein eingetragenes Warenzeichen
© 2020 Ewald v. Kleist Verlag, Berlin
[3]
Inhalt
I.Grundlagen des Verwaltungsprozessrechts
Lektion 1: Verwaltungsrechtsweg
Lektion 2: Allgemeine Sachentscheidungsvoraussetzungen
Lektion 3: Die verwaltungsgerichtlichen Klagearten im Überblick
II.Die einzelnen Klagearten
Lektion 4: Anfechtungsklage
Lektion 5: Verpflichtungsklage
Lektion 6: Die allgemeine Leistungsklage
Lektion 7: Allgemeine Feststellungsklage
Lektion 8: Fortsetzungsfeststellungsklage
Lektion 9: Verwaltungsgerichtliche Normenkontrolle
III.Vorläufiger Rechtsschutz
Lektion 10: Vorläufiger Rechtsschutz gemäß §§ 80 - 80b VwGO
Lektion 11: Die einstweilige Anordnung gemäß § 123 VwGO
Sachregister.
[4]
Übersichten * Prüfschemata
Übersicht 1 Abgrenzung öffentlich-rechtliche Streitigkeit
Prüfschema 1 Verwaltungsrechtsweg
Übersicht 2 Verwaltungsprozessrechtliche Prüfung
Übersicht 3 Allgemeine Sachentscheidungsvoraussetzungen
Übersicht 4 Die verwaltungsgerichtlichen Klagearten
Übersicht 5 Zulässigkeit der Anfechtungsklage
Übersicht 6 Statthaftigkeit der Anfechtungsklage
Übersicht 7 Begriffsmerkmale des Verwaltungsakts
Übersicht 8 Klagebefugnis
Übersicht 9 Klagebefugnis bei Drittanfechtung
Prüfschema 2 Bestimmung der Widerspruchsfrist
Übersicht 10 Anforderungen an die Rechtsbehelfsbelehrung
Prüfschema 3 Zulässigkeit der Anfechtungsklage
Prüfschema 4 Begründetheit der Anfechtungsklage
Übersicht 11 Statthaftigkeit der Verpflichtungsklage
Übersicht 12 Begründetheit der Verpflichtungsklage
Prüfschema 5 Verpflichtungsklage
Übersicht 13 Arten der allgemeinen Leistungsklage
Übersicht 14 Statthafte Klageart bei Auskunftserteilung
Übersicht 15 Statthafte Klageart bei Geldzahlungen
Übersicht 16 Qualifiziertes Rechtsschutzbedürfnis
Übersicht 17 Öffentlich-rechtliche Vertragsansprüche
Prüfschema 6 Allgemeine Leistungsklage
Übersicht 18 Arten der allgemeinen Feststellungsklage
Übersicht 19 Nichtigkeit gemäß § 44 VwVfG
Prüfschema 7 Allgemeinen Feststellungsklage
Übersicht 20 Erledigung des Verwaltungsakts
Übersicht 21 Varianten der Fortsetzungsfeststellungsklage
Prüfschema 8 Fortsetzungsfeststellungsklage
Übersicht 22 Zulässigkeit der Normenkontrolle
Prüfschema 9 Verwaltungsgerichtliche Normenkontrolle
Übersicht 23 Suspensiveffekt und Ausnahmen
Übersicht 24 Statthaftigkeit des Antrags nach § 80 V VwGO
Prüfschema 10 Zulässigkeit des Verfahrens nach § 80 V VwGO
Prüfschema 11 Statthaftigkeit des Antrags nach § 123 VwGO
Prüfschema 12 Einstweilige Anordnung gemäß § 123 VwGO
[5]
I. Grundlagen des Verwaltungsprozessrechts
Lektion 1: Verwaltungsrechtsweg
Auch die Verwaltung ist nicht unfehlbar. Zwar ist die vollziehende Gewalt gemäß Art. 20 III GG an Gesetz und Recht gebunden, doch liefe diese Bindung leer, wenn sie keinerlei Kontrolle unterworfen wäre. Eine solche Kontrolle zu gewährleisten, sind insbesondere die Verwaltungsgerichte berufen: Sie ermöglichen dem Bürger, mit Hilfe von Rechtsbehelfen eine gerichtliche Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen herbeizuführen. Dadurch wird zugleich dem Gewaltenteilungsprinzip Genüge getan, das eine gegenseitige Kontrolle der drei Staatsgewalten erfordert.
Verfahren, Organisation und Zuständigkeiten der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind in der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO - festgelegt. Verwaltungsprozessrecht ist also das Rechtsgebiet, das sich mit dem Verfahren vor den Verwaltungsgerichten befasst. Gegen Maßnahmen der Verwaltung kann sich der Bürger mit den in der VwGO vorgesehenen Klagen (etwa Anfechtungs- und Feststellungsklagen) und Anträgen (insbesondere auf vorläufigen Rechtsschutz) wehren.
Bereits an dieser Stelle ein kleiner Hinweis: Ohne die in diesem Band angegebenen Paragrafen nachlesen zu können, macht die Lektüre dieses Buchs wenig Freude (und noch weniger Sinn). Auch wenn der tiefe Griff in die Tasche Überwindung kostet, besorgen Sie sich - zumindest wenn Sie es häufiger mit dem Verwaltungs- und Verwaltungsprozessrecht zu tun haben - eine umfassende Gesetzessammlung. Bekannt ist da der „Sartorius“. Die VwGO alleine führt nicht weit genug, da die Beispielsfälle sich in vielerlei verwaltungsrechtliche Rechtsgebiete begeben werden.
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist also der Zweig der deutschen Gerichtsbarkeit, der der gerichtlichen Kontrolle eines Verwaltungshandelns dient. Wann aber ist der Rechtsweg zu ihr eröffnet, d.h. in welchen Fällen müssen die Verwaltungsgerichte (und nicht Zivil-, Finanz- oder Strafgerichte etc.) angerufen werden? Zur Klärung dieser Frage starten wir mit Beispielsfall 1:
[6]
Aufdrängende Sonderzuweisungen
Fall 1
Der Beamte der Bundespolizei B hat im letzten Jamaica-Urlaub neue religiöse Erkenntnisse gewonnen: Um seiner Verehrung für Haile Selassie Ausdruck zu verleihen, lässt er seine Haare lang wachsen und zu Dreadlocks formen. Sein Dienstvorgesetzter D ist von B's neuem Glauben dagegen wenig angetan: Er weist ihn an, zum Friseur zu gehen und sich die „Wursthaare“ wieder abschneiden zu lassen. Tief in seinen religiösen Gefühlen verletzt, will B gegen die Weisung gerichtlich vorgehen. Welcher Rechtsweg steht ihm offen?
Der Verwaltungsrechtsweg kann auf zwei verschiedene Arten eröffnet sein: Entweder weist eine so genannte aufdrängende Sonderzuweisung oder die Generalklausel des § 40 I VwGO einen Rechtsstreit den Verwaltungsgerichten zu.
Aufdrängende Sonderzuweisungen sind gesetzliche Bestimmungen, die eine Streitigkeit ganz explizit der Verwaltungsgerichtsbarkeit zuordnen: So heißt es in § 126 I BRRG, der mit Abstand bedeutendsten aufdrängenden Sonderzuweisung: „Für alle Klagen der Beamten, Ruhestandsbeamten, früheren Beamten und der Hinterbliebenen aus dem Beamtenverhältnis ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.“
Ist in der Prüfung eine beamtenrechtliche Streitigkeit zu bearbeiten, ist der Verwaltungsrechtsweg mithin in aller Regel bereits nach § 126 BRRG eröffnet. Ein Eingehen auf die Voraussetzungen des § 40 I VwGO erübrigt sich dann. Weitere Sonderzuweisungen finden sich etwa in § 54 BAFöG für Streitigkeiten über die Ausbildungsförderung, sowie in §§ 8 IV, 12, 16 III 2 HandwO für bestimmte Streitigkeiten im Rahmen der Handwerksordnung.
In Fall 1 muss B sich daher an das Verwaltungsgericht wenden: Er ist Beamter und will eine Anweisung seines Dienstherren angreifen; gemäß § 126 BRRG ist hier der Verwaltungsrechtsweg eröffnet.
[7]
Generalklausel
Fall 2
F betreibt einen Friseursalon. Die Geschäfte laufen blendend, doch mag F seine Gewinne nicht mit dem Finanzamt teilen: Trotz mehrerer Aufforderungen weigert er sich, Steuern zu zahlen. Die Gewerbeaufsichtsbehörde untersagt dem F daraufhin die weitere Ausübung des Betriebs nach § 35 GewO. F will sich vor Gericht wehren. Welcher Rechtsweg steht ihm offen?
In Prüfung wie Praxis kommen in den meisten Fällen aufdrängende Son-derzuweisungen nicht in Betracht. Die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs ist dann anhand der Generalklausel des § 40 I VwGO zu prüfen.
§ 40 I VwGO stellt an den jeweils zu entscheidenden Rechtsstreit drei Anforderungen für die Eröffnung des Rechtswegs zu den Verwaltungsgerichten:
Zunächst muss es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handeln; insoweit können mitunter schwierige Abgrenzungsfragen zu Privat-rechtsstreitigkeiten auftreten. Die öffentlich-rechtliche Streitigkeit muss darüber hinaus nichtverfassungsrechtlicher Art sein: Die Verwaltungsgerichte sollen sich nicht in die verfassungsrechtliche Willensbildung oberster Staatsorgane einmischen. Schließlich können Spezialvorschriften, so genannte abdrängende Sonderzuweisungen, die Streitigkeit trotz ihres öffentlich-rechtlichen Charakters nichtverfassungsrechtlicher Art anderen Gerichten als den Verwaltungsgerichten zuweisen.
Leitsatz 1
Generalklausel, § 40 I VwGO
§ 40 I VwGO stellt an den jeweils zu entscheidenden Rechtsstreit drei Anforderungen für die Eröffnung des Rechtswegs zu den Ver-waltungsgerichten:
►öffentlich-rechtliche Streitigkeit
►nichtverfassungsrechtlicher Art
►keine abdrängende Sonderzuweisung
[8]
Zunächst gilt es also stets zu klären, ob eine Streitigkeit öffentlich-rechtlich ist. Dies ist dann der Fall, wenn die für die Streitigkeit entscheidenden Normen dem öffentlichen Recht zuzuordnen sind. Zur Klärung dieser Frage wiederum muss zuerst die für die jeweilige Streitigkeit maßgebliche Vorschrift aufgefunden werden. In der Regel lässt sich die streitentscheidende Norm ohne größeren Aufwand eindeutig feststellen: So ist in Abwehrfällen die Norm, die der angegriffenen Belastung zugrundeliegt (sog. Ermächtigungsgrundlage) streitentscheidend. In Leistungsfällen hingegen ist streitentscheidende Norm diejenige, nach der die begehrte Leistung erfolgen würde (sog. Anspruchsgrundlage).
In Fall 2 handelt es sich unproblematisch um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit. Streitentscheidende Norm ist § 35 GewO, die Ermächtigungs-grundlage der Gewerbeuntersagung. Diese ist dem öffentlichen Recht zuzuordnen. Da es sich nicht um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit handelt und auch abdrängende Sonderzuweisungen nicht ersichtlich sind, ist für das Anliegen des F der Verwaltungsrechtsweg eröffnet.
Hausverbot
Fall 3
Inspiriert von einer durchzechten Partynacht kommt Partykönig P eine Geschäftsidee: Er will eine Diskothek eröffnen. Trotz hämmernder Kopf-schmerzen eilt er voller Tatendrang in das nahe liegende Rathaus der Stadt K und beantragt eine Gaststättenerlaubnis, schließlich will er in seiner Disko alkoholische Getränke ausschenken dürfen. Als der Beamte B ihm erklärt, dass er noch einige Unterlagen, u.a. ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müsse, schlägt die Euphorie des P in Wut um: Erbost ob dieser „bürokratischen Förmelei“ beleidigt er B unflätig. B erteilt ihm daraufhin ein Hausverbot für das Rathaus. P will gegen das erteilte Hausverbot gerichtlich vorgehen. Handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit?
Eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit liegt nach dem Vorgesagten vor, wenn die streitentscheidende Norm dem öffentlichen Recht zuzuordnen ist. In einigen Konstellationen jedoch ist das Auffinden der für die Streitigkeit maßgeblichen Vorschrift nicht unproblematisch, insbesondere weil mehrere Normen als streitentscheidend in Betracht kommen (und von ihnen eine dem Privatrecht, die andere dem öffentlichen Recht angehört) [9]oder eine gesetzliche Regelung gänzlich fehlt. Dies ist insbesondere bei Hausverboten, Verträgen zwischen Bürger und Verwaltung, Gewährung bzw. Rückforderung von Subventionen sowie Realakten der Fall.
Bei Hausverboten, die eine Behörde für die Räumlichkeiten gegenüber dem Bürger verfügt, kommen nämlich sowohl zivilrechtliche Vorschriften (insb. §§ 859, 1004 BGB) wie auch die öffentlich-rechtliche Sachherr- schaft als streitentscheidend in Betracht. Nach herrschender Meinung ist für die Frage des Rechtswegs nach dem vom Besucher verfolgten Zweck abzugrenzen: Ging es diesem, als ihm das Hausverbot erteilt wurde, um ein öffentlich-rechtliches Anliegen, so ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. In anderen Fällen (also etwa bei Wahrnehmung privatrechtlicher Angelegenheiten oder einem Betreten außerhalb der Zweckbestimmung) stützt sich das Hausverbot hingegen auf die Vorschriften des BGB; eröffnet ist dann der Zivilrechtsweg.
In Fall 3 müsste P also nach beiden Auffassungen gegen das erteilte Hausverbot vor dem Verwaltungsgericht vorgehen. P ging es um eine Gaststättenerlaubnis, also ein öffentlich-rechtliches Anliegen (§ 2 GastG), als ihm das Hausverbot erteilt wurde. Es handelt sich mithin um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit.
Zum besseren Verständnis hier als Abwandlung Fall 4:
Fall 4
P begibt sich nach Ablauf des Hausverbots erneut ins Rathaus - diesmal allerdings in der Absicht, Tickets für die in seiner Disko stattfindende „Luftgitarren-Meisterschaft“ zu verkaufen. Zu seinem Unmut können sich hierfür weder die Schlange stehenden Bürger noch die anwesenden Beamten begeistern. Er bekommt erneut einen Wutanfall und wird von Behördenleiter L des Hauses verwiesen. Vor welcher Gerichtsbarkeit kann P gegen das folgende Hausverbot vorgehen?
P hat in Fall 4 das Rathaus zur Wahrnehmung privatrechtlicher Angelegenheiten betreten: Er will dort Eintrittskarten verkaufen. Das Hausverbot erfolgt daher auf Grundlage von §§ 859, 1004 BGB. P müsste hiergegen vor der Zivilgerichtsbarkeit klagen. Eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit liegt nicht vor, da die streitentscheidenden Normen nicht dem öffentlichen Recht zuzuordnen sind.
[10]
Verträge zwischen Bürger und Verwaltung
Fall 5
Der Bürgermeister B der beschaulichen Gemeinde G ist ein großer Fan eines süddeutschen Sportwagenherstellers. Um die Angestellten seines Rathauses stärker zu motivieren, gedenkt er, den Dienstwagenfuhrpark der Gemeinde etwas aufzubessern. Er bestellt bei Autohändler A zwanzig PS-starke Cabrios eben dieses Sportwagenherstellers. A liefert die Fahrzeuge und übersendet die Rechnung. B ist entsetzt: Das Budget seiner Gemeinde hat er weit überzogen. Trotz mehrerer Mahnungen des A bleibt die Rechnung unbezahlt. A beauftragt schließlich seinen Rechtsanwalt R, den Kaufpreis einzuklagen. Vor welcher Gerichtsbarkeit wird R Klage erheben?
Trifft die Verwaltung mit dem Bürger vertragliche Vereinbarungen, so ist bei einer Streitigkeit fraglich, ob die Verwaltungs- oder die Zivilgerichte anzurufen sind. Die Behörden können nämlich sowohl verwaltungsrechtliche (§§ 54 ff VwVfG) wie auch zivilrechtliche Verträge (nach dem BGB) mit dem Bürger abschließen. Als streitentscheidend kommen bei derartigen Abreden demnach sowohl die öffentlich-rechtlichen Normen der §§ 54 ff VwVfG als auch die privatrechtlichen des BGB in Betracht.
Für die Abgrenzung maßgebend ist der Vertragsgegenstand: Ist Ver-tragsgegenstand ein privatrechtliches Rechtsverhältnis so handelt es sich bei der getroffenen Vereinbarung um einen Vertrag des Privatrechts: Bei einer Streitigkeit entscheidende Normen sind mithin die des BGB, eröffnet ist dann der Zivilrechtsweg. Handelt sich bei der Vereinbarung zwischen Verwaltung und Bürger dagegen um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag im Sinne der §§ 54 ff VwVfG (etwa Verpflichtung der Behörde zur Erteilung einer Bauerlaubnis; im Gegenzug öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Bürgers zur Schaffung von Stellplätzen), ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet.
In Fall 5 wird R daher im Namen von A Klage vor der Zivilgerichtsbarkeit erheben. R hat für die Gemeinde G mit A einen Kaufvertrag nach § 433 BGB abgeschlossen. Die streitentscheidende Norm gehört dem Privatrecht an. Der Verwaltungsrechtsweg ist nicht eröffnet.
[11]
Subventionen
Fall 6
A beantragt staatliche Subventionsleistungen in Form eines zinsgünstigen Darlehens für die Entwicklung von Solarenergiezellen; die zuständige Behörde weist seinen Antrag zurück. A möchte sein Anliegen gerichtlich durchsetzen. Handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit?
Auch bei der Gewährung bzw. Rückforderung von Subventionen kann es zu Abgrenzungsproblemen kommen, ob im Fall einer Streitigkeit öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Normen maßgeblich sind. Der herrschenden Meinung zufolge (sog. Zwei-Stufen-Theorie) ist für die Rechtswegfrage jeweils maßgeblich, auf welcher von zwei zu unterscheidenden Stufen (des „ob“ und des „wie“) das klägerische Begehren einzuordnen ist:
►1.Stufe: Geht es um das „Ob“, also um die Entscheidung, ob eine Subvention zu gewähren oder zurückzufordern ist, so ergeht diese aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften (bspw. Gewährung einer Subvention durch Bewilligungsbescheid, Rücknahme nach § 48 VwVfG).
►2.Stufe: Entzündet sich die Streitigkeit hingegen an Fragen der Abwicklung des Leistungsverhältnisses („Wie“), so ist der Zivilrechtsweg eröffnet: Sie geschieht nämlich durch privatrechtlichen (bspw. Darlehens-)Vertrag.
In Fall 6 ist demnach der Verwaltungsrechtsweg eröffnet: Dem A geht es um das „Ob“ der Subventionsgewährung, sein Begehren ist mithin auf die erste Stufe einzuordnen. Es handelt sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit.
Fall 7
S stört sich an einer Straßenlaterne, deren Licht bis in seine Schlafgemächer vordringt. Die „fiese Funzel“, wie S sie in seinen Beschwerdebriefen an die Stadt zu nennen pflegt, soll nach dem Willen des Straßenbauamts jedoch an Ort und Stelle verbleiben. S will daraufhin die Gerichte einschalten. Ist die Streitigkeit öffentlich-rechtlich?
[12]