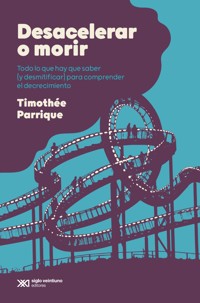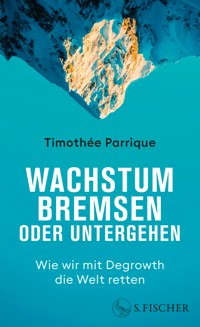
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Eine Grundlagenlektüre mit fundierten Argumenten und Analysen für alle, die beim Thema Degrowth mitreden wollen: Der renommierte Ökonom und Degrowth-Experte liefert eine ökologische Kritik des kapitalistischen Wachstumswahns und zeigt, wie das System geändert werden muss, um sowohl nachhaltiger als auch gerechter zu werden. Parrique räumt zunächst mit den Mythen und Dogmen der Wachstumsökonomie auf. Ein Beispiel ist das Dogma des Bruttosozialprodukts, nach dem dieses steigen muss, um Wohlstand nicht zu gefährden. Ein Mythos – er schlägt vor, genau das Gegenteil zu tun. Denn das BIP misst nicht Wohlstand, sondern die Produktion einer Volkswirtschaft - und üblicherweise wächst bei einem deutlichen Wachstum der Wirtschaft und des BIP auch die Armut. Er erklärt nicht nur, wo die ökologischen, sozialen und politischen Probleme des Wachstums liegen, sondern auch, wie sich Produktion und Konsum zurückfahren lassen, was das für Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet und was dabei wichtig ist: Eine demokratische Steuerung der Produktion auf der Grundlage sozialer Gerechtigkeit zum Beispiel ist unerlässlich. Überzeugend widerlegt Parrique die 12 wichtigsten Kritikpunkte an der Wachstumsbegrenzung, wie den Vorwurf, sie sei unwirksam, würde zu Armut führen und Verzicht bedeuten, oder sie sei innovationsfeindlich oder gar totalitär. Seine Vision ist eine nachhaltige und sozial gerechte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, und er zeigt Wege auf, wie dies erreicht werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Timothée Parrique
Wachstum bremsen oder untergehen
Wie wir mit Degrowth die Welt retten
Über dieses Buch
Wir streben nach grenzenlosem Wachstum auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen. Dadurch beschleunigen wir die Klimakatastrophe, Armut und Ungleichheit nehmen weiter zu. Der Degrowth-Experte Timothée Parrique erklärt, warum wir unser Wirtschaftssystem grundlegend neu denken müssen: Wir brauchen ein System, das den Konsum nicht weiter ankurbelt, sondern unsere Bedürfnisse auf effiziente Weise zu befriedigen vermag. Eines, das nicht Profite, sondern den Menschen und damit den sozialen Fortschritt und die Ökologie in den Mittelpunkt stellt.
Der Wirtschaftsexperte liefert eine konkrete Vision für ein solches zukunftsfähiges Wirtschaftssystem. Er zeigt, wie eine Wirtschaft auch ohne Wachstum florieren kann, wie der Übergang in die Postwachstumsökonomie gelingen kann, und warum wir alle von einem solchen Wandel profitieren würden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Timothée Parrique, geboren 1989 in Versailles, ist Wirtschaftswissenschaftler und an der Universität Lund (Schweden) im Bereich der ökologischen Wirtschaftsforschung tätig. Seine Doktorarbeit aus dem Jahr 2019 beschäftigt sich mit den wirtschaftlichen Auswirkungen von Degrowth. Er ist in der internationalen Degrowth- und Klimaschutz-Bewegung sehr bekannt und zählt zu den wichtigsten Kritikern des Wachstumsprinzips.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© Èditions du Seuil, September 2022
Covergestaltung: Kosmos Design
ISBN 978-3-10-491987-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Inhalt
Einleitung Die Ökonomie, eine Frage von Leben und Tod
1 Das geheime Leben des BIP
Die anthropologische Ökonomie
Die Geschichte des BIP
Die Grenzen des BIP
Wachstum: Eine Frage der Größe und Geschwindigkeit
Die Bestandteile der Wirtschaftsaktivität
Die Natur und die Werkzeuge
Die Arbeitszeit
Die Institutionen
Technischer Fortschritt und ökonomischer Fortschritt
Die Wachstumsmotoren
Die Ideologie des Wachstums
2 Die unmögliche Entkopplung
Grünes Wachstum und Entkopplung
Die Entkopplung: Fake News
Problem Nr. 1: Wir reden nur vom Kohlenstoff
Problem Nr. 2: Wir zählen die Importe nicht mit
Problem Nr. 3: Die Entkopplung ist oft nur temporär
Problem Nr. 4: Die Größenordnungen reichen nicht
Problem Nr. 5: Die Wachstumsraten sind winzig
Eine unwahrscheinliche Entkopplung
Grenze Nr. 1: Steigende Energiekosten
Grenze Nr. 2: Die Rebound-Effekte
Grenze Nr. 3: Der ökologische Fußabdruck von Dienstleistungen
Grenze Nr. 4: Die Grenzen des Recyclings
Grenze Nr. 5: Die technologischen Hemmnisse
3 Markt contra Gesellschaft
Die Sphäre der Reproduktion
Das Zeitbudget der Wirtschaft
Das magische Phantasma der Innovation
Lässt uns der »technische Fortschritt« wirklich Zeit gewinnen?
Der Widerspruch der sozialen Reproduktion
Trauriges Wachstum
Was bedeutet Kommerzialisierung?
Die Korrumpierung von Waren
Die Kommerzialisierung als Auflösung des Sozialen
Die Ökonomisierung der Mentalitäten
4 Falsche Versprechen
Die Armut
Die Ungleichheiten
Die Beschäftigung
Der öffentliche Haushalt
Lebensqualität
5 Kleine Geschichte des Degrowth
Die Vorgeschichte von Degrowth
Die Geburt von Degrowth
Degrowth heute
Degrowth als Forschungsfeld
Degrowth als Handlungsfeld
6 Ein Weg des Übergangs
Eine Reduzierung von Produktion und Konsum
Für eine Verringerung des ökologischen Fußabdrucks
Demokratisch geplant
Im Geiste sozialer Gerechtigkeit
Und in der Sorge um das Wohlbefinden
7 Ein Projekt der Gesellschaft
Eine stationäre Ökonomie
In Einklang mit der Natur
Wo Entscheidungen gemeinsam getroffen werden
Wo der Wohlstand gerecht geteilt wird
Um ohne Wachstum prosperieren zu können
8 Kontroversen
Ein Schreckgespenst?
Schmerzhaft?
Wirkungslos?
Arm machend?
Egoistisch?
Austeritär?
Kapitalistisch?
Innovationsfeindlich?
Unternehmensfeindlich?
Widernatürlich?
Inakzeptabel?
Totalitär?
Schluss Den Kapitalismus aufgeben
Dank
Einleitung: Die Ökonomie, eine Frage von Leben und Tod
9
1 Das geheime Leben des
BIP
2 Die unmögliche Entkopplung
3 Markt contra Gesellschaft
4 Falsche Versprechen
5 Kleine Geschichte des Degrowth
6 Ein Weg des Übergangs
7 Ein Projekt der Gesellschaft
8 Kontroversen
Schluss: Den Kapitalismus aufgeben
317
EinleitungDie Ökonomie, eine Frage von Leben und Tod
Bei dieser Art von Büchern wäre es üblich gewesen, zunächst festzustellen, dass unsere Lage extrem ernst ist. Ich hätte die gewohnte Bestandsaufnahme der ökologischen Kataklysmen und ihrer sozialen Folgen vorgenommen, einige schockierende Zahlen herausgegriffen und mit der einen oder anderen Geschichte garniert, um Aufmerksamkeit zu erregen. Doch warum Zeit verlieren? Jeder weiß, dass es ein Problem gibt, das in der Geschichte der Menschheit ohnegleichen ist. Der Umweltkollaps,[1] mit dem wir nunmehr konfrontiert sind, fordert jeden Tag seinen Tribut an Katastrophen, und nur wenige würden es jetzt wagen, die abgrundtiefe Verantwortung unserer Spezies zu bestreiten.
Willkommen im Anthropozän. So nennen die Wissenschaftler die mit dem Beginn der industriellen Revolution zusammenfallende Zeit, »in der die menschlichen Aktivitäten starke Auswirkungen auf die Ökosysteme der Erde haben und diese auf allen Ebenen verändern«.[1] Es wäre also die Menschheit als Ganzes (anthropos), die skandalöse Sapiens-Familie, der die Verantwortung für die Apokalypse zukommen würde: eine allgemeine Schuld, für die sich jeder Einzelne gleichermaßen zu schämen hätte und die nur kollektiv gesühnt werden könnte.
Wirklich die ganze Menschheit? 2021 besaßen die reichsten 10 % der Haushalte der Welt 76 % des Gesamtvermögens und vereinnahmten mehr als die Hälfte aller Einkünfte, womit sie über 38-mal mehr Vermögen und sechsmal mehr Einkommen verfügten als die ärmste Hälfte der Menschheit.[2] Schlimmer noch: Die reichsten 1 % (lediglich 51 Millionen Menschen) haben 38 % des gesamten seit 1995 geschaffenen Wohlstands empfangen, während die ärmste Hälfte der Menschheit nur 2 % erhalten hat. Die gleiche Situation herrscht in einem Land wie Frankreich, wo das reichste Dezil fast die Hälfte des nationalen Vermögens besitzt und ein Drittel des gesamten Einkommens vereinnahmt.[3]
Wer von einem Recht auf Vermögen spricht, spricht auch von einem Recht auf Verschmutzung. Die reichsten 10 % der Weltbevölkerung sind für die Hälfte der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich.[2] Zwischen Reichtum und Emissionen besteht eine nahezu perfekte Symmetrie. Diese »Verschmutzungselite«[3] verschmutzt viermal mehr als die ärmste Hälfte der Menschheit.[4]
Diese »globale Apartheid«[4] stellt eine doppelte Ungerechtigkeit dar: Die Reichen verschmutzen die Umwelt, und die Armen leiden darunter. Der somalische Fischer, der mitansehen muss, wie seine Fische immer weniger werden und wie der Meeresspiegel steigt, hat wahrscheinlich noch nie ein Flugzeug genommen; er war weder an der Erwärmung, die er erbt, noch an der Überfischung beteiligt. Trotzdem wird er den vollen Preis dafür bezahlen, und zwar als einer der Ersten. Es sind die verwundbarsten Bevölkerungsgruppen, angefangen bei jenen in den ärmsten Ländern, die verschmutztes Wasser trinken, giftige Dämpfe einatmen, in der Nähe von Mülldeponien leben, unter Überschwemmungen und Hitzewellen leiden etc. Der Begriff des Anthropozän täuscht über tiefe Ungleichheiten hinweg: Selbst wenn wir alle derselben Spezies angehören, sind wir weder gleich in Bezug auf die Verantwortung noch in Bezug auf die Gefahren, denen wir angesichts der Umweltkatastrophen von heute und morgen ausgesetzt sind.
Um es klar zu sagen: Der ökologische Kollaps ist keine Krise, sondern eine Misshandlung.[5] Der Klimawandel ist eine »langsame«[6] und diffuse Gewalt, eine Abnutzung, die sich allmählich und außerhalb der Sichtweite vollzieht und heute vor allem die am stärksten verarmten Bevölkerungsgruppen trifft, nach und nach aber die soziale Leiter emporklimmen wird. Diese Situation hat nichts mit einer vermeintlichen menschlichen Natur zu tun, sondern ist vielmehr das Symptom einer spezifischen sozialen Organisation, die eng mit einer bestimmten politischen Weltanschauung verbunden ist. Das ist zumindest die Argumentation, die ich mit diesem Buch vertreten werde: Die Hauptursache für die ökologische Entgleisung ist nicht die Menschheit, sondern der Kapitalismus, die Vorherrschaft des Ökonomischen über alles andere und das hemmungslose Streben nach Wachstum.
Vergessen wir also das Anthropozän und ziehen die Begriffe Kapitalozän, Ökonozän und BIPozän vor.[7] Reden wir nicht um die Sache herum: Die Wirtschaft ist zu einer Massenvernichtungswaffe geworden. Der Ökonom Serge Latouche greift in seinen Schriften die Terminologie von Hannah Arendt auf und spricht von der »ökonomischen Banalität des Bösen«:[8] einem System, das das Massaker am Lebenden orchestriert und gleichzeitig die Schuld derjenigen verwässert, die dafür verantwortlich sind. Jeder macht sich emsig an seine Arbeit und rechtfertigt sein Handeln, indem er sich sagt, wenn er beschließen würde, dies nicht zu tun, würden es andere an seiner Stelle tun.
Wie viele Bankangestellte sind damit beschäftigt, toxische Finanzprodukte zu erfinden, und wie viele Ingenieure bemühen sich, Superyachten zu entwerfen? Wie viele Führungskräfte entlassen aus »ökonomischen« Gründen? Wie viele Werbefachleute werben für schädliche und sinnlose Produkte? Wie viele Schlachthofarbeiter misshandeln und töten Tiere maschinell? Wie viele Lobbyisten lügen, um die Interessen der fossilen Energien zu schützen? Ich muss doch meine Rechnungen bezahlen, werden diejenigen antworten, denen man vorwirft, die Welt zu zerstören. Wenn ich es nicht tue, wird es jemand anderes an meiner Stelle tun.
Diese Gewalt ist ein zutage tretendes Phänomen, eine Art spontane Unordnung, die niemand direkt vorausgeplant hat und die unsere unspektakulärsten sozialen Verhaltensweisen bis zur Absurdität aufrechterhalten. Wir müssen einen Kredit zurückzahlen, eine Rechnung begleichen, die Aktionäre zufriedenstellen, Umsatz machen; wir sind Geiseln eines Systems, das teilweise Verhaltensweisen vorgibt, die ansonsten als unmoralisch gelten würden.
Würden wir unseren Freunden Geld zu Wucherzinsen leihen? Würden wir Werbung machen, um unsere Angehörigen zu nötigen, Produkte zu kaufen, die sie nicht brauchen? Würden wir uns dafür entscheiden, einen Freund zu entlassen, weil jemand am anderen Ende der Welt billiger arbeiten kann? Nein, freilich nicht. Wenn die Kobaltmine in meinem Garten läge und meine Kinder darin arbeiten würden, würde ich es mir zweimal überlegen, ob ich schon wieder ein neues Mobiltelefon brauche.
Dennoch haben wir keine Wahl. Die Ökonomie drängt sich uns mittels bestimmter Regeln auf, die wir vereinbarungsgemäß respektieren müssen: einen Preis, einen Arbeitsvertrag, einen Immobilienkredit, Buchhaltungsrichtlinien. Das Problem ist nicht die Existenz der Ökonomie an sich (jede Gesellschaft hat ihre produktiven Aktivitäten schon immer auf die eine oder andere Weise organisiert), sondern die Regeln, die wir ihr heute geben, sowie das zentrale Ziel, das sie antreibt: Wachstum. Egal, ob es sich um das Einkommen von Individuen, den Gewinn der Unternehmen oder das BIP eines Landes handelt, scheint in der Ökonomie mehr immer gleichbedeutend mit besser zu sein.
Was ist Wachstum? Das Wort ist allgegenwärtig, wird aber nie wirklich erklärt und noch weniger dekonstruiert. Als magisches Argument in Wahlkampagnen, als unverwüstliche Antwort auf die Verzweiflung der Haushalte hat es die Vorstellungswelt unserer Zeitgenossen so sehr durchdrungen, dass keiner von ihnen sich noch verbietet, seine Meinung zu diesem Thema zu äußern. Doch wenige wissen nicht nur, was das Wachstum ist und wie es gemessen wird, sondern auch, welche komplexen Verbindungen es zu Natur, Beschäftigung, Innovation, Armut und Ungleichheiten, Staatsverschuldung, sozialem Zusammenhalt und Wohlstand hat. In den 1930er Jahren aus einem buchhalterischen Begriff (dem Bruttonationalprodukt) geboren, ist es zu einem Mythos mit tausend Konnotationen geworden. Fortschritt, Prosperität, Entwicklung, Schutz, Innovation, Macht, Glück – das Wachstum ist nicht mehr nur ein Indikator, sondern ein symbolisches Gefäß, das mit kollektiven und individuellen Projektionen angefüllt ist.
Grünes Wachstum, kreislaufförmiges Wachstum, inklusives Wachstum, blaues Wachstum; fünfzig Nuancen von Wachstum, aber noch immer Wachstum. Der Einfluss dieser Wachstumsmatrix auf unsere kollektive Vorstellungswelt ist so groß, dass wir uns, anstatt uns über die Folgen unseres Wirtschaftsmodells für den Planeten Gedanken zu machen, um die Auswirkungen der Klimaerwärmung auf das BIP sorgen. Das ist eine verkehrte Welt. Wir können uns unseren Planeten leicht in allen möglichen Dystopien im Stil von Black Mirror vorstellen, sich aber eine Wirtschaft vorzustellen, in der weniger produziert wird als heute, kommt der Häresie gleich.
Früher hatte das Wachstum eine klare Funktion: die Ankurbelung der amerikanischen Wirtschaft nach der Großen Depression, die Herstellung der für den Krieg wichtigen Ausrüstung, die Überwindung des Hungers, die Beseitigung von Armut, die Gewährleistung von Vollbeschäftigung oder den Wiederaufbau Europas. Seine Messung erlaubte, den Fortschritt auf diese verschiedenen Ziele hin einzuschätzen. Im Laufe der Jahrzehnte wurde der Indikator zum Ziel: Wachstum um des Wachstums willen, ohne jeglichen zugrunde liegenden Zweck. Doch produzieren um des Produzierens willen ist ein Ziel ohne Substanz. Wir, die Bewohner der Länder, auf die der Rest der Welt neidisch blickt, opfern weiterhin unsere Zeit und unsere Ressourcen, um mehr zu produzieren und damit auch zu konsumieren, obwohl wir nichts mehr zu gewinnen – und viel zu verlieren – haben, wenn wir auf ein Wachstum unseres BIP bestehen. Man könnte dies mit einem jungen Erwachsenen vergleichen, der gerade sein Wachstum abgeschlossen hat und darauf beharrt, an Größe zunehmen zu wollen, ohne zu begreifen, dass das Wachstum ab einem bestimmten Alter nicht mehr in Zentimetern gemessen wird.
Während ich diese Zeilen schreibe, wird jeder zusätzliche Zentimeter unter Schmerzen erwirkt. Die Erde ist überhitzt, die Gesellschaften befinden sich im Burnout, und das BIP wird zu einer Art »Weltuntergangs-Countdown«.[9] Ein furchterregender, weil exponentieller Countdown: Je größer die Wirtschaft ist, desto schneller wächst sie. Bei einer Wachstumsrate von 2 % pro Jahr verdoppelt sich die Größe der Wirtschaft alle fünfunddreißig Jahre. Wir sitzen in einem Bus, der mit voller Geschwindigkeit und immer schneller auf eine Klippe zurast, und bejubeln jeden weiteren Kilometer pro Stunde als Fortschritt. Das ist grotesk. Das Wachstum zu maximieren bedeutet, auf das Gaspedal zu treten, mit der letztendlichen Gewissheit, in einem sozialen und ökologischen Kollaps unterzugehen.
Man kann von Landung, Verschlankung, Degrowth, Deeskalation, Absenkung, Harmonisierung, Genügsamkeit sprechen oder irgendeine andere Analogie vorschlagen. Die Herausforderung, die vor uns liegt, ist die des Weniger, des Leichteren, des Langsameren, des Kleineren. Es ist die Herausforderung der Genügsamkeit, der Frugalität, der Mäßigung und der Suffizienz. Aber es geht um eine Landung, nicht um einen Absturz; um eine Diät, nicht um eine Amputation; um eine Verlangsamung, nicht um einen Stillstand. Wir wissen, dass wir runterfahren müssen, und müssen uns nun überlegen, wie wir diesen Übergang intelligent planen können, damit er demokratisch, im Bemühen um soziale Gerechtigkeit und Wohlstand erfolgt.
Dazu müssen wir uns von der »Wachstumsmystik«[10] freimachen, das heißt das Wirtschaftswachstum als Phänomen entnaturalisieren. Wir müssen ganz dringend einen kritischen Blick auf Praktiken werfen, die wir als natürlich und universell normalisiert haben.[11] Muss jedes Unternehmen Gewinn machen? Müssen wir die Märkte entscheiden lassen, was produziert werden soll? Muss eine Regierung die Steigerung des BIP anstreben? Das Argument, das ich hier vertreten werde, lautet, Wachstum ist kein Schicksal, sondern eine Wahl.
Die Implikationen dieser These sind weitreichender, als es scheint: Wenn das Wachstum nicht von der menschlichen Natur bedingt ist, sondern vielmehr von bestimmten sozial konstruierten Institutionen, ist es möglich, sich eine Ökonomie vorzustellen, die funktionieren kann, ohne zwangsläufig mehr zu produzieren und zu konsumieren. Das ist die Herausforderung dieses Buches: sich Degrowth als Übergang zu einer Postwachstumsökonomie vorzustellen.
Hier findet sich die Doppeldefinition wieder, die uns durch das ganze Buch leiten wird: »Degrowth« als eine demokratisch geplante Reduzierung der Produktion und des Konsums zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks im Geiste sozialer Gerechtigkeit und in der Sorge um Wohlstand. Degrowth – bis wohin? Antwort: hin zum »Postwachstum«, einer statischen Wirtschaft in Einklang mit der Natur, in der Entscheidungen gemeinsam getroffen werden und der Reichtum gerecht verteilt wird, um ohne Wachstum prosperieren zu können.
Wir stehen vor einer dreifachen Herausforderung: Wir müssen verstehen, warum das Modell der Wachstumsökonomie eine Sackgasse ist (die Verwerfung), wir müssen die Konturen einer Postwachstumsökonomie entwerfen (das Projekt), und wir müssen Degrowth als Übergang zu diesem Ziel begreifen (der Weg).[12] Im Laufe dieser Kapitel vertritt das vorliegende Werk eine simple, aber radikale Idee: Das Wachstum ist zu einem existenziellen Problem geworden. Unser Überleben hängt nunmehr davon ab, ob wir in der Lage sind, das Wirtschaftsmodell zu ändern oder nicht.
Fußnoten
[1]
Gemäß der Definition des Larousse.
[2]
Laut dem »World Inequality Report« (2022, S. 26–27) gehören zu den reichsten 10 % der Welt 517 Millionen Menschen mit einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 7300 € und einem durchschnittlichen Vermögen von 550900 €. Sie besitzen 76 % des weltweiten Vermögens und vereinnahmen 52 % aller Einkommen. Die ärmste Hälfte der Menschheit umfasst 2,5 Milliarden Menschen; sie verdienen im Durchschnitt 230 € im Monat und besitzen im Durchschnitt 2900 € an Vermögen. Diese ärmste Hälfte besitzt nur 2 % des weltweiten Vermögens und erhält nur 8 % des Gesamteinkommens.
[3]
Laut dem »Rapport sur les riches en France« (2022, S. 12–13) besitzen die reichsten 10 % der Franzosen – diejenigen mit einem Mindesteinkommen von 3673 € pro Monat (4,5 Millionen Personen) und einem Mindestvermögen von 607700 € (2,9 Millionen Personen) – 46 % des nationalen Vermögens und beziehen 28 % des gesamten Einkommens vor Steuern.
[4]
Laut einem Bericht von Oxfam (»Confronting carbon inequality«, 21. Sept. 2020) hat eine halbe Milliarde Menschen bereits 56 % des mit Blick auf die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C angesetzten Kohlenstoffbudgets verbraucht, während die ärmsten 2,5 Milliarden Menschen nur 4 % davon verbraucht haben.
1Das geheime Leben des BIP
Zwischen Phänomen und Ideologie
Die Ökonomen preisen es, die Politiker vergöttern es: Das Wirtschaftswachstum ist unser Mantra, das »ständige Bestreben« unserer Wirtschaftspolitik, wie die Website des französischen Wirtschaftsministeriums offen verkündet.[1] Als wahres Barometer unserer modernen Gesellschaften bestimmt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) über Regen und schönes Wetter. Es ist die Zahl, die man kennen muss, die Staatschefs immer wieder betonen, um ihre Stellung unter den großen Nationen zu rechtfertigen, und die die meisten Medien sieben Tage die Woche kommentieren. Überall und gemeinsam soll man das berühmte Wachstum preisen und erhoffen, sei man nun arm, reich, Mieter, Eigentümer, Angestellter oder Beamter.
Aber was ist Wachstum? Ein Anstieg des BIP, werden einige antworten. Aber was ist das? Wachstum als Anstieg des BIP zu definieren ist so, als würde man Wärme als Anstieg der Temperatur beschreiben; das ist eine Beschreibung ohne Erklärung. Wie die Dunkle Materie der Physiker hat auch das Wachstum seine eigenen Geheimnisse, die in den Lehrbüchern der Ökonomie nicht aufgedeckt werden. Sie zu enthüllen ist jedoch notwendig, um zu verstehen, welche Rolle es bei der Krise hat, die wir heute durchmachen. Denn wenn das Wachstum zum Hauptmotor des sozial und ökologisch Unerträglichen geworden ist, ist das Verstehen und Entmystifizieren des Wachstums der einzige Weg, der aus ihm herausführt.
Fußnoten
[1]
Dieses Vokabular bleibt vielleicht allzu leicht in einer spezifischen Beziehung zur Natur stecken. Die Extraktion beinhaltet eine Form von Plünderung und die Elimination eine Ausscheidung in eine Umwelt außerhalb von uns selbst. Einige vormoderne Gemeinschaften werden von einer weniger gewaltsamen Kosmologie angetrieben, die westlichen Ökonomen heute zu denken geben sollte: Wie wäre es, wenn wir »Extraktion« eher als eine »Anleihe« bei Mutter Natur betrachten, für die wir eines Tages bezahlen müssen?
Die Geschichte des BIP
Die anthropologische Ökonomie ist jedoch nicht die Ökonomie, von der man in den Medien hört. Wie kommt es also, dass sich fast der gesamte ökonomische Eisberg unter Wasser befindet? Vor etwa einem Jahrhundert brachte die Revolution der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung das hervor, was heute zur Matrix des Wirtschaftslebens geworden ist: das BIP.
Seine Erfindung geht auf die Große Depression der 1930er Jahre in den USA zurück.[1] Mit ganzen Industrien, die abstarben, einer Flut von Konkursen, dem Zusammenbruch der Börse und einer Erwerbstätigenquote im freien Fall hatte die Ökonomie einen Herzstillstand. Die amerikanische Regierung versuchte verzweifelt, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, konnte aber die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen nicht wirklich einschätzen. 1932 beauftragte sie Simon Kuznets, einen russisch-amerikanischen Ökonomen, der Anfang der 1920er Jahre aus der Sowjetunion gekommen war, mit der Ausarbeitung einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, einer Art Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten. Kuznets hatte dann eine brillante Idee: die gesamte Produktion einer Volkswirtschaft in einer einzigen Zahl zusammenzufassen, dem Bruttonationalprodukt (BNP), dem Vorläufer des Bruttoinlandsprodukts. Kuznets erfand mit anderen Worten eine Art Blutdruckmesser, um den Puls der Ökonomie in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Das war nützlich, weil sich damit die Wirksamkeit staatlicher Interventionen einschätzen lässt. Wenn es steigt, ist es gut, man hat es geschafft, die Wirtschaft wiederzubeleben. Wenn es sich nicht bewegt, keine Wirkung zeigt, muss die Reanimation fortgesetzt und etwas anderes versucht werden. Wenn es weiter sinkt, ist es noch schlimmer.
Nach dem Ende der Krise von 1929 verwendete die Regierung weiterhin dieses Messinstrument, das sich als entscheidend erweisen sollte, um den spektakulären Anstieg der Rüstungsproduktion während des Zweiten Weltkriegs zu organisieren. 1953 veröffentlichten die Vereinten Nationen die ersten internationalen Standards zur Berechnung des Nationaleinkommens nach der Kuznets-Methodik und machten das BNP damit zu einem weltweiten Indikator – mit Ausnahme der Sowjetunion, die bis 1988 die Verwendung des »Nettomaterialprodukts« und des »Bruttosozialprodukts«[1] vorzog, bevor sie den Rahmen der Vereinten Nationen akzeptierte. In den 1990er Jahren wurde das Bruttonationalprodukt (BNP) zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), wobei die wirtschaftlichen Aktivitäten nicht mehr auf der Grundlage ihrer Nationalität (alle französischen Produktionseinheiten, auch die im Ausland, sind Teil des französischen BNP), sondern auf der Grundlage ihres Standorts gemessen werden (nur die in Frankreich ansässigen, seien sie französisch oder nicht, sind Teil des französischen BIP).
Diese statistischen Konventionen sind bis heute im Wesentlichen dieselben geblieben, trotz der fünf Revisionen von 1960, 1964, 1968, 1993 und 2008. Das offizielle Dokument, das erklärt, wie das BIP zu berechnen ist, definiert es als »Summe der Bruttowertschöpfung aller gebietsansässigen institutionellen Einheiten, die Produktionstätigkeiten ausüben«.[2] Die Wertschöpfung ist definiert als »der durch die Produktion geschaffene Wert«, oder genauer gesagt »der Beitrag von Arbeit und Kapital zum Produktionsprozess«. Das BIP-Wachstum ist somit der Anstieg der Summe der von einer Wirtschaft produzierten Wertschöpfung von einem Zeitraum zu einem anderen.
Es ist unmöglich, diese Wertschöpfung zu beziffern, ohne den Bereich der »wirtschaftlichen Produktion« abzugrenzen. Die Entscheidung, ob bestimmte Aktivitäten in den Bereich der Messung einbezogen oder ausgeschlossen werden, beeinflusst maßgeblich unsere heutige Sicht der Ökonomie. Das System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung definiert die Tätigkeiten, die in den Bereich der Wirtschaft einbezogen werden, folgendermaßen: »eine unter der Kontrolle und Verantwortung einer institutionellen Einheit ausgeübte Tätigkeit, die Inputs (Arbeit, Kapital, Waren und Dienstleistungen) einsetzt, um Outputs (Waren oder Dienstleistungen) zu produzieren«. Dies umfasst marktfähige und monetarisierte Tätigkeiten, ergänzt um einige nicht marktfähige Tätigkeiten, deren monetäre Werte leicht beziffert werden können.
Das BIP ist also das Ergebnis einer gigantischen Addition, so als würde ein riesiger Taschenrechner die Summe der gesamten Wertschöpfung der als wirtschaftlich geltenden Produktionen zusammenzählen. Diese Addition kann auf drei verschiedene Arten erfolgen.[3] Man kann entweder die Summe der Wertschöpfungen (Verkaufspreis abzüglich der Vorleistungen, das heißt der für die Produktion eines Guts oder einer Dienstleistung erforderlichen Einkäufe), die Summe der endgültigen Ausgaben (Kaufpreis eines für den Verbrauch bestimmten Produkts) oder die Summe aller Einkommen (Arbeitnehmerentgelt und Betriebsüberschüsse) bilden. Da diese drei Aggregate per Konvention buchhalterische Gleichheiten sind (die Konsumption und die Ausgaben des einen sind zwangsläufig die Produktion und das Einkommen des anderen), führen die verschiedenen Berechnungsmethoden zur selben Zahl: dem BIP.
Man spricht vom Bruttoinlandsprodukt und nicht vom Nettoinlandsprodukt (NIP), da es die »Kapitalminderung« nicht berücksichtigt, anders gesagt den Wertverlust bestimmter Produktionsfaktoren wie die Abnutzung von Straßen, Stromnetzen und Gebäuden. Wenn man nur die Maschinen und Infrastruktur zum Kapital zählt, ist der Unterschied zwischen BIP und NIP vernachlässigbar. Wird der Kapitalbegriff jedoch auf die Natur (Wertminderung des natürlichen Kapitals) und sogar auf die Gesundheit und das Wohl der Arbeitnehmer (Wertminderung der Arbeit) ausgedehnt, kann das Wachstum des BIP durch die von ihm verursachte Schädigung der Ökosysteme und Menschen zunichte gemacht werden – worauf wir zurückkommen werden.
Kuznets’ Idee mag zwar genial sein, aber es wäre falsch zu glauben, dass die Stärke des BIP aus seiner konzeptionellen Einfachheit und der Leichtigkeit seiner Berechnung resultiert. Die meisten Ökonomen wissen nicht, wie diese Zahl berechnet wird, nur eine Handvoll spezialisierter Statistiker beherrscht diese Aufgabe. Sie zu interpretieren erweist sich als nicht weniger riskant, da ihre Ausführung mit vielen Annahmen verbunden ist. Sich über einen Anstieg des BIP zu freuen, ohne zu wissen, wie die Zahl berechnet wird, ist so, als würde man sich darüber freuen, dass sich der Kühlschrank füllt, ohne zu wissen womit.
Fußnoten
[1]
Das in den 1920er Jahren entwickelte »Bruttosozialprodukt« maß den Gesamtwert der Produktion physischer Produkte (Dienstleistungen und staatliche Aktivitäten waren nicht eingeschlossen) und erlaubte, durch Abzug der Vorleistungen das »Nettomaterialprodukt« zu berechnen.
Die Grenzen des BIP
Als Simon Kuznets, der Schöpfer des Bruttonationalprodukts, die unreflektierte Begeisterung beobachtete, mit der die Regierungen es für die staatliche Politik nutzten, schlug er Alarm. Bereits 1934 erklärte er vor dem US-Kongress, dass »der Wohlstand einer Nation schwerlich aus einer Messung des Nationaleinkommens abgeleitet werden kann. Wenn das Nationaleinkommen steigt, warum geht es dem Land dann schlecht? Man muss die Unterscheidungen zwischen der Quantität und der Qualität des Wachstums, zwischen den Kosten und dem Nutzen sowie zwischen der Kurz- und Langfristigkeit bedenken. Das Ziel, das Wachstum zu steigern, sollte die Beschaffenheit und den Zweck dieses Wachstums spezifizieren«.
Der Indikator hat in der Tat mehrere Grenzen.[1] Das BIP ist nur eine selektive und approximative Bezifferung der Produktion, und dies nur gemäß einer bestimmten Wertvorstellung. Es misst nicht die anthropologische Ökonomie, sondern eine vereinfachte und quantifizierbare Darstellung derselben. Natürlich hatten die Statistiker der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung damals keine Wahl, sie mussten den Umfang der Ökonomie reduzieren, um sie anhand der verfügbaren Daten messen zu können. Versetzen wir uns in ihre Lage: Es ist schwierig, physische Mengen zu addieren, die in Körben mit Lauch, in Tonnen von hydroalkoholischem Gel und in Massagestunden gemessen werden. Um die Produktion als Ganzes zu beziffern, addiert das BIP diese Güter und Dienstleistungen anhand des Geldwerts, den sie auf dem Markt haben.
Diese Methode ist nicht perfekt. Zunächst einmal wird die Produktion ohne Geldäquivalent hier nicht oder nur teilweise erfasst. Das BIP misst die Tauschwerte, aber nicht die Gebrauchswerte. Kuznets’ Entscheidung, Produkte über ihren Preis zu bewerten, zwingt uns dazu, alle Dinge auszuschließen, die keinen Preis haben. Wenn ich dieses Buch als Open Access im Internet veröffentliche und eine Rekordzahl von Internetnutzern es liest, wird es nicht im BIP erfasst, da niemand bezahlt wurde, um es zu schreiben. Wenn das Buch jedoch vermarktet wird und ebenso viele Rekordverkäufe verzeichnet, wird es in den Augen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu einem Wirtschaftsgut. In beiden Fällen sind das Buch und seine Leserzahl identisch. In den Augen des BIP ist jedoch alles wertlos, was nicht zu einer monetären Transaktion führt. Sich um seine Kinder zu kümmern, für seine Angehörigen zu kochen, ein Treffen des Stadtteilkomitees zu organisieren – all diese Aktivitäten, die für die Gesellschaft doch wertschöpfend sind, werden im BIP nicht gezählt.
Die gesamte ehrenamtliche Tätigkeit, ohne die unsere Gesellschaft paralysiert wäre, wird aus dem BIP ausgeklammert. Stellen wir uns vor, wie unsere Gesellschaft ohne die 20 Millionen Freiwilligen aussehen würde, die das Vereinsleben in Frankreich in Gang halten.[1] Die Welt des Sports würde ohne all jene, die Amateursportvereine leiten, von einem Tag auf den anderen verschwinden. Les Restos du Cœur, Secours populaire, Action contre la faim, Armée du salut, Croix-Rouge, WWF, Petits Frères des pauvres, Agir pour l’environnement: all diese Organisationen, die nicht wirtschaftlicher sein könnten (weil sie Bedürfnisse befriedigen), werden unterschätzt, um nicht zu sagen ignoriert, weil ein Großteil derer, die dort arbeiten, dies auf freiwilliger Basis tut. Der Verkauf von nutzlosen Produkten trägt BIP-Punkte ein, während die Pflege eines kranken Kindes oder die Aufnahme von ausgesetzten Tieren keine einbringt.
Der Wert der Produktion des öffentlichen Bereichs wird seit den 1970er Jahren bei den Messungen stark unterschätzt. Gesundheit, Bildung und öffentlicher Verkehr werden zwar im BIP erfasst, aber nur in Höhe einiger ihrer buchhalterischen Kosten (hauptsächlich Löhne) und ohne Berücksichtigung ihrer tatsächlichen Wertschöpfung, die ohne die Existenz eines komplett vom Markt bestimmten Verkaufspreises schwer zu beziffern ist. Umgekehrt lässt sich die Wertschöpfung marktbestimmter Tätigkeiten leicht berechnen, indem man die Kosten für Vorleistungen vom Umsatz abzieht, der die Gewinne des Unternehmens einschließt. Die öffentliche Wertschöpfung wird nur anhand der Löhne gemessen, während die private Wertschöpfung anhand der Löhne und Gewinne gemessen wird. Aufgrund dieser Verzerrung trägt die gleiche Dienstleistung mehr zum BIP bei, wenn sie von einem privaten Unternehmen statt von einer öffentlichen Einheit erbracht wird, und dies nicht nur, weil die Löhne in der Privatwirtschaft oft höher sind, sondern auch, weil der Privatsektor über die Gewinne der Aktionäre einen zusätzlichen Produktionsfaktor vergüten muss.
Ein weiterer Kritikpunkt: Bei diesem Ansatz der Addition wird nicht zwischen wünschenswert und schädlich unterschieden. Der BIP-Rechner hat nur eine einzige Taste, und die ist ein »+«. Die Produktion eines Impfstoffs, eines elektrischen Kühlschranks, eines spekulativen Finanzprodukts, von Antidepressiva oder Reinigungsstunden nach einer Ölpest tragen in gleicher Weise zum BIP bei: Diese Produktionen werden nach ihrem Marktwert zum BIP hinzugefügt. Ein hochbezahlter Händler, der mit Lebensmitteln spekuliert, »produziert« so aus Sicht des BIP mehr als eine Kindergärtnerin, die den gesetzlichen Mindestlohn erhält. Die ehrenamtliche Arbeit von Aktivisten, die sich für den Schutz eines Waldes einsetzen, hat keinen Buchwert, während die bezahlten Arbeitsplätze derer, die den Wald kahlschlagen, im Sinne der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung eine Schaffung von Mehrwert darstellen. Ein privates und teureres Bildungssystem wie das der USA stellt einen größeren Beitrag zum BIP dar als ein vergleichsweise weniger teures, aber leistungsfähigeres öffentliches System wie das von Finnland.
Das BIP ist ein quantitativer Indikator, der uns über das Volumen der Geldströme informiert. Da es uns jedoch nichts über die positive oder negative Natur der produzierten Waren und Dienstleistungen sagt, ist sein Wachstum nicht zwangsläufig eine gute Nachricht. Die Statistiker, die das BIPerschaffen haben, waren übrigens die Ersten, die mahnten, dass es niemals ein Indikator für Wohlstand sein wird. »Während das BIP oft als Maßstab für den Wohlstand angesehen wird, erhebt das VGR [System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung] nicht den Anspruch, dieses Ziel zu verfolgen, zumal es mehrere Konventionen übernimmt, die einer Interpretation der Bücher zum Zweck der Einschätzung des Wohlstands entgegenstehen«.[2] Selbst für einen bestimmten Sektor oder ein bestimmtes Produkt spiegeln die Marktwerte die Entwicklung ihrer Qualität nur unzureichend wider. Wenn sich der reale (das heißt inflationsbereinigte) Preis eines Computers in den 1990er Jahren als derselbe erweist wie in den 2010er Jahren, dann wird er im BIP genau gleich erfasst, auch wenn das neueste Modell deutlich leistungsfähiger ist als das alte. Was subtil erscheinen mag, wird problematisch, wenn es um die Messung ganzer Sektoren geht, deren Leistung grundsätzlich qualitativ ist, wie Gesundheit oder Bildung.
Schließlich ist dies vielleicht die schädlichste Schwachstelle: Das BIP abstrahiert von der Natur. In seinem Berechnungsprotokoll wird dies schwarz auf weiß ausgeführt: »Ein rein natürlicher Prozess ohne menschliche Intervention oder Kontrolle ist keine Produktion im wirtschaftlichen Sinne«.[3] Obwohl Bienen Stunden damit verbringen, unermüdlich unsere landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu bestäuben (ein Beispiel für Ökosystemproduktion), werden sie aus dem im BIP ausgewiesenen Mehrwert der Agrikultur ausgeschlossen. Der Baum hat nur einen Wert, wenn er gefällt und verkauft wird, seine eigene Produktion durch die Biosphäre und die Dienstleistungen, die er während seines Lebens erbringt (Herstellung von Sauerstoff, Bindung von Kohlendioxid, Verbesserung der Luft, Stabilisierung des Bodens, Schutz der Biodiversität etc.), zählen hingegen nicht. Oder auch, gemäß einem in einem Lehrbuch genannten Beispiel: »Die unkontrollierte Zunahme der Fischbestände in internationalen Gewässern stellt im Gegensatz zur Fischzucht keine Produktion dar«.
Und wenn die Natur nicht zählt, hinterlässt ihre Zerstörung in den Tabellen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung keine Spuren. Die Waldbrände steigern in fine sogar das BIP durch die Ausgaben, die sie für die Löscharbeiten verursachen. Auch wenn das ökologische Erbe dadurch verkümmert, wird durch die Löhne der Feuerwehrleute und den Verkauf des Benzins für ihre Fahrzeuge ein Mehrwert verbucht. Im letzten IPCC-Bericht heißt es bei der Definition des BIP, dass es »ohne Abzug der Erschöpfung und Zerstörung natürlicher Ressourcen« ermittelt wird.[4] Nach dieser Logik würde zum großen Entsetzen der Umweltschützer die Ausrottung der letzten Mitglieder einer bedrohten Spezies, die in einem Restaurant verkauft und gegessen werden, den »Mehrwert« innerhalb der Wirtschaft erhöhen.
Der Ökonom Éloi Laurent fasst die Situation gut zusammen: »Das Wachstum verbucht treu einen immer unbedeutenderen Teil der menschlichen Aktivitäten: Güter und Dienstleistungen, aber nicht ihre Verteilung; Markttransaktionen, aber nicht die sozialen Bindungen; Geldwerte, aber nicht die natürlichen Mengen«; das BIP ist »einäugig, was das wirtschaftliche Wohl angeht, blind für das menschliche Wohl, taub für das soziale Leid und stumm in Bezug auf den Zustand des Planeten«.[5] Regelmäßig werden Kolloquien veranstaltet und Berichte verfasst, um diesen Indikator zu überwinden, doch bislang ohne nennenswerte Wirkung: Das BIP beherrscht weiterhin das politische Führungssystem der Nationen.
Fußnoten
[1]
Diese Kritik an den Indikatoren ist nicht neu. In Frankreich wurde sie Ende der 1990er Jahre mit den Arbeiten von Dominique Méda, Jean Gadrey, Florence Jany-Catrice, Isabelle Cassiers, Patrick Viveret und einem Dutzend anderer Denker entwickelt, die sich um das FAIR, das Forum pour d’Autres Indicateurs de Richesse (Forum für andere Wohlstandsindikatoren) versammelt haben (siehe: D. Méda, »Promouvoir de nouveaux indicateurs de richesse: histoire d’une cause inaboutie«, Fondation Maison des sciences de l’homme, 2020).
Wachstum: Eine Frage der Größe und Geschwindigkeit
Die Ökonomie wird oft mit einem Kuchen verglichen, den es zu teilen gilt, und das Wachstum mit der Weise, ihn größer werden zu lassen, damit jeder ein bedeutenderes Stück erhält. Doch das »Produkt« des Begriffs des BIP heißt nicht akkumulierter Reichtum. Das BIP misst nicht den Bestand an Reichtum (die Gesamtsumme auf einem Bankkonto oder die Anzahl der Fische in einem See), sondern den Strom der Produktion von Reichtum über einen bestimmten Zeitraum (das Geld und die Fische, die jedes Jahr hinzukommen).
Da man nicht zwischen Geldströmen, die reicher machen, und Geldströmen, die ärmer machen, unterscheiden kann (eine der Grenzen des BIP), ist es falsch, die Bewegungen des BIP zu feiern oder zu verunglimpfen. Zwei Personen können denselben Kuchen auf zwei verschiedene Arten backen, der eine ist ein weniger erfahrener Koch, der sicherlich mehr Zeit damit verbringt, seine Fehler bei der Herstellung auszubügeln und die Küche anschließend zu reinigen. Der Kuchen (der Reichtum) wird jedoch trotz dieser beiden unterschiedlichen Stile der Zubereitung derselbe sein (das BIP).
Was vielleicht etwas vorschnell als »Wachstum« bezeichnet wird, entspricht eher einer Intensivierung des ökonomischen Treibens als einem Anstieg des Gesamtreichtums. Machen wir den Vergleich mit einer Schneekugel, bei der jede Flocke eine Geldtransaktion darstellt. Was das BIP misst, ist das Treiben der Flocken in der Kugel, eine Art Maßstab für das Sprudeln der Geldwirtschaft. Somit kann man es auf zwei verschiedene Arten steigern: indem man mehr Flocken in die Kugel gibt oder indem man die Kugel stärker schüttelt. Damit haben wir zwei Arten von Wachstum: eines, das auf der Erweiterung des Umfangs der Warenwirtschaft beruht (die Hinzufügung von Flocken), und eines, das auf der Intensivierung bereits bestehender Transaktionsarten beruht.
Beginnen wir mit dem expansiven Wachstum. Mit dem Umfang der Wirtschaft meine ich den Anteil der Geldwirtschaft im Verhältnis zum Rest (das heißt die Grenze zwischen dem aufgetauchten und dem untergetauchten Teil des Eisbergs). Jedes Mal, wenn etwas, das sich außerhalb der monetären Sphäre befand, in ein Produkt verwandelt wird, das verkauft werden kann, erweitert sich der Umfang der Wirtschaft.
Ein Fisch, der bereits vor dem Fang existierte, wird erst dann zum BIP hinzugerechnet, wenn er vermarktet wird. Wenn man den Fisch fängt, um sich selbst zu ernähren, bleibt dieser Akt der Produktion außerhalb der Buchführung der Wirtschaft. Entscheidet man sich jedoch, den Fisch auf einem Markt zu verkaufen, wird das BIP steigen – oder besser gesagt wachsen –, da es einen weiteren Verkauf gibt, der in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfasst wird. Es hat sich nichts wirklich geändert, der Fisch wird gefangen und gegessen, aber seine Kommerzialisierung (die Tatsache, dass er zu einer Ware wird, die auf einem Markt verkauft wird) treibt das BIP in die Höhe.
Ein anderes Beispiel: Die Gründung von Airbnb hat den Umfang der Geldwirtschaft erweitert, indem sie eine Dienstleistung, die bis dahin keine Ware war, in eine solche verwandelt hat. Eine Wirtschaft, in der Übernachtungen über Couchsurfing (eine Plattform, die Gastgeber mit Personen verbindet, die eine kostenlose Kurzzeitunterkunft suchen) vermittelt werden, hätte unter sonst gleichen Bedingungen ein niedrigeres BIP als eine Wirtschaft, in der alle Ferienwohnungen über Airbnb vermietet werden, obwohl ein mindestens gleichwertiger Gebrauchswert produziert wird.
Dieselbe Situation hat man in einer Wirtschaft, in der man ein Taxi nehmen würde, anstatt sich von einem Freund mitnehmen zu lassen, und eine kostenpflichtige Dating-App nutzen würde, anstatt sich direkt mit jemandem zu unterhalten. Sobald etwas zu einer neuen Geldtransaktion führt, fügt es der Kugel Flocken hinzu. »Produktion« ist nicht immer gleichbedeutend mit »Herstellung«. Hier ist die Wohnung die gleiche, egal ob sie auf Couchsurfing oder Airbnb zu finden ist. Es sind nicht die Ressourcen, die sich ändern, sondern das Sozialprotokoll, das sie organisiert.
Die zweite Art von Wachstum (das stärkere Schütteln der Schneekugel) ist intuitiver: Es ist die Wirtschaft, so wie sie existiert, die sich schneller dreht. Wenn ich, anstatt alle zehn Jahre mein Telefon zu wechseln, durch Praktiken der organisierten Obsoleszenz gezwungen bin, alle zwei Jahre ein neues Telefon zu kaufen, steigt das Volumen von Mehrwert/Einkommen/Endausgaben (die drei Arten, das BIP zu messen). In diesem Fall ist es die Produktion, die sich beschleunigt – es müssen fünfmal so viele Telefone hergestellt und alle dafür notwendigen Ressourcen mobilisiert werden.
Diese begriffliche Trennung zwischen Expansion und Intensivierung funktioniert auch in die andere Richtung. Die Sphäre der Marktwirtschaft kann schrumpfen, wenn bislang vermarktete Güter und Dienstleistungen nun außerhalb der Sphäre des BIP produziert werden. Als kostenpflichtige Enzyklopädien wie Encarta Wikipedia wichen, und unter der Voraussetzung, dass der Rest der Wirtschaft diesen Rückgang nicht ausglich, schrumpfte das BIP (obwohl die Verbreitung von Wissen und damit von Wohlstand in einem weiten Sinne deutlich zugenommen hat). Die Menschen schreiben und lesen weiterhin Lexikonartikel, aber all dies geschieht in einer Sphäre, in der die Geldtransaktionen und Zugangsbarrieren gering sind.
Genauso wie ein Anstieg des BIP nicht immer das Auftreten einer zusätzlichen Produktion darstellt (sie konnte bereits in der Nichtmarktsphäre existieren), bedeutet ein Rückgang des BIP nicht zwangsläufig, dass Aktivitäten verschwinden – man könnte sagen, dass sie nur aus dem Bereich der verbuchbaren Ökonomie herausfallen.
Die Sphäre der Marktwirtschaft kann auch zurückgehen. Eine Pandemie tritt auf, und der Verkauf von Masken steigt, was ihren Beitrag zum BIP nach oben treibt. Sobald die Gesundheitskrise vorbei ist, sinkt das Volumen der Masken und damit auch ihr Beitrag zum BIP. Wenn ich mich entscheide, kein Fleisch mehr zu essen oder nicht mehr zu fliegen, und diese Transaktionen nicht durch andere kompensiert werden, sinkt das BIP. Dasselbe gilt, wenn ich ein Zugticket für 100 Euro kaufe, um in den Vulkanlandschaften der Auvergne zu wandern, anstatt für ein Flugticket 1000 Euro zu bezahlen, um La Réunion zu besuchen. Wenn man die Arbeitszeit massiv reduziert oder bestimmte Tätigkeiten wie die Werbung für besonders umweltschädliche Produkte verbietet, wird man vermutlich einen wirtschaftlichen Rückgang beobachten, weil diese Sektoren weniger betriebsam sind.
Warum soll man sich dafür einsetzen, das Wachstum in verschiedene Phänomene zu zerlegen? Dies ist eine notwendige Übung, um den modernen Glauben zu entmystifizieren, dass das Wachstum des BIP immer ein Fortschritt und der Rückgang zwangsläufig unerwünscht ist – ein Glaube, der suggeriert, dass man die Wirtschaft immer »ankurbeln« und nie schrumpfen oder zurückfahren sollte. Wenn es um komplexe institutionelle Veränderungen geht, verdunkelt der Kompass des BIP mehr, als er erhellt. Ein Gesundheitssystem zu verstaatlichen und die Immobilien- und Energiepreise zu deckeln wird das BIP sinken lassen, was nicht zwangsläufig eine schlechte Nachricht ist, solange die Indikatoren für Gesundheit, Wohlstand und Nachhaltigkeit wachsen.
Das Wachstum und die Schrumpfung des BIP sagen uns nicht viel über die wahre Leistung einer Ökonomie. Man kann bestimmte Formen der Betriebsamkeit feiern, wenn sie Bedürfnisse befriedigen (die Produktion von Masken während der Pandemie), die Produktion von künstlerischen Werken, das Schreiben von Büchern über das Klima etc. Andere, die unnötig sind (bestimmte Formen der Werbung, SUVs, Gadgets) oder für den Wohlstand sogar kontraproduktiv (die Gestaltung von geplanten Obsoleszenzen, Junkfood), kann man geißeln. Dasselbe gilt für die Entschleunigung. Manche Rückgänge der Produktion werden wie eine Amputation erlebt, mit Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit, Austerität und Armut, und andere gleichen eher Diäten: Situationen, in denen es einer Gemeinschaft gelingt, ihre Bedürfnisse mit einem geringeren wirtschaftlichen Aufwand zu befriedigen. Diese wirtschaftliche Rhythmik des Mehr und des Weniger ist kein Schicksal, sondern eine Folge gesellschaftlicher Entscheidungen.
Die Bestandteile der Wirtschaftsaktivität
Jede Aktivität erfordert Ressourcen, egal ob sie nun im Sinne des BIP