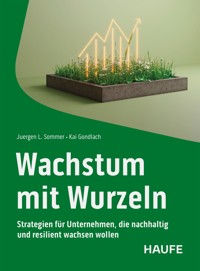
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist ein inspirierender Leitfaden für alle, die Nachhaltigkeit als Chance begreifen - und nicht als Bürde. Es lädt dazu ein, die Grundlagen nachhaltigen Wirtschaftens zu entdecken – Prinzipien, die im Garten ebenso wie in der Unternehmensstrategie Anwendung finden. Juergen L. Sommer und Kai Gondlach zeigen praxisnah, wie durch kluge Entscheidungen und ein tiefes Verständnis natürlicher Prozesse mehr Nachhaltigkeit, Effizienz und Erfolg erreicht werden können. Sie richten sich dabei an alle, die aktiv mitgestalten möchten: an diejenigen, die bereit sind, neue Wege zu gehen und sich symbolisch "die Hände schmutzig zu machen", um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts mutig zu begegnen. Inhalte: - Traditionelle Gartenbaumethoden als Vorbild für nachhaltige Lösungen - Nachhaltigkeit als Grundlage für eine zukunftsfähige Wirtschaft - Prinzipien der nachhaltigen Unternehmensführung - Die 7 Prinzipen des nachhaltigen Gärtnerns übertragen auf die Unternehmensführung - Entwicklung und Umsetzung einer resilienten Strategie -
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumGrußwort von Ruth von HeusingerVorwort: Wie alles begann1 Der Gartenbau im Wandel1.1 Die historischen Wurzeln des nachhaltigen Gartenbaus1.2 Traditionelle Gartenbaumethoden als Vorbild für nachhaltige Lösungen1.3 Der Übergang zur industriellen Landwirtschaft und ihre Folgen1.4 Die Wiederentdeckung nachhaltiger Gartenbaumethoden1.5 Aktuelle Trends und Entwicklungen im nachhaltigen Gartenbau1.5.1 Bildung und Gemeinschaft1.5.2 Smart Gardening & Digitalisierung1.5.3 Urban & Vertical Gardening1.6 Ziele im nachhaltigen Gartenbau1.6.1 Ökologische Ziele: Schutz und Förderung natürlicher Ressourcen1.6.2 Ökonomische Ziele: Wirtschaftlichkeit, Innovation und Resilienz1.6.3 Soziale und gesellschaftliche Ziele: Zusammengehörigkeit, Bewusstseinsbildung2 Nachhaltigkeit als Grundlage für eine zukunftsfähige Wirtschaft2.1 Die Ziele des nachhaltigen Gärtnerns übertragen auf Unternehmen2.1.1 Ökonomische Ziele2.1.1.1 Wachstum – aber richtig2.1.1.2 Kosteneinsparung durch Kreislaufwirtschaft2.1.1.3 Innovation als Wachstumstreiber2.1.1.4 Diversität verstärkt die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz2.1.1.5 Nachhaltige Produkte als Selbstläufer2.1.2 Ökologische Ziele2.1.2.1 CO₂-Reduktion – die Low-Hanging Fruits ernten2.1.2.2 Unabhängigkeit von fossilen Energien2.1.2.3 Wassermanagement – jeder Tropfen zählt2.1.3 Soziale und gesellschaftliche Ziele2.1.3.1 Strategische Resilienz – der Gärtner denkt voraus2.1.3.2 Diversität – Mischkultur macht stark2.1.3.3 Fairness – alle Pflanzen brauchen Sonne2.2 Wellbeing – gesunde Pflanzen, gesunde Ernte3 Prinzipien der nachhaltigen Unternehmensführung3.1 Die Wertschöpfungskette: Wie Unternehmen wirklich funktionieren3.2 Was sind eigentlich Aufbau- und Ablauforganisation?3.3 Aufbauorganisation: Nachhaltigkeit strukturell verankern3.3.1 Die Führungsebene: Der Hauptgärtner3.3.2 Die Fachabteilungen: Spezialgärtner mit klaren Aufgaben3.4 Ablauforganisation: Nachhaltige Prozesse etablieren3.5 Stakeholder: Das Unternehmens-Ökosystem verstehen3.6 Die Früchte ernten: Vorteile nachhaltiger Führung3.6.1 Kosteneinsparungen durch Effizienz3.6.2 Innovation als Wettbewerbsvorteil3.6.3 Vertrauen und Reputation aufbauen3.6.4 Langfristige Stabilität sichern3.7 Herausforderungen meistern: Die Hürden überwinden3.7.1 Kurzfristiger Denkhorizont3.7.2 Hohe Anfangsinvestitionen3.7.3 Mangelndes Know-how3.7.4 Komplexe Regularien3.7.5 Widerstand im Unternehmen3.7.6 Technologische Hürden3.8 Alt gegen Neu: Zwei Welten der Unternehmensführung3.8.1 Traditionelles Management: Die Monokultur3.8.2 Nachhaltiges Management: Das Ökosystem3.8.3 Zeithorizont: Sprint vs. Marathon3.8.4 Erfolgsmessung: Eindimensional vs. Mehrdimensional3.8.5 Innovationsverständnis: Technologie vs. System3.8.6 Organisationsstruktur: Hierarchie vs. Netzwerk3.8.7 Mitarbeiterrolle: Ressource vs. Partner4 Die 7 Prinzipen des nachhaltigen Gärtnerns übertragen auf die Unternehmensführung4.1 Prinzip 1: Strategische Planung – Anpassung an lokale Gegebenheiten und Risikomanagement4.1.1 Warum Kakteen im Moor keine gute Idee sind – und was Manager daraus lernen können4.1.2 Meyer-Zitronen und Medizintechnik: Eine Geschichte über falsche Standorte4.2 Prinzip 2: Bodenpflege und -erhaltung – Unternehmenskultur und Ethik4.2.1 Der 200-Prozent-Dünger und andere Managementmärchen4.2.2 Zwei Männer, eine Bank und die Kunst des fruchtbaren Schweigens4.3 Prinzip 3: Das Samenkorn – Innovation4.3.1 Von Saatgut-Monopolen und der Magie samenfester Tomaten4.3.2 Vom Silicon-Valley-Hybrid zur Hausgarten-KI4.4 Prinzip 4: Nachhaltige Bewässerung – Ressourceneffizienz & Liquidität4.4.1 Warum der Rasensprenger der natürliche Feind des CFO ist4.4.2 Petra und die Kunst, im Regen zu verdursten4.5 Prinzip 5: Diversität – Resilienz und Balance4.5.1 Von Rasen-Fundamentalisten und der Weisheit wilder Wiesen4.5.2 Wie ein Maschinenbauer lernte, seine Wiese verwildern zu lassen4.6 Prinzip 6: Natürliche Schädlingsbekämpfung – Kooperation4.6.1 Warum die Wespen immer vor den Vögeln kommen4.6.2 Von Brombeerschädlingen zu Business-Nützlingen4.7 Prinzip 7: Kompostierung – Kreislaufwirtschaft4.7.1 Warum Müll das neue Gold ist – und warum ich trotzdem fluche4.7.2 Der Kompost-König und seine stinkende Erleuchtung5 Einsatz von Systemdenken zur Erstellung einer nachhaltigen Unternehmenswachstumsstrategie 5.1 Grundlagen des vernetzten Denkens und Handelns 5.1.1 Systemdenken als Entscheidungsgrundlage5.1.1.1 Das Viable System Model5.1.1.2 Die Essenz für die Praxis: Ableitungen aus dem VSM5.1.1.3 Fazit VSM5.1.2 Integration von Systemdenken in das unternehmerische Geschäftsmodell 5.1.2.1 Konkret im operativen Geschäft5.1.2.2 Nachhaltigkeit und langfristige Wertschöpfung5.1.2.3 Best Cases585.1.3 Fazit Systemdenken5.2 Geschäftsmodelle: Von traditionellen Ansätzen zu nachhaltiger Zukunft 5.2.1 Grundlagen5.2.2 Warum Geschäftsmodelle wichtig sind5.2.3 Herkömmliche Geschäftsmodelle5.2.3.1 Die Grundprinzipien verstehen5.2.3.2 Vertriebsmodelle: Wege zum Kunden5.2.3.3 Produktionsmodelle: Effizienz durch Masse5.2.3.4 Erlös- und Preismodelle: Monetarisierung verstehen5.2.3.5 Service- und Dienstleistungsmodelle: Expertise verkaufen5.2.3.6 Eigentums- und Besitzmodelle: Verschiedene Nutzungsformen5.2.3.7 Finanzierungs- und Kapitalmodelle: Geld arbeiten lassen5.2.3.8 Fazit: Bewährte Grundlagen mit Entwicklungsbedarf5.2.4 Nachhaltige Geschäftsmodelle: Der Weg zu langfristigem Erfolg5.2.4.1 Die neue Denkweise verstehen5.2.4.2 Kreislaufwirtschaft: Aus Abfall wird Wert5.2.4.3 Digitale Geschäftsmodelle: Technologie für Nachhaltigkeit5.2.4.4 Plattformmodelle und Sharing Economy: Teilen statt besitzen5.2.4.5 Soziales Unternehmertum: Profit mit Purpose5.2.4.6 Kollaborative Geschäftsmodelle: Gemeinsam stark5.2.4.7 Fairer Handel: Gerechtigkeit in globalen Lieferketten5.2.4.8 Lokalisierungs- und Regionalitätsmodelle: Stärkung lokaler Kreisläufe5.2.5 Das erweiterte Treacy & Wiersema Modell für nachhaltige Wettbewerbsvorteile5.2.5.1 Operational Excellence wird zu Green Efficiency5.2.5.2 Product Leadership wird zu nachhaltiger Innovation5.2.5.3 Kundennähe wird zu Purpose-getriebenem Engagement5.2.5.4 Neue Dimensionen: Ecosystem Thinking und Regenerative Impact5.2.5.5 Integration und Synergien schaffen5.2.6 Vorteile nachhaltiger Geschäftsmodelle5.2.6.1 Kosteneinsparungen und Effizienzgewinne5.2.6.2 Innovation und Marktchancen5.2.6.3 Vertrauen und Reputation5.2.6.4 Risikomanagement und Resilienz5.2.6.5 Finanzielle Vorteile und Kapitalzugang5.2.6.6 Stakeholder-Engagement und Partnerschaften5.2.6.7 Zukunftsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit5.2.7 Herausforderungen bei der Transformation zu nachhaltigen Geschäftsmodellen5.2.7.1 People: Kultureller Wandel und Transformation des Mindsets5.2.7.2 Process: Systemische Neugestaltung von Abläufen5.2.7.3 Technology: Digitale Transformation als Enabler5.2.7.4 Finanzielle und strategische Herausforderungen5.2.7.5 Externe Herausforderungen und Marktdynamiken5.2.8 Die sieben Prinzipien nachhaltiger Geschäftsmodelle5.2.8.1 Prinzip 1: Strategische Planung – Anpassung an lokale Gegebenheiten und Risikomanagement5.2.8.2 Prinzip 2: Bodenpflege – Unternehmenskultur und Ethik als Fundament5.2.8.3 Prinzip 3: Das Samenkorn – Innovation als Wachstumstreiber5.2.8.4 Prinzip 4: Nachhaltige Bewässerung – Ressourceneffizienz5.2.8.5 Prinzip 5: Diversität – Resilienz und Balance durch Vielfalt5.2.8.6 Prinzip 6: Natürliche Schädlingsbekämpfung – Kooperation und Partnerschaften5.2.8.7 Prinzip 7: Kompostierung – Kreislaufwirtschaft und Regeneration5.3 Zukunftsaussichten unter Berücksichtigung nachhaltiger Wachstumsstrategien und KI5.3.1 Best-Case-Szenario: Nachhaltiges Hochleistungsmodell5.3.2 Worst-Case-Szenario: Reaktionäres Chaos5.3.3 Moderates Szenario: Resiliente Evolution mit Brüchen5.3.4 Schlüsselfaktoren der Szenarien5.3.5 Ausblick6 Entwicklung einer resilienten Strategie6.1 Die nachhaltige Unternehmenswachstumsstrategie6.1.1 Nachhaltigkeit als Sinngeber6.1.2 Digitalisierung als Hebel6.1.3 Digitale Technologien für nachhaltige Praktiken6.1.4 Vorteile der Twin Transformation6.1.4.1 Strategische Agilität und bessere Entscheidungsfindung6.1.4.2 Effizienzsteigerung und Kostensenkung6.1.4.3 Stärkung der Resilienz6.1.4.4 Förderung von Innovation und Zukunftssicherheit6.1.4.5 Imagegewinn und Employer Branding6.1.4.6 Regulatorische Sicherheit und gesellschaftliche Akzeptanz6.1.5 Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten6.1.5.1 Voraussetzungen für erfolgreiche Twin Transformation6.1.5.2 Kernherausforderungen bei der Umsetzung6.1.5.3 Technologische und organisatorische Hürden6.1.5.4 Investitionsanforderungen6.1.6 Parallelen zum nachhaltigen Gärtnern6.2 Das VMOST-Modell als Grundlage strategischer Exzellenz 6.2.1 Das VMOST-Modell verstehen6.2.2 Die fünf Ebenen systematisch entwickeln6.2.2.1 Vision: Den Nordstern formulieren6.2.2.2 Mission: Den Unternehmensauftrag definieren6.2.2.3 Objectives: Messbare Ziele setzen6.2.2.4 Strategy: Den Masterplan entwickeln6.2.2.5 Tactics: Konkrete Schritte festlegen6.3 Risikomanagement: Vom Nutzgarten zur Unternehmensstrategie6.3.1 Der Sommer 1976: Lektionen in Opas Garten6.3.2 Risikomanagement: Die Kunst der klugen Vorsorge in vernetzten Systemen6.3.3 Die neue Welt der Unsicherheit: Von VUCA zu BANI6.3.4 Zwei Seiten einer Medaille: Risikomanagement, doppelte Wesentlichkeit und die Inside-Out-/Outside-In-Perspektive6.3.4.1 Outside-In: Die Welt kommt ins Unternehmen6.3.4.2 Inside-Out: Das Unternehmen wirkt in die Welt6.3.4.3 Die Medaille dreht sich: Risiko wird zur Chance6.3.4.4 Die Kunst der Balance: Systemisches Risikomanagement6.3.4.5 Praktische Umsetzung: Die Medaille in der Unternehmenspraxis6.3.4.6 Die Zukunft: Wenn Risiko und Chance verschmelzen6.3.5 Die vier Säulen der Risikobehandlung – systemisch gedacht6.3.5.1 Vermeiden6.3.5.2 Vermindern6.3.5.3 Übertragen6.3.5.4 Akzeptieren6.3.6 Der Risikomanagement-Prozess: Vom linearen Denken zum Systemverständnis6.3.6.1 Schritt 1: Risikoidentifikation – das ganze System betrachten6.3.6.2 Schritt 2: Risikobewertung – nicht-lineare Effekte verstehen 6.3.6.3 Schritt 3: Maßnahmen planen – Resilienz statt Kontrolle6.3.6.4 Schritt 4: Überwachung – das Wetter im Blick behalten6.3.7 Risikokommunikation: Offenheit als Erfolgsfaktor6.4 Elf Quick Wins im Risikomanagement6.4.1 Integration in die Unternehmensstrategie: Risikomanagement als Wettbewerbsvorteil6.4.2 Die drei häufigsten Fehler beim Risikomanagement6.4.3 Digitale Helfer: Wenn Technologie zum Frühwarnsystem wird6.4.4 Risikomanagement im Mittelstand – kleine Unternehmen, große Wirkung6.4.5 Nachhaltigkeit als Risikomanagement: Vorsorge für Generationen6.4.6 Die Psychologie des Risikos: Warum wir oft falsch entscheiden6.4.7 Die Psychologie der Vernetzung: Warum unser Gehirn Systeme nicht versteht6.4.8 Regeneratives Risikomanagement: Risiken als Chancen6.4.9 Krisenmanagement im Zeitalter der Vernetzung6.4.10 Die Zukunft des Risikomanagements: von der Kontrolle zur Kultivierung6.4.11 Ein neues Mindset: vom Maschinen- zum Gartendenken7 Von der Theorie zur Praxis 7.1 Die FrankenMotion GmbH: Ein Praxisbeispiel7.1.1 Unternehmensporträt7.1.2 Herausforderungen der Branche7.1.2.1 Digitalisierung7.1.2.2 Nachhaltigkeit7.1.2.3 Fachkräftemangel7.1.2.4 Marktdruck7.2 VMOST-Entwicklung bei FrankenMotion7.2.1 Vision: Der Nordstern7.2.2 Mission: Der Auftrag7.2.3 Objectives: Messbare Ziele7.2.4 Strategien: Der Masterplan7.2.5 Tactics: Konkrete Umsetzung7.3 Die 8 Schritte zur praktischen Umsetzung7.3.1 Schritt 1: Standortbestimmung – Bodenanalyse7.3.2 Schritt 2: Integrierte Transformationsstrategie – Pflanzplan7.3.3 Schritt 3: Organisationale Grundlagen – Beetstruktur7.3.4 Schritt 4: Daten- und Technologiebasis – Bewässerung & Sensorik7.3.5 Schritt 5: Pilotprojekte umsetzen – erste Ernteprojekte7.3.6 Schritt 6: Kulturelle Verankerung – Pflege & Beteiligung7.3.7 Schritt 7: Fortschritt messen – Erntestatistik7.3.8 Schritt 8: Kontinuierliche Verbesserung – Beetpflege, Fruchtfolge und neue Aussaat7.4 Fazit: Wachstum mit Wurzeln – die Twin Transformation als lebendiger ProzessDie 10 wichtigsten Bauernregeln für die nachhaltige UnternehmensführungRegel 1: Wer ernten will, muss säenRegel 2: Ist der Mai kühl und nass, fülltʼs dem Bauern Scheunʼ und FassRegel 3: Viele Hände, schnelles EndeRegel 4: Nach Regen folgt SonnenscheinRegel 5: Der Apfel fällt nicht weit vom StammRegel 6: Wer nicht gießt, wird nichts genießenRegel 7: Kleinvieh macht auch MistRegel 8: Morgenstund hat Gold im MundRegel 9: Wie die Saat, so die ErnteRegel 10: Ohne Fleiß kein PreisFazit: Die zeitlose Weisheit der GärtnerQuellenStichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-648-19004-3
Bestell-Nr. 12233-0001
ePub:
ISBN 978-3-648-19005-0
Bestell-Nr. 12233-0100
ePDF:
ISBN 978-3-648-19006-7
Bestell-Nr. 12233-0150
Juergen L. Sommer/Kai Gondlach
Wachstum mit Wurzeln
1. Auflage, November 2025
© 2025 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg
www.haufe.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © Eoneren, iStock
Produktmanagement: Mirjam Gabler
Lektorat: Helmut Haunreiter
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Stimmen zum Buch
Professor Dr. Michael Braungart
Leuphana Universität Lüneburg, Pionier des Cradle-to-Cradle-Design-Konzeptes, Gründer und wissenschaftlicher Geschäftsführer von BRAUNGART EPEA, internationales Umweltforschungs- und Beratungsinstitut, Hamburg
»Nachhaltigkeit wird in Deutschland oftmals als moralischer Luxus begriffen, der sofort vergessen wird, wenn eine Krise droht. Nachhaltigkeit ist eine echte Innovationschance. Es lohnt sich, zu den Wurzeln zurückzugehen und radikal neu zu denken, so wie es die beiden Autoren brillant zeigen.«
Bettina Dietsche
Allianz Group Chief People and Culture Officer
»›Wachstum mit Wurzeln‹ ermutigt Unternehmen dazu, von disruptiven zu regenerativen Praktiken zu wechseln. Für mich ist es ein tolles Konzept, das ökologische Prinzipien mit Unternehmensstrategien verknüpft und den Menschen in den Mittelpunkt jeder Veränderung stellt. Es ist ein Aufruf zu widerstandsfähigeren Unternehmen, leistungsfähigeren Mitarbeitenden und einem menschenzentrierten Miteinander, das gemeinsam mit dem technologischen Wandel gestaltet wird – Vertrauen und Inklusion machen den Unterschied!«
Fritz Lietsch
Chefredakteur des Magazins forum nachhaltig Wirtschaften
»Mein Garten ist ein idealer Lehrmeister für innovatives und nachhaltiges Wirtschaften – und auch Vorbild für eine resiliente Finanzwirtschaft. Ich empfehle dieses Buch wärmstens, denn darin steckt die Weisheit für zukünftig erfolgreiches und enkeltaugliches Wirtschaften.«
Isabella Chacón Troidl
CEO | Vorsitzende der Geschäftsführung, BNP Paribas Real Estate Investment Management
»Transformation ist wie das Anlegen eines Gartens: Es ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Wie ein Gärtner, der mit Geduld den Boden vorbereitet, Pflanzen setzt und über Jahre hinweg pflegt, braucht auch der Wandel Zeit und stetige Aufmerksamkeit. Der wahre Erfolg entsteht nicht durch schnelle Ergebnisse, sondern durch das nachhaltige Gedeihen, das mit Hingabe und Ausdauer wächst.«
Grußwort von Ruth von Heusinger
Gründerin ForTomorrow, Vorstandsmitglied Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und European Sustainable Business Federation
Als ich gefragt wurde, ein Grußwort für ein Buch zu schreiben, das die Prinzipien des Gartenbaus auf die Prinzipien der Unternehmensführung überträgt, war ich sofort begeistert.
Meine Mutter liebt das Gärtnern und mein Vater stammt vom Bauernhof.
Die Natur hat mich seit frühester Kindheit begleitet.
Als ich später Physik studierte, war ich noch begeisterter von den komplexen Zusammenhängen und wie gut das Zusammenspiel funktioniert.
Die Kreisläufe, die stetige Veränderung, die natürlichen Prozesse, die ineinandergreifen und im großen Ganzen eine Harmonie bilden.
Der Mensch hat sehr stark in diese Prozesse eingegriffen und verändert gerade das stabile Klima, in dem die Menschheit sich überhaupt erst entwickeln konnte. Die Art, wie wir wirtschaften, sorgt momentan für eine Zerstörung der Wirtschaftsgrundlage – und nicht nur dieser.
Verhaltensforscherin Jane Goodall hat gefragt: »Wie kommt es, dass das intelligenteste Lebewesen, das jemals auf der Erde gelebt hat, seinen einzigen Lebensraum zerstört?« Ja, warum? Ich denke, wir haben zu sehr den Bezug zur Natur verloren. Wir sehen zu wenig, wie verbunden wir mit allem um uns herum sind und wie sehr unser Handeln unser Umfeld beeinflusst. Gleichzeitig haben wir Systeme geschaffen, die Ausbeutung statt Nachhaltigkeit incentivieren. Die kurzfristige Erfolgsstrategien statt langfristiger Strategien belohnen. Im Stil von Nach mir die Sintflut.
Deutschland hat 2025 bereits am 3. Mai alle Ressourcen verbraucht, die der Planet uns für ein Jahr zur Verfügung stellt. Wir leben massiv über unsere Verhältnisse und häufen einen enormen Schuldenberg bei unserer Umwelt an.
Wie kommen wir da wieder heraus?
Dieses Buch bietet Lösungen. Es zeigt, wie wir von der Natur lernen können: »Die Natur ist der erfolgreichste Konzern der Welt. Vier Milliarden Jahre am Markt, überlebt jede Krise.«
Trotz der enormen technologischen Entwicklungen können wir keine Maschine produzieren, die so kosteneffizient CO2 aus der Luft holt wie ein Baum. Keine Maschine kann aus Sonne, Luft, Erde und Wasser Nahrungsmittel produzieren. Das können nur Lebewesen.
Es ist Zeit, unsere Denkweise zu ändern. Manchmal habe ich das Gefühl, die Menschheit befinde sich in einer Art Pubertät und möchte sich von Mutter Natur abgrenzen, gegen sie rebellieren, zeigen, dass Technologie viel besser sei. Es ist Zeit, sich aus dieser pubertären Phase herauszuentwickeln. Es ist Zeit, ins Erwachsenenalter überzugehen und die Natur mit der Technologie zu verbinden. Wie? Das zeigt dieses Buch. Als Gründerin und Geschäftsführerin freue ich mich jetzt schon, dieses Buch noch oft zur Hand zu nehmen und auf die praktische Umsetzung in meinem Unternehmen.
Und wo ist der Silberstreif am Horizont?
Der Silberstreif am Horizont ist, dass uns eine neue Denk- und Handlungsweise glücklicher machen wird. Denn die ausbeutenden Systeme, die wir geschaffen haben, sorgen längst nicht mehr für größeres Glück. Selbst die Lebenserwartung ist in einigen Industrienationen, auch in Deutschland, rückläufig. Es ist Zeit, die Errungenschaften zu bewahren und so zu transformieren, dass sie ohne Ausbeutung funktionieren. Dann leben wir in einem natürlichen Kreislauf, der sich stetig weiterentwickeln und erneuern kann. Dann sind wir krisenfest.
Viel Freude beim Lesen!
Ruth von Heusinger
Vorwort: Wie alles begann
Als Kind verbrachte ich unzählige Stunden in meines Großvaters Garten, einem vielfältigen Nutzgarten mit Obstbäumen, Kartoffeln und Gemüse. Damals standen dort, wo sich heute ein Geräteschuppen befindet, ein Hühner- und ein Hasenstall. Ohne es zu wissen, lebten wir bereits nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft: Organische Abfälle wurden recycelt, Ressourcen effizient genutzt und alles fügte sich harmonisch in den natürlichen Kreislauf ein. Nach dem Tod meiner Großeltern änderte sich vieles – der einstige Nutzgarten wurde von meinen Eltern in eine große Rasenfläche umgewandelt. »Pflegeleicht« sagten sie. Praktisch. Modern.
Abb. 1:
Juergen L. Sommers Elternhaus in den 1960iger Jahren
Viele Jahre sind seitdem vergangen und mein beruflicher Weg führte mich weit weg – sowohl geografisch als auch inhaltlich – von meiner Heimat und den Werten einer nachhaltigen Lebensweise. Konzernkarriere, internationale Projekte, Excel-Tabellen statt Erde unter den Fingernägeln. Doch das Leben hält oft unerwartete Wendungen bereit.
Im Sommer 2018 kehrte ich in meine Heimat und mein Elternhaus zurück. Es war eine Rückkehr zu vertrauten Orten, aber auch ein Schock. Der einst lebendige Garten war zu einem sterilen Rasen geworden, die prächtigen Hecken hatten ihre Strahlkraft verloren und der alte Jägerzaun aus den 1970er-Jahren stand noch, war jedoch sichtbar gezeichnet von der Zeit. Es sah aus, wie sich meine Karriere angefühlt hatte: funktional, aber lieblos.
Mir wurde klar, dass es Zeit für Veränderung war. Doch wo anfangen? Wie soll der Garten künftig aussehen? Welche Pflanzen passen? Wie lässt sich der Pflegeaufwand reduzieren, ohne der Natur zu schaden? Fragen über Fragen – und ich hatte keine Antworten. Noch nicht.
Diese Überlegungen waren der Start meiner Reise als Sustainable Business Gardener. Gemeinsam mit meiner Frau entschied ich, unseren tristen Rasengarten in einen lebendigen, zertifizierten Naturgarten zu verwandeln.
Während dieses schweißtreibenden Projekts wurde mir immer klarer, wie viele Parallelen zwischen nachhaltiger Gartengestaltung und effektiver Unternehmensführung bestehen. Die Wespen, die meine Brombeeren fraßen? Wie Wettbewerber, die Marktanteile klauen. Der Komposthaufen? Perfekte Metapher für Kreislaufwirtschaft. Die Monokultur-Rasenfläche? Wie ein Unternehmen ohne Diversität – beim ersten Problem am Ende.
Abb. 2:
Juergen L. Sommers Haus im Jahr 2024 mit neu angelegtem Garten
Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, sorgfältig zu planen, Ressourcen effizient zu nutzen und den natürlichen Kreislauf zu respektieren – Werte, die nicht nur im Garten, sondern auch in der Unternehmensführung entscheidend sind. Der Garten lehrte mich Geduld (Tomaten wachsen langsam!), langfristiges Denken (Obstbäume noch langsamer!) und die Fähigkeit, Systeme so zu gestalten, dass sie nicht nur wachsen, sondern auch resilient bleiben.
Im Jahr 2023 lernte ich Kai Gondlach kennen, einen renommierten Zukunftsforscher. Er ist Inhaber des Leipziger Zukunftsinstituts PROFORE, das sich auf die Schnittstelle zwischen seriöser Trend- und Zukunftsforschung auf der einen und Strategieberatung auf der anderen Seite spezialisiert hat. Gleichzeitig veröffentlichte er bis dato einige Fach- und Sachbücher über Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit, bekannt ist er daneben vor allem als Keynote Speaker, auch wenn er sich nie selbst so nennen würde.
Aus unseren inspirierenden Gesprächen entstand die Idee für dieses Buch. Während ich meine gesammelten Erfahrungen aus der Praxis einbringe (inklusive aller Fehlschläge und Peinlichkeiten), ergänzt Kai die Perspektive um Systemdenken und einen spannenden Ausblick in die Zukunft. Diese Kombination aus gelebtem Wissen und zukunftsorientierten Fortschreibungen unserer komplexen Ausgangssituation soll Führungskräften helfen, nachhaltige Ansätze für die Herausforderungen von morgen zu entwickeln. Ohne Buzzword-Bingo, versprochen.
Ein wichtiger Hinweis: Die Geschichten in diesem Buch sind Beispiele aus meiner langjährigen beruflichen Praxis. Namen, Orte und Zeiten habe ich verfremdet, doch sie haben alle ihren Ursprung in realen Veränderungsprozessen.
Dieses Buch lädt Sie ein, die Grundlagen nachhaltigen Wirtschaftens zu entdecken – Prinzipien, die sowohl im Garten als auch in der Unternehmensstrategie funktionieren. In den folgenden Kapiteln zeigen wir, wie kluge Entscheidungen und ein tiefes Verständnis für natürliche Prozesse zu mehr Nachhaltigkeit, Effizienz und Erfolg führen. Keine Sorge, Sie müssen nicht gleich Ihren Rasen umgraben. Aber vielleicht denken Sie danach anders darüber nach.
Denn genau hier liegt eine unserer größten, oft unterschätzten Chancen: der deutsche Garten. Was, wenn diese Millionen von privaten Grünflächen, die oft noch wie der Rasen meiner Eltern »pflegeleicht« und steril gehalten werden, zu wahren Ökosystemen würden? Wenn jeder Einzelne von uns, wie ich in meinem eigenen Garten, beginnt, nach den Prinzipien von Kreislaufwirtschaft, Wassereffizienz und Bodengesundheit zu wirtschaften, summiert sich das Potenzial immens auf. Stellen Sie sich vor: Allein durch eine nachhaltigere Bewässerung, den Verzicht auf Kunstdünger und Pestizide sowie den systematischen Humusaufbau könnten Deutschlands Gärten jährlich signifikante Mengen an Wasser, Ressourcen und sogar CO₂ einsparen und binden. Das wäre ein kollektiver Beitrag, der zeigt, dass Klimaschutz und Ressourcenschonung nicht nur in großen Fabriken und Konzernzentralen stattfinden, sondern buchstäblich vor unserer eigenen Haustür beginnen. Eine Metamorphose, die nicht nur unsere Gärten, sondern unsere gesamte Umgebung vitaler macht – Schritt für Schritt, Wurzel für Wurzel.1
Dieses Buch richtet sich an alle, die nicht nur zuhören, sondern aktiv mitgestalten wollen. An die, die bereit sind, sich metaphorisch die Hände schmutzig zu machen. Und vor allem an jene, die schon gemerkt haben, dass es neue Ansätze braucht, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern.
Willkommen bei Wachstum mit Wurzeln.
1 Vgl. Umweltbundesamt (UBA), u. a. zu Wasserverbrauch in Haushalten und Gärten; Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) zu Auswirkungen von Kompost und Bio-Anbau; Johann Heinrich von Thünen-Institut (TI) zu Kohlenstoffspeicherung in Böden.
1 Der Gartenbau im Wandel
»Herr Sommer, verstehen Sie das nicht falsch«, sagte die Geschäftsführerin eines mittelständischen Maschinenbauers zu mir, als wir durch ihren privaten Gemüsegarten liefen. »Aber nachhaltiger Gartenbau kommt mir vor wie ein Widerspruch in sich. Entweder nachhaltig oder erfolgreich.«
»Aha«, antwortete ich und deutete auf die prallen Tomaten um uns herum. »Und was ist das hier?«
Sie lachte. »Touché. Aber Sie wissen, was ich meine. In meiner Branche muss ich Gewinne erwirtschaften. Da bleibt wenig Zeit für Experimente.«
»Das dachten unsere Großeltern auch«, entgegnete ich. »Nur andersherum.«
Für die Generation meiner Großeltern war nachhaltiges Gärtnern kein Trend – es war Überlebensstrategie. Mit der Natur arbeiten, statt gegen sie. Kreisläufe nutzen, statt verschwenden. Was heute als Innovation gefeiert wird, war damals schlicht Normalität.
Dann kam die große Verführung des 20. Jahrhunderts: Kunstdünger, Pestizide, maximale Erträge in kurzer Zeit. Wir tauschten Weisheit gegen Effizienz. Das funktionierte auch eine Zeit lang. Aber jetzt, da die Rechnung kommt und Böden unfruchtbar werden, die BiodiversitätBiodiversität kurz vor dem Infarkt steht und Monokulturen nicht mehr resistent gegen Klima und Schädlinge sind, besinnen wir uns wieder auf das, was schon immer funktionierte.
Wie in meinem Garten letzten Herbst: Nach Jahren der Chemie-Abstinenz ist mein Boden so vital, dass er selbst extreme Wetterlagen wegsteckt. Dabei habe ich einfach nur das Wissen meiner Großeltern angewandt! Was unsere Vorfahren intuitiv wussten, bestätigt heute die Wissenschaft: Nachhaltigkeit ist keine Bremse für den Erfolg – sie ist der Garant für langfristige Stabilität.
Abb. 3:
Der Gartenbau im Wandel
1.1 Die historischen Wurzeln des nachhaltigen Gartenbaus
KlosterGartenbau, nachhaltignachhaltiger Gartenbau Weingarten im 13. Jahrhundert. Bruder Antonius plant sein Gartenjahr. Erst Bohnen, dann Kohl, zwischendurch Brachzeit mit Klee. Keine Philosophie – pure Pragmatik. Er weiß: Die Bohnen pumpen Stickstoff in den Boden, den Klee futtert das Vieh und der Mist düngt wiederum den Kohl.
Ein geschlossener Kreislauf. Kein Lehrbuch, keine Berater, keine PowerPoint-Präsentationen.
Die mittelalterlichen Klostergärten waren die ersten echten Nachhaltigkeits-Champions. Die Mönche beherrschten Techniken, für die wir heute Berater anheuern: Crop RotatioCrop Rotation, Companion PlantingCompanion Planting, Zero WasteZero Waste. Nur nannten sie es anders: FruchtwechselFruchtwechsel, MischkulturMischkultur, Wirtschaftlichkeit.
Ein Kunde von mir, Leiter eines Familienunternehmens mit 100-jähriger Geschichte, sagte mal: »Wissen Sie, was ich an den Klostergärten bewundere? Die hatten keine Exit-Strategie. Die mussten für Generationen planen.«
Das ist der Punkt. Diese Gärten vereinten alles: Küche für die Gemeinschaft, Apotheke für die Kranken, Ruheort für die Seele. Multifunktional. Wie ein gut geführtes Unternehmen, das mehrere Märkte bedient und dabei Wert auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden legt.
Das Faszinierende: Diese Systeme liefen jahrhundertelang ohne ein einziges Software-Update. Keine geplante Obsoleszenz, kein Wartungsvertrag. Pure, funktionierende Nachhaltigkeit.
1.2 Traditionelle Gartenbaumethoden als Vorbild für nachhaltige Lösungen
»Dietraditioneller Gartenbau drei Schwestern« – soGartenbau, traditionell nennen die Maya ihr geniales Anbausystem aus Mais, Bohnen und Kürbis.2 Jede Pflanze hat ihre Aufgabe: Der Mais ist die Rankhilfe, die Bohnen liefern Stickstoff, der Kürbis fungiert als lebender Mulch.
»Wie im Garten«, illustriere ich das gerne in meinen Workshops. »Stellen Sie sich vor, Ihre Abteilungen würden so zusammenarbeiten. Marketing unterstützt Vertrieb, Entwicklung versorgt Produktion mit Innovationen und die Verwaltung hält allen den Rücken frei.«
Das machen diese drei Pflanzen seit über 1000 Jahren.
In Südostasien entwickelten findige Landwirte derweil ein anderes Meisterwerk: die Reisterrassen von Banaue (Philippinen).3 2000 Jahre alt, immer noch in Betrieb. Ein Bewässerungssystem, das ohne Pumpen, ohne Strom, ohne komplizierte Technik auskommt. Nur mit Schwerkraft.
Und in Afrika kultivierten die Menschen Waldgärten.4 Das sind mehrschichtige Anbausysteme, die einem natürlichen Wald nachempfunden sind. Gemüse unten, Beeren in der Mitte, Obstbäume oben. Jede Etage nutzt das verfügbare Licht optimal. Effizienter als jede Fabrikhalle, nachhaltiger als jede Monokultur.
All diese Systeme folgen einem simplen Prinzip: Sie arbeiten mit natürlichen Prozessen, nicht gegen sie. Ein Konzept, das wir heute unter dem schicken Begriff »Biomimikri« wiederentdecken.5
2 Lubera (o.J.): Die drei Indianerschwestern: Mais, Stangenbohnen und Kürbis. Online verfügbar unter: https://www.lubera.com/de/gartenbuch/die-drei-indianerschwestern-p774 (abgerufen am 14. Juli 2925).
3 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, »Rice Terraces of the Philippine Cordilleras,« World Heritage List, 1995.
4 Gemeint sind Waldgärten wie die Gedeo Agroforestry Systems in Äthiopien, Chagga Home Gardens in Tansania, traditionelle Agroforstsysteme unter anderem in Nigeria und viele mehr.
5 Benyus, J. M. (1997). Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. HarperCollins Publishers.
1.3 Der Übergang zur industriellen Landwirtschaft und ihre Folgen
Dannindustrielle Landwirtschaft kam die Mitte des 20. Jahrhunderts – und mit ihr die große Verführung. Nach zwei Weltkriegen wollte niemand mehr hungern. Die Industrie versprach eine Lösung: KunstdüngerKunstdünger aus der Munitionsfabrik, PestizidePestizide aus dem Chemielabor.
»Warum mühsam kompostieren«, dachten sich unsere Großväter, »wenn es Kunstdünger gibt? Warum Nützlinge fördern, wenn man Schädlinge einfach wegspritzen kann?«
Die Zahlen sprachen für sich: Erträge explodierten, Arbeitszeit schrumpfte, Kosten sanken. Jeder Controller wäre begeistert gewesen. Das Problem? Niemand führte eine Vollkostenrechnung durch.
Ein Kunde von mir, ein Landmaschinenhändler, erklärte es mir einmal so: »Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Auto für 20.000 Euro, aber der Motor hält nur ein Jahr. Billig oder teuer?« Die industrielle Landwirtschaft war das billige Auto – mit dem Unterschied, dass der Boden nicht so einfach zu ersetzen ist wie ein Motor.
Die UN-Ernährungsorganisation FAO schlug 2015 Alarm: Bei der aktuellen Degradationsrate bleiben uns weltweit nur noch etwa 60 Ernten. Sechzig! Das entspricht ungefähr zwei Generationen.6 Die Zukunft unserer Enkel steht buchstäblich auf Treibsand.
6 FAO and Intergovernmental Technical Panel on Soils, »Status of the Worldʼs Soil Resources,« 2015.
1.4 Die Wiederentdeckung nachhaltiger Gartenbaumethoden
DieGartenbau, nachhaltignachhaltiger Gartenbau 1970er Jahre waren nicht nur die Ära von Schlaghosen und Flower-Power. Es war auch das Jahrzehnt des ökologischen Erwachens. Der Weckruf kam schon 1962 – als Rachel Carson mit Silent Spring7 erstmals eindringlich vor den Folgen von Pestiziden warnte. Ihre Botschaft hallte nach: »Houston, wir haben ein Problem.« Und jetzt hörte die Welt endlich hin.
Bill Mollison und David Holmgren begründeten die PermakulturPermakultur nicht am Reißbrett, sondern durch geduldige Beobachtung der Natur. Statt gegen Ökosysteme zu arbeiten, fragten sie sich: »Warum nicht von ihnen lernen?« Ihr Ansatz: Kreisläufe verstehen, natürliche Prinzipien übernehmen – und dadurch produktive, resiliente und nachhaltige Systeme gestalten.8
Demeter-Betriebe gehen noch weiter: Ihre biodynamische Landwirtschaft bezieht sogar MondphasenMondphasen und kosmische Rhythmen in die Aussaat ein. Umstritten in der Theorie, überzeugend in der Praxis: Diese Flächen weisen nachweislich höhere Humusgehalte und bessere Bodenfruchtbarkeit auf als konventionelle Betriebe.9
Nachhaltigkeit ist keine Raketenwissenschaft. Es ist eher wie Fahrradfahren: Am Anfang schwierig, dann selbstverständlich. Die meisten »neuen« Methoden sind uralt. Mulchen kannten schon die Römer. Mischkultur war und ist Standard bei indigenen Völkern. Kompostierung ist so alt wie die Landwirtschaft selbst.
Wir haben das Rad nicht neu erfunden – wir haben nur vergessen, dass es schon immer rund war.
7 Carson, R. (1962). Silent Spring. Houghton Mifflin Company.
8 Mollison, B., & Holmgren, D. (1978). Permaculture One: A Perennial Agriculture for Human Settlements. Corgi Books.
9 FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau): Vergleichende Langzeitstudien zu Humusgehalt in Bio- und Demeter-Betrieben, Studie: Biodynamic Preparations Influence Soil Quality and Yield (Kunz et al., 2001).
1.5 Aktuelle Trends und Entwicklungen im nachhaltigen Gartenbau
1.5.1 Bildung und Gemeinschaft
Ein GartenGartenbau, aktuelle Trends ohne Gärtner ist wie ein Unternehmen ohne Mitarbeitende. Deshalb boomen Gemeinschaftsgärten wie Steinpilze nach einem warmen Regen.
Im April 2024 besuchte ich einen urbanen Gemeinschaftsgarten in Bamberg. Dort diskutierten Werner (77, pensionierter Ingenieur) und Fatima (25, Softwareentwicklerin) hitzig über Tomatensorten. »Die alten Sorten haben Geschmack!«, beharrte Werner. »Aber die neuen sind resistenter!«, konterte Fatima.
Am Ende pflanzten sie beide Sorten nebeneinander. Experiment statt Ideologie. Oder wie wir Gärtner sagen: Diversifikation des Portfolios.
Als ich im September wiederkam, strahlten beide. Werners alte Sorten hatten tatsächlich mehr Geschmack entwickelt, Fatimas resistente Hybriden aber die heißen Augustwochen besser überstanden. »Jetzt mischen wir«, lachte Werner. »Alte Gene für den Geschmack, neue Züchtungen für die Sicherheit.« Fatima nickte: »Wie beim Mergen verschiedener Code-Branches: das Beste aus beiden Welten zusammenführen.« Aus Konkurrenten waren Kollaborateure geworden.
Diese Gärten sind wie Universitäten ohne Hörsäle. Wissen wird beim Unkrautjäten weitergegeben, Innovationen entstehen zwischen Kohlrabi und Karotten. Alte Weisheit trifft neue Ideen. Ein Netzwerk, das organisch wächst – im wahrsten Sinne des Wortes.
1.5.2 Smart Gardening & Digitalisierung
»MeinSmart Gardening Garten hat mehr Sensoren als manche Fabrik«, erzählte mir neulich ein IT-Manager stolz. Bodenfeuchtigkeit, pH-Wert, Nährstoffgehalt – alles live auf seinem Smartphone verfügbar.
Früher hätte ich gelacht. Heute staune ich. Warum? Weil intelligente Technologie Fehler verhindern kann, die selbst erfahrene Gärtner machen.
Ein Beispiel: Automatische Bewässerungssysteme, die mit Wetterdaten gekoppelt sind. »Morgen regnet es? Dann heute kein Wasser!« Das spart nicht nur Ressourcen – es verhindert auch Staunässe, den stillen Tod jeder Tomatenpflanze.
Abb. 4:
Automatische Bewässerungssteuerung
Besonders clever finde ich Apps zur Pflanzenerkennung. Unkraut oder Wildkraut? Nützling oder Schädling? »Ich mache ein Foto und die KI liefert die Antwort. Früher musste ich Bestimmungsbücher wälzen, heute machtʼs die App in drei Sekunden.«
Aber Vorsicht vor Technik-Gläubigkeit: Ein Sensor ersetzt kein Gespür. Die beste App ist immer noch die eigene Beobachtungsgabe. Digital unterstützt analog – nicht umgekehrt.
1.5.3 Urban & Vertical Gardening
»Kein Platz für einen Garten?« Diese Ausrede zählt nicht mehr. Ich kenne Hobbygärtner, die auf wenigen Quadratmetern Balkon mehr ernten als mancher Schrebergarten-Besitzer.
Die Lösung? VerticalVertical Gardening Thinking! Vertikale Gärten nutzen Wände wie Anbauflächen. Salat in Europaletten, Erdbeeren in selbstgebauten Türmen, Kräuter in Pflanztaschen – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Ein Beispiel aus meiner Heimat zeigt, wie aus Beton neue Wurzeln sprießen können: Eine Gärtnerei betreibt Vertical Farming in einer ehemaligen Bunkeranlage. Microgreens wachsen hier auf mehreren Ebenen – mit 30 Prozent weniger Wasser, 90 Prozent kürzeren Transportwegen und 365 Tagen Erntezeit. Und die Qualität? Köche und Restaurants reißen sich darum. Urbane Landwirtschaft trifft Hochtechnologie – mitten im Beton.
Urban GardeningUrban Gardening demokratisiert den Gartenbau. Man braucht nicht viel Grund und Boden – nur Ideen und Engagement. Wie in der Start-up-Szene: Der beste Plan des besten Teams schlägt das größte Budget.
1.6 Ziele im nachhaltigen Gartenbau
Abb. 5:
Ziele im nachhaltigen Gartenbau
1.6.1 Ökologische Ziele: Schutz und Förderung natürlicher Ressourcen
»Wasnachhaltiger Gartenbau, Ziele ist Ihr wichtigstes Kapital?«, frage ich Unternehmer gerne zu Beginn meiner Workshops. Die Antworten variieren: Mitarbeitende, Maschinen, Know-how. Alles richtig. Das Wichtigste aber übersehen viele: den Boden unter ihren Füßen.
Ohne fruchtbaren Boden keine Nahrung. Ohne Nahrung keine Gesellschaft. Ohne Gesellschaft keine Wirtschaft. So einfach ist die Rechnung.
Die ökologischen Ziele des nachhaltigen Gartenbaus lesen sich wie eine Unternehmensstrategie:
CO₂-ReduktionCO₂-Reduktion durch Humusaufbau: Ein gesunder Boden ist ein enormer Kohlenstoffspeicher. Tatsächlich halten die Böden der Welt mehr Kohlenstoff als die gesamte Vegetation und die Atmosphäre zusammen.10 Klimaschutz beginnt wortwörtlich unter unseren Füßen.
RessourceneffizienzRessourceneffizienz durch Kreisläufe. Weniger Input, mehr Output. Abfall wird zu Rohstoff. Was in der Wirtschaft »Circular Economy« heißt, praktizieren Gärtner seit Jahrhunderten.11
BiodiversitätBiodiversität als Risikostreuung. Vielfalt macht robust. Ein Monokultur-Unternehmen ist wie ein Ein-Produkt-Unternehmen: ein Klumpenrisiko auf Beinen.
Wie in meinem Garten zeigt sich: Ökologie ist nicht der Gegner der Ökonomie – sie ist ihr bester Freund. Schließlich ist rund die Hälfte des globalen Bruttoinlandprodukts mäßig bis hochgradig abhängig von der Biodiversität, eine stolze Summe von schätzungsweise 44 Billionen US-Dollar.12
1.6.2 Ökonomische Ziele: Wirtschaftlichkeit, Innovation und Resilienz
»Nachhaltigkeit kostet nur Geld!« Diesen Satz höre ich oft. Meine Antwort darauf: »Nicht-Nachhaltigkeit kostet mehr – die Rechnung kommt nur später.«
Ein Beispiel aus meinem Netzwerk: Stefan führt einen Gemüsehof mit Direktvermarktung im Chiemgau. Vor sechs Jahren stellte er komplett auf biologischen Anbau um. Die ersten beiden Jahre: Ertragsrückgang, Mehrkosten, schlaflose Nächte.
Heute? »40 Prozent niedrigere Betriebskosten, weil ich keine Chemie mehr kaufen muss. Zudem im Durchschnitt 30 Prozent höhere Verkaufspreise durch Bio-Qualität. Und gesünderen Boden, der auch Extremwetter wegsteckt.«
Die Dürre 2022 war der Lackmustest: »Meine konventionellen Nachbarn hatten Totalausfall. Mein humusreicher Boden hielt die Feuchtigkeit. Beste Ernte seit Jahren.«
Der Bio-Markt boomt übrigens ungebrochen: 2023 gaben Deutsche über 16,1 Milliarden Euro für ökologische Lebensmittel aus – ein Plus von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.13
»Früher musste ich erklären, warum meine Tomaten teurer sind«, berichtet eine Marktstandbetreiberin. »Heute fragen die Kunden von selbst nach ungespritzter Ware mit authentischem Geschmack.«
Selbst Discounter haben begriffen: Nachhaltigkeit verkauft sich. »Unser Bio-Sortiment haben wir verdreifacht«, verriet mir ein Filialleiter aus dem Nachbarort. »Bessere Marge, zufriedenere Kunden.«
Aber Vorsicht vor Greenwashing! Authentizität ist das A und O. Echte Nachhaltigkeitsgeschichten verkaufen sich besser als jede Hochglanzwerbung.
1.6.3 Soziale und gesellschaftliche Ziele: Zusammengehörigkeit, Bewusstseinsbildung
»Ein Garten ist der kleinste Beitrag zum Weltfrieden«, sagte einmal eine ältere Gärtnerin zu mir.
Übertrieben? Schauen Sie sich um:
In Gemeinschaftsgärten gärtnern Manager neben Studierenden. Ausländische Mitbürger zeigen Einheimischen, wie man Okra anbaut. Kinder lernen, dass Pommes mal Kartoffeln waren.
»Und das Schönste?«, berichtete mir kürzlich eine Grundschullehrerin. »Die Kinder aus unserem Schulgarten arbeiten besser zusammen. Sie haben gelernt, dass Wachstum Geduld und Fürsorge braucht.«
Nachhaltige Gärten sind Klassenzimmer, Begegnungsstätten und Therapiezentren in einem. Sie erden uns – im wahrsten Sinne des Wortes. In einer Welt, die immer virtueller wird, ist das unbezahlbar.
Fairness gehört auch dazu: Faire Preise für Saatgut, faire Löhne für Gärtner, faire Chancen für alle. Wenn wir schon die Welt verbessern wollen, dann richtig.
Der nachhaltige Gartenbau beweist: Ökologie, Ökonomie und Soziales sind keine Gegensätze. Sie sind wie die drei Schwestern der Maya – gemeinsam unschlagbar.
10 Lal, R., »Soil Carbon Sequestration Impacts on Global Climate Change,« Science, 2004.
11 Grundlagenwerk: McDonough, W., & Braungart, M. (2002). Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. North Point Press. Führende Institution: Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition. Ellen MacArthur Foundation.
12 Weltbank (2022): Securing Our Future Through Biodiversity, online verfügbar unter: https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2022/12/07/securing-our-future-through-biodiversity (abgerufen am 14. Juli 2925) und World Economic Forum (2020): Half of World’s GDP Moderately or Highly Dependent on Nature, Says New Report, online verfügbar unter: https://www.weforum.org/press/2020/01/half-of-world-s-gdp-moderately-or-highly-dependent-on-nature-says-new-report (abgerufen am 14. Juli 2925).
13 Bundesverband Naturkost Naturwaren, »Branchenreport 2024«.
2 Nachhaltigkeit als Grundlage für eine zukunftsfähige Wirtschaft
»NachhaltigkeitNachhaltigkeit ist das Modewort unserer Zeit«, stöhnt Lars und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. »Alle reden davon, aber wennʼs um Taten geht, bleibtʼs beim guten alten Bullshit-Bingo.«
Lars, Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens in der Metallindustrie, klingt genervt. Aber ich kenne ihn gut genug – hinter seinem Frust blitzt Sorge durch. Er weiß längst: Trotz des Hin und Her und der versprochenen Erleichterungen der Politik bezüglich der Lieferketten und CSRD-Regularien, dass er dieses Thema nicht mehr lange aussitzen kann.





























