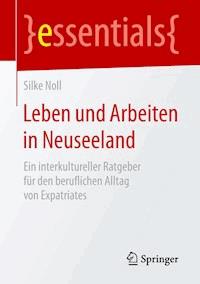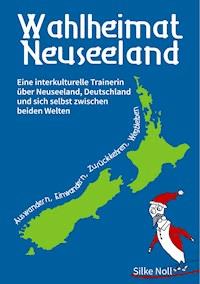
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wahlheimat Neuseeland schaut interkulturell auf Menschen und ihre Weisen, die Welt zu sehen. Mit Fokus auf die kleinen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Neuseeland und Europa erzählt Silke Noll, was sie bei ihrer ersten Rückreise seit ihrer Auswanderung nach Wellington, Neuseeland, erlebt und bewegt. Auswandern und Zurückkehren - beides hat seine Tücken. Was geschieht bei einer Rückkehr in unsere vermeintlich wohl bekannte Heimat? Was erinnert wie an die Wahlheimat? Ob Auswanderer, Einwanderer, Rückkehrer, Wegbleiber, Geschäftsreisender, Weltreisender, Normalbürger ... Reisen und Leben in anderen Ländern prägt. Die Autorin liebt das Leben "anders" und "anderswo" und doch "normal". Wie viele Weltreisende gestaltet sie ihre eigene kleine Welt. Humorvoll erklärt sie mit ihrem Mentor Kaitiaki, einem "klugscheißenden" Tui-Vogel, Unterschiede, Eigenarten und Gemeinsamkeiten der Kulturen. Das in der interkulturellen Theorie oft verwendete Eisbergmodell erklärt die verschiedenen Ebenen. Im Buch ersetzt die neuseeländische Vulkaninsel White Island es. So wird deutlich, dass nur wenig oberflächlich sichtbar ist, was die Kultur eines Landes ausmacht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Verena
Keiner kommt von einer Reise so zurück, wie er weggefahren ist.
Graham Greene (1904 – 1991)
Empfehlungen
Als interkulturelle Trainerin und Ausbilderin muss ich viele Texte zum Thema lesen. Häufig sind sie wissenschaftlich und trocken, noch häufiger fehlen gute Beispiele um Konzepte verständlich zu machen. Das verwundert, fußen interkulturelle Studien schließlich auf eingehenden Beobachtungen menschlichen Handelns. Umso erfreulicher war die Lektüre dieses Buches über Neuseeland – aus der Sicht einer sehr reiseerfahrenen, noch jungen Auswanderin. Die Autorin würzt geschickt die eigenen Erlebnisse mit fundiertem interkulturellem Wissen, und verquirlt Beobachtungen aus ihren Reisen in aller Welt zu einem faszinierenden und kurzweiligen Bericht über das Leben in Neuseeland und Deutschland, garniert mit ein bisschen anderswo. Länderwissen, gekoppelt mit Selbstreflektion ist ein bewährtes Rezept für interkulturelle Kompetenz. Wahlheimat Neuseeland demonstriert wie das geht. Ich vergebe die höchste Sternzahl!
– Susan Hoppe, interkulturelle Trainerin
Jeder, der in Neuseeland war, sagt: "Ein traumhaftes Land, und die Menschen sind so toll und entspannt …!" Ich selbst habe ein Jahr in Neuseeland gearbeitet und mir mit 3 Kiwi-Mädels eine WG geteilt. Ich konnte nie sagen, was es eigentlich war, das mir den Abschied von Neuseeland so schwer gemacht hat. Beim Lesen von Wahlheimat Neuseeland hatte ich viele Aha-Effekte. Ich habe viele Antworten bekommen, warum ich das Land und die Leute so liebe.
Durch die persönlichen Erzählungen der Autorin erfährt man nebenbei auch ganz viel über die eigenen Landsleute und viele andere Nationen.
– Petra Lenz, Rückkehrerin, die heute in Hamburg lebt
Wahlheimat Neuseeland ist nicht nur lustmachender Ratgeber, sondern setzt sich mit länderspezifischen Eigenarten sowie kulturellen Unterschieden humorvoll und reflektierend auseinander. Dabei entsteht ein umfassendes, die Welt umarmendes Bild, das das Heimatland der Autorin ebenso zeigt wie das neu gefundene Zuhause im Südpazifik. So erlebt man nicht nur die zwischenmenschlichen Beziehungen, Lebensart und Eigenarten der Insel durch die Augen der Autorin, sondern auch die oft mit einem Lächeln angenommenen Probleme bzw. deren Bewohner. Spannend zu lesen und mit einem vielfältigen Angebot an Infos zu Land und Leuten zeichnet das Buch ein herrliches Gegenstück zu Deutschland und sogar Europa bzw. dessen Einwohnern und Weisen, das Leben zu meistern; wobei die Liebe zur ursprünglichen Heimat jedoch durch jede Zeile durchscheint. Ein gelungenes Stück erzählender und zugleich auf interkulturellem Ansatz basierender fundierter Einblick in einen eher ungewöhnlichen Alltag auf der anderen Seite der Weltkugel.
– Marika Mochi, Lektorin
Ich lebe seit acht Jahren in Neuseeland und habe schon einige Bücher über das Leben in Neuseeland aus deutscher Sicht gelesen. Wahlheimat Neuseeland ragt für mich heraus, da die Autorin gelungen an verschiedenen realen Beispielen den neuseeländischen Alltag sowie die Neuseeländer mit Witz und Charme beschreibt und geschickt und mit Hilfe des begleitenden Tui-Vogels Kaitiaki die wichtigsten kulturellen Unterschiede hervorhebt.
Der Autorin ist es bestens gelungen, die Hürden, die wir Einwanderer zu überwinden haben, aufzudecken und die Hintergründe zu erklären. Auch die Sicht der Neuseeländer kommt nicht zu kurz. Das Buch blickt eigentlich von zwei Kulturen auf zwei Kulturen – wechselseitig wird auf die Sicht der Neuseeländer und der Deutschen eingegangen. Von der Autorin sehr greifbar dargestellt. Mir gefällt auch, wie sie ihr Wissen als interkulturelle Trainerin einfließen lässt, ohne dabei mit trockenen Fakten den Leser zu langweilen. Spannung, Witz und tiefe kulturelle Einblicke sind garantiert!
– Manuela Mühlbauer, deutsche Auswanderin in Neuseeland
It was a pleasure to be one of the first people to read Wahlheimat Neuseeland. The author vividly captures the kiwi soul through her personal experiences, flavouring it with deep intercultural knowledge. I am a born-and-bred New Zealander, and reading the book got me excited and emotional about my own country! I even gave some pages to my Mum to try to translate as she took German for fun in her fifties. My mother is 94 and still sprightly.
One example of my mother's adaptability – one of the things described in the book – is when I picked her up at the airport the other day, she had no hesitation in coming to our bach where there was no power on. So she coped with no electricity, no running water, no flush in the toilet, no oven to cook or quick way to make a cup of tea! She took it all in her stride and enjoyed the simplicity of it. She brought out her knitting as she said she could still do that no matter what! I put it all down to the pioneering spirit.
My father, aside from his chosen profession as a medical doctor and engineer had many skills up his sleeve. Carpenter skills – he added in a new room to our house each time a new member of the family came along there are 6 of us (!), electrical skills. He sorted these problems out in our house, built retaining walls and garden sheds. He could also upholster and deep button furniture, lay out vege gardens and make compost. He built us kids a 15 meter concrete swimming pool with solar heating! He even cut his own hair – you would never have guessed! He was also a reasonable artist, violinist and could whip up a decent dinner.
Of course some of these skills were passed down from his father and mother but at that time the DIY was even more strongly evident than today. He said sometimes you could easily do a job properly and better yourself! Do a good job. Be independent. Be resourceful. Instead of relying too much upon others. The pioneering spirit is still alive! The early settlers (1840s and onwards) needed to be resourceful, self-reliant, adaptable to survive a new life in a strange land inhabited for that time only by strange people. These traits are clearly seen in my parents. And in theirs before them.
The book stirred up so many memories! It is a must read for people who love NZ and like to live in this beautiful country. Long live the kiwi pioneering spirit!!
– Susan Sellers, waschechte Neuseeländerin mit Pioniergeist
Über die Autorin
Lange Zeit war sie dort, nie hier – bis sie Neuseeland entdeckte. Zugegeben einige Seeleute kamen ihr bei der Entdeckung zuvor, aber immerhin, auch die Autorin fand erstaunlicherweise den Weg.
Die zertifizierte interkulturelle Trainerin, Autorin und Neuseelandexpertin Silke Noll interessiert sich bereits seit ihrer Kindheit für Menschen anderer Kulturen. Als Agile Coach und Scrum Master ist sie international freiberuflich tätig. Sie wurde von einer Weltreisenden zu einer Auswanderin nach Neuseeland und lebt heute in ihrem Beachhouse in Wellington. Natürlich hat sie auch den neuseeländischen Weihnachtsbaum, Pōhutukawa, ganzjährig vor der Tür stehen, der im Sommer Hochsaison hat. Von ihren sehr persönlichen Erfahrungen mit der neuseeländischen, deutschen und anderen Kulturen im multikulturellen Land am anderen Ende der Welt erzählt sie im ersten umfassenden Buch über Neuseeland aus interkultureller Sicht, angereichert durch ihr fundiertes Know-how als Trainerin und Pfälzerin. Nicht Deutsche, wo kämen wir denn da hin, da wäre sie ja die erste Deutsche, die zugeben würde, deutsch zu sein. Ihre Liebe zum Land scheint neben der Darstellung typischer Stolpersteine bei der Einwanderung auf jeder Seite des Buches durch. Mittelerde als Lebensmittelpunkt – was nach einer locker-leichten, ähnlich westlichen Kultur ausschaut, ist bei näherem Hinsehen doch ganz schön anders mit tief sitzenden Tücken, die sogar ihre Wanduhr nach der Ankunft im Container durchdrehen ließen. Dabei versucht sie das für eine Deutsche aus internationaler Sicht schier Unmögliche: mit einer guten Brise Humor den Leser zu fesseln, wobei ihr Begleiter und Mentor, der Tuivogel Kaitiaki, sie glücklicherweise mehrsprachig zwitschernd unterstützt. Sonst wäre der Versuch, witzig zu sein, womöglich in die Hose gegangen.
Mehr über sie erfährst Du unter www.wahlheimat-neuseeland.de.
Stationen einer Reise
He kupu whakataki – Vorwort
Interkulturelles Inhaltsverzeichnis
Wie kam ich nach Neuseeland? – oder: Wie ich von einer Weltreisenden zu einer Auswanderin wurde…
Abreise aus Neuseeland
Unterwegs Richtung Europa: San Francisco
Unterwegs Richtung Europa: Kuba
Europa. Deutsche Weingegend – die Pfalz
Köln – oder: Die Rückkehr der Straßencafés
Besuch in der Saunalandschaft
Frankfurt – Willkommen in der Stadt der Pinguine
London – die Stadt, wo alles begann…
Fitness-World
Barcelona – pura vida
Berlin – die explodierende neue Welt
Die Alltagswelt – Museen, Medien, Kindheit, Helikoptereltern und die Arbeitswelt
Das alte Zuhause – Hamburch und Sylt
Die ehemalige Station im Rheinland – Düsseldorf und Köln
Die alte Liebe – Toskana
Fast das alte Studien-Zuhause – Nizza
Hallo Deutschland – oder: Wie geht es weiter, wenn du nach einem Auslandsaufenthalt langfristig in deine Heimat zurückkehrst?
Auf dem Weg zurück nach Neuseeland: Nicaragua
Auf dem Weg zurück nach Neuseeland: San Francisco
Ankunft in Neuseeland
Drei Wochen später – zu Hause in Neuseeland
Einen Monat später – der Tag, an dem die Erde bebte
Eine Woche nach dem Erdbeben – zurück im Berufsalltag
Sechs Monate nach der Reise – Erholung nicht abgeschlossen
Kupu opaniraa – Schlusswort
Whakawhetai – Danksagung
Anhang
Kiwi Wiki – Miniglossar
Weiterführende Literatur
Anmerkungen
Index
He kupu whakataki – Vorwort
Wer kennt es nicht? Dieses Gefühl, wieder nach Hause zu kommen in die gute alte Stube. Seit meiner Kindheit war ich etliche Male in meinem Leben wieder nach Deutschland zurückgekommen – nach Reisen, Auslandsstudium oder einem Job im Ausland. Jedes Mal ein bisschen weniger. Jedes Mal blieb ein bisschen mehr von mir irgendwo da draußen in der weiten Welt. Nachdem ich Neuseeland für mich entdeckt hatte, wurde das Fernweh mit jedem Besuch stärker. Mit jeder Reise blieb ein bisschen mehr von mir in dem fernen Land, bis ich an das für mich schönste Ende der Welt umzog.
Bei meiner ersten Rückreise seit der Auswanderung möchte ich mir von außen bei dem Besuch in deutschen Gefilden zuschauen und darüber schreiben. Mit Fokus auf die kleinen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Neuseeland und Europa. Das alles mit einem schmunzelnden Auge auf mich als Deutsche und Deutschland, auf Europa, Neuseeland und den Rest der Welt. Die Reise startet und endet in Neuseeland und führt über Kuba und Nicaragua. In Europa führen die Stationen quer durch Deutschland, nach Barcelona, in die Toskana, durch England sowie Frankreich. Erinnerungen an Erlebnisse mit italienischen Freunden und deren Kultur kommen häufiger ins Spiel. Hilfreich, um die eigene und andere Kulturen zu verstehen. Maßgeblichen Einfluss hatte eine Brasilienreise, die mir meinen Weg nach Neuseeland zeigte.
Egal wo wir auf dieser Welt unterwegs sind: Wer reist oder in einem anderen Land lebt, kommt nicht um Vergleiche, wobei meist die eigene Kultur als normal und unkritisch wahrgenommen wird. Unterschiede erregen Aufmerksamkeit. Die eigene Kultur dient als Orientierungsrahmen, um die Beobachtungen in der anderen Kultur sinnvoll einordnen zu können.1 In einer internationaler werdenden Gesellschaft ziehen Vergleiche vermehrt in den Alltag ein. Daher sehe ich die Beobachtungen in Neuseeland nicht allein in meinem deutsch-europäischen Kontext. Asiatische und andere Einflüsse sind in der originär bi-kulturellen und heutzutage zutiefst multi-kulturellen Gesellschaft Neuseelands nicht wegzudenken. Historisch auf zwei Kulturen basierend kommen englische Aspekte ins Spiel sowie Facetten der einheimischen Kultur der Māori.
In Kuba, Nicaragua und auf Reisen in Europa erklären einige Erfahrungen meinen deutschen, europäischen oder westlichen Blickwinkel, andere die Wahrnehmungen als Auswanderin vom anderen Ende der Welt.
Vor allem interessiert mich, was Neuseeland seit der Auswanderung kulturell aus mir gemacht hatte. Als interkulturelle Trainerin berate ich Menschen, die in ein neues Land reisen (Eingliederung) oder die zurück in ihr Heimatland ziehen (Wiedereingliederung). In unzähligen Büchern sind Besonderheiten bestimmter Länder dokumentiert, auf was zu achten ist, wenn man in ein anderes Land immigriert. Kaum beschrieben wird das Zurückkommen, das für viele die einschneidendere Erfahrung ist. In einem fremden Land erwartet man Unbekanntes. Bei einer Heimkehr erwartet man nicht, dass man sich selbst auf der Reise verändert hat, und dass sich das vermeintlich Vertraute gewandelt hat oder auch nicht. Beides kann überraschen. Ich bin gespannt, was bei der Rückkehr nach Deutschland bzw. Europa, mit mir passieren wird. Werde ich den üblichen Wiedereingliederungsschock (Reverse Culture Shock) erleben? Ich bin gut vorbereitet. Oder vielleicht doch nicht? Wir werden sehen …
Da es unter Reisenden und Auswanderern kein „Sie“ gibt, bleibe ich in diesem Buch beim „Du“.
Wie sich auf der Reise zeigt, können die Eigenarten einer Kultur auf verschiedenen Ebenen wahrgenommen werden. Diese werden in der interkulturellen Theorie mit dem häufig verwendeten Eisbergmodell erklärt. Sprache, Kleidung, Literatur, Symbole etc. sind sichtbar und liegen über der Oberfläche. Werte, Normen und Erwartungen liegen darunter. Die Spitze des Eisbergs zeigt nur einen geringen Teil dessen, was die Kultur eines Landes ausmacht. Der ausschlaggebende Teil ist verdeckt und wird oft nur subtil wahrgenommen. Die Struktur dieses Buches wird in Anlehnung an dieses Modell durch einen ganz besonderen Berg bestimmt: White Island, einer der Vulkane, die das neuseeländische Leben maßgeblich beeinflussen. Der Krater der aktiven Vulkaninsel im Nordosten der Nordinsel zeigt die Existenz des Vulkans nur andeutungsweise über der Wasseroberfläche. Darunter brodelt es ständig. Eruptionen passieren unvorhersehbar.
Glücklicherweise wird mich der mit der Natur besonders verbundene, indigene Tui-Vogel Kaitiaki auf der Reise begleiten. Nur er vermag zu erklären, was sich im Verborgenen tatsächlich abspielt. „Kaitiaki“ ist ein Wort der neuseeländischen Ureinwohner, der Māori. Es bedeutet Beschützer, Orientierungshilfe, Anker. Er bleibt dem Brauch der Māori treu, die sich über ihre internen Regeln bewusst sind: Bevor man als Fremder in die Gemeinschaft eingeladen wird, bekommt man bei den neuseeländischen Ureinwohnern einen Mentor zugewiesen, der den Gast in die unsichtbaren Regeln der unbekannten Kultur einführt. Mein persönlicher Ansprechpartner Kaitiaki ist der Tui, der jeden Morgen um mein Haus in Wellingtons Lyall Bay herum zwitschert, wenn ich meinen Kaffee trinke oder mir im Bad kaltes Wasser ins Gesicht schaufele, um aufzuwachen. Der Tui ist ein typischer neuseeländischer Vogel, fesch und seriös zugleich, dessen zwei weiße Federn im Kragenbereich aussehen wie eine weiße Fliege. Tuis sind dafür bekannt, dass sie das Gezwitscher anderer Vögel imitieren. Auch Kaitiaki kann sich sehr gut in andere hinein versetzen. Er spricht mehrere Sprachen. Wundere dich also nicht, wenn er auch mal gackert oder sonstige Töne von sich gibt. Er wollte mich unbedingt auf meiner Reise nach Europa begleiten, das er noch nicht kennt. Zu gerne möchte er interkulturell klugscheißen.
Übrigens findest du im Buch ab Seite → ein kleines Kiwi Wiki, ein Miniglossar, das dich neben den Anmerkungen, dem Index und weiterführender Literatur auf deiner Buchreise begleitet.
Interkulturelles Inhaltsverzeichnis
Auf den folgenden sechs Seiten entdeckst Du das interkulturelle Inhaltsverzeichnis, das dir anhand der Vulkaninsel White Island den Weg weist zu den interkulturellen Unterschieden zwischen Deutschland und Neuseeland.
Oberhalb des Wasserspiegels findest Du die Bereiche, die dir bewusst und weniger problematisch sind im gegenseitigen Verständnis der Kulturen.
Unterhalb der Meeresoberfläche sind die eher unbewussten bzw. verdeckten Bereiche zu sehen, die vor allem für Missverständnisse sorgen.
Die Seitenzahlen verweisen auf die Stellen im Buch, wo sie erklärt werden. Im Text selbst sind sie wie hier in den vorherigen beiden Sätzen durch unterschiedliche Schriften verdeutlicht.
Small Talk, Kontakt aufnehmen und Distanz
Wie du zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Rituale vom Kennenlernen im Geschäftsalltag bis zur Begrüßung unter Freunden verwendest.
DIY, oder: „Vermisst du eigentlich gar nichts aus Deutschland?“
Was dir in Neuseeland fehlen wird – und wie du als Auswanderer damit zurecht kommst.
Motto-Partys
Der deutsche Karneval – Surfer, Paraglider und LKW-Fahrer im Nikolauskostüm.
Waschmaschinen
Eine nie enden wollende Diskussion in neuseeländisch-deutschen Haushalten.
Selbständigkeit, Individualismus und Kollektivismus
Weshalb Hilfsbereitschaft und den Anderen machen lassen kein Widerspruch ist – und was du tun kannst, wenn du dich allein gelassen fühlst und dir mehr Unterstützung wünschst.
Humor
Warum Humor nicht gleich Humor ist, wie du Fettnäpfchen vermeidest und wie der nationale Humor sich in Filmen und im Kabarett widerspiegelt.
Kiwi Ingenuity und der deutsche Ingenieur und Handwerker
Vom Nummer 8-Draht über Baumärkte bis zu Bunnings, von Anpassungsfähigkeit und Erfindergen als Nationalsymbole.
Neuseeländische Häuser
Weshalb du in Neuseeland keinen deutschen Baustandard vorfinden wirst.
Wein
Von den kleinen Unterschieden, und wie / wo du in Neuseeland den richtigen Wein für dich findest.
Typisch deutsch
Was ist eigentlich typisch deutsch? Erste Gedanken zu dieser Frage, die sich jeder Auswanderer irgendwann stellt.
Der Mensch sieht nur so viel, wie er aus eigener Erfahrung kennt
Was Moskitospray aus Traktorauspuffen und Kolumbus gemeinsam haben.
Klimatische Besonderheiten
Gedanken während der Reise zu klimatischen Besonderheiten im interkulturellen Kontext und im Land der langen weißen Wolke.
Essen – oder: Was vermisst der Neuseeländer im Ausland?
Neuseeländisches Essen – leider oft unterschätzt und als nicht vorhanden abgehakt.
Neuseeländer – Jäger, Fischer, Angler
Der Umgang mit der Natur und das selbstverständliche Verhältnis zum Jagen in einem Land, in dem es ursprünglich kaum Säugetiere gab.
Scheibenwischer
Das andere Rechts.
Der deutsche Bleifuß
Ein eigenständiger Teil von mir, zurückzuführen auf „the German Autobahn“.
Kreisverkehr in Deutschland und Neuseeland
Wie man in Neuseeland und Deutschland in den Kreisel hinein- und hinausfährt.
Toiletten – „schöner Scheißen“ in Neuseeland
Der kleine, aber feine Unterschied hinter verschlossenen Türen.
Sicherheit – Risiko – Freiheit – Stabilität – Flexibilität
Wichtige Werte im Interkulturellen, bei denen ich meinen Wandel von einer Deutschen zu einer Möchtegern-Kiwi spüre.
Lokales Selbstbewusstsein in Deutschland
Aus Sicht einer pfälzischen „Grenzgängerin“.
Flughäfen, Gepäckbänder, Aufzüge und der deutsche Killerblick
Ein deutsches Phänomen: einzigartig, nicht erlernbar und nicht abtrainierbar.
Flugsicherheitsvideos
Aus der humorvollen Welt der Hobbits und ihrem deutschen Pendant.
Versicherungen
Ein Resultat des nationalen Sicherheitsbewusstseins und ein Vergleich, der keiner ist: Genau hinschauen lohnt sich.
Ping-pong Poms
Vom ewigen Pendeln zwischen Down Under und Europa.
Hilfe zur Selbsthilfe
Von defekten Gasheizungen, elektrischen Garagenöffnern und Toilettentürgriffen – Geld gegen Leistung oder Leistung gegen Leistung?
Gesellschaftliche Abende – und was hat das mit Zuverlässigkeit zu tun?
Warum du als deutscher Auswanderer anfangs daran verzweifelst, erst am Ende einer Party zu wissen, wie viele Leute kommen werden.
Mögliche erste Phase des Wiedereingliederungsprozesses
Jubidubidu! Nichts ist schöner als die Heimat.
Entfernungsbewusstsein
Busfahren im Flugzeug mit Kindern und das neuseeländische Jahr „overseas“.
Das WG-Leben – und „the German Gemütlichkeit“
Von Mikrokosmen, Makrokosmen, Stoßlüften und Luftentfeuchtern.
Trinkgeld und Bezahlen
Wie ich in Europa regelmäßig die Zeche prellte, von „Koha“, „round-buying“, „free -loading“ und „fair-playing“.
Besuch in der Saunalandschaft
Von Thermen, romantischen Saunaboxen, dem deutschen Parallel-Stereotypen, gemischten Umkleidekabinen und Saunen, Eisbecken, Kaltwasserschläuchen, Aufgüssen und besetzten Liegen. Sowie von Nacktwettbewerben und Nacktstränden in Neuseeland.
Mögliche zweite Phase des Wiedereingliederungsprozesses
Ups! Alles ist anders und irgendwie auch nicht.
Zeitverständnis – Zurück voraus in die Vergangenheit
Von der Sauerkraut-Frequenz und der Kiwi-Frequenz, und warum die Wanduhr nur die halbe Wahrheit über die Zeit sagt. Zeit – eine der Stimmen der „stillen Sprache“, die tief in uns schlummert und der Ursprung vieler sichtbarer Verhaltensweisen und Rituale ist.
Down Under in Deutschland, oder: Ein Leben unter Tage – Der Deutsche und sein Maulwurfgen
Und was es sonst noch so gibt: Wetterfühligkeit, Frühjahrsmüdigkeit, Föhnkrankheit.
Eingedeutscht
Integration anders herum – erste Gedanken zu Einwanderern in Deutschland.
Deutsche Direktheit – und wie komm ich raus aus derNummer. Oder: Wie sagt man „nein“, ohne „nein“ zu sagen?
Eine Feldstudie, die nach Alternativen sucht zu „Nein!“ und „Yeah naaaaa.“
Tax-free Shopping
Eine kurze Anleitung, wie man als Nicht-Mehr-EU-Bürger seine Mehrwertsteuer erstattet bekommt.
Freundschaft
Die „Anderen“ sind zu oberflächlich – oder bist du vielleicht einfach zu loyal? „Echte“ Freundschaft interkulturell betrachtet.
Hierarchie und Egalitarismus
Von einer nicht vorhandenen Klassengesellschaft rund um SNAKS, TORKS, IWIKS und BENZERS, der Auswirkung auf andere Werte, Verhaltensweisen und Gewohnheiten, und Hierarchiegedanken im Rest der Welt
Bankenwesen
PostIdent auf neuseeländisch, WebID und sonstige Besonderheiten.
Kleiderordnung
Von Flip-Flops unter Berateranzügen und typisch deutschen Jeans.
Tanzen
Wo tanzt man wieviel, und was ist sonst so der Mittelpunkt einer Party?
Verbote, Regeln und Kontrolle
Was nicht verboten ist, ist erst einmal erlaubt – von regelorientierter Kontrolle, personenorientierter Kontrolle, sonstiger Kontrolle und dem Recht, Recht zu haben.
Lebensqualität
Eine Frage des Blickwinkels – und einige Gedanken zu mit auswandernden Partnern.
Von Pfirsichen und Kokosnüssen
Ein interkultureller Vergleich.
Die eigene Meinung – Feedback - Direktheit – low context – Sachbezogenheit - Ehrlichkeit
Von der Tugend, eine eigene Meinung zu haben und gleichzeitig dem anderen nicht sagen zu wollen, was er tun sollte – kein Widerspruch.
Kaffee
Nein, es geht nicht um neueste Modetrends, wenn der Neuseeländer vom kurzen Schwarzen oder flachen Weißen spricht.
Ein kultureller Blick auf den Immobilienmarkt
Mieten, kaufen, investieren, vermieten oder Nest bauen?
Fitness-World
Von Duschkabinen, Kursplänen, Saunagesprächen und der Sehnsucht nach der Natur.
Vereine
Wie findest du Anschluss?
Beziehungen, Emanzipation, Dating und platonische Freundschaften
Über Gleichberechtigung, Kuscheln und wie schnell man zur Sache kommen sollte (oder nicht).
Third Culture Kids
Menschen mit mehr als einer Seele in der Brust.
Mögliche dritte Phase des Wiedereingliederungsprozesses
Zu Hause sein. Rückkehrer berichten, wie sie im Heimatland wieder Fuß fassten.
Weihnachten
Von Weihnachtsbäumen im Sommer am Strand.
Einer der besten Tage
Wie in Neuseeland aus einem verlorenen einer der besten Tage werden kann.
Strände
Strand ist nicht gleich Strand.
Middle of Middle Earth
Vom eigentlichen Zentrum der Welt, SUPen und dem Flughafen in Wellington.
De Deutsche und seine Karre
Der Deutsche und sein Auto. Statussymbol und Nationalstolz zugleich.
Museen
Von den etwas anderen Dinosauriern am Ende der Welt – und was hat das mit Bildung zu tun?
Space – Raum
Wie du auf einmal, ohne es zu wollen, auf der anderen Straßenseite landen kannst.
Effizienz, Planung und Organisation – oder der Deutsche und seine drei P: Planning, Preparation, Process
Vom Arbeiten ohne zu arbeiten.
Kinder
Ein paar flüchtige Gedanken zu Auswanderern mit Kindern.
Lieferung nach Neuseeland
Wie leicht ist es wirklich, Dinge in und nach Neuseeland zu bestellen, und ein paar praktische Tipps.
Arbeitsmärkte
Kündigungsfristen, Probezeiten und Weltuntergang.
Schuluniformen
Vordergründiges Symbol für Gleichheit und Egalitarismus.
Einwohnermeldeamt
Von nicht vorhandenen Namen auf Briefkästen.
Umweltbewusstsein
Eine Gemeinsamkeit – und zugleich eine kontroverse Diskussion.
Tradition und Wandel
Widerspruch oder natürliche Ergänzung?
Es kann an einem Tag Winter und Sommer sein
Vom anderen „Moooin“, Dünen, Schafen, Gezeiten, Möwen, Leuchttürmen, Walen und Wetter.
Busfahren in Neuseeland
„Thanks, Mr. Driver“, und was das mit Krücken zu tun hat.
Tarawera-Marathon
Von Verwandtschaftsgraden, Thermal- und Vulkanlandschaften, Geysiren, einem Heißwasserstrand und einem Land, in dem Träume gelebt werden dürfen.
Unbezahlter Urlaub
Und was das mit „Angst“ zu tun hat.
Außerhalb der Zone deutscher Effizienz und Pünktlichkeit
Wie die gefühlte Geschwindigkeit auf einer Reise ab- und auf einmal wieder zunehmen kann.
Meetings und Entscheidungsfindung
In der Welt der Ureinwohner gibt es keine strengen Agenden und Zeitlimite.
Facework / Face Negotiation Theory – Gesichtsarbeit / Gesichtsverhandlungstheorie
Das Gesicht wahren, verlieren, behalten, wieder gewinnen – essenzielle Gedanken zum Leben und zur Arbeit insbesondere mit asiatischen Kulturen.
Zebrastreifen
In manchen Teilen der Welt absolut überbewertet.
Deutsche Geschichte in der Schule
Und wie man dies in Gesprächen mit dem Rest der Welt nutzen kann.
Expat-Community
Das etwas andere Leben im Ausland.
Great Walks, Outdoor-Aktivitäten, Schulfächer
Früh übt sich ein Leben in freier Natur.
Neighbourliness
Die Bedeutung der Nachbarschaft von Pionierzeiten bis ins heutige Zeitalter.
Tikanga Māori – Fettnäpfchenführer für die maorische Kultur
Ein Helm auf dem Mofasitz und die Bedeutung von Köpfen, Hüten, Kissen und Essen in der Kultur der Māori.
Wie kam ich nach Neuseeland? – oder: Wie ich von einer Weltreisenden zu einer Auswanderin wurde …
Seit ich denken kann, zogen mich andere Kulturen an. Immer wollte ich weg, Neues entdecken … seit dem Schüleraustausch mit der Stadt Nancy in Frankreich. Das erste Mal von zu Hause weg. Heimweh am ersten Abend. Nach Hause telefonieren. Die Welt ging unter. Danach nie wieder.
Nach der Schule machte ich eine Banklehre in meiner Heimatstadt Kaiserslautern, dann hielt mich nichts mehr. Erste Station: London für ein Praktikum. Es war nur ein Monat, aber der sollte mein Leben verändern. Fertig zum Aufbruch rollte ich meinen Koffer zum Auto. Oder besser: schleppte. Damals gab es, glaube ich, noch keine rollenden Koffer. Plötzlich bemerkte ich, wie meine Mutter heulte. Ich schaute sie an und sagte: „Mama, ich bin doch nur kurz in London und in einem Monat wieder hier.“ Sie sagte mit Tränen in den Augen: „Nein, du kommst nicht mehr wieder.“ Wie Recht sie hatte.
Nach der Rückreise von London blieb ich für drei Tage. Dann startete ich direkt weiter in die Toskana, um dort für einige Monate zu arbeiten. Dann das Studium in Passau. Für mich eine Spielwiese, so viele Berufe wie möglich während verschiedener Praktika auszuprobieren, und das in möglichst vielen Ländern, um möglichst viele Lebensarten zu erfahren und Sprachen zu lernen. Fernsehpraktikum in London, Zeitschriftenjournalismus in München (tiefstes Ausland – Scherz), Bank in Barcelona und so weiter. Während des Studiums ging ich für ein Jahr nach Toulouse. Mein komplettes Zimmer packte ich in meinen Fiat Panda und fuhr über Land von Passau in mehreren Tagesetappen nach Toulouse. Der überladene Panda war leicht tiefer gelegt, so dass ich die Reifen alle paar Kilometer aufpumpen musste. Was für eine Zeit! Manchmal sehnte ich mich danach zurück, nichts außer einer Autoladung zu besitzen und einfach nur frei durch die Welt zu ziehen. Nichts hatte ich geplant – auch keine Unterkunft. Ich ging einfach davon aus, dass ich am Tag der Ankunft etwas finden würde. Der Plan, keinen Plan zu haben, ging auf.
In Toulouse kam ich auch zum ersten Mal mit Small Talk in Berührung. Eine Sache, die uns Deutschen höchst suspekt ist. Warum soll ich über Unwichtiges reden? Lieber rede ich gar nicht, als über belangloses Zeug. Nach einem Jahr hatte ich das Ritual lieb gewonnen, mich mit der Bäckerin ein paar Minuten über das Wetter und sonstige Alltäglichkeiten auszutauschen. Warum nicht freundlich sein, sich ein bisschen über Gott und die Welt unterhalten? Das war doch viel angenehmer, als muffelig sein Croissant zu bestellen und dem international bekannten „grumpy German“ (mürrischer Deutscher) alle Ehre zu machen.
Small Talk, Kontakt aufnehmen und Distanz
Kaitiaki fand das Ritual absolut nachvollziehbar. „Small Talk ist in vielen Nationen der Welt ein gängiges Mittel, um Kontakt aufzubauen und ein Gespräch anzufangen.“ Ich erwiderte: „Außer in Deutschland. Wenn wir es nicht von Auslandsaufenthalten gewohnt sind, finden wir es einfach absolut unnötig, über Dinge zu reden, die unwichtig sind.“
Kaitiaki konterte: „Nun sei doch nicht so streng mit den Deutschen und sehe es positiv. Der Deutsche hat ein anderes Mittel zum Smalltalken: sich beschweren. Ihr nörgelt nur, um ins Gespräch zu kommen! Warum sonst beschwert ihr euch über die späte Bahn, die langsame Verkäuferin oder über das Wetter, das gar nichts dafür kann?" So, wie Kaitiaki das sagt, bekommt das ewige Beschweren auf hohem Niveau in Deutschland doch gleich eine andere Farbe.
Wenn man sich entfernt kennt oder sich vorstellt, kommt das Händeschütteln ins Spiel. Die Wichtigkeit des Händedrucks bei Begrüßung und Verabschiedung wird durch den passenden Gesichtsausdruck unterstrichen. Kaitiaki hatte ihn nach kurzer Zeit perfekt drauf, unterstützt durch den signifikant seriösen Eindruck seiner Fliege. Zu diesem Zeitpunkt sind wir auch noch streng per „Sie“, außer wir lernen uns über Freunde kennen oder sind nicht „ausgewachsen“. Ist ein Kollege länger in der Firma oder ist der Gesprächspartner älter, gebührt ihm indiskutabel Sie-Respekt. In anderen Ländern gibt es Küsschen links und rechts, eine Umarmung … Die Umarmung gibt es bei uns, wenn wir uns dann besser kennen. Nichts geht über eine gute, herzliche, deutsche Umarmung, gerne auch zusammen mit dem Handschlag. Für Kaitiaki war das Umarmen nach der anfänglichen Distanz fast befremdlich. Er musste sich erst daran gewöhnen. Zum Zeitpunkt der Umarmung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir ins „Du“ übergehen. Eine gewisse Distanz wahren wir jedoch stets. Durchaus möglich, dass wir uns auch nach dreißig Jahren siezen. Das „Du“ wird heutzutage immer mehr und immer früher angeboten, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. In Verkaufsläden kommt es beispielsweise häufiger zum „Du“, was früher undenkbar gewesen wäre. Die Süddeutsche Zeitung berichtete, dass immer mehr Unternehmen die lockere Atmosphäre von Start-up-Unternehmen kopieren und bei sich einführen wollen. Dazu gehört das Duzen des Vorstandes. Was beim Einführen des Duzens jedoch oft übersehen wird: In Deutschland ist das „Du“ mit einer informellen Vertrautheit verbunden, die nicht mit der Position des Chefs in einem Großkonzern zusammenpasst. Beim englischen „You“ wird man nicht automatisch informell und privater. Ein gewisser Respekt bleibt bestehen, der beim deutschen Duzen oft unbewusst wegfällt.2
Im Interkulturellen gehört „Interpersonale Distanzdifferenzierung“ zu den deutschen „Kulturstandards“. Diesen Begriff hat Alexander Thomas geprägt, ein deutscher emeritierter Hochschullehrer mit dem Forschungsschwerpunkt interkulturelle Psychologie. Sie klassifizieren und beschreiben die Mentalität einer Kultur.3
Deutsche lassen sich eben ein bisschen Zeit, den Anderen kennenzulernen. Nennt man dann jemanden Freund, meint man das auch. Ein deutscher Freund ist meist ein Freund fürs Leben. Dazu liest du mehr im Abschnitt über Freundschaft auf Seite →.
Unser einheimischer Vogel fing an, über seine Heimat zu erzählen: „In Neuseeland gibt es den Nasenkuss (Hongi) der Ureinwohner, der im Alltag nur selten Anwendung findet. Ich liebe ihn allerdings und möchte ihn als Teil unserer Kultur auf keinen Fall aufgeben. Dann gibt es den Small Talk, den Handschlag, den Augenbrauenaufschlag sowie die Umarmung. Die „Taktung“ ist leicht unterschiedlich als in deinem Land. Small Talk ist immer gut. Der Augenbrauenaufschlag ist eine übliche Begrüßung, auch unter Fremden und auf die Entfernung. Etwa um zu signalisieren, dass man einen Blickkontakt oder eine Entschuldigungsgeste auf die Entfernung mit Wohlwollen entgegen genommen hat. Dabei geht der Kopf leicht zurück. Ungefähr die Bewegung, wie wenn Deutsche sagen ‚Was willst du denn?’, nur nicht heftig und abrupt, sondern eher sanft, mit Augenbrauenaufschlag und Lächeln. Die Umarmung gibt es unter Freunden; wenn man sich vertraut ist, auch unter Kollegen. Der Handschlag findet fast ausschließlich im Berufsalltag statt und mehr im internationalen Umfeld. Er ist üblicher bei Männern als bei Frauen untereinander, seltener zwischen Mann und Frau.4 Die Frage des „Sie“ stellt sich gar nicht erst. Man „you’t“ sich grundsätzlich und redet sich mit dem Vornamen an, egal ob im Berufs- oder Privatleben.“ Stimmt. Kaitiaki hatte gar keine Berührungsprobleme, als ich in das Lyall-Bay-Haus einzog, an dem er wohnte. Er zwitscherte mich seit Beginn fröhlich mit „you“ an, egal ob ich verschlafen die Wäsche aufhängte oder bei einem Glas Wein auf dem Balkon die Aussicht genoss. Er fügte hinzu: „Übrigens spricht man sich auch bei geschäftlichen E-Mails und sogar in Bewerbungsschreiben grundsätzlich mit dem Vornamen an, nicht mit Frau Schmitt oder Mr. and Mrs. Smith wie in Deutschland oder England.“
Wenn der Deutsche nun versucht Small Talk zu betreiben, kommt er meist nicht umhin, doch nach etwas Sinnvollem zu fragen. Nach dem Beruf, der Karriere, … Bildung und Ausbildung sind sehr wichtig bei uns in Deutschland. Etwas, an dem wir uns messen. Kaitiaki fuhr fort: „Auch das ist in anderen Ländern anders. Da erzählt man eher von der Familie, dem letzten Wochenende, der Freizeit. So auch in Neuseeland. Die Frage nach dem ’What do you do for living’ kommt meist später im Gespräch, wenn überhaupt. Hier gibt es regionale Unterschiede: In Wellington fragt man: 'What do you do for living?* In Christchurch: 'What school did you go to?' In Dunedin: 'What do you study?' In Auckland: 'Where in Auckland do you live?' Am Westcoast: 'Where are you from?' Māori präsentieren sich traditionell im Kontext ihres Stammes.“ Vergleiche weiter den Abschnitt „Selbständigkeit, Individualismus und Kollektivismus“ auf Seite →.
Der Deutsche weiß anfangs oft nichts mit der Frage „How are you?“, oder auf neuseeländisch „How yuh doing?“, „How’s it going“ zu Beginn einer Konversation anzufangen. Er kann mehr anfangen mit offenen, jedoch konkreten Fragen, zum Beispiel: „Wie ist das Wetter heute bei ihnen?“, „Wie war ihr Urlaub?“, „Wie war ihr Wochenende?“.5
Im Geschäftskontext sind in Deutschland gewisse Fragen in der Regel tabu, wie beispielsweise die Frage nach dem Gehalt. Einem Freund erzählt man eventuell freiwillig davon. Man fragt andersherum allerdings nicht initiativ danach, außer unter sehr guten Freunden. Generell als verletzend wird die Frage empfunden, warum man nicht verheiratet ist. Oder Fragen über Kinder, Familienstand und andere persönliche Themen. So kann man schon an solch vermeintlich Oberflächlichem wie der Begrüßung recht viel über das Leben in einem Land erfahren. Wegen der Karriere und des Geldes kommt kaum jemand nach Neuseeland.
Nach dem Studium landete ich dann doch kurz im Hamsterrad. Investmentbanking. Haifischbecken sagen manche. Meine Deutung: In der Waschmaschine auf höchster Stufe durchgewaschen, definitiv geschüttelt, nicht gerührt, um dann klatschnass wie ein triefender Pudel herauszukommen, sich umzugucken und zu fragen: „Was mache ich hier eigentlich?“ Toller Waschgang muss ich sagen. Das Gute ist, dass ein Jobwechsel in dem Bereich ein paar Monate bezahlten Urlaub mit sich bringt. Lottogewinn! Also das Once-in-a-lifetime-Ding machen, das Besondere, das nie wieder kommt. Ich lief meinen ersten Halbmarathon in Berlin, nahm meine ersten Kitesurfstunden in Venezuela und machte meinen ersten Backpackingurlaub in Australien. Backpacker sind die Reisenden mit dem großen Rucksack auf dem Rücken. Anfangs denkt man, man reist alternativ, lernt das Land besser kennen. Aus heutiger Sicht finde ich: Das einzig Andere ist, dass man günstiger und mit Rucksack statt Koffer reist. Richtig in ein Land eintauchen geht nur, wenn man dort länger lebt. Destination Australien also. Soweit kommst du nie wieder. Dachte ich damals. Ha, von wegen.
Einen weiteren Australienurlaub und vier Neuseelandurlaube später – na ja, du weißt. Jetzt hatte ich einen Tui im Schlepptau.
Doch wieder zurück. Reisen verändert. Woanders zu leben, sei es nur für einen Monat, verändert noch mehr. Dinge anders sehen zu wollen, wird normal. Alltägliches Infragestellen. Aus dem Trott auszusteigen, Neues auszuprobieren. Heute halte ich es mit Rosenstolz: „Ich liebe den Moment, in dem man fällt.“ Man wächst an schwierigen Situationen mehr als an gewohnten, vorhersehbaren.
Irgendwann wechselte ich den Job und wurde Beraterin. IT-Beraterin. In der Finanzwelt gibt es viel IT, Computer und Systeme. Weniges wird noch manuell gemacht. Ein Leben aus dem Koffer folgte: Immer neue Projekte, jede Woche zum Kunden fliegen, viel reisen. An den Wochenenden konnte ich mir aussuchen, ob ich nach Hause nach Hamburg fliegen wollte oder zu meinen Freunden, die überall in Europa verstreut sind. Das gefiel mir. Ich hatte in der Zwischenzeit mehrere gefühlte Zuhause. Leider sah ich von meiner geliebten Stadt Hamburg nicht mehr viel. Bis ich am Wochenende alles erledigt hatte, was unter der Woche liegen blieb, war es wieder an der Zeit den Koffer zu packen.
Während dieser Zeit gab es diesen Moment, wo ich es schwer fand zu entscheiden, wo ich nun meinen Urlaub verbringen wollte. Ich reiste ohnehin ständig. Aber ich hatte auch viele Urlaubstage. Luxusproblem. Die Entscheidung fiel auf Brasilien. Immer noch war ich keine Kitesurferin, sondern eine Möchtegern-Kitesurferin, da ich jedes Mal am Ende eines Backpackingurlaubs nur ein paar Tage Kiten einschob. Brasilien ist eines der Länder mit Windgarantie, viel Meer und viel Küste. Auf ging’s! Diese Reise sollte mein Leben verändern.
Der Wind in Brasilien kommt meist nachmittags auf. Man kann vor dem Kitesurfen langsam den Tag angehen. Eines Tages döste ich im Garten des Cumbuco Guesthouse in der Hängematte mit meinem Kaffee vor mich hin. Auch einige andere Kitesurfer waren abgestiegen. Neue Freunde, die ich später auch besuchte und sie mich. Plötzlich öffnete sich das Tor. Ein Jeep tauchte auf. Alle waren aufgeregt und liefen wild umher. Die zwei Kerle schienen bekannt zu sein, Louis und Trevor. Sie hatten einen ziemlich spitzbübischen Humor. Aus der Entfernung beobachtete ich das Ganze. Ich lag einfach zu bequem-chillig mit einer Brise Wind um die Nase in der Hängematte. Dann ging ich kitesurfen. Am Anfang kann man den Wind noch nicht „hochkiten“. Man lernt erst mit der Zeit, wie man Höhe hält und sich gegen die Richtung des Windes bewegen kann. Also verbrachte ich den Nachmittag damit den Wind „runterzukiten“, dann wieder am Strand entlang den Wind hochzulaufen. Immer schön hoch und runter. Der Kite machte mit mir als Anfängerin, was er wollte, besonders wenn die Kräfte nachließen. Dann zog er mich quer über das Meer oder den Strand. Hach, wie toll, dass niemand zuguckte. Abends sagte der eine von den beiden Kitern aus dem Jeep, Louis, ich solle doch dies und jenes probieren. Das würde mir helfen. Oh nein! Ich dachte, ich war unbeobachtet! Wir freundeten uns an. Irgendwann fand ich heraus, dass er Neuseeländer ist und sich auf einen Langstrecken-Weltrekord vorbereitete. 2000 Kilometer an der brasilianischen Küste entlang.
Ein paar Monate später besuchte ich ihn. Neuseeland war nicht auf der Liste der Länder, die ich im Alter von 35 bereisen wollte. Es war eher eins der Länder, in die ich hinfahren konnte, wenn ich in Rente wäre. Da ich am liebsten zu Menschen und nicht in Länder reise, weil ich so am meisten von dem Land erfahre, buchte ich spontan einen Flug. Wir fuhren ein paar Wochen herum, zum Kitesurfen, Wildcampen, Kajaken und Stand-up-Paddeln (SUP), was damals in Europa noch niemand kannte. Die Neuseeländer unternehmen Aktivitäten je nach Wetterlage. Das Land ist dazu prädestiniert. Mein Vater sagte einmal, als er versuchte, mir die Heimat wieder schmackhaft zu machen: „Aber das kannst du doch auch hier machen!“ Nene, Neuseeland ist anders. Da machen alle alles, und jeder macht mit. Das Leben findet „outdoors“, draußen, statt. Die Werte bzw. Prioritäten sind unterschiedlich. Mir gefiel die neuseeländische Art zu leben. Während unserer Reise lernte ich einige Neuseeländer kennen und konnte so direkt an deren Leben teilnehmen. Ein Freund von Louis war häufiger mit uns unterwegs. Mit den beiden zu reisen war unglaublich entspannt. So sind sie eben, die Neuseeländer. Manchmal fast ein bisschen zu nonchalant.
Selbständigkeit, Individualismus und Kollektivismus
Bei dem Thema flatterte Kaitiaki nervös. Er sah mich vorwurfsvoll an. „Du spinnst. Wie kann man zu lässig sein? Ist das nicht einer der Gründe, warum Leute nach Neuseeland einreisen wollen?“ Ich schaute ihn fragend an.
„Um das zu erklären, hole ich etwas aus. In Bezug auf Selbständigkeit und Individualismus stehen wir Neuseeländer euch in nichts nach. Ein hervorragendes Beispiel einer Kulturdimension nach Geert Hofstede, die beide Länder grundsätzlich teilen. Hofstede ist emeritierter Professor für Organisationsanthropologie und Internationales Management an der Universität Maastricht. Im Gegensatz zu kollektivistisch orientierten Regionen wie Asien oder Lateinamerika ist die deutsche im internationalen Vergleich eine von Individualismus geprägte Kultur. Neuseeland kann das noch toppen.6
Wir Neuseeländer sind es gewohnt, Sachen selbst in die Hand zu nehmen, hinzubekommen (Stichwort Kiwi Ingenuity oder DIY). Kein Wunder, dass in Neuseeland noch so viele alte Autos herumfahren. Täglicher Nationalsport, sie und unser anderes Spielzeug wie Kajaks, Surfboards, Buggies, Mountainbikes, womit neuseeländische Garagen gefüllt sind, zu reparieren. Geht doch, Shbireitmeit (auf neuseeländisch: She’ll be right mate, ein bisschen mehr genuschelt allerdings). Funktioniert doch noch alles. Wohlgemerkt ist nur das Spielzeug in der Garage, nicht etwa das Auto. Das wird draußen geparkt.
Wir wachsen in der Erwartung auf, Hürden selbst zu bewältigen: „Piece of Cake“, eine Leichtigkeit.7 Gar nicht so erstaunlich, wenn man berücksichtigt, dass wir traditionell außerhalb der Großstädte tatsächlich nicht viele andere Menschen, sondern eher Schafe um uns herum hatten und größtenteils noch haben.“
Beispiel Kitesurfen: Nahezu jeder kann sicher den Kite selbst in die Luft bekommen und wieder landen. In den meisten anderen Ländern bevorzugt man einen Helfer, der den Kite am Boden sicher festhält und parkt, oder ihn aufhebt und in die richtige Position bringt, um ihn fliegen zu lassen. Aus diesem „Auf-sich-selbst-gestellt-sein“ entspringt fast automatisch ein gewisser Individualismus. Kaitiaki erklärte, dass er sich nicht darauf verlassen konnte, einen anderen Tui in der Weite des Landes zu finden, der helfen konnte. Er machte sich über sich selbst lustig: „Mit Schafen wäre das wahrscheinlich einfacher gewesen. Da fällt mir ein: Auch wenn ich auf der Schafsinsel lebe, habe ich Schafsgeblöke zu imitieren bisher nicht gelernt.“
Auch Geert Hofstede bestätigt auf seiner Internetseite Hofstede-Insights.com den im Vergleich leicht stärker ausgeprägten Individualismus. „Neuseeland hat eine individualistische Kultur. Das spiegelt sich durch eine locker gestrickte Gesellschaft wider, in der die Erwartungshaltung vorherrscht, dass Leute auf sich selbst und ihre unmittelbare Familie aufpassen. In der Geschäftswelt wird von Angestellten erwartet, selbständig zu arbeiten und Initiative zu zeigen. Ebenso werden Anstellungs- und Beförderungsentscheidungen basierend auf Leistung und Erreichtem getroffen.8 Auch Deutschland ist eine wahrhaftig individualistische Gesellschaft. Kleinfamilien mit Fokus auf die Eltern-Kind-Beziehung und weniger Onkel und Tanten sind üblich. Es existiert ein starker Glauben an Selbstverwirklichung. Loyalität basiert auf einer persönlichen Vorliebe für bestimmte Menschen als auch auf einem Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein. Definiert wird dies durch den Arbeitsvertrag. Der Kommunikationsstil gehört zu den direktesten weltweit. Er folgt dem Ideal, ehrlich zu sein, auch wenn es weh tut – um dem Gegenüber eine faire Chance zu geben, aus seinen Fehlern zu lernen.“9 Du findest zu diesem Abschnitt den englischen Originaltext im Literaturverzeichnis, Seite → (Anmerkung: übersetzt von der Autorin).
Die deutsche Kultur ist ebenfalls durch eine gewisse Sachorientierung (deutscher Kulturstandard) geprägt.10 Wenn wir zum Beispiel rein sachlich und faktisch keine Zeit haben, darf der Hilfesuchende warten.
Interessant in diesem Kontext ist die eher kollektivistisch geprägte Kultur der Māori, die – wie auch das Zeitverständnis, das ich später in diesem Buch beschreibe – im Kontrast zum individualistischen Ansatz von Deutschen und Pākehā, Nicht-Māori, steht. Das Wort Pākehā wird im Alltag allerdings nicht gebraucht, es heißen einfach alle „Kiwis“. Ein Sprichwort besagt: ‚Kāhore taku toa i te toa takitahi, he toa takitini.‘ We cannot succeed without the support of those around us. Wir können nicht erfolgreich sein ohne die Unterstützung derer um uns herum.
Māori definieren sich über ihre Position innerhalb ihres sozialen Netzwerks. Wenn sich Māori gegenseitig im Māori-Kontext vorstellen, ist es angebracht, den Namen und den Ort ihres Stammes oder Unterstammes (Iwi oder Hapū) mit zu nennen, da die größeren Gruppierungen Iwi und Hapū gesellschaftlich am bekanntesten sind. Die Selbstdefinition und der Ausdruck seiner selbst durch die Stämme wird durch folgendes Interview mit Harata Ria Te Uira Parata deutlich: „Ich sehe mich selbst nicht als Individuum, sondern als Teil einer Gruppe. Das ist der Unterschied zwischen unserer und der westlichen Kultur. In der westlichen Kultur steht das Individuum an erster Stelle. Wenn mich im Māori-Kontext jemand sieht, wäre mein Name ‚Harata‘ das letzte, was er [bei der Begrüßung zu mir] sagen würde. Er sagt den Namen meines Stammes, ‚Ngati Toa‘ oder ‚Ngati Raukawa‘.“
Soziale Bindungen sind sehr wichtig für Māori. Aus Sicht der Māori ist das Ideal, alleine herauszustechen, unabhängig zu sein, sogar eine ungesunde Position, da bei den Māori Interdependenz ermutigt wird. Das bedeutet nicht, dass Māori sich nicht individuell engagieren. Es bedeutet eher, dass Aktivitäten traditionell in einer Art vollbracht werden, die Harmonie in der Gruppe und Kollektivismus fördert. Pākehā hingegen sind traditionell individualistisch und unabhängig, angefangen von den ersten britischen Siedlern. Das westliche Konzept steht für Autonomie, Freiheit, Selbstinteresse, Anspruchsberechtigung und Leistung. Das Konzept des Kollektivismus hingegen steht für Werte wie Beziehungsorientierung, Gegenseitigkeit und Verbundenheit mit früheren Generationen.11 Anmerkung: Das Einbeziehen der früheren Generationen bei Entscheidungsfindungen drückt sich auch im unterschiedlichen Zeitverständnis aus. Siehe dazu den entsprechenden Abschnitt auf Seite →. Den englischen Originaltext zu diesem Abschnitt findest du im Literaturverzeichnis, Seite →.
Unser Tui resümierte: „Zurück zum Punkt zu relaxed. Es ist normal, dass man sich selbst zu helfen weiß. Davon gehen wir auch bei anderen aus. Pragmatismus und Unabhängigkeit sind wünschenswert.12 Und nicht, dass einem jemand anderes hilft. In Deutschland fragst du eher nach, beispielsweise bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Als deutscher Neuankömmling in Neuseeland fühlst du dich manchmal im Stich gelassen und hast das Gefühl, dass uns alles egal ist. Ist es aber nicht. Wir gehen einfach davon aus, dass du zurechtkommst. Damit letzteres nicht falsch verstanden wird: Es ist kein Widerspruch, dass in meinem Land gleichzeitig auch die ungefragte Hilfsbereitschaft von fremden Menschen heraussticht. Wenn du Hilfe brauchst, frag einfach.“
Zurück zu meiner ersten Neuseelandreise. Kurzum, ich fand das Land okay. Irgendwie wie bei uns. Westlich eben. Die große Liebe zum Land schlug erst im Laufe der Zeit ein. Es war ein Prozess. Frühestens ein halbes Jahr nach Rückkunft in Deutschland merkte ich, dass das Land mich nicht losließ. Ich mailte meine Freundin Manu in Christchurch an und kündigte mich zu Besuch an. Was für ein Glück, dass ich damals bei Manu und Tim wohnen konnte. Zunächst zögerlich fing ich an, nach Jobs zu suchen. Nicht wirklich ernsthaft. Dementsprechend wurde nichts daraus. Die meisten, bei denen ich mich für einen Job bewarb, dachten, dass ich nur auf Durchreise war. Ein Jahr später war ich wieder da. Ich meldete mich bei denselben Personen. „Ups, die meint es wirklich ernst.“ Diesmal blieb ich kurze Zeit bei einem Freund in Dunedin, dann brachte ich für Mietwagengesellschaften Autos und Campervans von Süden nach Norden. Die Route von Norden nach Süden scheint in den meisten Touristenführern empfohlen zu werden. Daher fahren die meisten Touristen in diese Richtung und geben ihren Wagen im Süden ab. Für den Umzug nach Norden zahlen Mietgesellschaften sogar zum Teil Benzin und die Fähre. Dadurch hatte ich für ein paar Tage ein Dach über dem Kopf. Dann flog ich Standby, was damals noch möglich war, wieder zurück nach Süden und zog den nächsten Wagen nach Norden um, dieses Mal auf einer anderen Route. Eine Neuseelandreise später arbeitete ich in einem Hostel in Raglan, lernte surfen und bewarb mich auf Jobs in der IT-Branche, die mir ein Visum sichern konnten. Wenn der Wind da war, kitesurfte ich. Hatte ich Interviews aufgrund von Bewerbungen, war ich kurz weg. Einen Tag vor Abreise die Nachricht: Ich hatte einen Job! Zu Hause in Deutschland fing ich einen neuen Job an, den ich bereits vor Neuseeland unterschrieben hatte. Vor der Neuseelandreise hatte ich nicht gewusst, ob ich dieses Mal einen Arbeitsvertrag bekommen würde. Die nächsten drei Monate packte ich am Wochenende Kisten, brachte sie zur Containerstation und löste die Wohnung auf. Zwei Wochen vor Abflug in der Probezeit kündigte ich. Für meinen deutschen Chef kam das nicht wirklich überraschend, nur hatte er nicht so schnell damit gerechnet. Er hatte dennoch volles Verständnis, was ich toll fand. Auch der im internationalen Vergleich beste Arbeitsvertrag konnte mich nicht mehr halten. In Deutschland kündigte ich alles. Versicherungen, die Wohnung …
„Willst du nicht erst schauen, wie’s wird?“ „Nein, ich weiß, dass es das für mich ist. Ich komme nicht mehr zurück.“ Natürlich noch für einen Urlaub oder zum Arbeiten.
Dann begann mein neues Leben in Neuseeland. „Warum Neuseeland?“, werde ich oft gefragt. Rückblickend habe ich mich im Laufe der Reisen und Auslandsaufenthalte verändert. Ich bin Deutsche und werde es immer sein. Dennoch verschob sich mein Lebensentwurf, den ich in meinem Lieblingsland mehr ausleben konnte als in Deutschland. Das Reisen war ein Suchen nach meinem Platz auf dieser Welt. In Neuseeland fand ich ihn. Gezweifelt habe ich nie auch nur eine Sekunde, den Schritt gegangen zu sein. Weder vor noch seit der Auswanderung. Was man weiß, das weiß man. Irgendwann kapieren es dann auch alle anderen. Zumindest akzeptieren sie es, wobei es wahrscheinlich nur wenige richtig verstehen werden.
Für viele zu Hause in Deutschland bin und bleibe ich irgendwie nicht ganz normal. Irgendwie auch mutig. Für einige eine Motivation, mehr aus ihrem Leben zu machen. In Neuseeland oder auf Reisen treffe ich viele Menschen wie mich. Wir sprechen die gleiche Sprache, ich meine nicht die Muttersprache, und fühlen uns ansonsten oft von anderen nicht recht verstanden. Umgekehrt gilt wahrscheinlich dasselbe. Das ist auch okay so. Wäre doch langweilig, wenn wir alle gleich wären und nach Aotearoa (Māori für Neuseeland und heißt übersetzt „Land der großen weißen Wolke“) ziehen wollten. Manchmal fühlt es sich so an, als gäbe es eine eigene Kultur unter Auswanderern irgendwo zwischen der Kultur der Heimat und der der Wahlheimat. Alexander Thomas beschreibt Kultur als „ein „Orientierungssystem“, das Fühlen, Denken, Handeln und Bewerten bestimmt.“ Fons Trompenaars, ein niederländisch-französischer Wissenschaftler im Bereich der interkulturellen Kommunikation, beschreibt: „Für uns ist Kultur, was das Wasser für den Fisch ist. Ein Fisch spürt erst dann, dass er Wasser zum Leben braucht, wenn er nicht mehr darin schwimmt. Wir leben und atmen durch sie.“13 Wenn nun die andere Kultur das Meer und die eigene ein Fluss ist, fühlen wir Auswanderer und Reisenden uns vielleicht in der Flussmündung am wohlsten und brauchen beides zum Leben und Atmen.
Um Prioritäten oder besser um Werte in verschiedenen Kulturen geht es beim interkulturellen Verständnis. Durch unsere Zugehörigkeit zu einem bestimmten Land, einer Region, einer Familie, einer Stadt bekommen wir tief sitzende, meist unbewusste Werte. Diese können sich im Laufe des Lebens ändern wie durch das Arbeiten in unterschiedlichen Unternehmenskulturen oder das Leben in verschiedenen Ländern. Man hinterfragt die eigenen Werte und nimmt manchmal bewusst, manchmal unbewusst andere auf, lässt wieder andere hinter sich. Sie bestimmen unser Handeln, unser Denken. Du wirst einige dieser deutschen Werte kennenlernen sowie die Divergenzen oder die Gemeinsamkeiten mit den neuseeländischen. Deutsche und Neuseeländer haben nämlich durchaus einiges gemeinsam. Kaitiaki saß auf meiner Schulter und nickte heftig. Oh, Moment, dann wiegte er den Kopf abwägend … an dich gerichtet: Du darfst selbst entscheiden.
DIY, oder: „Vermisst du eigentlich gar nichts aus Deutschland?“
Die meist gestellte Eingangsfrage zu Gesprächen über meine Auswanderung. Natürlich vermisse ich in der Fremde manches aus Deutschland und Europa. Über Mangelerscheinungen wegen in Neuseeland nicht vorhandenen Bierdeckeln habe ich bisher noch nichts gehört.
Jedoch entdeckt man auch deutsche Eisbecher wie Spaghettieis in Neuseeland nicht. Es gibt einfach nur Eis. Vanilleeis mit heißen Himbeeren, Erdbeeren oder sonstigen Früchten ist typisch deutsch, werden die Neuseeländer nach alter Manier jedoch als ihr eigenes Rezept von Großmuttern deklarieren wollen. Leibniz-Butterkekse, Kinder-Schoko-Bons, Händlmaier Senf und riesige NIVEA Creme-Dosen sucht man vergeblich. Bratkartoffeln und andere Kartoffelgerichte muss man schon zu Hause machen. Pilze fehlen, insbesondere die Vielzahl an Pilzen sowie bestimmte Sorten wie Pfifferlinge. Weißer Spargel ist schwer zu bekommen. Übrigens ist die nationale Verrücktheit nach Spargel ein deutsches Phänomen. Aus Sicht anderer Nationen verläuft das deutsche Jahr rund um die Spargelzeit. Man vermutete bereits, dass nicht etwa der Karneval die fünfte Jahreszeit sei, sondern die Spargelzeit. Nebenbei bemerkt: Kölner, Düsseldorfer und Mainzer Narren, sorry, dass ich euch in einem Satz erwähne, müssen auf ihre fünfte Jahreszeit nicht verzichten.
Die Neuseeländer lieben Motto-Partys. Sie verkleiden sich rund ums Jahr unheimlich gerne. Ob auf der Skipiste, auf dem Surfboard oder beim Marathon. Immer wieder gern gesehen: das Weihnachtsmannkostüm beim Surfen.
Apropos Weihnachten – die in Deutschland jährlich an Silvester ausgestrahlte, englische Komödie „Dinner for one" ist in englischsprachigen Ländern äußerst unbekannt und typisch deutsch.
Was Deutsche in Neuseeland ebenso zelebrieren und was leicht gezaubert werden kann, ist unser deutsches Frühstück. Ganz einfach: Den kompletten Kühlschrankinhalt auf den Tisch stellen und einen halben Tag lang gemütlich beisammensitzen, essen, Kaffee trinken, plaudern. Obwohl wir den halben Tag im Land der Freizeitaktivitäten meist nicht packen, da ruft dann doch wieder das Meer, der „Bush“ oder irgendein Track.
Und was gibt es außerdem nur in Deutschland? Apfelschorle, Weinschorle, Rhabarberschorle …