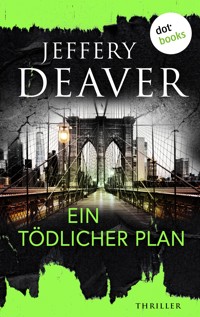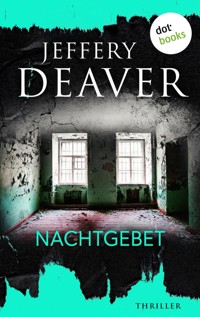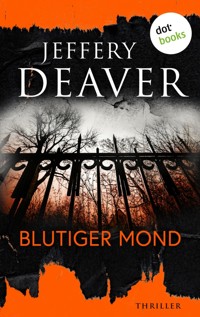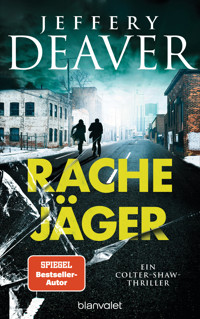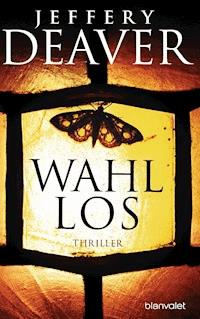
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kathryn-Dance-Thriller
- Sprache: Deutsch
Seine größte Waffe ist deine Angst!
Ein Konzert in einem beliebten Nachtclub endet für die Besucher in einem Albtraum, als ein Feueralarm ausgelöst wird. Der Notausgang ist blockiert – es kommt zu einer Massenpanik, bei der zahlreiche Menschen sterben. Kathryn Dance ermittelt und stößt auf Beweise, die infrage stellen, dass es sich bei den Geschehnissen um ein tragisches Unglück handelte. Ein psychopathischer Täter hat offenbar die Angst der Konzertbesucher ausgenutzt, um seine perversen Bedürfnisse zu befriedigen. Dance muss alles daransetzen, ihn unschädlich zu machen, denn sie ist sicher, dass er wieder zuschlagen wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Ein Konzert in einem beliebten Nachtklub endet für die Besucher in einem Albtraum, als ein Feueralarm ausgelöst wird. Der Notausgang ist blockiert – es kommt zu einer Massenpanik, bei der zahlreiche Menschen sterben. Kathryn Dance ermittelt und stößt auf Beweise, die infrage stellen, dass es sich bei den Geschehnissen um ein tragisches Unglück handelte. Ein psychopathischer Täter hat offenbar die Angst der Konzertbesucher ausgenutzt, um seine perversen Bedürfnisse zu befriedigen. Dance muss alles daransetzen, ihn unschädlich zu machen, denn sie ist sicher, dass er wieder zuschlagen wird …
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffrey Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm bereits zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht. Auch die Verfilmung seines Romans Der Knochenjäger (mit Denzel Washington und Angelina Jolie in den Hauptrollen) war weltweit ein sensationeller Kinoerfolg.Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet undwww.twitter.com/BlanvaletVerlag
Jeffery Deaver
Wahllos
Thriller
Ins Deutsche übertragen von Thomas Haufschild
Den Bibliotheken und Bibliothekaren allerorten …
Die Angst tötet das Bewusstsein.
Frank Herbert, Der Wüstenplanet
PANIK Dienstag, 4. April
1
Das Roadhouse war gemütlich, freundlich, preiswert. Rundherum gut.
Und vor allem ungefährlich.
Denn das spielte immer eine Rolle, wenn man seine halbwüchsige Tochter zu einem Abend mit Livemusik mitnahm.
Jedenfalls für Michelle Cooper. Ungefährlich im Hinblick auf die Band und ihre Musik, die Gäste, das Bedienpersonal.
Auch was den eigentlichen Klub anging, den – gut beleuchteten – Parkplatz, die Notausgänge und die Sprinkleranlage.
Darauf achtete Michelle stets ganz besonders. Wiederum wegen der Teenager-Tochter.
Das Solitude Creek zog ein gemischtes Publikum an, Alt und Jung, Männer und Frauen, Weiße, Latinos, Asiaten und einige Afroamerikaner, ein Querschnitt der Bevölkerung rund um die Monterey Bay. Es war nun kurz nach neunzehn Uhr dreißig, und Michelle ließ den Blick über die etwa zweihundert Besucher schweifen, die sich aus der näheren und ferneren Umgebung eingefunden hatten, allesamt in gehobener Stimmung und voller Vorfreude auf die aufstrebende Band. Falls sie Sorgen mitgebracht hatten, schoben diese sich bei der Aussicht auf Bier, skurrile Cocktails, Chicken Wings und Musik zusehends in den Hintergrund.
Die Gruppe war aus Los Angeles eingeflogen, eine ehemalige Garagen-, dann Begleitband und nun Roadhouse-Hauptact, dank Twitter und YouTube und Vidster. Heutzutage wurden Musiker durch Mundpropaganda und Talent bekannt, und die sechs Jungs von Lizard Annie arbeiteten mit ihren Smartphones genauso hart wie auf der Bühne. Noch waren sie zwar nicht O. A. R. oder Linkin Park, aber mit etwas Glück vielleicht bald.
Michelles und Trishs Unterstützung war ihnen zumindest sicher. Anscheinend konnte die niedliche Boygroup sogar auf jede Menge Mütter und Töchter zählen, wenn man sich hier so umsah: hauptsächlich Eltern und ihre Heranwachsenden – die Texte waren auch weitgehend jugendfrei. Heute Abend lag das Alter der Anwesenden so zwischen sechzehn und vierzig, schätzte Michelle. Na gut, womöglich Mitte vierzig.
Sie bemerkte das Samsung in der Hand ihrer Tochter. »Sims später weiter. Nicht jetzt.«
»Mom.«
»Wer ist es denn?«
»Cho.«
Ein nettes Mädchen aus Trishs Musikunterricht.
»Zwei Minuten.«
Der Klub füllte sich. Das Solitude Creek war ein vierzig Jahre altes eingeschossiges Gebäude mit einer kleinen rechteckigen Tanzfläche aus verschrammter Eiche, umgeben von hohen Tischen und Barhockern. Die knapp einen Meter hohe Bühne befand sich am nördlichen Ende, der Tresen auf der gegenüberliegenden Seite. Im Osten lag die Küche, die eine umfangreiche Karte vorweisen konnte. Dadurch entfiel die Altersgrenze: Lokale mit Alkoholausschank durften nur dann von Minderjährigen frequentiert werden, wenn es dort ein vollwertiges Speisenangebot gab. Die westliche Wand hatte drei Notausgänge.
An der dunklen Holzvertäfelung hingen Plakate und Bühnenfotos, manche mit echten oder falschen Autogrammen, die viele jener Künstler zeigten, die am legendären Monterey Pop Festival vom Juni 1967 teilgenommen hatten: Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Ravi Shankar, Al Kooper, Country Joe und Dutzende andere. In einem schmutzigen Plexiglaskasten lag das Bruchstück einer elektrischen Gitarre, die damals nach dem Auftritt von The Who angeblich von Pete Townshend höchstpersönlich zertrümmert worden war.
Die Tische im Solitude Creek ließen sich nicht reservieren – wer zuerst kam, mahlte zuerst – und waren inzwischen alle besetzt. Die Show sollte in zwanzig Minuten beginnen. Unterdessen lieferten die Bedienungen die letzten Bestellungen aus und reckten dabei mit gespreizten Fingern ihre Tabletts empor, auf denen Teller mit mächtigen Burgern und Hähnchenflügeln standen, daneben Getränke. Von hinter der Bühne ertönte das Miauen von Gitarrensaiten, die gestimmt wurden, einige schnelle Akkorde eines Saxofons und das wuchtige A eines Basses. Die Anspannung stieg. Gleich würde die Musik sie packen und mit sich reißen.
Das Stimmengewirr war laut, die Worte unverständlich. Wer keinen Tisch hatte, suchte sich einen möglichst guten Stehplatz. Da das Bühnenpodest nicht hoch und der Boden flach war, hatte man längst nicht von überall einen freien Blick auf die Künstler. Es gab etwas Gedränge, aber kaum Streit.
So war man das im Solitude Creek gewohnt. Stets zivilisiert.
Ungefährlich …
Mit einem musste Michelle Cooper sich allerdings abfinden: der Klaustrophobie. Die Decke des Klubs war niedrig und trug zu dem Gefühl der Enge bei. Der halbdunkle Raum war zudem nicht besonders groß, und die Belüftung ließ zu wünschen übrig. Die Mischung aus Körperausdünstungen, Rasierwasser und Parfum, die sogar die Grill- und Friteusengerüche überdeckte, steigerte die Beklemmung noch. Man kam sich vor wie in einer Sardinenbüchse. Nein, das hatte Michelle Cooper noch nie als angenehm empfunden.
Sie strich sich geistesabwesend über ihr mattes blondes Haar, schaute noch einmal zu den – relativ nahen –Notausgängen und war beruhigt.
Noch ein Schluck Wein.
Ihr fiel auf, dass Trish einen Jungen an einem der anderen Tische musterte. Langes Haar, markantes Gesicht, schmale Hüften. Unverschämt gut aussehend. Er trank ein Bier, daher legte die Mutter sogleich ein – wenngleich stummes – Veto gegen Trishs eventuelle Absichten ein. Nicht wegen des Alkohols, sondern wegen des Alters: Das Getränk bedeutete, dass er mindestens einundzwanzig war und somit völlig ungeeignet für ihre siebzehnjährige Tochter.
Wenigstens kann ich es versuchen, dachte sie sarkastisch.
Ein Blick auf ihre diamantene Rolex. Noch fünf Minuten.
»Der Song, der für den Grammy nominiert war«, sagte Michelle. »War das ›Escape‹?«
»Ja.«
»Sieh mich an, Kind.«
Das Mädchen verzog das Gesicht. »Mom.« Sie wandte den Blick von dem Jungen mit dem Bier ab.
Michelle hoffte, dass Lizard Annie heute »Escape« spielen würden. Das Lied war nicht nur eingängig, sondern mit schönen Erinnerungen verbunden. Sie hatte es neulich nach der ersten Verabredung mit einem Anwalt aus Salinas gehört. In den sechs Jahren seit ihrer schlimmen Scheidung waren ihr zahlreiche peinliche Abendessen und Kinobesuche widerfahren, aber die Stunden mit Ross zählten nicht dazu. Sie hatten beide viel gelacht und sich im Spaß über die besten Veep- und Homeland-Episoden gestritten. Und niemand hatte sich unter Druck gesetzt gefühlt – in keinerlei Hinsicht. Was bei einer ersten Verabredung überaus selten vorkam.
Mutter und Tochter aßen noch etwas von dem Artischocken-Dip, und Michelle nippte an ihrem Wein. Wenn sie noch fahren musste, gönnte sie sich höchstens zwei Gläser, bevor sie sich ans Steuer setzte, mehr nicht.
Trish rückte ihr rosafarbenes geblümtes Stirnband zurecht und trank einen Schluck Cola light. Sie trug eine schwarze Jeans, nicht zu eng – juhu! –, und einen weißen Pullover. Michelle hatte Bluejeans an, enger als die ihrer Tochter – was aber eher einen Mangel an sportlicher Betätigung verriet – sowie eine rote Seidenbluse.
»Mom. Fahren wir am Wochenende nach San Francisco? Bitte. Ich brauche unbedingt diese Jacke.«
»Wir fahren nach Carmel.« Michelle gab einen beachtlichen Teil ihrer Maklerprovisionen in den noblen Geschäften der malerischen und fast schon klischeehaft romantischen Kleinstadt aus.
»Herrje, Mom, ich bin doch keine dreißig.« Uralt, hieß das. Trish wies lediglich auf den weitgehend zutreffenden Umstand hin, dass es hier auf der Halbinsel kaum Einkaufsmöglichkeiten für coole Teenagerklamotten gab. Die Gegend galt nicht umsonst – und mit nur wenig Übertreibung – als Refugium der Frischverheirateten und fast schon Toten.
»Okay. Wir reden noch darüber.«
Trish umarmte sie, und Michelle erstrahlte.
Sie und ihre Tochter hatten ihre Schwierigkeiten gehabt. Eine vermeintlich gute Ehe war an Untreue gescheitert. Alles ging zu Bruch. Frederick (niemals Fred) zog aus, als das Mädchen elf war – was für ein tragisches Erlebnis in diesem Alter, eine derartige Trennung mitzumachen. Doch Michelle hatte hart daran gearbeitet, ihrer Tochter ein gutes Leben zu ermöglichen und ihr zurückzugeben, was ihr durch den Betrug und die folgende Scheidung entrissen worden war.
Und mittlerweile lief es rund. Mittlerweile schien das Mädchen glücklich zu sein. Michelle sah ihre Tochter aus großen Augen an, und Trish bemerkte es.
»Mom, ist was?«
»Nein, schon gut.«
Das Licht ging aus.
Die Lautsprecherdurchsagen – man möge sein Mobiltelefon ausschalten, die Notausgänge seien da drüben und so weiter – übernahm immer der Eigentümer des Klubs persönlich, der ehrenwerte Sam Cohen, eine Ikone hier an der Monterey Bay. Jeder kannte Sam. Jeder mochte Sam.
»Und nun, Ladies und Gentlemen«, fuhr seine Stimme fort, »heißt das Solitude Creek, das beste Roadhouse der Westküste …«
Applaus.
»… die Band herzlich willkommen. Direkt aus der Stadt der Engel … Lizard Annie!«
Tosender Beifall. Johlen.
Die Jungs betraten die Bühne. Stöpselten ihre Gitarren ein. Der Drummer nahm Platz. Ebenso der Keyboarder.
Der Leadsänger warf sich seine lange Mähne aus der Stirn und streckte dem Publikum eine Handfläche entgegen. Die typische Geste zu Beginn eines jeden Auftritts der Gruppe. »Seid ihr bereit, ausgiebig zu feiern?«
Jaulen und Pfeifen.
»Nun, wir schon.«
Die Gitarrenriffs setzten ein. Ja! Der Song war »Escape«. Michelle und ihre Tochter fingen an mitzuklatschen, genau wie die zweihundert anderen in dem kleinen Saal. Die Wärme hatte zugenommen, die Luftfeuchtigkeit, der intensive Geruch der Körper. Auch die Klaustrophobie. Michelle strahlte und lachte trotzdem.
Der hämmernde Beat ging weiter, Bass, Drums und die zahllosen Handflächen.
Doch dann hielt Michelle inne. Stirnrunzelnd schaute sie sich um, neigte den Kopf. Was war das? Hier im Klub herrschte, wie überall in Kalifornien, eigentlich Rauchverbot. Doch jemand hatte sich eine Zigarette angezündet, da war sie sich sicher. Sie roch eindeutig Rauch.
Allerdings konnte sie niemanden mit einer Zigarette im Mund entdecken.
»Was ist denn?«, rief Trish, der die besorgte Miene ihrer Mutter auffiel.
»Nichts«, erwiderte die Frau und fing wieder an, im Rhythmus zu klatschen.
2
Beim dritten Wort im zweiten Song – das zufällig »Love« war –, wusste Michelle Cooper, dass etwas nicht stimmte.
Sie roch den Rauch nun stärker. Und er rührte nicht von einer Zigarette her, sondern eher von brennendem Holz oder Papier.
Oder den alten, trockenen Wänden oder Bodendielen eines überfüllten Konzertsaals.
»Mom?« Trish runzelte die Stirn und sah sich ebenfalls um. Sie rümpfte die Stupsnase. »Ist das …?«
»Ich rieche es auch«, flüsterte Michelle. Sie konnte keine Schwaden ausmachen, aber der Geruch war unverkennbar und nahm immer mehr zu. »Wir gehen. Sofort.« Sie stand schnell auf.
»He, Lady«, rief ein Mann, fing den kippenden Barhocker auf und stellte ihn hin. »Alles in Ordnung?« Dann stutzte er. »Herrje. Ist das Rauch?«
Auch andere Leute schauten sich um, rochen dasselbe.
Niemand im Raum, keiner der etwa zweihundert anderen – ob nun Angestellte, Gäste oder Musiker –, existierte mehr für Michelle Cooper. Sie musste ihre Tochter hier rausschaffen. Gemeinsam mit Trish steuerte sie den nächstgelegenen Notausgang an.
»Meine Tasche«, rief Trish über die Musik hinweg. Die Brighton Bag, ein Geschenk von Michelle, war auf dem Boden unter dem Tisch versteckt – nur für alle Fälle. Das Mädchen riss sich los, um die Tasche mit dem Metallherz zu holen.
»Vergiss sie, komm her!«, befahl ihre Mutter.
»Es dauert nur eine …«, setzte das Mädchen an und bückte sich.
»Trish! Nein! Lass das.«
Mittlerweile achteten einige Leute im näheren Umkreis, denen Michelles jäher Aufbruch und der Vorstoß in Richtung Ausgang aufgefallen waren, nicht länger auf die Musik, sondern sahen sich um. Einer nach dem anderen standen auch sie von ihren Plätzen auf. Sie schauten fragend und besorgt drein. Aus Lächeln wurde Stirnrunzeln. Augen verengten sich, wirkten plötzlich irgendwie raubtierhaft und wild.
Fünf oder sechs der Leute schoben sich zwischen Michelle und ihre Tochter, die immer noch nach der Handtasche tastete. Michelle bahnte sich kurzerhand einen Weg, packte das Mädchen an der Schulter und zog. Sie bekam nur den Pullover zu fassen. Der Stoff dehnte sich.
»Mom!« Trish machte sich los.
In diesem Moment leuchtete ein greller Scheinwerfer auf und richtete sich auf die Ausgänge.
Die Musik erstarb abrupt. Der Leadsänger sagte ins Mikrofon: »He, äh … Leute, hört mal … keine Panik, ja?«
»Mein Gott, was ist …?«, rief jemand neben Michelle.
Schreie wurden laut. Ohrenbetäubend laut, im ganzen Saal, fast an der Schmerzgrenze.
Michelle bemühte sich, zu Trish zu gelangen, aber immer mehr Zuschauer zwängten sich dazwischen. Sie wurden beide in entgegengesetzte Richtungen abgedrängt.
Eine Durchsage über Lautsprecher: »Ladies und Gentlemen, es brennt. Verlassen Sie unverzüglich den Saal! Gehen Sie nicht durch die Küchentür oder den Bühnenausgang – denn dort ist das Feuer ausgebrochen! Wählen Sie die Notausgänge.«
In die Schreie mischte sich Geheul.
Gäste sprangen auf und stießen ihre Hocker und Gläser um. Zwei der hohen Tische kippten und krachten zu Boden. Die Leute hielten auf die Notausgänge zu, deren rot leuchtende Beschilderung weiterhin klar zu erkennen war; es roch zwar stark nach Rauch, aber die Sicht blieb gut.
»Trish! Hier drüben!«, schrie Michelle. Mittlerweile befanden sich zwei Dutzend Leute zwischen ihnen. Warum zum Teufel hatte sie wegen dieser dämlichen Tasche kehrtgemacht? »Wir müssen raus hier!«
Ihre Tochter versuchte, durch die Menge zu ihr zu gelangen. Doch die wogende Masse riss Michelle einfach mit in Richtung Ausgang, während Trish in einer anderen Gruppe gefangen war.
»Schatz!«
»Mom!«
Michelle, die zu den Türen gezerrt wurde, spannte jeden Muskel in ihrem Körper an, um sich zu ihrer Tochter umzudrehen, konnte aber nichts ausrichten, denn sie steckte zwischen zwei Zuschauern fest: einem stämmigen Mann mit T-Shirt, das bereits ziemlich zerrissen war, sodass man die Kratzspuren von Fingernägeln auf seiner roten Haut erkennen konnte, und einer Frau, deren falsche Brüste schmerzhaft in Michelles Seite drückten.
»Trish, Trish, Trish!«
Sie hätte ebenso gut stumm sein können. Das Geschrei und Wehklagen der Menschen – aus Angst und vor lauter Schmerzen – übertönte alles. Sie konnte nur noch den Kopf ihres Vordermannes und das Ausgangsschild sehen, zu dem sie hingetrieben wurden. Michelle hieb auf Schultern, Arme, Hälse und Gesichter ein und wurde in gleicher Weise von den Fäusten der anderen getroffen.
»Ich muss zu meiner Tochter! Machen Sie Platz, weg da, lassen Sie mich durch!«
Aber der Strom in Richtung der Ausgänge ließ sich nicht aufhalten. Michelle Cooper bekam kaum noch Luft. Und dazu der Schmerz – in ihrer Brust, ihrer Seite, ihrem Bauch. Furchtbar. Ihre Arme waren nun ebenfalls eingeklemmt, ihre Füße hatten keinen Bodenkontakt mehr.
Das helle Licht im Saal war an. Michelle wurde – ohne eigenes Zutun – ein kleines Stück zur Seite gedreht und sah die Gesichter der Gäste in ihrer Nähe: panisch aufgerissene Augen, dunkelrote Streifen an den Mündern. Hatten die Leute sich vor Angst auf die Zungen gebissen? Oder brachen im Gedränge ihre Rippen und bohrten sich in die Lungen? Ein Mann, Mitte vierzig, war bewusstlos und aschfahl. War er ohnmächtig geworden? Oder hatte er einen Herzinfarkt erlitten? Wie auch immer – jedenfalls wurde er durch die wogende Menge weiter aufrecht gehalten.
Der Rauchgeruch war fortwährend stärker geworden, und das Atmen fiel immer schwerer – vielleicht zog das Feuer den Sauerstoff aus dem Saal, wenngleich Michelle noch immer keine Flammen sehen konnte. Oder die panische Menge brauchte die Luft rasend schnell auf. Der Druck der anderen Leiber gegen ihre Brust tat ein Übriges.
»Trish! Schatz!«, wollte sie rufen, aber es kam nur ein Flüstern über ihre Lippen, das so leise wie der Atemzug flach war.
Wo steckte ihr Kind? War jemand ihr bei der Flucht behilflich? Wohl kaum. Niemand hier, kein Einziger, schien überhaupt einem anderen zu helfen. Das war animalische Raserei. Jeder war auf sich allein gestellt. Der reine Überlebenskampf.
Bitte …
Die Gruppe Zuschauer, in deren Mitte sie eingeklemmt war, stolperte über etwas.
O Gott …
Michelle erhaschte einen kurzen Blick auf eine schlanke junge Latina in einem rot-schwarzen Kleid, die mit zutiefst entsetzter, schmerzverzerrter Miene unten am Boden lag. Ihr rechter Arm war gebrochen und nach hinten gebogen. Die andere Hand streckte sie in diesem Moment nach oben aus und klammerte sich an die Hosentasche eines Mannes.
Sie war völlig hilflos und kam einfach nicht auf die Beine. Niemand schenkte ihr auch nur die geringste Beachtung, obwohl sie bei jedem scharrenden Fuß aufschrie, der gegen ihren Körper trat.
Michelle sah der Frau direkt in die Augen, als ein Stiefel sich auf ihre Kehle senkte. Der Mann versuchte, es zu vermeiden, und flehte die Menschen um ihn herum an: »Nein, macht Platz, macht Platz.« Doch genau wie alle anderen konnte auch er seine Richtung, seine Bewegungen, seine Schritte nicht mehr kontrollieren.
Unter dem Druck des Gewichts auf ihrem Hals drehte der Kopf der Frau sich sogar noch weiter zur Seite, und sie fing an, heftig zu erzittern. Als Michelle weitergeschoben wurde, waren die Augen der Latina bereits glasig, und die Zunge schaute ein Stück zwischen ihren hellroten Lippen hervor.
Michelle Cooper hatte soeben jemanden sterben gesehen.
Weitere Lautsprecherdurchsagen. Michelle konnte kein Wort davon verstehen. Nicht, dass es eine Rolle gespielt hätte. Sie konnte derzeit sowieso nichts mehr ausrichten.
Trish, hoffte sie inständig, bleib ja auf den Beinen. Fall nicht hin. Bitte …
Als die Menge um sie herum sich weiter in Richtung der Ausgänge schob, drehte sie sich ein Stück nach rechts, und kurz darauf konnte Michelle den Rest des Klubs sehen.
Da! Ja, da war ihre Tochter! Trish war noch auf den Beinen, steckte allerdings ebenfalls in einem Knäuel Leiber fest. »Trish, Trish!«
Doch diesmal kam überhaupt kein Laut mehr aus ihrem Mund.
Mutter und Tochter bewegten sich in entgegengesetzte Richtungen.
Michelle blinzelte sich Tränen und Schweiß aus den Augen. Ihre Gruppe hatte die Ausgänge fast erreicht. In wenigen Sekunden würde sie draußen sein. Trish befand sich hingegen in der Nähe der Küche – wo doch angeblich das Feuer wütete.
»Trish! Hierher!«
Zwecklos.
Und dann sah sie, wie der Mann neben ihrer Tochter völlig die Kontrolle verlor – er schlug auf das Gesicht seines Nebenmannes ein und fing an, auf die Schultern und Köpfe der anderen zu klettern, als würde er in seinem Wahn glauben, er könne sich mit bloßen Händen einen Weg durch die Decke bahnen. Er war groß und schwer, und eine der Personen, die er als Trittbrett missbrauchte, war Trish, die fünfzig Kilo weniger wog als er. Michelle sah, wie ihre Tochter den Mund zu einem Schrei öffnete und dann durch das erdrückende Gewicht des Mannes unter der Oberfläche dieses wogenden Irrsinns verschwand.
AUSGANGSBASIS Mittwoch, 5. April
3
Die zwei Leute, die an dem langen Konferenztisch saßen, musterten sie mit unterschiedlich großem Interesse.
War da noch etwas?, fragte sie sich. Argwohn, Abneigung, Eifersucht?
Kathryn Dance, eine Expertin für Kinesik – Körpersprache –, wurde dafür bezahlt, Menschen zu lesen, doch bei Gesetzeshütern war das meistens ziemlich schwierig, und so konnte sie sich im Augenblick nicht sicher sein, was den beiden durch die Köpfe ging.
Ebenfalls anwesend war ihr Chef, Charles Overby, doch er saß nicht am Tisch, sondern stand an der Tür, vertieft in sein Smartphone. Er war gerade erst eingetroffen.
Sie alle befanden sich im Erdgeschoss der Dienststelle des California Bureau of Investigation für den Westen von Zentralkalifornien, gelegen an der Route 68 in Monterey, unweit des Flughafens. Der schlecht beleuchtete, unangenehm riechende Beobachtungsraum war vom benachbarten Verhörzimmer durch einen von dieser Seite aus durchsichtigen Spiegel getrennt, den nicht mal die einfältigsten oder bekifftesten Verdächtigen für einen harmlosen Wandschmuck hielten, vor dem man sich die Krawatte oder die Frisur richten konnte.
Was die Kleidung anging, machten die beiden Besucher einen eher sachlichen Eindruck. Der Mann am Tisch – am Kopfende, genauer gesagt – hieß Steve Foster, gut sitzender schwarzer Anzug, weißes Hemd. Er war leitender Sonderermittler des California Bureau of Investigation und in der Zentrale in Sacramento beheimatet. Dance, einen Meter achtundsechzig groß und ungefähr fünfundfünfzig Kilo schwer, wusste nicht genau, ab wann man jemanden als imposant bezeichnen konnte, aber Foster kam dem jedenfalls ziemlich nahe. Mit seiner breiten Statur, der silbernen Mähne und dem stattlichen Schnurrbart, den man mit Wachs zu beachtlicher Länge hätte zwirbeln können, wäre er waagerecht und nicht u-förmig gewachsen, wirkte Foster wie ein Marshal aus dem Wilden Westen.
Im rechten Winkel zu ihm saß Carol Allerton, voluminöser grauer Hosenanzug, das kurze schwarze Haar silbern und grau gesprenkelt. Sie war eine hochrangige Agentin der Drug Enforcement Administration und aus Oakland angereist. Die untersetzte Frau konnte auf ein Dutzend bedeutender Festnahmen verweisen. Damit war sie zwar keine Legende, genoss aber großen Respekt. Sie hätte einen Karrieresprung nach Sacramento oder sogar Washington machen können, hatte das Angebot aber abgelehnt.
Kathryn Dance trug einen schwarzen Rock samt weißer Bluse, beides aus dicker Baumwolle, und darüber eine dunkelbraune Jacke, die so geschnitten war, dass sie die Glock größtenteils verdeckte. Das einzig Bunte an ihr war ein blaues Band am Ende ihres dunkelblonden französischen Zopfes. Ihre Tochter hatte es ihr am Morgen auf dem Weg zur Schule umgebunden.
»Erledigt.« Der etwa fünfzigjährige Charles Overby blickte von seinem Telefon auf. Hatte er sich gerade zum Tennis verabredet oder eine E-Mail des Gouverneurs gelesen? Nun ja, in Anbetracht dieses Meetings lag die Wahrheit wohl irgendwo in der Mitte. »Okay, alle bereit?«, fragte der sportliche, wenngleich birnenförmige Mann. »Dann mal los.« Er setzte sich und klappte einen Aktendeckel auf.
Sein freundlicher Tonfall wurde mit denselben kühlen Blicken zur Kenntnis genommen, die soeben noch Dance gemustert hatten. In Behördenkreisen galt Overby seit jeher vor allem als fähiger Verwaltungsbeamter. Die beiden Besucher waren hingegen hartgesottene Ermittler und legten wenig Wert auf unnötige Floskeln.
Sie murmelten einen knappen Gruß und nickten kurz.
Die Angelegenheit, um die es hier ging, war Teil eines für ganz Kalifornien geplanten gemeinschaftlichen Vorstoßes gegen einen neuen Aspekt der Bandenkriminalität. Das organisierte Verbrechen hatte sich im gesamten Bundesstaat ausgebreitet, konzentrierte sich aber im Norden und im Süden, in Oakland und Los Angeles. Doch anstatt Rivalen zu bleiben, hatten die beiden Gruppen eine einträgliche Zusammenarbeit beschlossen: Aus der Bay Area wurden Waffen nach Süden geliefert, und im Gegenzug kamen Drogen nach Norden. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt waren auf der Interstate 5, dem Highway 101 und dem staubigen, langsameren 99 Dutzende illegaler Transporte unterwegs.
Um die Verfolgung dieser Transporte zu erschweren, hatten die Obergangster sich etwas Neues ausgedacht: Sie nutzten diverse Zwischenstationen, um die Fracht von den ursprünglichen Sattelschleppern auf zahllose kleinere Last- und Lieferwagen zu verteilen. Das zwei Stunden südlich von Oakland und fünf Stunden nördlich von L. A. gelegene Salinas mit seiner aktiven Bandenpopulation bot sich zu diesem Zweck geradezu an. Es gab hier Hunderte von Lagerhäusern und Tausende von geeigneten Fahrzeugen. Die Fahndungserfolge der Polizei gingen gegen null, und die illegalen Geschäfte florierten. Die Kriminalstatistik prognostizierte allein für das laufende Jahr einen Anstieg des kombinierten Waffen- und Drogenhandels um fast eine halbe Milliarde Dollar.
Vor sechs Monaten hatten CBI, FBI, DEA und die örtlichen Strafverfolgungsbehörden als Gegenmaßnahme die Operation Pipeline ins Leben gerufen, leider bislang mit dürftigem Erfolg. Die Gangster waren so gut vernetzt, so gerissen und dreist, dass sie ihren Verfolgern stets einen Schritt voraus blieben. Erwischt wurden nur einige kleine Dealer oder Drogenkuriere, die sich ein paar Unzen Stoff in den Schritt geklebt hatten und somit den Papierkram bei der Verhaftung kaum wert schienen. Und was noch schlimmer war, mehrere Informanten flogen auf und wurden gefoltert und ermordet, bevor sich konkrete Spuren ergeben hatten.
Als Bestandteil von Pipeline leitete Kathryn Dance eine Sondereinheit, zu der Foster, Allerton und zwei weitere Beamte gehörten, die sich gegenwärtig im Einsatz befanden. Intern bezeichneten sie ihren Teilbereich als die Guzman Connection, benannt nach einem massigen, ziemlich psychotischen Gangster, der angeblich mindestens die Hälfte der Übergabestellen in und um Salinas kannte. In der verrückten Welt der Strafverfolgung war so jemand praktisch ein Hauptgewinn.
Nach umfangreicher Vorarbeit hatte Dance dem Rest der Truppe am Abend zuvor per SMS mitgeteilt, dass nun eine erste konkrete Spur zu Guzman führe und alle sich hier und jetzt zu einer Besprechung einfinden sollten.
»Also, dann erzählen Sie uns mal von dem Trottel, mit dem Sie heute reden wollen und der uns angeblich Guzman liefern wird«, sagte Steve Foster. »Wie heißt er doch gleich? Serrano?«
»Ja«, erwiderte Dance. »Joaquin Serrano. Er hat keinen Dreck am Stecken – zumindest soweit wir wissen. Keine Vorstrafen. Zweiunddreißig Jahre alt. Auf ihn gebracht hat uns einer unserer Spitzel …«
»Wessen genau?«, fiel Foster ihr ins Wort. Das konnte er gut, wie Dance mittlerweile aus Erfahrung wusste. Außerdem waren Ermittler stets besonders empfindlich, wenn Kollegen versuchten, ihnen einen vertraulichen Informanten auszuspannen.
»Er wird von unserer Dienststelle geführt.«
Foster gab ein Grunzen von sich. Vielleicht war er verärgert, weil man ihn erst jetzt davon in Kenntnis setzte. Mit einer beiläufigen Handbewegung forderte er Dance auf, ihre Ausführungen fortzusetzen.
»Serrano kann eine Verbindung zwischen Guzman und dem Tod von Trauerkloß herstellen.«
Das Opfer hieß eigentlich Hector Mendoza und verdankte den Spitznamen seinen hängenden Augenlidern. Er hatte sowohl die nördlichen als auch die südlichen Führungsriegen gekannt und wäre ein perfekter Belastungszeuge gewesen – vorausgesetzt, er hätte überlebt.
Sogar der zynische, mürrische Foster schien von der Aussicht angetan zu sein, Guzman die Ermordung von Trauerkloß nachweisen zu können.
Overby war mal wieder gut darin, das Offensichtliche festzustellen. »Falls Guzman umfällt, könnten die anderen Pipeline-Banden wie Dominosteine folgen.« Dann schien ihm die eigene Metapher nicht zu gefallen.
»Dieser Zeuge, Serrano. Erzählen Sie uns mehr über ihn.« Allerton spielte an einem großen gelben Notizblock herum. Dann schien es ihr bewusst zu werden. Sie rückte den Block zurecht und ließ von ihm ab.
»Er ist Landschaftsgärtner bei einer der großen Firmen in Monterey. Mit legalen Papieren. Anscheinend glaubwürdig.«
»Anscheinend«, sagte Foster.
»Ist er hier?«, fragte Allerton.
»Draußen«, entgegnete Overby.
»Wieso sollte er mit uns sprechen?«, fragte Foster. »Ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Dieser Kerl weiß ganz genau, was Guzman mit ihm anstellen wird, falls er Wind davon bekommt.«
»Vielleicht will er Geld«, mutmaßte Allerton. »Oder er kennt jemanden im Knast, dem wir helfen sollen.«
»Oder er will womöglich einfach nur das Richtige tun«, sagte Dance, was Foster auflachen ließ. Auch sie selbst lächelte matt. »Ich habe gehört, das soll gelegentlich vorkommen.«
»Er hat sich freiwillig bereit erklärt?«, grübelte Allerton laut.
»Ja. Ich habe ihn angerufen, und er war einverstanden.«
»Wir bauen also allein auf seinen guten Willen, uns behilflich zu sein?«, hakte Overby nach.
»Mehr oder weniger.« Das Telefon an der Wand summte. Dance stand auf und hob ab. »Ja?«
»He, Boss.«
Der Anrufer war TJ Scanlon, um die dreißig Jahre alt und hier bei der CBI-Dienststelle für den Westen von Zentralkalifornien einer von Dances Mitarbeitern, wenngleich streng genommen nicht ihr Untergebener. Er war ein zuverlässiger, sehr arbeitsamer Kollege und, gelinde gesagt, eine für diese konservative Behörde eher untypische Erscheinung.
»Er ist hier«, sagte TJ. »Es kann losgehen.«
»Okay, bring ihn her.« Dance hängte den Hörer ein. »Serrano kommt jetzt«, teilte sie den anderen mit.
Sie verfolgten, wie sich jenseits des Spiegels die Tür des Verhörzimmers öffnete. TJ trat ein, schlank, der rote Lockenschopf noch widerspenstiger als üblich. Er trug ein kariertes Sakko und eine rote Schlaghose, dazu ein Batik-T-Shirt, gelb und orange.
Untypisch …
Ihm folgte ein hochgewachsener Latino mit dichtem kurzem Haar. Der Mann sah sich im Raum um. Seine dunkelblaue Jeans war eng geschnitten. Und neu. Er trug ein graues Kapuzenshirt mit der Aufschrift »UCSC« auf der Brust.
»Sieh an«, murmelte Foster. »Ein Absolvent der Uni Santa Cruz. Ganz bestimmt.«
»Einen Abschluss hat er zwar nicht, aber er hat dort tatsächlich mal Seminare belegt«, stellte Dance klar.
»Hmm.«
Die rechte Hand des Latinos war tätowiert, allerdings wohl nicht mit einem Bandensymbol, und auch auf seinem linken Unterarm schien der Anfang eines Tattoos aus dem Ärmel hervorzuschauen. Seine Miene wirkte unbekümmert.
»Da wären wir«, ertönte TJ Scanlons Stimme aus dem Lautsprecher. »Dort. Bitte nehmen Sie Platz. Möchten Sie ein Glas Wasser?«
»Nein«, sagte der Mann ruhig.
»Es kommt gleich jemand.«
Der Mann nickte und setzte sich mit dem Gesicht zu den Beobachtern auf einen Stuhl. Nach einem kurzen Blick auf den Spiegel zog er sein Mobiltelefon aus der Tasche und musterte das Display.
Foster verlagerte sein Gewicht. Dance hätte auch ohne ihre Fachkenntnisse gewusst, was er dachte. »Vergessen Sie nicht, er ist ein Zeuge«, sagte sie. »Wir haben keine rechtliche Handhabe gegen ihn. Er hat nichts verbrochen.«
»Oh, natürlich hat er das«, widersprach Foster. »Wir wissen es bloß noch nicht.«
Sie sah ihn an.
»Ich kann es riechen.«
Dance stand auf, zog ihre Glock aus dem Holster und legte die Waffe auf den Tisch. Dann nahm sie ihren Stift und einen Notizblock.
Mal sehen, was es wirklich mit diesem Serrano auf sich hatte.
4
»Sie wirkt mit diesem Kinesik-Kram also wahre Wunder, ja?«, fragte Foster.
»Kathryn ist gut, durchaus.« Overby mochte Foster nicht besonders, denn er hielt ihn für den Typ Ermittler, der bereitwillig die Lorbeeren einheimsen und sich vor den Medien in Szene setzen würde, auch wenn in Wahrheit andere den größten Teil der Arbeit erledigt hatten. Doch Overby musste vorsichtig sein. Foster hatte zwar ungefähr seine Gehaltsklasse, war aber einflussreicher, denn er saß in Sacramento, keine zehn Meter vom Büro des CBI-Direktors entfernt. Und er war politisch gut vernetzt.
Allerton nahm ihren bislang leeren Block und schrieb eine »1« darauf.
»Schon seltsam«, fuhr Overby fort. »Wenn man weiß, was sie draufhat – dieses ganze Körpersprache-Zeug –, dann sitzt man mit ihr zum Beispiel beim Mittagessen und achtet die ganze Zeit darauf, was man tut und wohin man guckt. Als würde man damit rechnen, dass sie auf einmal sagt: ›Aha, Sie haben sich also heute Morgen mit Ihrer Frau gestritten. Wegen der vielen unbezahlten Rechnungen, schätze ich.‹«
»Wie bei Sherlock Holmes«, sagte Allerton. »Ich mag ja diese britische Serie. Mit dem Schauspieler, der so komisch heißt. Ähnlich wie ›Kummerbund‹.«
Overby blickte geistesabwesend in das Verhörzimmer. »Nein, so läuft das nicht mit der Kinesik.«
»Nicht?«, fragte Foster.
Overby sagte nichts mehr. Als Foster und Allerton sich dem Spiegel zuwandten, nahm er die beiden Beamten kurz in Augenschein. Dann betrat Dance das Verhörzimmer, und auch Overbys Aufmerksamkeit richtete sich auf das Geschehen dort drinnen.
»Mr. Serrano, ich bin Agent Dance«, ertönte knisternd ihre Stimme aus dem Wandlautsprecher im Beobachtungsraum.
»Mister«, murmelte Foster.
Die Augen des Latinos verengten sich. Er musterte Dance prüfend. »Guten Tag.« Weder seine Miene noch seine Haltung wirkten auf Overby irgendwie nervös.
Sie nahm gegenüber von ihm Platz. »Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind.«
Ein Nicken. Freundlich.
»Zunächst mal möchte ich betonen, dass nicht gegen Sie ermittelt wird. Nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Wir sprechen mit Dutzenden, vielleicht sogar Hunderten von Leuten. Unser Interesse gilt der Bandenkriminalität hier auf der Halbinsel. Und wir hoffen, dass Sie uns behilflich sein können.«
»Also brauche ich keinen Anwalt.«
Sie lächelte. »Nein, nein. Und Sie können jederzeit gehen. Oder sich entscheiden, auf eine Frage nicht zu antworten.«
»Aber würde ich mich damit nicht verdächtig machen?«
»Ich könnte Sie fragen, wie Ihnen gestern Abend der Braten Ihrer Frau geschmeckt hat. Da würden Sie die Antwort womöglich lieber verweigern.«
Allerton lachte. Foster wirkte ungeduldig.
»Ich könnte darauf gar nicht antworten.«
»Sie sind nicht verheiratet?«
»Richtig, aber selbst wenn ich es wäre, würde ich das Kochen übernehmen. Ich kann das ganz gut.« Dann ein Stirnrunzeln. »Doch ich möchte helfen. Manche der Dinge, die im Umfeld der Banden passieren, sind schrecklich.« Er schloss kurz die Augen. »Abscheulich.«
»Wohnen Sie schon länger hier in der Gegend?«
»Zehn Jahre.«
»Sie sind ledig. Lebt Ihre Familie hier?«
»Nein, in Bakersfield.«
»Hätte sie das nicht alles im Vorfeld eruieren müssen?«, fragte Foster.
»Oh, das hat sie«, sagte Overby. »Sie weiß alles über ihn. Zumindest alles, was sie in den letzten acht Stunden herausfinden konnte, seitdem sie seinen Namen kennt.«
Er hatte viele von Dances Verhören verfolgt und kannte auch einen ihrer akademischen Vorträge zum Thema. Daher konnte er den anderen eine kurze Zusammenfassung liefern. »Bei der Kinesik geht es hauptsächlich darum, nach Anzeichen für Stress Ausschau zu halten. Wenn jemand lügt, steht er zwangsläufig unter Druck. Manche Verdächtige können das so gut verbergen, dass es kaum wahrnehmbar ist. Aber den meisten von uns merkt man es an. Kathryn führt mit Serrano anfangs eine ganz gewöhnliche Unterhaltung, ohne auf Banden oder Straftaten zu sprechen zu kommen, sondern eher auf das Wetter, die eigene Jugend, Restaurants oder das Leben auf der Halbinsel. So gewinnt sie einen grundlegenden Eindruck von seiner Körpersprache.«
»Und wozu?«
»Es ist die Basis für alles Weitere. Sie weiß dadurch, wie er sich verhält, wenn er wahrheitsgemäß antwortet. Als ich vorhin gesagt habe, so läuft das nicht mit der Kinesik, habe ich gemeint, dass sie nicht in einem Vakuum funktioniert. Es ist nahezu unmöglich, jemanden zu treffen und sofort zu durchschauen. Man muss erst tun, was Kathryn gerade macht – sich diesen grundlegenden Eindruck verschaffen. Danach wird sie ihn über die Bandenaktivitäten befragen, von denen er etwas wissen könnte, dann über Guzman.«
»Sie vergleicht also sein späteres Verhalten mit seinem jetzigen, das seine wahrheitsgemäßen Aussagen begleitet«, sagte Allerton.
»Ganz genau«, bestätigte Overby. »Und etwaige Abweichungen werden darauf hindeuten, dass er Stress empfindet.«
»Und zwar, weil er dann lügt«, ergänzte Foster.
»Kann sein. Aber es gibt natürlich Unterschiede. Man lügt zum Beispiel, weil man gerade jemanden erschossen hat, oder man lügt, um nicht selbst erschossen zu werden. Der Täuschungsversuch wird bedeuten, dass Serrano ab einem gewissen Punkt nicht mehr kooperativ ist. Und Kathryns Aufgabe ist es, ihn dennoch zur Zusammenarbeit zu bewegen.«
»Zusammenarbeit«, wiederholte Foster zynisch und so langsam, dass das Wort aus mehr als fünf Silben zu bestehen schien.
Overby bemerkte, dass Foster Raucher war oder zumindest bis vor Kurzem geraucht hatte – sein Zeige- und Mittelfinger waren leicht verfärbt und seine Zähne gelblich.
Sherlock.
Vor ihnen, in dem kleinen, kargen Raum, fuhr Kathryn Dance damit fort, Fragen zu stellen, zu plaudern, Gemeinsamkeiten zu finden.
Fünfzehn Minuten vergingen.
»Arbeiten Sie gern als Gärtner?«, fragte Dance.
»Und ob, sí … Es ist … Keine Ahnung … Ich arbeite gern mit den Händen. Vielleicht wäre ich sogar Künstler geworden, wenn ich das entsprechende Talent gehabt hätte. Hab ich aber nicht. Doch Gartenarbeit, die liegt mir richtig gut.«
Overby fielen die schwarzen Fingernägel des Mannes auf.
»Lassen Sie uns nun auf die Ermittlungen zu sprechen kommen. Vor zwei Wochen wurde ein Mann namens Hector Mendoza getötet. Erschossen. Sein Spitzname war Trauerkloß. Er kam gerade aus einem Restaurant in New Monterey. An der Lighthouse Avenue.«
»Trauerkloß. Ja, ja. Das war in den Nachrichten. Bei der Filiale von Baskin-Robbins, richtig?«
»Genau.«
»War das … ich weiß nicht mehr so recht, aber wurde er nicht aus einem vorbeifahrenden Wagen erschossen?«
»Stimmt.«
»Wurde sonst noch jemand verletzt?« Er runzelte die Stirn. »Ich hasse es, wenn Kinder oder Unbeteiligte zu Schaden kommen. Diese Gangster, die scheren sich nicht darum, wen sie erwischen oder nicht.«
Dance nickte mit freundlicher Miene. »Nun, Mr. Serrano, der Grund, aus dem ich dies anspreche, ist folgender: Bei unseren Nachforschungen ist Ihr Name aufgetaucht.«
»Mein Name?« Er wirkte verwundert, aber nicht schockiert. Sein dunkles Gesicht legte sich kurz in Falten.
»An dem Tag, an dem dieser besagte Mendoza ermordet wurde, haben Sie, soweit ich weiß, im Haus von Rodrigo Guzman gearbeitet. Das war am einundzwanzigsten März. Haben Sie, während Sie für Mr. Guzman tätig waren, einen schwarzen BMW gesehen? Einen großen? Es geht um den Nachmittag des Einundzwanzigsten. So etwa fünfzehn Uhr.«
»Ich hab da mehrere Autos gesehen. Vielleicht auch ein paar schwarze, aber ich glaube eher nicht. Und keinen BMW. Ganz bestimmt.« Er lächelte wehmütig. »So einen hätte ich nämlich gern, und er wäre mir aufgefallen. Ich hätte ihn mir aus der Nähe angeschaut.«
»Wie lange waren Sie denn da?«
»Oh, den Großteil des Tages. Ich fange immer so früh wie möglich mit der Arbeit an, sobald die Kunden mich lassen. Señor Guzman hat ein sehr großes Grundstück, und es gibt immer viel zu tun. Ich war um sieben Uhr dreißig da. Gegen halb zwölf habe ich Mittagspause gemacht, aber nur eine halbe Stunde. Doch wollen Sie etwa andeuten, dass ich für jemanden arbeite, der mit den Banden zu tun hat? Allen Ernstes?« Sein Stirnrunzeln vertiefte sich. »Er ist ein sehr netter Mann. Behaupten Sie etwa, er ist in den Tod von diesem Kerl verwickelt, diesem … Men…?«
»Mendoza. Hector Mendoza.«
»Sí. Señor Guzman ist so freundlich. Er könnte niemandem wehtun.«
»Noch mal, Mr. Serrano, wir versuchen bloß, die Fakten herauszufinden.«
»Seine Reaktionen sagen mir nichts«, warf Allerton ein. »Er rutscht auf seinem Stuhl herum, blickt zur Seite, sieht sie an. Ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat.«
»Das ist ja auch Kathryns Job«, sagte Overby.
»Ich halte ihn für einen Scheißkerl«, sagte Foster. »Und dazu brauche ich keine Körpersprache. Er klingt einfach zu unschuldig.«
»Er hat gerade erfahren, dass einer der einträglichsten Kunden seiner Firma ein Gangster sein könnte, und ist nicht allzu glücklich darüber«, sagte Overby. »Mir ginge es da ähnlich.«
»Ach ja?«, entgegnete Foster.
Overbys Kopf ruckte hoch, aber er sagte nichts und nahm die herablassende Bemerkung hin. Allerton warf Foster einen bohrenden Blick zu. »Ich meine ja nur«, sagte dieser. »Ich traue dem Kerl nicht über den Weg.«
»Noch mal, Mr. Serrano, es gibt viele offene Fragen, auf die wir keine Antwort wissen«, sagte Dance. »Der Mann, der Mr. Mendoza erschossen hat, soll sich mit Mr. Guzman getroffen haben, und zwar unmittelbar bevor er nach New Monterey gefahren ist. Aber so wurde es uns bloß berichtet. Und nun müssen wir es überprüfen, das können Sie doch bestimmt verstehen.«
»Ja, na klar.«
»Sie sagen also, Sie sind sich sicher, dass an jenem Vormittag kein BMW bei dem Haus geparkt stand?«
»Ganz recht, Agent Dancer … nein, Dance, richtig? Agent Dance. Und ich bin mir fast genauso sicher, dass keiner der Wagen dort schwarz war. Und zu der Zeit habe ich auf der Vorderseite des Anwesens gearbeitet, in der Nähe der Auffahrt. Die Autos wären mir aufgefallen. Ich habe Hortensien gepflanzt. Er mag die blauen.«
»Danke für die Info. Eine Sache noch. Falls ich Ihnen Fotos einiger Männer zeigen würde, könnten Sie mir dann sagen, ob einer oder mehrere von denen bei Mr. Guzmans Haus aufgetaucht sind, während Sie dort waren? Idealerweise am Einundzwanzigsten, aber auch an jedem anderen Datum.«
»Ich werd’s versuchen.«
Dance klappte ihren Notizblock auf und holte drei Bilder hervor.
»Die sind nicht besonders gut. Wurden die mit einer, wie heißt das, Spionagekamera oder so aufgenommen?«
»Ja, richtig, eine Überwachungskamera.«
Der junge Mann beugte sich vor und zog die Fotos näher heran. Dabei schienen ihm seine schmutzigen Fingernägel aufzufallen und peinlich zu sein. Sobald er sich die Aufnahmen zurechtgelegt hatte, senkte er beide Hände in den Schoß.
Dann nahm er die Fotos lange in Augenschein.
»Er scheint sich wirklich Mühe zu geben«, sagte Allerton. »Daumen drücken.«
Doch dann lehnte der junge Mann sich zurück. »Nein, ich bin mir sicher, dass ich keinen von denen je gesehen habe. Aber der da« – er tippte auf eines der Bilder – »hat große Ähnlichkeit mit diesem Outfielder der Oakland Athletics.«
Dance lächelte.
»Auf wen hat er gezeigt?«, fragte Foster. »Ich kann es nicht erkennen.«
»Auf Contino, glaube ich«, sagte Allerton.
»Ein Arschloch, wie es im Buche steht«, schimpfte Foster.
Ein Killer in Diensten einer der Banden aus Oakland.
Dance sammelte die Fotos ein und steckte sie weg. »Ich glaube, das war alles, Mr. Serrano.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen, Agent Dance. Ich hasse die Gangs genauso wie Sie, nein, vermutlich noch mehr.« Sein Tonfall festigte sich. »Es sind unsere Teenager und Kinder, die getötet werden. Auf unseren Straßen.«
Nun war es Dance, die sich vorbeugte. »Falls Sie doch etwas bei Mr. Guzmans Haus gesehen haben und es mir anvertrauen, werden wir Sie beschützen«, sagte sie leise. »Sie und Ihre Angehörigen.«
Der junge Mann wandte den Kopf ab. Es dauerte einen Moment, bis er antwortete. »Nein, nicht nötig. Ich schätze, ich werde nicht mehr dort arbeiten. Ich werde meinen Chef bitten, mir andere Aufträge zu geben. Auch wenn ich dann weniger verdiene.«
»Der Junge hat nicht die cojones, den Mund aufzumachen«, sagte Allerton.
»Sie hat ihm ja auch nichts angeboten«, murmelte Foster. »Wieso sollte er …?«
»Wissen Sie, Mr. Serrano, wir haben ein Budget für Leute, die uns behilflich sind, die Bandengefahr zu eliminieren. Es wird in bar gezahlt, also muss niemand davon erfahren.«
Der junge Mann stand lächelnd auf. »Da gibt es nur ein Problem. Sie sprechen von ›eliminieren‹, und falls Sie das wirklich könnten, würde ich womöglich darüber nachdenken. Aber in Wahrheit können Sie höchstens ein paar von denen hinter Gitter bringen. Und viele andere bleiben draußen und können dann mir, meiner Freundin und ihrer Familie einen Besuch abstatten. Also muss ich leider ablehnen.«
Sie streckte die Hand aus. »Danke, dass Sie hier waren.«
»Es tut mir leid. Meine Hände sind nicht so sauber.« Er zeigte seine Handflächen, nicht aber die Fingernägel.
»Schon in Ordnung.«
Er schüttelte ihr die Hand und verließ das Zimmer. Dance schaltete das Licht aus.
5
Dance betrat den Beobachtungsraum und schloss die Tür hinter sich. Dann ging sie zum Tisch und legte ihren Notizblock hin. Sie drückte den Knopf, der den Rekorder ausschaltete. Und sie schob die Glock zurück ins Holster.
»Und?«, fragte Steve Foster. »Ist irgendwas Tolles passiert, das mir entgangen sein könnte?«
»Wie lautet Ihre Bewertung, Kathryn?«, fragte Overby.
»Nur sehr wenige Abweichungen von der Ausgangsbasis. Ich glaube, er sagt die Wahrheit«, verkündete Dance. »Er weiß nichts.« Dann erklärte sie, dass es zwar Meister der Täuschung gebe, die das eigene Verhalten vollständig im Griff hätten – ähnlich wie Yoga-Experten, die ihren Herzschlag fast bis auf null reduzieren könnten –, doch dass Serrano ihr nicht als derartig begabt vorgekommen sei.
»Oh, er hat bestimmt was auf dem Kerbholz. Aber nichts, das mit dem Informanten, den Banden oder Guzman zu tun hat. Ich schätze, er hat als Jugendlicher mal ein Auto geklaut oder kauft sich hin und wieder Gras. Als wir über das Leben auf der Halbinsel gesprochen haben und darüber, dass er nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei, hat er kurz mal ausweichend reagiert. Aber das war nur Kleinkram.«
»Das konnten Sie ihm ansehen?«, fragte Allerton.
»Ich habe es aus seinem Verhalten gefolgert und halte es für zutreffend. Aber es ist nichts, das uns weiterhilft.«
»Mist«, murmelte Overby. »Unsere einzige Chance, Guzman festzunageln.«
»Eine Chance«, korrigierte Dance ihn. »Die zu nichts geführt hat. Das ist alles. Es wird andere geben.«
»Tja, vorläufig war’s das aber erst mal«, wandte Foster ein.
»Wir haben doch noch diesen Auslieferungsfahrer«, sagte Carol Allerton. »Der weiß was.«
»Der Pizzabengel?«, murmelte Foster. »Den können wir vergessen. Die Spur ist längst kalt. Eiskalt.« Seine Miene verhärtete sich. »Mit diesem Arschloch Serrano stimmt was nicht. Ich kann ihn nicht leiden. Er war zu aalglatt. Haben Sie in der Körperspracheschule denn nichts über aalglatt gelernt?«
Dance antwortete nicht.
»Ein Pfeffer heißt so«, sagte Allerton.
»Was?«, fragte Overby.
»Serrano ist eine Pfeffersorte. Ich mein ja nur.«
Foster las einige Textnachrichten. Verschickte selbst ein paar.
Allerton überlegte kurz. »Ich glaube, wir sollten es noch mal versuchen – ihn umzudrehen, meine ich. Wir sollten ihm mehr Geld bieten.«
»Das hätte keinen Sinn«, sagte Dance. »Serrano ist eine Sackgasse. Ich schlage vor, Guzman stärker zu überwachen. Mit einem eigenen Team.«
»Was denn, Kathryn, etwa rund um die Uhr? Wissen Sie, was das kostet? Versuchen Sie es mit dem Pizzaboten, versuchen Sie es mit Guzmans Hauspersonal. Gehen Sie den anderen Spuren nach.« Overby sah auf die Uhr. »Ich überlasse es den anwesenden Jungs und Mädels, die Einzelheiten festzulegen.« Seine Körpersprache ließ erkennen, dass er die Formulierung sofort bereute. Political Correctness konnte wirklich nerven, dachte Dance. Overby stand auf und ging zur Tür.
Und wurde beinahe umgerannt, als TJ Scanlon hereinstürmte. Er blickte an ihnen vorbei in das Verhörzimmer. Seine Augen wurden groß. »Wo ist Serrano?«
»Gerade gegangen«, sagte Dance.
Scanlon verzog das Gesicht. »Scheiße.«
»Was ist los, TJ?«, fragte Overby in scharfem Ton.
»Er ist weg!«, rief der junge Kollege.
»Was?«, herrschte Foster ihn an.
»Amy Grabe hat angerufen.« Die Leiterin der FBI-Dienststelle San Francisco. »Die haben in Salinas einen Kerl mit einem Haufen Drogen hochgenommen. Er hat Serrano ans Messer geliefert.«
»Ans Messer geliefert?« Fosters Stirn legte sich in tiefe Falten.
TJ nickte. »Boss, Serrano steht auf Guzmans Gehaltsliste.«
»Wie bitte?«, keuchte Dance.
»Er ist ein Killer. Er war der Schütze, der Trauerkloß umgelegt hat. Serrano hat sich an jenem Nachmittag bei Guzman in den BMW gesetzt, hat Mendoza erschossen und ist dann zurückgekehrt, um seine Schicht zu beenden und weiter Gänseblümchen oder Stiefmütterchen oder sonst was zu pflanzen. In den letzten sechs Monaten hat er für Guzman insgesamt vier Zeugen erledigt.«
»Verfluchte Kacke«, tobte Foster mit Blick auf Dance. »Ein Outfielder der Oakland Athletics?«
»Ist das bestätigt?«
»Man hat die Tatwaffe gefunden. Der Ballistikbefund stimmt überein. Und sie ist mit Serranos Fingerabdrücken übersät.«
»Nein«, flüsterte Dance erschrocken. Sie riss die Tür auf und rannte den Flur hinunter.
* * *
Er erwischte sie, bevor sie auf dem Parkplatz hinter dem CBI-Gebäude auch nur drei Schritte weit gekommen war.
Der Bodycheck ließ Dance hart auf den Beton stürzen. Sie bekam die Glock aus dem Holster, aber er entriss ihr die Waffe mit der Geschwindigkeit einer zubeißenden Schlange. Immerhin schoss er nicht. Er sah, dass Dance überrumpelt am Boden lag, und ergriff so schnell wie möglich die Flucht.
»Serrano!«, rief sie. »Stehen bleiben!«
Er schaute zu seinem Auto und begriff, dass er es nicht rechtzeitig erreichen würde. Dann entdeckte er ganz in der Nähe eine schlanke rothaarige Frau in einem schwarzen Hosenanzug – eine zivile Angestellte des CBI. Sie stieg gerade aus ihrem Nissan Altima, den sie zwischen zwei SUVs geparkt hatte. Serrano lief sofort zu ihr, stieß sie zu Boden und riss ihr den Schlüssel aus der Hand. Er sprang in den Wagen, ließ ihn an und gab Gas.
Der Lärm der quietschenden, qualmenden Reifen und des aufheulenden Motors war beträchtlich. Aber er überdeckte nicht das nun folgende Geräusch: ein grauenhaftes Knirschen. Die Schreie der Frau hörten abrupt auf.
»Nein!«, murmelte Dance. »O bitte nicht.« Sie rappelte sich auf und griff sich an das schmerzende Handgelenk, das sie dem Sturz auf den Beton verdankte.
Die anderen Mitglieder der Sondereinheit erreichten sie.
»Ich habe einen Krankenwagen angefordert und das Sheriff’s Office verständigt«, sagte TJ Scanlon und eilte der rothaarigen Frau zu Hilfe.
Foster hob seine Glock und visierte den sich entfernenden Altima an.
»Nicht!«, sagte Dance und legte ihm eine Hand auf den Arm.
»Scheiße, was soll das, Agent?«
Es war Overby, der dazwischenging. »Sehen Sie das Gebäude auf der anderen Seite der Schnellstraße? Da hinter den Bäumen? Das ist eine Kindertagesstätte.«
Foster senkte widerwillig die Waffe, als fühle er sich beleidigt, dass man sein Zielvermögen infrage gestellt hatte. Er steckte die Glock wieder ein, und das gestohlene Fahrzeug verschwand außer Sicht. Foster sah Dance an, und auch wenn er ihr ihre Worte über die angebliche Unschuld des jungen Mannes nicht mitten ins Gesicht brüllte, ließ seine Körpersprache diesbezüglich keine Zweifel offen.
6
Was würden die nächsten paar Stunden, die nächsten paar Tage bringen?
Kathryn Dance saß allein in Charles Overbys Büro. Ihr Blick wanderte von Fotos des Mannes mit seiner Familie über Bilder von ihm in weißer Tenniskleidung und in einem seltsam karierten Golf-Outfit zu Aufnahmen, die ihn mit örtlichen Würdenträgern und Geschäftsleuten zeigten. Es ging das Gerücht, Overby strebe ein politisches Amt an. Hier auf der Halbinsel oder notfalls auch in San Francisco. Nicht allerdings in Sacramento; er würde nie nach den Sternen greifen. Außerdem lag nur hier an der Küste das ganze Jahr hindurch stets ein Golf- oder Tennisklub in erreichbarer Nähe.
Seit dem Vorfall auf dem Parkplatz waren zwei Stunden vergangen.
Und in ein paar weiteren Stunden?, fragte sie sich erneut.
Und Tagen und Wochen?
Auf dem Korridor regte sich etwas. Overby und Steve Foster, die hochrangigsten CBI-Beamten vor Ort, traten ein und setzten dabei ihr Gespräch fort.
»… überwachen die Zubringer nach Fresno, den Eins-null-eins und die Fünf, für den Fall, dass er sich beeilt. Die California Highway Patrol übernimmt den Neunundneunziger. Und auf dem Eins haben wir Straßensperren errichtet.«
»Ich an seiner Stelle würde den Eins-null-eins nach Salinas nehmen«, sagte Foster. »Von dort aus nach Norden. Er kann bestimmt hinten auf einem von deren Gemüselastern mitfahren. Unbemerkt und sicher, bis hoch nach San Jose. Dort sammeln die G-Forty-sevens ihn ein, und er verschwindet in Oakland.«
Overby schien darüber nachzudenken. »In L. A. könnte er einfacher abtauchen. Aber er käme schwieriger hin, mit all den Straßensperren und so. Ich glaube, Sie haben recht, Steve. Ich verständige Alameda und San Jose. Oh, Kathryn. Hab Sie gar nicht gesehen.«
Obwohl er sie vor zehn Minuten gebeten – nein, angewiesen – hatte, in seinem Büro auf ihn zu warten.
Sie nickte den beiden Männern zu, stand aber nicht auf. Als Frau bei einer Strafverfolgungsbehörde verhandelte sie ihre Stellung ständig neu. Es konnte sie den Respekt der Vorgesetzten und Kollegen kosten, wenn sie sich zu fügsam gab – oder zu eigensinnig. »Charles, Steve.«
Foster nahm neben ihr Platz, und der Stuhl ächzte auf.
»Was gibt’s Neues?«
»Nichts Gutes, wie es aussieht.«
»Das Monterey County Sheriff’s Office hat den Altima in Carmel gefunden, in einer Wohngegend unweit des Barnyard.«
Das war ein altes Einkaufszentrum mit mehreren Parkplätzen.
Auf denen es jede Menge Autos aufzubrechen gab.
»Falls er sich einen neuen Wagen organisiert hat, wurde der Diebstahl bis jetzt jedenfalls nicht gemeldet«, sagte Overby.
»Was bedeuten kann, dass der Eigentümer tot im Kofferraum liegt«, merkte Foster an und gab damit zugleich Dance die Schuld an dem etwaigen Mord.
»Wir haben gerade darüber gesprochen, ob er wohl eher nach Norden oder Süden flieht. Was meinen Sie, Kathryn?«
»Nach allem, was wir wissen, gehört er zur Jacinto-Crew. Die haben engere Verbindungen nach Süden.«
»Wie schon gesagt«, wandte Foster sich ausschließlich an Overby, »im Süden liegen fünfhundert Kilometer mit relativ wenigen Straßen und Highways, während im Norden das Verkehrsnetz sehr viel dichter ist. Wir können nicht alles überwachen. Und Oakland liegt für ihn nur zwei Stunden entfernt.«
»Er könnte auch ein Flugzeug nehmen, Steve«, sagte Dance. »Dann landet er auf einer privaten Bahn am Rand von L. A. und ist im Handumdrehen in South Central.«
»Ein Flugzeug? Er ist kein Kartellboss, Kathryn«, widersprach Foster. »Er ist die Sorte Gangster, die sich auf der Ladefläche eines Transporters versteckt.«
Overby setzte seine nachdenkliche Miene auf. Dann: »Wir können unsere Augen nicht überall haben, und ich halte Steves Ansatz für, Sie wissen schon, logischer.«
»Also gut, konzentrieren wir uns auf den Norden. Ich spreche mit Amy Grabe. Sie wird ihre Leute auf Oakland ansetzen, die Docks, die East Bay. Und …«
»Meine Güte, Kathryn.« Overby sah so überrascht aus, als hätte sie gerade verkündet, sie wolle nun nach Santa Cruz schwimmen.
Dance musterte ihn stirnrunzelnd. Sein Tonfall hatte recht herablassend gewirkt.
Sie schaute kurz zu Foster, der das Interesse an ihr verloren zu haben schien und stattdessen einen goldfarbenen Golfball auf Overbys Schreibtisch betrachtete, irgendeine Trophäe. Er wollte sich seine hämische Freude nicht anmerken lassen, wenn Dance zu hören bekam, was nun folgen würde. Da widmete er sich lieber einem wertlosen Stück Plastik, das sich als kostbares Metall ausgab.
»Ich habe Rücksprache mit Sacramento gehalten«, sagte Overby. »Mit Peter.«
Dem Direktor des CBI. Dem obersten Vorgesetzten.
»Wir haben eine Weile geredet, ich habe ihm erklärt, dass …«
»Wie lautet das Ergebnis, Charles?«
»Ich habe getan, was ich konnte, Kathryn. Hab mich für Sie ins Zeug gelegt.«
»Und jetzt bin ich suspendiert.«
»Nicht suspendiert, nein, nein, wo denken Sie hin?« Er strahlte, als hätte sie bei einer Tombola soeben eine Karibikkreuzfahrt gewonnen. »Jedenfalls nicht vollständig. Sie haben Ihre Waffe verloren, Kathryn. Er hat sie jetzt. Das ist … Nun ja, das wissen Sie selbst. Man könnte Sie dafür ohne Bezüge vom Dienst suspendieren. So weit will man nicht gehen. Aber Sie werden bis auf Weiteres in die Civil Division versetzt.«
Das war das CBI-Äquivalent der Abteilung für Verkehrsüberwachung in einer städtischen Polizeibehörde. Man trug keine Waffe und besaß bei der Festnahme von Straftätern keine größeren Befugnisse als jeder beliebige Zivilist. Es war die Einstiegsabteilung des CBI, und man sammelte dort beispielsweise Informationen über Firmen und Einzelpersonen, die Regelverstöße und Ordnungswidrigkeiten begangen hatten, etwa im Hinblick auf Bauvorschriften, Abgabenverordnungen, unzureichende Beschilderungen am Arbeitsplatz oder auch nur die verspätete Weiterleitung von eingenommenem Flaschenpfand. Nur die wenigsten Mitarbeiter hielten den endlosen Papierkram und die erdrückende Eintönigkeit lange aus. Falls sie es nicht schafften, in die Criminal Division befördert zu werden, reichten sie für gewöhnlich die Kündigung ein.
»Es tut mir leid, Kathryn. Ich hatte keine Wahl. Ich habe es versucht, das dürfen Sie mir glauben.«
Ja, er hatte sich wirklich für sie ins Zeug gelegt.
Foster sah nun Overby mit neutralem Blick an. Dance hingegen las darin Verachtung für den Rückzieher ihres Chefs.
»Ich habe ihm erklärt, dass Körpersprache keine exakte Wissenschaft ist. Sie haben bei Serrano Ihr Bestes gegeben, das habe ich selbst gesehen. Wir waren doch alle dabei. Für mich sah es so aus, als würde er die Wahrheit sagen. Nicht wahr, Steve? Wer von uns hätte das Gegenteil behaupten können?«
Dance sah Foster an, was er dachte: Aber es ist ja auch nicht unser Fachgebiet, einem Verdächtigen gegenüberzusitzen und all seine Worte, Körperhaltungen und Gesten zu zerpflücken, um zur Wahrheit vorzudringen.
»Zum Glück wurde niemand verletzt«, fuhr Overby fort. »Zumindest nicht schlimm. Und es ist kein Schuss gefallen.«
Die Frau auf dem Parkplatz war doch nicht überfahren worden. Sie hatte sich geistesgegenwärtig unter den SUV gerollt, der direkt neben ihr parkte, als der Altima davongerast war. Ihr Mittagessen und ihr Laptop hatten allerdings nicht überlebt, daher auch das schreckliche Knirschen.
»Charles, Serrano ist ein hochgradiger Machiavellist. Zugegeben, das ist mir entgangen. Aber die kommen nur in einem von hundert Fällen vor.«
»Was war das? Ein hochgradiger …?«, fragte Foster.
»Es gibt unterschiedliche Lügnerpersönlichkeiten. Die skrupellosesten und, ja, aalglattesten« – sie schleuderte Foster das Wort förmlich ins Gesicht – »sind die sogenannten Machiavellisten. Sie lieben es zu lügen. Sie lügen ungestraft und finden nichts Falsches daran. Eine Täuschung ist für sie lediglich ein Mittel zum Zweck, so wie normale Leute ein Smartphone oder eine Suchmaschine benutzen würden, um ihre Ziele zu erreichen, ob in der Liebe, im Berufsleben, in der Politik – oder bei Verbrechen.« Sie fügte hinzu, dass es noch andere Ausprägungen gab, zum Beispiel die Geselligkeitslügner, die zum Vergnügen die Unwahrheit sagten, oder die Anpasser, die aus Gehemmtheit durch ihre Lügen einen positiven Eindruck hinterlassen wollten. Ebenfalls weit verbreitet waren die »Schauspieler«, bei denen es vor allem um Kontrolle ging. »Die lügen nicht grundsätzlich, sondern nur bei Bedarf. Aber Serrano hat wie keiner von denen gewirkt. Eindeutig nicht wie ein Machiavellist. Wie gesagt, mir sind an ihm bloß ein paar ausweichende Reaktionen aufgefallen. Allerweltslügen.«
»Wie ist das gemeint?«
»Wir alle lügen, laut Statistik mindestens ein- oder zweimal am Tag.« Dance sah Foster an. »Wann haben Sie zuletzt gelogen?«
Er verdrehte die Augen. Sie dachte: Vielleicht als er mir heute Früh einen guten Morgen gewünscht hat.
»Doch ich habe ihn immerhin ein Stück weit kennengelernt«, fuhr sie fort. »Ich bin in dieser und auch in jeder anderen Behörde die einzige Person, die etwas Zeit mit ihm verbracht hat. Und nun wissen wir, dass er eine Schlüsselfigur der gesamten Operation sein könnte. Ich brauche ja nicht die Leitung zu behalten. Aber ziehen Sie mich nicht von dem Fall ab.«
Overby strich sich über das schüttere Haar. »Kathryn, Sie wollen es wieder ausbügeln. Das verstehe ich gut. Natürlich wollen Sie das. Aber ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll. Es ist entschieden. Peter hat die Versetzung bereits abgesegnet.«
»So schnell.«
»Bei Licht besehen eine rationelle Entscheidung«, sagte Foster. »Wir haben nicht wirklich zwei Beamte aus dieser Dienststelle benötigt. Und Jimmy Gomez ist doch wirklich ein fähiger Kollege, meinen Sie nicht auch, Kathryn?«
Ein junger CBI-Agent, einer der beiden anderen Angehörigen der Guzman-Sondereinheit. Ja, er war fähig. Darum ging es hier aber nicht. Sie ignorierte Foster, stand auf und sah Overby an. »Und?«
Er hob fragend eine Augenbraue.
Sie zog seufzend beide Schultern hoch und ließ sie wieder sacken. »Ich bin nicht suspendiert, sondern zur Civil Division versetzt. Wie lautet meine erste Aufgabe?«
Einen Moment lang sah er sie nur verdutzt an. Dann suchte er seinen Schreibtisch ab. Ihm fiel ein gelber Haftnotizzettel auf, der in einem kleinen Rechteck aus Sonnenlicht hell erstrahlte. »Hier ist was. Die Feuerwehr hat vorhin eine Meldung rausgeschickt. Über den Zwischenfall beim Solitude Creek.«
»Den Roadhouse-Brand?«
»Ja. Die Ermittlungen fallen in die Zuständigkeit des Bezirks, aber ein Beamter des Staates Kalifornien sollte sich vergewissern, dass die Steuer- und Versicherungsunterlagen des Klubs auf dem neuesten Stand sind.«
»Steuern? Versicherungen?«
»Die Staatspolizei hat dankend abgelehnt.«
Warum wohl?, dachte Dance sarkastisch.
Fosters stoische Miene war schlimmer als jedes noch so gehässige Grinsen.
»Kümmern Sie sich darum. Danach sehen wir, was sonst noch erledigt werden muss.«
Nachdem Dance nun beauftragt war, sich mit dem Kleingedruckten der kalifornischen Versicherungsvorschriften zu beschäftigen, war ihre Anwesenheit nicht länger erforderlich. Overby wandte sich Steve Foster zu, um die Großfahndung nach Joaquin Serrano zu besprechen.
7
»Zunächst mal dürfte von Interesse sein, dass es gar kein Feuer gegeben hat.«
»Nicht?«, fragte Dance. Sie stand vor dem Solitude Creek. Der Klub war mit gelbem Flatterband abgesperrt. Der untersetzte Mann vor ihr war Mitte vierzig und hatte ein auffälliges Mal im Gesicht; es sah wie ein Muttermal aus, aber sie wusste, dass es eine Brandnarbe war, die der damals noch unerfahrene Feuerwehrmann sich bei einem seiner ersten Einsätze zugezogen hatte.
Inzwischen war Robert Holly als Brandmeister für das Monterey County Fire Department tätig. Dance hatte schon bei mehreren Gelegenheiten mit ihm zusammengearbeitet und ihn als einen besonnenen, klugen und verständigen Fachmann kennengelernt.
»Nun ja, genau genommen schon«, fuhr er fort. »Aber draußen. Der Klub selbst hat zu keinem Zeitpunkt gebrannt. Da, die Öltonne.«
Dance schaute zu dem verrosteten Zweihundert-Liter-Fass, wie es auf Parkplätzen oder hinter Geschäften und Restaurants häufig als Abfallbehälter diente. Es stand neben der Klimaanlage des Klubs.
»Unser vorläufiger Befund hat ein paar mit Motoröl und Benzin getränkte Lumpen ergeben. Dann hat jemand eine Zigarette hinterhergeworfen. Mehr war nicht nötig.«
»Jemand hat Öl und Benzin als Brandbeschleuniger benutzt?«, fragte Dance.
»Das war jedenfalls der Effekt, aber es deutet bislang nichts auf Vorsatz hin.«
»Die Leute haben also Rauch gerochen und geglaubt, das Gebäude würde brennen.«
»Ja. Und als sie durch die Notausgänge nach draußen wollten, gab es ein Problem. Sie waren blockiert.«
»Inwiefern?«
»Sehen Sie den Lastwagen?«
Er zeigte auf einen großen Sattelschlepper, der an der Westseite des Klubs geparkt und ebenfalls von gelbem Absperrband umgeben war. »Der gehört der Spedition da drüben. Henderson.«
Dance musterte das großflächige, eingeschossige Gebäude. An und in der Nähe der Laderampe stand ein halbes Dutzend ähnlicher Zugmaschinen. Mehrere Männer und Frauen, die meisten in Arbeitskleidung, einige wenige in Anzügen, hatten sich dort und vor dem Büro versammelt und starrten zum Klub herüber, als wäre es ein gestrandeter Wal.
»Hat der Fahrer ihn dort abgestellt?«
»Er behauptet das Gegenteil. Aber was soll er groß sagen? Deren Laster haben schon häufiger den Parkplatz hier blockiert. Aber noch nie die Notausgänge.«
»Ist er heute hier?«
»Er kommt bald. Ich habe ihn zu Hause angerufen. Er ist ziemlich durch den Wind. Aber er war bereit herzukommen.«