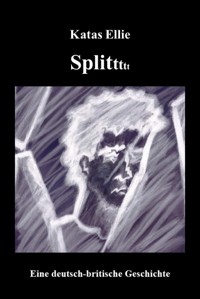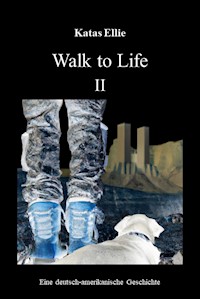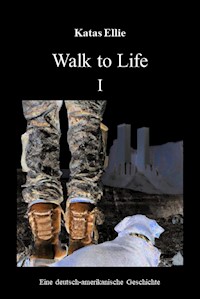
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Fehler, die man einmal gemacht hat, holen einen immer wieder ein. Als die deutsche Fotografin Sanna für ein Fotoprojekt in den Südwesten der USA reist, ahnt sie noch nicht, dass sich dieser Spruch für sie als allzu wahr herausstellen wird. Viel hat sie bereits durchgemacht und ist hart im Nehmen, doch nun wartet auf sie die größte Herausforderung ihres gesamten bisherigen Lebens. Denn in ihrer Vergangenheit gibt es einen dunklen Fleck, ein Geheimnis, das sie um jeden Preis vor den Amerikanern verbergen will.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 691
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katas Ellie
Walk to Life
I
Eine deutsch- amerikanische Geschichte
Impressum
Texte:© 2023 Copyright by Katas Ellie
Umschlag:© 2023 Copyright by Katas Ellie
Inga Rieckmann alias Katas Ellie
c/o Block Services
Stuttgarter Str. 106
70736 Fellbach
https://www.facebook.com/Katas.Ellie
Veröffentlicht über Epubli - ein Service der Nepubli GmbH, Köpenicker Strasse 154a, 10997 Berlin
Kapitel 1
Gut Haulensteen Anfang Januar
»Hast du alles? Pass? Flugtickets? Dein Visum?« Kris schaut mich besorgt an. Den ganzen Morgen ist sie mir kaum von der Seite gewichen, so nervös ist sie.
»Ja, Mama! Ich habe alles eingepackt. Meine Güte, nun lass mir doch etwas Luft! Es ist ja schließlich nicht das erste Mal, dass ich wegfahre.« Mit einem langen Seufzer sehe ich mich in der winzigen, aber gemütlichen Behausung um. Es ist warm in der Wohnküche, im Küchenofen glimmt ein letzter Rest des morgendlichen Feuers. Neben dem Küchentresen lehnt mein gepackter Wanderrucksack an der Wand. Draußen vor dem großen, doppelflügeligen Halbrundfenster treibt der Wind heulend die Regentropfen vorbei. Januar in Mecklenburg von seiner ungemütlichsten Seite, ein Tag, an dem man nicht mal einen Hund vor die Tür jagen will. Genauso wenig wie den dicken schwarzen Kater Putin mit dem Knickohr, unseren Hofdiktator, der sich jetzt gähnend auf dem Sofa in die Länge streckt und uns aus seinen grünen Augen indigniert anstarrt.
»Na, hoffentlich fahren die Züge. Das fehlte noch, dass du deinen Flug verpasst«, erwidert Kris, packt den Rucksack und zieht ihn zur Tür. Zu tragen schafft sie ihn nicht, zierlich, wie sie ist. Ganz im Gegensatz zu mir. Ein Kreuz wie ein Bauarbeiter, scherzt Kris manchmal, was ja auch teilweise stimmt. Denn das bin ich die letzten zweieinhalb Jahre mehr oder weniger gewesen, und ganz sicher war ich niemals so zierlich wie sie.
»Komm, Dicker, raus mit dir!«, scheuche ich den Kater vom Sofa. »Hier wird jetzt abgeschlossen. Such dir einen anderen Schlafplatz!«
Er maunzt empört, huscht aber angesichts der Übermacht in den Vorraum und schlüpft dann zur Tür hinaus. Aber nur halb. Kaum bemerkt er die fliegenden Regentropfen, will er sofort wieder umdrehen. Kris schiebt sanft mit dem Fuß hinterher und schließt die Tür wieder. Seufzend schaut sie nach draußen, leichte Sorge im Blick. »Hoffentlich hält das Dach durch. Heute Nacht haben sie Orkanböen angesagt.«
Ich schaue ebenfalls nach draußen. Das große Haupthaus verschwindet fast in der nebeligen Suppe auf der anderen Seite des Hofes, so schlecht ist die Sicht. »Keine Sorge, die Jungs haben gute Arbeit geleistet. Das Dach wird halten. Ich habe jede einzelne verdammte Klammer kontrolliert, die sie gesetzt haben.« Wir tauschen ein Verschwörerinnengrinsen.
Sicherlich haben die Dachdecker vom Gutshausretterverein vieles erwartet, als sie im Frühsommer hier angefangen haben, aber ganz sicherlich nicht, dass eines der verrückten Weiber (O-Ton des Altgesellen) ständig auf dem riesigen Gerüst herumturnt, immer ihnen über die Schulter schauend und mit ihnen durch die Dachsparren kletternd. Denn ich wollte lernen, was sie da machen, egal was. Zuerst waren sie genervt. Dann haben sie versucht, mich anzubaggern, besonders die Älteren. Doch das habe ich ignoriert, und als sie merkten, dass ich mit anfasse und wirklich etwas kann, da haben sie mich akzeptiert und mir sogar Dinge gezeigt, die wir wissen müssen, sollte mal etwas kaputt gehen. Denn wir können nicht immer auf Handwerker zurückgreifen. Die Förder- und Spendengelder haben für die Sanierung des Daches gerade so gereicht. Den Rest müssen wir selber stemmen.
Ich ziehe mir rasch die Winter-Trekkingjacke über. »Bereit?«
Kris nickt und schaltet das Licht aus. »Eins, zwei... drei!« Ich schwinge mir den Rucksack auf den Rücken, packe die selbst genähte Kameratasche – Spezialanfertigung - und folge ihr aus der Tür. Ein kurzer Sprint rüber zum Kücheneingang des Gutshauses bewahrt mich vor dem schlimmsten Regen, aber meine Wanderstiefel platschen durch den Matsch und sind im Nu eingesaut. Na super, hoffentlich bekomme ich die wieder einigermaßen sauber, sonst schmeißen mich die Amis gleich wieder raus oder unser liebster Taxifahrer, der jetzt jeden Moment eintreffen muss, nimmt mich gar nicht erst mit. Hastig trete ich sie ab und schlüpfe ins Haus. Als ich mich umdrehe, um die Tür zu schließen, sehe ich aus den Augenwinkeln eine Bewegung im Nebel, eine kleine Gestalt. Ganz kurz nur, ein Winken. Ich lächele zurück, dann ist sie wieder weg. Mit einem tiefen Durchatmen schließe ich die Tür.
In der Waschküche empfängt mich der muffige Geruch eines alten Kellers, wie das in so uralten Häusern halt ist. Aber dahinter, in der großen Gutsküche, ist der Herd voll durchgefeuert, und es riecht nach Rauch, Essen und Gemütlichkeit. Notdürftig streife ich mir den Matsch von den Schuhen, während Kris in ihre Crogs schlüpft. Keine Dreckschuhe im Haus. Eiserne Regel im Winter, aber heute gilt sie nicht für mich. Sorgfältig auf das ausgelegte Malerfliess tretend, steige ich die Treppe mit dem Eisengeländer hoch in die Eingangshalle.
Kris folgt mir und fragt leise: »Wer war es, der Junge oder das Mädchen?«
»Der Junge. Hat sich verabschiedet«, erwidere ich genauso leise. Mehr sage ich nicht.
Oben in der Halle ist es wie zu erwarten so eiskalt, dass kleine Dampfwölkchen vor meinem Mund aufsteigen. Zwar ist die Heizung bereits angeschlossen, aber wir heizen mit Holz, so viel es nur irgend geht, um die Gaskosten zu sparen. Neues Dach hin oder her, dieser Kasten ist so zugig wie ein alter DDR Eisenbahnwagen mit geöffneten Fenstern bei voller Fahrt im Winter. Wie gut habe ich es doch in dem winzigen Nebenhaus, dem ehemaligen Backhaus des Gutes. Irgendeiner der ambitionierten, aber gescheiterten Vorbesitzer hatte dort mit der Restaurierung angefangen und zumindest neuere Fenster und ein richtiges Bad eingebaut. Ein Segen bei diesem Wetter.
Aber Kris stört das nicht und ihre bessere Hälfte auch nicht. Sie sind gleich hier eingezogen, selbst als das Dach noch offen war und die Hälfte aller Böden kaputt und durchgebrochen. Camping auf der Baustelle, anfangs sogar im Zelt. Doch es wird langsam. Überall kann man die vergangene Schönheit des Hauses bereits erahnen, das konnte man mit viel Fantasie von Anfang an. Über uns schraubt sich die wuchtige Wendeltreppe in fast schon wieder alter Eleganz in die Höhe. Das wird das Prachtstück des Hauses, sollte sie erst einmal fertig werden.
Von oben aus dem ersten Stock dröhnt Deep Purple aus einer Musikbox gegen das Kreischen einer Flex an. Kris tritt an das Geländer der Wendeltreppe, nimmt den Schlegel, der dort hängt, und schlägt ein paar Mal kräftig gegen das Metall. »Perri, komm runter und sag Sanna auf Wiedersehen!«, brüllt sie gegen den Lärm an. Man hört ein lautes Scheppern, dann einen Fluch. Dann verstummt die Musik.
»Ich komm’ ja schon! Ist das Taxi da?«
»Noch nicht«, rufe ich mit einem Blick über die Schulter.
Perri kommt die Treppe heruntergepoltert. Diese zittert richtig unter seinem Gewicht. Er ist von Geburt Däne, hat aber schon überall auf der Welt als Zimmermann und Schiffsbauer gearbeitet, bis er sich in die elfengleiche Kris verliebt hat und mit ihr in dieses Wahnsinnsprojekt eingestiegen ist. Langer Zottelbart mit zwei geflochtenen Zöpfen, ehemals rotblonde, jetzt mit viel Grau durchsetztes Haar und über zwei Meter groß, kann man ihn sich gut als Schrecken der Meere vorstellen. Seit Jahren sind er und Kris ein Paar, wie es ungleicher nicht sein kann. Sie mit ihrer unerschöpflichen Energie und er mit seiner unerschütterlichen Ruhe und Gelassenheit. Ich mag beide wahnsinnig gerne und nehme jetzt mit Tränen in den Augen Abschied.
Er umarmt mich, hebt mich regelrecht vom Boden hoch und gibt mir einen dicken Kuss. »Pass auf dich auf, Süße. Und denk an das, was dich der Meister gelehrt hat.«
Ich muss lachen und erwidere seine Umarmung fest. »Mach ich doch, keine Sorge.« Draußen hupt es. Perri setzt mich wieder auf dem Boden ab, und die beiden bringen mich zur Tür.
»Mach uns spektakuläre Fotos, ja?« Kris umarmt mich ein letztes Mal.
»Das werde ich. Genug mit dafür habe ich ja«, erwidere ich mit einem Grinsen und rolle die Schultern. Ich habe sehr viel in den Ultralight Backpacker Foren geforscht und mir die Ausrüstung so leicht gemacht, wie es nur irgend geht. Aber die Technik wiegt nun einmal, die Kamera, das Stativ, die Akkus, Solarladegerät, das Ultrabook, die Ladekabel. Zumal ich im Winter losziehe, das bedeutet einen dickeren Schlafsack, wärmere Klamotten. Alles in allem trage ich runde fünfzehn Kilo Gewicht mit mir herum, und da sind noch keine Vorräte und kein Wasser dabei. Ganz schön viel für meine Verhältnisse. Aber wer Winterfotos haben will, muss halt im Winter los, besonders solch spezielle, wie ich sie machen will. Oder Kris sie haben möchte.
Der Taxifahrer steigt aus. Ich bin erfreut, ein bekanntes Gesicht für die Fahrt nach Rostock bei mir zu haben. »Kurt! Wie geht es dir?«
Er öffnet mir grinsend den Kofferraum. »Immer rein damit und dann ab ins Warme, Mädel«, begrüßt er mich mit seinem breiten berliner Akzent und hilft mir mit dem Rucksack. Ich winke meinen beiden Freunden in der Eingangstür noch einmal zu und schlüpfe aufatmend auf den Beifahrersitz. Geheizt. Grinsend mache ich es mir gemütlich. Auf Kurt ist doch immer Verlass! Er wechselt noch ein paar Worte mit Kris und Perri, dann steigt er ächzend hinter das Steuer.
Kurt ist eine echte Legende in der Gegend. Längst in Rente, verdient er sich mit dem Taxifahren ein Zubrot. Oder er versucht der Langeweile zu entkommen, wie er manchmal augenzwinkernd meint. Als die Direktorin der Samtgemeinde über die Köpfe der Dorfbewohner hinweg klammheimlich mit einigen Immobilienhaien den Verkauf und Abriss von Gut Haulensteen beschlossen hatte, war er einer der ersten gewesen, der eine Bürgerinitiative zur Rettung des Anwesens ins Leben gerufen hat. Erst hat die Direktorin das noch milde belächelt. Doch sie hat ihre Rechnung ohne Kurt gemacht. Er ist ein Veteran der 89er Bewegung und kann Reden schwingen, dass einem das Hören und Sehen vergeht. Sie hatte keine Chance. Vor drei Jahren dann haben Kris und Perri das Haus zu einem symbolischen Preis von einem Euro – und einer Million Bauauflagen - gekauft. Da war die Samtgemeinde nur noch froh, dass endlich Ruhe um den Kasten herrscht. Ein abgedrehtes Künstlerpärchen war ihnen da allemal lieber als die Horden von linken Hausbesetzern, die sich etliche Scharmützel mit der Polizei und der örtlichen rechten Szene aus der Nachbarstadt geliefert haben.
Kurt brummt ungehalten und schaltet den Scheibenwischer auf eine höhere Stufe, bevor er losfährt. »Mensch Mädel, da hast du dir aber ein beschissenes Wetter für deine Reise ausgesucht. Ich täte ja nichts lieber, als mich jetzt in so eine schaukelnde Blechkiste zu setzen!«
»Ach, das ist schon okay. Ich bin schon bei schlimmerem Wetter geflogen«, winke ich ab. Die Bäume in der lang gezogenen Allee biegen sich gen Osten. Ich schaue besorgt nach oben. Hoffentlich kommt nicht ausgerechnet jetzt ein Ast runter! Wir haben es noch nicht geschafft, alle Totäste zu beseitigen, es sind einfach zu viele. Der Sommer war so kurz und randvoll mit Arbeit, da blieb für die Baumpflege keine Zeit.
Doch dann ist die Allee zu Ende, und Kurt biegt durch die Toreinfahrt auf die Landstraße ein. Am Gutsverwalterhaus stehen zwei Gestalten in der Tür und winken, und ich winke zurück. Helena und ihr Mann Georg sind uns gute Freunde geworden und er mein Mentor in Sachen Selbstverteidigung. Der Meister, wie Perri sagt. Wenn man als Frau allein auf Reisen geht, dann ist man gut beraten, sich verteidigen zu können, und Georg ist als pensionierter Polizist und ehemaliges Mitglied einer Spezialeinheit der ideale Partner, mir das beizubringen. Er hat mich im letzten halben Jahr ganz schön rangenommen, und mittlerweile traue ich mir einiges zu. Was nicht ist immer so gewesen ist.
Ich seufze bei dem Gedanken. Kurt tätschelt mir das Knie. »Kopf hoch Mädel, kein Trübsal blasen! Nun erzähl doch mal, wie läuft’s denn so bei euch in dem alten Kasten?«
Und damit schafft er es, dass meine trüben Gedanken im Nu verflogen sind. Begeistert unterhalten wir uns über die Fortschritte im Obergeschoss und die Pläne, die Kris mit ihrer Galerie in der Scheune hat. Er verspricht mir, während meiner Abwesenheit nach den Fahrzeugen zu sehen und sie gebührend spazieren zu fahren und zu pflegen, damit sie keinen Rost ansetzen. Kurt ist einfach ein Schatz, und das sage ich ihm auch, als er in die Taxischleife am Rostocker Bahnhof einbiegt.
»Ach lass nur, Mädel! Deine beiden Schätzchen sind tolle Spielzeuge für einen alten Mann wie mich«, grinst er mich an und hebt mir den Rucksack aus dem Kofferraum. Damit hat er vermutlich recht. Den zwanzig Jahre alten Landrover Defender und den über Sechzig Jahre alten Unimog habe ich mitsamt Anhänger, Tonnen von Werkzeugen und Maschinen in dieses Projekt mit eingebracht. Aus einem anderen Leben. Es war ein Tauschgeschäft für die Unterkunft im Backhaus, dringend benötigtes Material, ohne das Perri und Kris nie so weit hätten kommen können. Dass ich damit jedoch auch Freunde fürs Leben eintausche, hätte ich nie gedacht.
Ich vereinbare mit Kurt, dass ich mich kurz über Handy melde, sobald klar ist, ob der Zug auch wirklich fährt. Ansonsten würde er mich auch nach Hamburg fahren, selbst bei diesem Wetter. Doch es geht alles glatt. Die Regionalbahn ist sogar pünktlich, und ich steige erleichtert ein. Ein kurzer Anruf, und ich schaue aus dem Fenster ins Leere. Meine Gedanken und Gefühle sind abgestumpft, erschöpft. Die Fröhlichkeit mit den anderen lediglich aufgesetzte Fassade. Deshalb will ich auch weg. Eigentlich ist der Winter zum Verschnaufen da, um zu sich zu kommen. Aber auf Haulensteen lächelt einen die Arbeit immer an, und ich kann sie einfach nicht ignorieren. Das liegt nicht in meiner Natur. Nicht, wenn Kris und Perri es auch nicht machen. Was wäre ich denn für eine Freundin, wenn ich die beiden schuften ließe und selber die Füße hochlege? Deshalb ist es gut, dass ich erst einmal für ein paar Monate woanders bin. Und allein. Das vor allem.
Über den Flug von Hamburg nach London gibt es nicht viel zu berichten. Die Piloten sind stürmisches Wetter gewohnt, und ich habe es fast noch nie erlebt, dass diese wichtige Verbindung eingestellt worden ist. Natürlich gibt es angenehmere Tage zum Fliegen, aber das Gerüttel und der damit verbundene Lärm verhindern wenigstens, dass man in aufdringliche Gespräche verwickelt wird.
Wir kommen einigermaßen pünktlich in Heathrow an, aber dann geht plötzlich alles schief. Ich sehe es schon auf der ersten Anzeigetafel, zahlreiche Flüge stehen entweder auf delayed oder sogar cancelled, und leider auch mein schöner Direktflug nach Phoenix in Arizona. Aufgeregte Rufe und Stöhnen aller Passagiere ringsherum.
Heathrow gleicht einem Tollhaus. Ich als Business-Class Passagier habe es da noch vergleichsweise gut, ich darf an einen extra Schalter und werde aufmerksam betreut. Doch leider wartet dann noch eine Hiobsbotschaft auf mich: Die nächste einigermaßen verlässliche Verbindung zum eigentlichen Ziel, Tucson in Arizona, geht ausgerechnet über New York. Ich würde am geplanten Tag dort ankommen, jedoch fände dann der Stopover nicht in Phoenix, sondern in New York statt. Einen Moment lang zögere ich. Will ich das? Doch es nützt ja nichts, offenbar hat das Wetter derartig viele Verbindungen beeinträchtigt, dass mir kaum eine andere Wahl bleibt, ansonsten würde ich erst Tage später ankommen. Also greife ich zu. Irgendwie werde ich es schon schaffen.
Ich lenke mich ab, indem ich mir eine einigermaßen ruhige Ecke suche und mich ins Netz einlogge, um das Hotel in Phoenix zu stornieren. Mit dem in Tucson brauche ich das ja zum Glück nicht zu tun. Um mich herum finden allerlei aufgeregte Telefonate statt. Es hängen offenbar ziemlich viele Leute komplett hier fest. Da hatte ich ja Glück!
Kopfschüttelnd schaue ich mich um. Warum lamentieren die denn so? Sie können es ja nicht ändern! Diese Businesstypen, die altmodischen mit, die neumodischen ohne Schlips, alle ach so wichtig mit ihren Smartphones und Laptops, habe ich noch nie leiden können, was auch an meinen früheren Jobs liegt. Gott sei Dank bin ich aus dieser Falle raus, denke ich und lege verächtlich die schlammbespritzten Wanderstiefel übereinander, als ich den Terminal in Heathrow gewechselt und mich in den Wartebereich für den Flug nach New York begeben habe. Dennoch, egal wie ich daherkomme, wie ich mich gebe, immer versucht irgendeiner, mich in aufdringliche Gespräche zu verwickeln, und das geht mir entsetzlich auf den Keks. Diesmal ist es ein rotgesichtiger Engländer mit einem so starken Cockney Akzent, dass ich ihn kaum verstehe. Dankend lehne ich die Einladung auf einen Drink ab und flüchte auf die Toilette. Mit etwas saubereren Stiefeln und eingestöpselten Kopfhörern setze ich mich demonstrativ in eine andere Ecke, die Kameratasche Abstand einfordernd auf dem leeren Platz neben mir.
Was finden diese Typen nur an mir? Ich schaue innerlich kopfschüttelnd auf das Spiegelbild in der großen Außenscheibe des Terminals. Da sitzt eine knapp 1,65 Meter große, kräftig gebaute, schlanke Frau mit mittellangen, zu einem kurzen Zopf geflochtenen Haaren in undefinierbarer Farbe. Straßenköterblond, durchmischt mit grauen Strähnen. Im Sommer eher blond, im Winter eher braun. Trekking Kleidung in brauner Farbe, Wollkapuzenpulli, kein Schmuck, nicht einmal eine Uhr. Ich bin Ende Vierzig, sehe aber jünger aus und habe ein eher rundliches Gesicht mit einer für meinen Geschmack etwas zu dicken Nase und breitem Mund und großen blauen Augen, die je nach Stimmung entweder grau oder leuchtend blau sein können, wie meine Freunde sagen. Oder eisig, richtig eisig, wenn ich wütend bin. Ganz normaler Durchschnitt und weit entfernt von diesen eleganten Stöckelschuhtanten mit all ihrer Schminke und Parfüms. Dafür habe ich mich nie interessiert. Morgens eine Stunde Zeit im Badezimmer? Von wegen! 15 Minuten. Maximum. Keine Chemie, kein Lack. Stattdessen habe ich immer hart gearbeitet, beruflich wie privat, und viel Zeit in der Natur verbracht, und das sieht man vor allem meinen Händen auch an. Kurz und kräftig sind sie und mittlerweile ziemlich faltig von zu viel Baustaub.
Ich habe meinen Weg gemacht, auch ohne mich die Karriereleiter hoch zu schlafen, habe mich auf einen Bereich der IT spezialisiert, in dem es nicht viele Leute gibt, die so etwas können, und ziemlich gut verdient, bis... ja bis mein ach so abgesichertes Leben mit Volldampf gegen die Wand gefahren und zerbrochen ist. Vor Haulensteen.
Bevor die Gedanken in diese gefährlichen Regionen wandern können, wird der Flug nach New York aufgerufen. First und Business Class zuerst, zumindest eine kleine Gnade heute! Ich hole Pass, Visa Unterlagen und Flugticket hervor und laufe mit einem nicht unbefriedigenden Gefühl an den Schlipsträgern vorbei, die von ihren Firmen zur Economy-Class verdonnert worden sind, und stelle mich in die Reihe der noch eleganteren Passagiere. Ungläubige Blicke folgen mir und teilweise auch leise Verachtung angesichts der klobigen Stiefel von den Frauen. Es ist mir herzlich egal. Ich habe mir einfach geschworen, nie wieder einen Langstreckenflug in der Bretterklasse zu machen. Wofür habe ich so hart gearbeitet, wenn ich mir nicht mal etwas gönnen kann? Dann fliege ich lieber weniger und dafür ausführlich.
Doch erstmal ist die Passkontrolle dran. Neben dem britischen Zollbeamten sitzt einer von den Amerikanern. Hier geht das schon los?, denke ich beunruhigt. Ich weiß, dass sie in letzter Zeit wieder stärker kontrollieren, wegen der vielen illegalen Migranten und ernst zu nehmender Terrorwarnungen. Mit einem Lächeln reiche ich die Unterlagen hinüber, und der Ami lächelt tatsächlich zurück. Gescannt, geprüft, pieps, und ich darf weiter. Schönen Flug, Madam. Thank you, Sir.
Erleichtert gehe ich zum Flieger, einer noch recht neuen großen Maschine, die mit allem Komfort ausgestattet ist. Ich habe einen Einzelsitz am Fenster, der Platz neben mir bleibt frei, was für ein Glück! Die Stewardess fragt, ob ich vor dem Abflug einen Drink haben möchte, und ich nehme gerne an, während sich hinter mir nach und nach die Economy-Class füllt. Sinnierend betrachte ich das Visum und fahre mit dem Daumen über das Emblem. United States of freaking America. Wer hätte das gedacht, dass ich da jemals wieder hinreise!
Als Kris und ich die Idee mit den Winterfotos aus der Wüste hatten – ein Bereich, den meine alten Reisefotos leider nicht abdecken – habe ich erst gar nicht an die USA gedacht, sondern eher an Südamerika, die Anden. Das hätte aber bedeutet, dass ich Haulensteen im Sommer hätte verlassen müssen, in der betriebsamsten Zeit, was wir beide nicht wollten. Nach einer Recherche im Internet sind wir jedoch auf einen neuen Trail in Arizona gestoßen, der erst letztes Jahr angelegt worden ist. Im Süden und Westen der USA reihen sich die Nationalparks und Reservate wie an einer chaotischen Perlenschnur aneinander. Dieser Trail ist noch relativ unbekannt, eigentlich eine Zusammenlegung von vielen bereits existierenden Wanderwegen, nur für die Lücken hat man neue Streckenabschnitte geschaffen. Genau richtig für mich, aber ich bin nicht so fanatisch, dass ich unbedingt jeden Meter eines Weges durchwandern muss. Wenn die Strecke zu ätzend, zu eintönig ist, kann man auch mal den Daumen rausstrecken und sich mitnehmen lassen bis zum nächsten Abschnitt oder ganz woanders entlangwandern.
Unbekannte Wege bedeuten nicht viele Fotos im Stock, den Portalen zur Stockfotografie, womit ich mittlerweile mein – wenn auch bescheidenes – Auskommen bestreite, gemessen an dem, was ich früher verdient habe. Aber für die laufenden Kosten des Lebens auf dem Gut reicht es. Und gerade die Siedlungen im Westen der USA, die alten Minenstädte, verlassene Wüstenkäffer, bedeuten eine Menge Lost Places.
Landschaftsfotos sind für die Stockfotografie eher uninteressant, dort geht es mehr um Menschen, Berufe, Motive für Werbung, welche die Agenturen einkaufen. Oder Firmen. Gut Haulensteen mit seiner Mega Baustelle, dieser Lost Place, hat mir Tonnen von Fotos beschert und ein stetes Einkommen in den bekanntesten Agenturen. Mittlerweile habe ich mir bei gewissen Tags einen Namen gemacht, historische Handwerksarbeit, und ich bekomme sogar Anfragen wie "hast du nicht ein Motiv mit traditionellen Zimmerleuten" oder Ähnliches. Ich mag das nicht. Fotos kann man nicht erzwingen, sie entstehen aus einer Stimmung heraus. Ich fotografiere nach Gefühl, bediene die Kamera wie im Schlaf, denke nie über Belichtung, diese ganzen technischen Details nach, an denen sich vor allem männliche Fotografen stundenlang aufhalten können. Ich spiele damit. Meistens kommen bei meinen Bildern auch so sehr gute Dinge heraus. Ein Bild muss man betreten können, sagt Kris immer, und damit hat sie recht, und deshalb ist meine Leidenschaft auch die Landschafts- und Gebäudefotografie.
Die gute Kris. Ich lächele in die Scheibe des schmalen Flugzeugfensters, und mein müdes Gesicht lächelt zurück. Kris und Perri habe ich auf einer Wanderung in Südengland kennen gelernt, nach dem Zusammenbruch meines alten Lebens. In Land’s End habe ich sie getroffen, ausgerechnet an dieser Touristenabzocke, wo man Eintritt zahlen muss, um das zu sehen, was man ein paar Meter weiter ganz umsonst bekommen kann: eine atemberaubende Landschaft. Sie stritten lauthals auf Deutsch und er fluchte zwischendrin kräftig auf Dänisch herum, dieser Riesenkerl. Es war herzerfrischend, denn ich verstehe das Dänische ziemlich gut, und ich habe die beiden schmunzelnd beobachtet. Mittlerweile konnte ich das wieder, unter Menschen sein, beobachten und Gespräche führen. Am Anfang wäre das nicht möglich gewesen.
Sinngemäß ging es bei den beiden darum, dass sie, obwohl sie alle Hände voll zu tun hatten, extra wegen dieser dämlichen Fotos hierhergefahren waren und jetzt das Wetter so schlecht war, dass sie rein gar nichts sahen und Perri nicht den teuren Eintritt für Lands End bezahlen wollte. Und tatsächlich blies der kräftige Wind gerade eine gewaltige Schauerwolke heran, sodass Kris ihre riesige Kamera schleunigst wieder einpacken musste und sie zurück ins Dorf gefahren und in den nächsten Pub geflüchtet sind.
Ich hatte dort in der Nähe ein Zimmer reserviert, und so traf ich die beiden im Pub wieder. Wir kamen ins Gespräch, und sie luden mich zum Essen ein. Sie erzählten mir von Haulensteen, das ihnen nächste Woche übergeben werden sollte, und ihren Plänen. Kris ist Künstlerin, Malerin, und macht auch Kollagen aus Fotos, und sie brauchten Platz, viel Platz. Ich muss doch etwas skeptisch dreingeschaut haben, doch sie lächelte nur und holte aus ihrer Riesenumhängetasche eine Broschüre mit Fotos heraus.
»Hier, von meiner Galerie in Berlin«, sagte sie und zeigte mir ein paar ihrer Arbeiten. Was ich da sah, verschlug mir die Sprache. Diese Bilder, riesig, mehr als mannshoch, wie sie diese zusammenfügte, aber vor allem die Rahmen waren der reine Wahnsinn. »Die Rahmen macht Perri«, sagte sie, und er wurde doch tatsächlich rot. Wie süß! »Aber es ist so schwer, an gute Fotos heranzukommen. Für unsere Zwecke, meine ich, und ich selber kann leider gar nicht gut fotografieren«, fügte sie seufzend hinzu und schaute missmutig auf ihre Kamera. So ein riesiges Ding habe ich nie besessen. Mir sind die kleinen Allrounder lieber, alles in einem.
»Fotografen wollen immer Geld für ihre Bilder, und für so eine Collage brauchen wir mindestens ein Dutzend Fotos. Das können wir uns nicht immer leisten«, ergänzte Perri.
Naja, ich machte ja genug Fotos, und so zeigte ich ihr einige von den letzten, von der Küste vor Land’s End, wie der Sturm aufzog. In ein irres Licht getauchte Felsen und die schwarzen Wolken mit der aufgewühlten See im Hintergrund, solche Stimmungen liebe ich. Als Kris diese Bilder sah, geriet sie völlig aus dem Häuschen. »Sanna, die sind ja fantastisch! Oh, du musst mir erlauben, damit zu arbeiten!« Also trafen wir eine Vereinbarung. Ich überließ den beiden die Land’s End Serie, und sie luden mich ein, sie auf dem Gut zu besuchen, und dann könnten wir über eine weitere Zusammenarbeit sprechen. Ich konnte es kaum glauben. Sollte das etwa ein Wegweiser in die Zukunft sein?
Und so kam es, dass ich Wochen später mit Sack und Pack auf Gut Haulensteen gelandet bin, und diese Entscheidung hat mein ganzes Leben von Grund auf verändert.
Den Flug nach New York verbringe ich trotz des komfortablen Sitzes zunächst schlaflos, denn ich bin nervös. Ob es bei der Einreise Schwierigkeiten gibt? Allein schon herauszufinden, welches Visum für mich das Richtige ist, war eine Wissenschaft für sich. Denn ich bin ja professionell unterwegs und nicht als reine Touristin, also kam das Standardverfahren für mich nicht infrage. Ich habe mich bei einem befreundeten Journalisten schlau gemacht und eine Mischung aus dem langfristigen Reise- und Arbeitsvisum beantragt und dazu gleich noch einen neuen Pass, denn der alte, der hat derartig viele arabische Stempel in den Seiten, dass sie mich damit niemals reingelassen hätten.
Nach einigen Wochen erhielt ich endlich Nachricht und wurde nach Berlin in die Botschaft zitiert. Es gäbe da eine Unstimmigkeit, die ich erklären müsste, hieß es im schönsten Diplomatenjargon. Da hätte ich das Projekt am liebsten abgebrochen, aber Kris hat mich dazu überredet, dennoch hinzufahren. »Mehr als Nein sagen können sie nicht, oder hast du Angst, die sperren dich ein?« Ich muss doch sehr blass gewesen sein, denn sie sprach mir Mut zu. Sie wusste ja, warum ich blass geworden war, sie kennt meine Geschichte ganz genau.
Also bin ich nach Berlin gefahren, in die amerikanische Botschaft am Pariser Platz, die etwa so aussieht wie die Stasi Zentrale des einundzwanzigsten Jahrhunderts und gesichert ist wie eine Festung. Gut, das muss sie vielleicht auch sein, aber als Besucher wird man wie ein potenzieller Selbstmordattentäter durchsucht und gefilzt.
Doch die Befürchtungen bestätigten sich nicht. Ich wurde genauer zur Art und Zweck des Aufenthaltes befragt und nach kaum dreißig Minuten wieder entlassen. Drei Wochen später hatte ich mein Visum ohne eine weitere Erklärung.
Ob das in New York auch so reibungslos klappt? Man hört ja allerlei Horrorstorys von Leuten, die 48 Stunden in der Immigration festgehalten wurden wegen solcher Lappalien. Dabei ist diese Lappalie kein Vergleich zu dem, was wirklich in meiner Vergangenheit vorgefallen ist. Wie von selbst fahren meine Hände unter die Achseln, halten fest, was dort unter dem Shirt vor den Blicken der Welt verborgen in die Haut eintätowiert ist. So eingerollt auf dem komfortablen Schlafsitz, versuche ich nicht an das zu denken, was hinter mir liegt, sondern vor mir.
Irgendwann muss ich dann doch erschöpft eingeschlafen sein, denn das Nächste, was ich mitbekomme, ist die Stewardess, die mich sanft an der Schulter rüttelt. »Ma’am, Sie müssen aufwachen. Es gibt gleich etwas zu essen. In einer halben Stunde beginnen wir mit dem Landeanflug auf New York.«
Müde reibe ich mir die Augen und tapse auf den Flugzeugsocken in die Toilette, um mich etwas frisch zu machen. Business Class hin oder her, nach einem Langstreckenflug sieht die Toilette aus wie Sau, denn auch die Schlipsträger bekommen es nicht hin, sich zum Pinkeln hinzusetzen, weshalb ich über die dicken Socken echt dankbar bin. Als ich zurückkomme, steht auf dem Klapptisch neben meinem Sitz bereits das Essen. Ich staune, wie schnell sie das immer hinbekommen, und lasse es mir schmecken.
Die Küste liegt im Nebel, als wir sie überqueren. Nur undeutlich kann man unten Straßen und Häuser erahnen. Zunächst die ausgedehnten Siedlungen an den Stränden, Ferienparadiese für reiche Amerikaner, doch bald wird die Besiedlung dichter. Industrie, wohin das Auge blickt, dazwischen Siedlungen und dann die ersten Hochhäuser. Amerika oder Europa, Asien oder Afrika, diese Vorstädte sehen doch alle gleich aus. Ich bin ganz froh, dass die Sicht nicht so gut ist, denn ich möchte gar nicht mehr sehen.
»Meine Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten«, meldet sich die Chefstewardess über die Lautsprecher. »Die Behörden haben eine kurzfristige Änderung der Einreiseregelungen verfügt. Meine Kollegen und Kolleginnen werden Ihnen jetzt gleich ein Formular überreichen, das Sie bitte wahrheitsgemäß ausfüllen und bei der Passkontrolle bereithalten müssen.«
Ach herrje, denke ich und nehme erstaunt das weiße Kärtchen entgegen. Weil ich Deutsche bin, bekomme ich ein ganz Spezielles. Kopfschütteln und ungläubiges Gemurmel rings um mich herum. Ja, gibt es denn so was? Nach Jahren der elektronischen Einreise schwenken sie jetzt wieder auf Karteikarten um? Wir sind hier doch nicht in Afrika! Konsterniert gehe ich die Fragen durch. War Ihr Vater oder Ihr Großvater ein Nazi? Woher soll ich das wissen, mein Vater ist nach dem Krieg geboren, und mein Großvater ist tot und hat nie darüber gesprochen. Also kreuze ich brav Nein an. Reisen Sie mit einer terroristischen Absicht in die Vereinigten Staaten ein? Nehmen Sie Drogen oder führen Sie welche ein? Als wenn ich euch das auf die Nase binden würde, ihr Idioten! Dass sie so naiv sind, so dumm! Oder arrogant? Ich kann es kaum glauben.
Um mich herum werden Witze gerissen, offenbar haben auch die Briten so ihre Probleme mit den Dingen, die sie dort ankreuzen sollen. Einer witzelt, ob sie ihre Joints nicht lieber gleich aufrauchen sollten, noch wäre genug Zeit. Die Stewardessen lächeln milde und sammeln die Kugelschreiber wieder ein. Dann müssen wir uns auch schon anschnallen und die Sitze aufrecht stellen.
Auf dem JFK Flughafen muss ich vom internationalen Terminal in den nationalen wechseln. Es ist früher Abend und bereits dunkel draußen und nebelig, sodass mir etwaige Anblicke der Skyline von Manhattan verborgen bleiben. Die Immigration ist ein richtiges Tollhaus, lange Schlangen und genervte Einreisebeamte und Passagiere, denn offenbar waren die Änderungen derart kurzfristig, dass alle nicht so recht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Einige Passagiere schreien die Beamten regelrecht an, unbeeindruckt von den massigen Wachleuten mit den Händen an den Waffen.
Die Flieger werden der Reihe nach abgefertigt und die Passagiere anhand der alphabetischen Namensfolge. Ich lese das so, dass sie verhindern wollen, dass jemand heimlich als ein anderer Passagier durchschlüpft. Da ich sehe, dass unser Flieger der fünfte auf der Liste ist, und dass jeder Flieger jeweils nur einem Doppel von Beamten zugewiesen ist, weiß ich, das kann dauern. Zumal ich mit Buchstabe R ziemlich weit hinten auf der Liste stehe. Aber ich habe ja Zeit, der Anschlussflug nach Tucson in Arizona geht erst morgen früh.
Ich lehne mich an einen Pfeiler und versuche, mich in das freie Wifi des Terminals einzuwählen, um Kris und Perri eine Nachricht zu schicken, doch das Handy, ganz neu und ultraleicht, zickt herum, und ich stecke es entnervt wieder weg.
Zu mir an die Säule gesellt sich einer der Briten aus der Business Class des Fliegers. »Oh man, das kann ja dauern«, seufzt er.
Da wir nichts anderes zu tun haben und er nicht so aufdringlich wirkt wie der andere in Heathrow, kommen wir ins Gespräch. Er erzählt mir, dass er mit seiner amerikanischen Frau und den Kindern in New York lebt, aber immer noch seinen britischen Pass hat. Normalerweise kein Problem, denn die Daueraufenthaltsgenehmigungen werden entsprechend abgefertigt, aber jetzt hängt er wie alle Ausländer in dieser Prozedur fest.
»Ach, bekommt man bei der Heirat nicht automatisch die doppelte Staatsbürgerschaft?«, frage ich verwundert und beobachte die wenigen Amerikaner, die gelassen an der langen Schlange vorbeigehen und zu den automatischen Scannern für US Citizens, ganz wie wir das in der EU mit unseren Bürgern auch machen.
Nein, bekommt man nicht, den kann man erst nach Jahren beantragen, was er aber nie getan hat, er wollte nicht. Was ich gut verstehen kann. Er erzählt mir ein wenig von dem Leben in New York und was er von den Amerikanern dort hält, ich erzähle ihm ein wenig von meiner Reise durch den Südwesten Englands und wie nett ich die Leute dort fand, was ihn sehr erfreut, und darüber, was ich auf dieser Reise vorhabe, was ihn einigermaßen beeindruckt. Er gibt mir ein paar Tipps, wie ich mir im Terminal am besten die Nacht um die Ohren schlagen kann, und wir reißen noch ein paar Witze auf Kosten der dämlichen Einreiseformulare der Amerikaner, dann springt die Anzeige über einer Box, besetzt mit zwei großbusigen Afroamerikanerinnen, auf unseren Flieger um. Es geht los. Ich bin schlagartig nervös, kann das aber gut verbergen vor dem Briten. Als sein Name aufgerufen wird, wünscht er mir viel Erfolg und winkt mir zum Abschied zu.
M, N, O... als P aufgerufen wird, marschiert mein Freund aus Heathrow zum Schalter. Ach herrje, der sieht aus, als stünde er völlig unter Dampf, denke ich und lausche, wie er die Beamtin anraunzt, warum das so lange dauert und was das soll und überhaupt. Ich schüttele nur den Kopf und rolle mit den Augen, was die andere Beamtin sieht. Ihr strenges, finsteres Gesicht wird einen winzigen Moment etwas freundlicher, und sie zwinkert mir unmerklich zu.
Sie schaut auf ihre Liste. »Räymän!«, ruft sie. Damit bin dann wohl ich gemeint. Mittlerweile ist der Bereich in der Immigration recht leer geworden, sodass ich mich nicht mehr durch die Menge nach vorne schieben muss. Ich trete an den Schalter und reiche ihr die Unterlagen durch. Sie scannt alles, geht die Fragen auf dem Kärtchen durch, macht einige Eingaben in ihrem Computer. Nebenan führt sich mein Freund aus Heathrow ganz unmöglich auf und dampft schließlich ab, ohne sich zu bedanken, als er seine Unterlagen zurückerhält.
»Was für ein Arschloch«, grummelt die andere Beamtin und trinkt einen Schluck aus ihrer Colaflasche. Das sollte sie mal lassen, denn sie ist wirklich ziemlich dick.
Ich lehne mich bequem an den Schalter. »Der ist ein ganz widerlicher Typ. In Heathrow hat er versucht, mich anzubaggern. Da hatte er schon ziemlich viel intus. Igitt.«
»Oh, really?« Beamtin Cola zieht die Augenbrauen hoch und trinkt noch einen Schluck. Ich sehe in Gedanken die Zuckerstückchen ihren Hals hinunterpurzeln.
»Männer sind doch alle Schweine«, murmelt meine Beamtin, während sie weiter konzentriert auf ihren Bildschirm starrt.
»Oh yeah, Baby!«, gluckst die andere dieses tiefe kehlige Lachen der Afroamerikanerinnen und wackelt ein wenig mit ihrem umfangreichen Busen. Aber nur ganz unauffällig. Offenbar ist ihnen Fröhlichkeit im Dienst nicht erlaubt. Dann wird ihre Miene wieder unbeweglich, und sie schaut auf die Liste und ruft den nächsten Kandidaten auf.
Der Computer meiner Beamtin piepst, eine Fehlermeldung. Sie zieht überrascht die Augenbrauen hoch. Oh nein, jetzt ist es passiert, doch ich bleibe äußerlich gelassen. »Gibt es ein Problem?«
»Hmm, hier steht, dass Ihr Visumsantrag einer genaueren Untersuchung unterzogen worden ist. Warum?«
»Ach, so.« Ich winke ab und erzähle ihr von dem Besuch in der berliner Botschaft.
»Und wegen so ‘nem Scheiß lassen die Sie extra nach Berlin fahren? Haben die kein Telefon?« Ungläubig schüttelt sie den Kopf.
»Tja, was soll ich machen«, zucke ich mit den Schultern und erzähle ihr freiwillig, warum ich in die USA reise. Danach muss sie eh fragen. Sie schaut mit großen Augen auf die doch sehr merkwürdig aussehende Kameratasche.
»Sie ganz allein? Die Wüste ist verdammt groß«, meint sie mit dem Respekt einer echten Stadtpflanze vor der ach so gefährlichen Natur. Bei ihrer Figur bewegt sie sich bestimmt nicht viel draußen. »Glauben Sie, dass das 90 Tage Visum reicht?«, fragt sie zweifelnd mit Blick auf das offene Rückflugticket.
»Keine Ahnung«, erwidere ich. »Kommt auf das Wetter an. Sonst muss ich halt verlängern.«
»Ach, wissen Sie was, wir machen gleich 120 Tage draus, dann haben Sie damit keinen Ärger und können in aller Ruhe unser schönes Land fotografieren. Und hinterher kommen Sie hierher und zeigen uns die Bilder, bevor Sie wieder nach Deutschland fliegen.« Sie macht die entsprechenden Eintragungen und reicht mir die Unterlagen zurück. Ich bedanke mich artig und wünsche den beiden einen schönen Feierabend, wofür sie sich schon sehr viel fröhlicher bedanken. Mit weichen Knien gehe ich an den grimmig dreinschauenden Wachleuten vorbei zum Ausgang. Geschafft! Ich gehe durch die Türen und bin drin. United States of freaking America!
Am nächsten Morgen sitze ich erschöpft an einem Fensterplatz in der Business Class des Fliegers nach Tucson. Die Nacht ist ein ziemlicher Albtraum gewesen. Anstatt einige Dinge auf meiner ToDo-Liste abzuhaken, zum Beispiel amerikanische Sim Karten und Datenraten für das Handy und Ultrabook zu kaufen und zu installieren und anschließend gemütlich in irgendeiner Ecke etwas Schlaf suchen zu können, gibt es einen Feueralarm. Alle müssen den Terminal verlassen. Feuerwehr und Polizei überall. Fröstelnd stehen wir draußen in der Kälte und warten, dass wir wieder rein können. Ich staune darüber, wie viele Einsatzfahrzeuge vorfahren und die große Anzahl an Feuerwehrleuten, die in den Terminal strömten. Doch dann fällt mir der katastrophale Flughafenbrand in Düsseldorf vor einigen Jahren ein und die ewigen Brandschutzdiskussionen vom BER. Sie werden wohl ihre Gründe für dieses Aufgebot haben. Unruhig sehe ich den Männern und Frauen in ihrer schweren schwarzgelb gestreiften Schutzkleidung hinterher. Hoffentlich passiert ihnen nichts!
Als wir dann endlich wieder reindürfen, entdeckt mich unglücklicherweise Heathrow in der Menge und beschließt, mich mit seiner ungeteilten Aufmerksamkeit zu beglücken. Also bin ich die restliche Nacht auf Achse, immer auf der Flucht vor dem aufdringlichen Gesellen. Zum Glück sitzt er jetzt nicht in diesem Flieger, darauf habe ich geachtet!
Als wir abheben, ist die Sicht wesentlich besser als am Vortag. Ein schöner klarer Wintermorgen. Die Maschine dreht eine große Schleife, bevor sie nach Südwesten einschwenkt, und der Pilot macht eine Durchsage, dass man auf meiner Seite einen fantastischen Blick auf die Skyline von Manhattan, die Freiheitsstatue und so weiter hätte. Alle lehnen sich herüber, auch mein Sitznachbar. Ich biete ihm meinen Platz an, denn er hat sein Smartphone gezückt und fuchtelt mir damit unangenehm dicht vor dem Gesicht herum. Er bedankt sich begeistert, während ich mich auf den innen liegenden Platz zurückziehe. Ich mag dort nicht hinausschauen, mag nicht die Südspitze von Manhattan sehen. Dies ist einer der wenigen Momente, bei dem die Kamera ganz bewusst in der Tasche bleibt. Denn ich sehe dort nicht die glitzernden Hochhäuser, sondern nur Trümmer und Asche. Und die Geister der Toten. Verdammt, warum gab es keinen Flug über Washington oder einen der anderen großen Flughäfen? Warum ausgerechnet hier? Ich weiß keine Antwort darauf.
Ich muss doch sehr blass geworden sein, denn später erkundigt sich die Stewardess besorgt nach meinem Befinden. Doch ich winke ab, erkläre meine Blässe mit Müdigkeit. Nach dem Frühstück ziehe ich den Sonnenschutz herunter, tue mir Ohrstöpsel in die Ohren und falle binnen Sekunden in tiefen Schlaf.
Über Tucson gibt es nicht viel zu berichten. Eine amerikanische Stadt halt, gesichtslos, ein wenig Wildwest mit Indianer Folklorechichi. Man merkt die Nähe der mexikanischen Grenze, ich höre viel Spanisch, und mir fallen die vielen, vielen Grenzbeamten auf, schwergewichtige Männer, bis an die Zähne bewaffnet und mit großen Jeeps unterwegs.
Ich nehme mir zwei Tage Zeit, mich zu akklimatisieren, meine Sachen zu richten, Vorräte zu kaufen. Ich habe darauf verzichtet, Lebensmittel mitzubringen, wegen der Zollformalitäten. In einer abgelegenen Ecke der Innenstadt finde ich einen Bioladen, in dem ich mich mit den Grundnahrungsmitteln eindecke. Nüsse, Müsli, Reis, Couscous und Nudeln und Trockenfrüchte. Milchpulver. Tee. Für den Rest muss leider der übliche Convienience Store herhalten, und dort ist wie befürchtet die Auswahl an gesunden Lebensmitteln eher beschränkt. Also wähle ich das kleinste Übel aus Tütensoßen und YumYums, den asiatischen Nudelsuppen, die unschlagbar leicht sind und doch so gut sättigen.
Die Touristeninformation ist natürlich Pflicht, denn nur dort kann ich mich über kurzfristige Änderungen von Öffnungszeiten einiger Parks, gesperrte Wege und etwaige Permits erkundigen. Doch es ist absolute Nebensaison und die Parks fast völlig verlassen, kein Problem, die Permits für die Übernachtungsplätze in den Nationalparks zu bekommen. Anfang Januar, die Amerikaner haben keine Ferien, und auf den Hochebenen ist es eisig kalt, wie man mir sagt, und sie erwarten einige Schneefälle weiter im Norden. Nur die riesigen Campingplätze rings um die Stadt sind randvoll mit Dauercampern, die das milde Klima zum Überwintern nutzen, aber um solche Plätze mache ich sowieso stets einen großen Bogen.
Ich freue mich über die Aussicht, endlich allein zu sein, sage es aber nicht laut, denn ich werde eh schon schräg genug angeschaut, eine Frau, ohne Begleitung im Winter auf Wanderschaft. Den Rest des Tages verbringe ich in der Hotelbar bei etlichen Latte Macchiatos und gehe auf dem Ultrabook die geplante Route durch. Lautlos fluchend kämpfe ich anschließend mit dem neuen Handy, endlich das Wifi und das GPS zum Laufen zu bekommen, installiere die Sim-Karten, für das Ultrabook mit unbegrenzter Datenrate, für das Handy ohne, und auch eine bekannte Wanderapp sowie das unverzichtbare Verzeichnis aller Camping- und Übernachtungsplätze der Staaten. Mit der neuen Telefonnummer und einer eigens eingerichteten E-Mail-Adresse melde ich mich bei WhatsApp und unserem deutschen Chatprovider an und schicke die Kontaktdaten nach Hause. Ein anschließendes erfolgreiches Telefonat mit Kris hebt meine Stimmung doch sehr, und ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.
Ein Ranger nimmt mich zum Eingang des nächsten Nationalparks mit. Ich sage Nationalpark, aber die Amerikaner haben tausend verschiedene Bezeichnungen für ihre Parks. National Park, Wilderness Area, National Forest, um nur ein paar zu nennen. Den Unterschied habe ich nie so richtig verstanden, und so informiert er mich ein wenig über lokale, bundesstattliche und nationale sowie private Schutzgebiete und die Reservate der Indigenen, die einen ganz eigenen Status haben. Ich höre vor allem heraus, dass es um Geld geht, Boden, Immobilien und wie man die besten Fördermittel abgreift. Das kommt mir doch sehr bekannt vor! Ich frage, ob ich die Indianerreservate betreten und durchwandern darf, und er rät mir, vorher mit den Stammesältesten zu reden, denn einige reagieren ganz schön empfindlich auf ungebetene Fremde, vor allem solche, die fotografieren. Was ich gut verstehen kann angesichts ihrer leidvollen Geschichte.
Am Eingang angekommen, erkundigt er sich, wann ich denn wieder zurückkommen will. Ich lächele nur. Gar nicht. Aber das braucht er ja nicht zu wissen. Ich bekomme noch eine Warnung mit, dass der große Zaun in letzter Zeit ziemlich durchlässig sei und einige Illegale in der Gegend. Gefährliche Gestalten, wie er voller Verachtung des weißen Amerikaners für alle Migranten meint. Ich bedanke mich, und er lässt mich ziehen.
------------
Kapitel 2
Etliche Tage später habe ich meinen Rhythmus gefunden. Die anfangs noch schmerzenden Knochen und Füße sind vergangen, und ich beginne, die Reise richtig zu genießen. Das Alleinsein, dieses sich Dahintreiben lassen, wie hat es mir gefehlt! So etwas sollte ich viel öfter machen. Schon nach wenigen Tagen merke ich, dass ich wieder mehr in mir selber ruhe, schon fast traumhaft dahinwandere. Ich schlafe wie ein Stein, genieße die Landschaft und mache Hunderte von Fotos, ein befriedigendes Gefühl. Die schönsten Bilder entstehen morgens und abends, wenn die tief stehende Sonne das Land in eine Zauberlandschaft verwandelt. Diese Stimmungen, besonders wenn am Horizont dunkle Wolken aufziehen, sind einfach unglaublich. Ich kenne die Weite der Wälder und Prärien im Norden durch eine Reise durch Kanada, aber hier, mit den vielen Bergen und den Schluchten, wirkt das Land wilder und fremd. Sicherlich, die Weite des Himmels, das hat man auch hier, aber es ist eben doch anders. An anderen Stellen ist es überraschend grün. Kakteen und blühende Landschaften, dazwischen rotgelbe Felsen, in höheren Lagen auch dichte Wälder. Einfach wunderschön!
Es ist jetzt Ende Januar, und ich bin ein gutes Stück weiter nördlich in Arizona unterwegs. Das Land steigt langsam an, ich merke es an den fallenden Temperaturen und der dünneren Luft. Die Gegend ist noch nicht so spektakulär wie weiter im Norden, wo es die tiefen Canyons und die berühmten rotgelben Felsen gibt, aber jeder Park, jede Area hat einen ganz eigenen Reiz, den ich versuche, mit der Kamera einzufangen.
Ein paar Tage in der Wildnis wechsele ich mit einem Waschtag in den Kleinstädten ab. Teilweise erwarten mich echte Absteigen mit schimmeligen Bädern, wo ich lieber auf dem Fußboden schlafe als in den durchgelegenen Betten und nach einer Nacht wieder das Weite suche, aber oft habe ich auch Glück und finde eine Farm, eine Lodge oder ein kleines B&B, sowieso die mir liebsten Unterkünfte, weil man da meistens zusammen mit der Familie wohnt. Dort bleibe ich dann in der Regel zwei Nächte und werde rund um die Uhr beköstigt und führe die nettesten Gespräche, die man sich vorstellen kann. An solchen Tagen bleibt es mir erspart, eine Bar oder ein Diner aufzusuchen und dort allein am Tisch oder am Tresen eine ziemlich kalorienreiche Mahlzeit in mich hineinschaufeln zu müssen.
Allein zu sein in einer Bar, das vermeide ich, wo es nur geht, denn das lockt in schöner Regelmäßigkeit ungebetene Aufmerksamkeit an. Frau allein unterwegs, einige Männer betrachten das als Herausforderung. Doch richtig zudringlich wird eigentlich niemand, da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt. Sei es, weil ich mir den Ehering gleich bei der Einreise an die linke Hand gesteckt habe anstatt an die rechte. Oder weil ich demonstrativ das Ultrabook aufklappe und deshalb nur abwesend und einsilbig auf Ansprachen reagiere. Außerdem setze ich mich stets in die Nähe der Bedienung hinter dem Tresen, die pfeift die ganz Zudringlichen schon zurück, wenn’s nötig ist.
Das Ultrabook ist nicht nur Schutz, ich arbeite wirklich. Fotografie bedeutet auch viel Dokumentation, die Orte, Namen, Geo-Daten und etwaige Urheberrechte wollen festgehalten werden. Dazu zwinge ich mich an diesen Abenden, auch wenn es eine echt ätzende Arbeit ist, denn nach der Reise alles zu rekonstruieren, ist nahezu unmöglich. Daneben schicke ich Kris erste Serien, fülle meine Stocks. Viel Arbeit.
Leider ist die Ausbeute an Schneefotos noch recht mager. Es schneit zwar ab und an, das ja, aber in den Niederungen taut alles sehr schnell wieder weg, wenn es nicht gleich regnet, was es nur selten tut. Es ist teilweise so warm und sonnig, dass ich die Jacke im Rucksack lassen kann. Wirklich angenehm zum Wandern, und auch in den Nächten kann ich den Schlafsack manchmal offenlassen, aber für meine Ziele nicht wirklich hilfreich. Daher mache ich mich jetzt auf den Weg nach Norden, wo die Hochebenen liegen, der Grand Canyon und die fantastischen Felsenwelten an der Grenze zu Utah. Aber bis dahin dauert es noch eine ganze Weile.
Diese Nacht schlafe ich in einem Motel. Da bin ich immer ganz besonders vorsichtig, verbarrikadiere Fenster und Tür, so gut es geht. Ich möchte nicht mitten in der Nacht aufwachen und einen Unbekannten über mir stehen sehen, und diese amerikanische Leichtbauweise trägt dazu bei, sich nicht allzu sicher zu fühlen. Am Morgen packe ich erleichtert meine Sachen zusammen, alles gewaschen und trocken.
Der typische Abend in einem Motel sieht so aus: die schmutzigen Sachen durchgewaschen, dann möglichst fest in die Motel-eigenen Handtücher eingedreht, sodass die meiste Feuchtigkeit bereits rausgepresst wird. Dann eine Schnur gespannt, Klimaanlage auf Vollgas, und wenn ich vom Essen zurückkomme, sind die meisten Sachen bereits trocken, wenn auch das Zimmer eine eisige Höhle oder die tropische Hölle ist, je nachdem. Energieverschwendung pur, aber ich habe das Zimmer ja bezahlt.
Da ich erst gestern Abend eingetroffen bin, hatte ich noch keine Zeit, das Tourismusbüro zu besuchen. Wie so oft in solch kleinen Käffern gibt es auch hier keine richtige Touristeninformation, sondern im Rathaus findet man alles auf einem Haufen: die Stadtverwaltung, das Büro des Sheriffs und eben jenen Tresen, einen Ständer mit Broschüren, eine Karte an der Wand und eventuell einen freundlichen Menschen, der einem weiterhilft. Was oft genug der Sheriff höchstpersönlich oder einer seiner Deputies ist.
Diesmal jedoch erwartet mich eine Überraschung, ein richtiger Trekking Store, klein, aber gut bestückt. Trekking Läden sind für mich das, was für andere Frauen Parfümerien sind. Ich kann mich stundenlang in ihnen aufhalten. Und eine Menge Geld ausgeben.
Eine Frau, etwas jünger als ich, steht hinter dem Tresen, schwarze lange Haare, hohe Wangenknochen, ein bildschönes Gesicht. Sie mustert mich interessiert. »Wollfan, was?«, meint sie mit einem Grinsen.
Ich lächele zurück. »Ganz genau. Es gibt in meiner Heimat ein Sprichwort: Cotton kills.« Dass dieser Spruch aus Island stammt, dem Land aller Wollpulliträger, tut nichts zur Sache.
»Ha!« Sie lacht. »Das ist ein gutes Sprichwort. Hast du den Hoodie selbst gemacht?« Ich erlaube ihr, die gewalkte Wolle zu befühlen. Sie brummt anerkennend. Nicht zu dick, aber warm.
»Eine Freundin. Sie versteht sich auf traditionelle Wollverarbeitung und hält selber Schafe. In Deutschland.« Die Fangemeinde von Haulensteen ist groß und vielfältig, und Kris und Perri haben zahlreiche nützliche Kontakte.
»So was brauchen wir hier noch«, seufzt sie und zeigt um sich. Ihr Handrücken ist tätowiert, sehe ich, ein interessantes Muster aus Punkten und Rauten. »All dieses Plastikzeug, das taugt doch nichts. Aber da rede ich bei meinem Chef gegen Wände.«
»Nee, und nach ein oder zwei Tagen Tragen fängt es echt an zu stinken«, grinse ich, und wir lachen und fangen an zu quatschen. Sie heißt Faith und ist eine Navajo aus der Gegend, wohnt im örtlichen Reservat. Da habe ich ja gleich jemanden für meine Fragen gefunden. Ich erzähle von dem Projekt, zeige ihr ein paar meiner Bilder und die geplante Route, frage nach dem Wetter. Sie schnalzt zweifelnd mit der Zunge.
»Schöner Weg, aber der hier durch ist viel besser. Nicht offiziell. Unser Land«, sagt sie und lächelt stolz. Auf meinen fragenden Blick erklärt sie: »Die Regierung hat damals unserem Volk ein Stück Land zugewiesen, wie allen anderen Stämmen auch, ohne Rücksicht auf die ursprünglichen Siedlungsgebiete. Dieses Land hier haben wir zurückerstritten, es ist uns heilig.«
»Ah, und ihr wollt bestimmt nicht, dass da Horden von Touristen durchtrampeln«, sage ich verständnisvoll.
»Nein, und vor allem nicht, dass sie überall ihren Müll hinterlassen und uns ablichten wie seltene Tiere. Das ist echt widerlich. Einige Clans weiter im Norden verdienen damit ihr Geld, mimen die bösen Indianer. Bauen Casinos. Für mich ist das wie Hurerei. Zumal dies unser Stammesland ist und nicht irgendein zugewiesenes Reservat.«
»Das kann ich gut verstehen. Mir sind diese ganzen Selfie-Horden und Busgruppen auch zuwider.« Ich erzähle ihr ein wenig, wie Kris und ich arbeiten, und dann: »Ich habe ein Mantra: Ich fotografiere niemals fremde Menschen, auch nicht mit ihrer Erlaubnis. Das ist, als würde man ein Stück ihrer Seele einfangen und mitnehmen. Ich würde es bei mir nicht wollen, und deshalb mache ich es auch nicht bei anderen. Wenn ich Menschen fotografiere, dann nur Freunde und Familie, weil ich den Augenblick mit ihnen festhalten und ihnen schenken will.«
Einen Moment schaut sie mich sinnierend an. Dann dreht sie sich um, geht zur Zwischentür, die in die Verwaltung hinübergeht, zieht sie auf. »Hey, Al, komm mal her!«, ruft sie in den Gang.
Nach einigen Augenblicken stapft ein Deputy herein, ein schwergewichtiger, riesengroßer Kerl und ganz offensichtlich von ihrem Volk. »Mein Bruder. Sieht man nicht, was?«, sagt sie und grinst, als ich den Mund aufreiße. Denn sie ist ausgesprochen schlank und sportlich.
»Freut mich«, bringe ich ächzend hervor, als meine Hand in seiner Pranke verschwindet und fast zerquetscht wird.
»Sanna ist Fotografin und macht echt coole Fotos«, fängt sie an und wechselt dann in ihre Stammessprache, spricht eindringlich auf ihn ein. Ich warte geduldig. Er brummt etwas, mustert mich aus seinen braunschwarzen Augen. Sie redet weiter auf ihn ein. Er verzieht das Gesicht, kraust die Nase. Merkwürdig sieht das aus. Dann wendet sie sich an mich. »Wir planen, hier ein Kulturzentrum aufzubauen, ein richtiges, keine Folklore. Aber dazu brauchen wir Fotos, wirklich gute professionelle Fotos von unseren heiligsten Bergen und von der Gegend für gerahmte Bilder, Poster und so. Nur kostet ein Profi sehr viel Geld, und das haben wir nicht. Wärest du vielleicht bereit, uns zu helfen?«
»Läuft denn der Pfad an euren heiligen Bergen vorbei?«, frage ich und schaue interessiert auf die Karte.
»Oh ja. Wir könnten dir die Stellen markieren, wo du einen guten Blick hast.« Faith schaut mich hoffnungsvoll an. Da ich weiß, was professionelle Fotografen und die Lizenzgebühren kosten, wundert mich diese Bitte nicht. Das Geld ist knapp in dieser Gegend, das sieht man schon an den verfallenen Häusern einfachster Billigbauweise, und in den Reservaten ist es meist noch ärmlicher.
»Ich bin keine typische Profi-Fotografin«, gebe ich zu bedenken. »Und unsere Arbeit ist eher künstlerischer Natur. Aber ich kann es gerne versuchen, und ich will dafür auch kein Geld haben. Wenn euch die Fotos nicht gefallen, nehmt ihr sie einfach nicht. Im Gegenzug dafür erlaubt ihr mir, von der Gegend da oben Bilder zu machen. Wir werden keine heiligen Stätten für unsere Arbeiten verwenden, das verspreche ich. Also muss mir hinterher jemand helfen, die entsprechenden Bilder auszusortieren, die ich dann euch ausschließlich überlasse. Ein paar der Übrigen nehmen wir ausschließlich für unsere Werke, und der unbedenkliche Rest geht im Stock auf, und ihr könnt sie für Poster und Postkarten verwenden. Aber eines sollte euch klar sein: Ich lehne es grundsätzlich ab, meine Fotos farbtechnisch nachzubearbeiten. So etwas mache ich nicht. Diese bonbonfarbenen, überzeichneten Google Hintergrundbilder werdet ihr von mir nicht bekommen. Ich nehme die Dinge auf, wie sie wirklich sind, und verfälsche sie nicht.«
»Hmm«, macht Deputy Al und wechselt einen Blick mit seiner Schwester.
»Das zu verhandeln, steht uns eigentlich nicht zu«, sagt sie vorsichtig.
Er nickt und seufzt dann. »Kommen Sie mit. Wir reden mit unserem Vater.«
Wir fahren in seinem riesigen Polizeijeep in eine Gegend, wohin sich bestimmt kein Tourist verirren würde. Große Schilder an der Zufahrtsstraße, kein Zutritt für Fremde. Es geht bergauf. Er brettert mit lautem Geschepper über etliche Viehgatter hinweg. Krüppelhafte Bäume bewalden die Hänge. Dann eine Ansammlung von halb verfallenen Hütten, kaputte Fahrzeuge und Schrott überall. Ärmliches Amerika, wie es schlimmer kaum geht. Doch als wir in die Mitte der Siedlung kommen, wird es etwas besser. Einige Häuser sind Rundbauten aus Holz und Lehm, teilweise auch aus modernen Materialien und noch recht neu. Vor einem solchen hält er an. Vor der Tür in einem Schaukelstuhl sitzt ein älterer Mann mit einem Gesicht wie gemeißelt. Er fängt an zu lächeln, als er uns sieht, und hebt die Hand.
Ich werde vorgestellt und hineingebeten. Sie erklären mir, dass dieses Haus ein sogenannter Hogan ist, die traditionelle Behausung der Navajo. Drinnen ist jedoch Schluss mit Tradition. In einem einzigen Raum ist alles untergebracht, Schlafstätte, Sitzgelegenheiten, ein Ofen in der Mitte mit Rauchabzug und ein ganz stinknormaler Küchenblock, wo wir uns an den Küchentisch setzen. Der Deputy höchst persönlich kocht uns einen Tee, während sein Vater, der Stammeschef, und ich uns unterhalten. Er ist sehr interessiert, fragt nach meiner Heimat, wo ich herkomme, und was ich so mache. Ich betone, dass mir an alten Dingen sehr viel liegt, dass ich die Schönheit der Natur schätze und respektiere und sie auf meine Weise ehren will.
Die beiden fangen an zu lachen und winken ab. »Kein Grund, einen solchen Eiertanz aufzuführen«, gluckst der Vater.
»Dass Sie keine von den typischen Touristen sind, das merkt man schon daran, wie Sie sich geben, verhalten«, fügt der Deputy hinzu.
Ich werde ein wenig verlegen, und der ältere Mann tätschelt mir die Hand. Und dann fängt er an, mit mir zu feilschen, dass mir Hören und Sehen vergeht. Von wegen, rückständige, ärmliche Ureinwohner! Der ist mit allen Wassern gewaschen und weiß genau, was er will. Er war es, der dieses Land für die Navajo – oder Diné, wie sie sich selber nennen - zurückerstritten hat. Teils von den Apachen, die eigentlich in dieser Gegend wohnen, teils von der Regierung.
Aber ich weiß auch, was ich will, und verhandeln, das habe ich von der Pike auf gelernt. Ich erkläre ihm den Unterschied zwischen den Bildern, die ich in den Stock lade, die also im Netz nach Bezahlung für jedermann zugänglich sind, und denjenigen, die ausschließlich Kris für ihre Werke verwendet. Denn diese landen nie im Stock, da hat sie hält die Rechte drauf. Außerdem erkläre ich ihnen den Unterschied zwischen den Foto Formaten RAW und JPEG und dass ich die JPEGs nicht benutze, da sie immer eine Umwandlung bedeuten, dass die Elektronik der Kamera die Bilder verändert, um das JPEG erzeugen zu können. Ich fotografiere ausschließlich im RAW Format, muss aber, damit sie die Bilder für ihre Zwecke nutzen können, im JPEG liefern. D.h. ich mache die Umwandlung selber, was ein wenig Arbeit bedeutet und daher Zeit kostet, aber die bin ich gerne bereit zu investieren.
Und so treffen wir eine Vereinbarung, mit der wir alle leben können. Innerlich führe ich einen kleinen Freudentanz auf. Ich darf einen wirklich unbekannten Pfad betreten, sie bekommen die Fotos für ihr Kulturzentrum. Wenn das keine Win-Win Situation ist! Wir vereinbaren, dass ich in ein paar Tagen am nördlichen Ende des Weges zu einem Ort namens Harper’s Creek gehe, wo ein Cousin von ihm wohnt und der mir helfen wird, die Fotos zu sortieren. Wir tauschen Kontaktadressen aus, er holt seinen Laptop, schreibt mir eine E-Mail und kopiert seinen Cousin mit ein, und ich bestätige. Mittlerweile sind wir beim Du angekommen, und ich unterhalte mich angeregt mit Joe und Al, Vater und Sohn.
»Wie sieht es denn mit deiner Ausrüstung aus? Hast du alles für einen Wintermarsch durch die Berge?«
Ausrüstungstechnisch bin ich auf dem besten Stand, da kann ich sie beruhigen, doch sie empfehlen mir, auch Schneeschuhe mitzunehmen, etwas, das ich nicht in meinem Reisegepäck habe, weil zu voluminös. Also fährt mich Al noch einmal zum Laden seiner Schwester, und sie zeigt mir ein Modell aus Karbon, dem Material, das die Herzen aller Ultralight Backpacker höherschlagen lässt. Der Preis aber auch. Aber was soll’s, den Rat der Einheimischen soll man beherzigen, und so kaufe ich die Dinger. Beim Bezahlen fällt mir dann siedend heiß etwas ein.
»Ach, verdammt, das habe ich euren Vater ganz vergessen zu fragen. Neben euren heiligen Stätten habt ihr doch sicherlich auch alte Grabstätten, Totengründe, die ihr vielleicht auch speziell kennzeichnet, oder? Ich möchte sie nicht betreten und damit ein Tabu brechen.« Nein, das möchte ich auf keinen Fall, und ich habe bereits in den wenigen Wochen gelernt, dass jeder Stamm oder Teil eines größeren Stammesverbandes seine eigenen Symbole und Orte dafür hat. Dass ich ganz bewusst danach frage, hat mir bereits etliche Türen geöffnet. Das tut es bereits seit Jahren, es ist in fast allen Ländern mit Stammesbevölkerung dasselbe. Dass meine wahren Gründe jedoch ganz andere sind, behalte ich tunlichst für mich.
Die beiden wechseln einen Blick. »Du solltest mit der Großmutter reden. Sie weiß das am besten«, sagt Al, schaut auf die Uhr und seufzt. Er ist schließlich im Dienst.
»Ich habe gleich Mittagspause, ich bringe dich hin«, sagt Faith, und so fahren wir eine halbe Stunde später ans andere Ende der Siedlung, wo in einem schmucklosen Betonkasten das Pflegeheim der Gegend untergebracht ist.
Faith steigt aus und schaut grimmig. »Wenn ich mal alt werde, werde ich mich eher in den Canyon stürzen als so zu enden«, sagt sie zu mir.
Ich nicke mitfühlend. »Diese Altenheime unterscheiden sich nicht wirklich, das ist überall auf der Welt gleich.«
»Wir hätten Großmutter ja gepflegt, aber sie wollte es nicht, wollte keine Last für uns sein. Hat halt nen Dickschädel, wie alle in der Familie. Außerdem sind alle ihre Freundinnen hier, die haben eine richtige WG gegründet.« Sie schaut etwas fröhlicher und führt mich ins Haus.
Die alte Frau besteht nur noch aus Runzeln in dem dunklen Gesicht. Sie freut sich sehr, ihre Enkelin zu sehen, und als diese auch noch interessanten Besuch mitbringt, ist der Tag für sie gerettet und ihre Mitbewohnerinnen gleich mit. Ich werde bemuttert und gelöchert, dass mir Hören und Sehen vergeht und der Nachmittag noch dazu. Meine Pläne, heute noch aufzubrechen, schwinden dahin, aber das ist nicht schlimm, denn die Frauen bieten mir einen unerwarteten Schatz aus Geschichten über die Gegend, die wohl kein Tourist sonst zu hören bekommt. Das sollten sie in ihrem Kulturzentrum festhalten, Audible History, also mündliche Überlieferung in Ton festgehalten. Ich beschließe, Faith das vorzuschlagen.
Als ich nach einiger Zeit, da ist Faith schon lange wieder losgefahren, weil ihre Pause vorbei ist, mein Anliegen vorbringe, bemerke ich, wie die alte Dame mich mit intensivem Blick mustert, einem viel zu intensiven, wissenden Blick, unter dem mir ganz unwohl wird. Auf einmal sagt sie etwas in ihrer Stammessprache, und die anderen verstummen. Sie schaut mir in die Augen. Ihr Blick schimmert. Dann hebt sie die Hände und legt sie an meine Schläfen. Ihre Linke ist tätowiert in demselben Muster wie bei Faith auch, erkenne ich jetzt, kaum zu sehen unter all den Runzeln und Altersflecken. Ich sitze ganz still. Sie sagt etwas in ihrer Sprache, ein leiser Singsang. Ich versinke fast in ihrem Blick, bin wie hypnotisiert. Dann sagt sie auf Englisch: »Du bist eine, die eine Brücke schlägt. Warum leugnest du, was du bist?«
Ich fahre keuchend zurück. »Ich...« Ich muss schlucken. Räuspere mich. »Das tue ich nicht.«
»Nein?« Sie lächelt wissend, und ich senke ermattet den Kopf.
»Nein. Ich bin nur vorsichtig.«
»Hast du Angst davor?«, fragt sie behutsam, und als ich aufblicke, ist der unheimliche Blick fort und sie schaut mich mitfühlend an. Ich nicke unmerklich.
»Ach, Kind.« Sie tätschelt meine Hand, und die anderen Frauen, bisher stumm, brummen mitfühlend. »Hab keine Angst davor. Dir wird nichts geschehen. Denn du trägst das Gute, das Leben in dir.« Sie guckt auf mein aufgeschlagenes Notizbuch, wo schon viele Skizzen verewigt sind. »Die Orte, die brauchst du doch gar nicht vorher zu wissen. Du spürst es auch so.«
Ich lächele matt. »Nein, die sind nur ein Andenken an diese Reise und eine Überzeugungshilfe. Würden Sie mir diese trotzdem aufmalen?«
Da kichern die alten Frauen los, umarmen mich und tun mir den Gefallen. Als ich eine halbe Stunde später aufbreche, ist mir etwas leichter ums Herz. Zu Fuß laufe ich in den Ort zurück und erreiche die Stadtverwaltung gerade, als Faith den Laden schließen will. Draußen wird es dunkel, und ich habe keine Unterkunft für die Nacht. Schöner Mist, wieder in dieses muffige Motel.
»Nichts da, du kommst mit zu mir!«, bestimmt Faith, als sie von meinem Dilemma hört. »Du willst doch eh von da oben loswandern, dann bist du morgen früh gleich vor Ort.« Und so fahre ich zum dritten Mal an diesem Tag die Strecke, die sonst kein Tourist betritt.
Ihr Hogan steht etwas außerhalb der Siedlung, ist winzig klein und gemütlich. Sie entschuldigt sich für den fehlenden Platz, doch den Zahn kann ich ihr gleich ziehen, denn das Backhaus, das ist noch enger. Es fasziniert sie, so wie es mich fasziniert, etwas aus ihrem Leben zu erfahren. Die halbe Nacht verbringen wir mit Erzählen und leeren dabei etliche Kannen Tee. Im Reservat und selbst im Supermarkt in der Stadt gibt es keinen Alkohol, wofür sie sich entschuldigt, doch ich winke ab, trinke eh so gut wie nie. Begeistert nimmt sie meinen Vorschlag mit den Geschichten der alten Frauen auf, und wir überlegen, wie das Kulturzentrum zu etwas ganz Besonderem werden kann. Meine Reiseerfahrungen zapft sie dabei gerne an, und ich gebe ihr zahlreiche Ideen aus aller Herren Länder. Irgendwann aber schlafen wir fast ein und beschließen, zu Bett zu gehen. Ich nächtige auf dem Sofa und wache am Morgen etwas steif auf, weil es so durchgesessen ist.
Nach einem herzhaften Frühstück bringt sie mich zu Fuß zum Beginn des Pfades in die Berge. Wir begegnen keinem Menschen, die Siedlung ist hinter den Bäumen verborgen. »Sei vorsichtig«, sagt sie zum Abschied und umarmt mich. »Es ist ein Fremder in der Gegend, jemand, der nicht hierhergehört. Wir haben Spuren gefunden. Den Männern gefällt das nicht. Mein Vater hat allen von dir erzählt, sodass du nichts zu befürchten hast, aber pass trotzdem auf.«
Aber der andere?, frage ich mich, als ich ihre Umarmung erwidere. »Das werde ich. Ich bin nicht wehrlos. Wir hören in ein paar Tagen voneinander.« Ich hebe die Hand zum Abschied, und sie läuft in die Siedlung zurück. Dann drehe ich mich um, atme tief durch und sehe auf den Pfad, der sich vor mir durch das Gebüsch schlängelt. Jetzt fängt meine Reise erst richtig an, das spüre ich.
-----------
Kapitel 3
Ich bin wirklich allein. In den anderen Parks war ich ab und an noch einem anderen Wanderer oder Spaziergänger begegnet, doch hier ist absolut niemand. Stammesland. Der Weg eher ein unscheinbarer Trampelpfad, oft auch gar nicht zu erkennen. Ich behalte den roten Punkt meines Standortes in der Karte der Wanderapp genau im Auge. Faith hat mir die GPS Punkte der Route gestern Abend überspielt und ich sie in die App geladen, sodass ich genau on Track bin.
Das Gelände steigt an, die Bäume werden zahlreicher und größer. Pinien und Kiefern hauptsächlich, ihr Duft begleitet meinen Weg. Es wird kälter, immer noch sonnig, aber der Wind frischt auf. Es passt zu der Stimmung, zu den dahinjagenden Wolken unter der Wintersonne. Den ersten der heiligen Berge erreiche ich am späten Nachmittag. Die Sonne senkt sich gerade gen Horizont, ein wirklich schönes Licht. Und da, dort blitzt es weiß zwischen den Bäumen auf. Mit einem Jubelruf laufe ich los. Endlich Schnee! Der Wald bleibt zurück, ich betrete ein kleines Plateau. Vor mir liegt ein Bergpanorama aus wild gezackten Felsen. Die Sonne lässt die Felsen rötlich gelb leuchten und dazu den Schnee glitzern wie verrückt. Jetzt hält mich nichts mehr. So schnell hatte ich das Stativ noch nie aufgebaut, denn das Licht, es wird schwinden. Jeder Moment ist einzigartig und wird nie wieder genauso erscheinen wie jetzt.