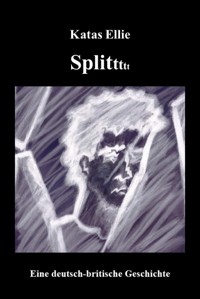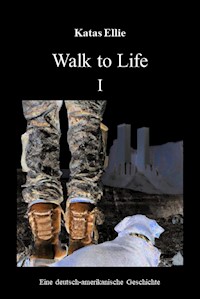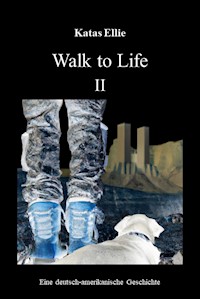
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Stunde der Wahrheit ist für Sanna gekommen: Nun muss sie ihre Verbindung zu den Attentätern des 11. September offenlegen. Dies bringt alles in Gefahr, was Sanna in den vorherigen Wochen und Monaten erreicht hat, vor allem ihre Daseinsberechtigung in den USA. Wie kann sie dies ihren Freunden erklären, jenen Menschen, die so grausame Dinge erlebt und so furchtbare Verluste durch die Anschläge erlitten haben? Und was werden die Behörden tun, wenn sie davon erfahren? Wird es für Sanna einen Weg aus dieser Falle geben, ohne dass sie ihre Freiheit und alles, was ihr lieb und teuer ist, verliert?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katas Ellie
Walk to Life
II
Eine deutsch- amerikanische Geschichte
Impressum
Texte:© 2023 Copyright by Katas Ellie
Umschlag:© 2023 Copyright by Katas Ellie
Inga Rieckmann alias Katas Ellie
c/o Block Services
Stuttgarter Str. 106
70736 Fellbach
https://www.facebook.com/Katas.Ellie
Veröffentlicht über Epubli - ein Service der Nepubli GmbH, Köpenicker Strasse 154a, 10997 Berlin
Kapitel 1
Die Feuerwache in Page, Arizona
Mit hämmerndem Herzen und schmerzendem Kopf hocke ich in der Toilettenkabine und weiß weder ein noch aus. Mir ist eiskalt, ich zittere regelrecht. Verdammt, wo habe ich mich da nur reingeritten? Wie hatte es soweit kommen können? Und warum nur kann ich meine Klappe nicht halten?!
Draußen geht die Tür. »Sanna?« Mo kommt herein, klopft an die Kabinentür.
»Ich lebe noch«, krächze ich. Unter Aufbietung all meiner Kraft schaffe ich es, mich hochzustemmen und die Tür zu öffnen. Mos Blick ausweichend, gehe ich zum Waschbecken und wasche mir das Gesicht, spüle mir den Mund aus.
»Geht es?«, fragt sie und reicht mir ein Handtuch.
Immer noch hämmert mein Herz wie verrückt. Mein Gesicht ist bleich, ich erkenne es kaum wieder im Spiegel. Am liebsten wäre ich davongelaufen, hätte mich verkrochen. Doch das geht nicht. Sie warten draußen, erwarten eine Antwort.
»Oh je, das muss dir ja wirklich an die Nieren gegangen sein. Hast ne Menge Scheiß über 9/11 im Netz gesehen, was?« Sie drückt mich tröstend.
Hast du eine Ahnung! »Sei so gut und koche mir einen starken Tee, ja? Mit viel Zucker drin. Ich komme gleich. Tut mir leid um euer schönes Essen, wirklich.« Nur zögernd lässt sie mich allein, und ich höre durch die geschlossene Tür die Stimmen der anderen, wie sie nach mir fragen.
Vielleicht ist es besser so. Raus damit, dann kannst du die ganze Sache hinter dir lassen, einschließlich Tom, einschließlich der Jungs und dieser verrückten Geschichte. Dieser Gedanke kommt mir unwillkürlich. Doch so einfach ist es nicht, und das weiß ich auch. Dafür habe ich sie einfach zu gern. Aber sie werden es danach ganz sicher nicht mehr. All meine Kraft zusammennehmend, ziehe ich leise die Tür ein stückweit auf. Im Flur ist niemand, aber ich höre die Stimmen der anderen.
»Meine Güte, so empfindlich kam sie mir gar nicht vor«, sagt Vince gerade.
»Das ist sie auch nicht«, kommt es von Tom. »Nein, sie hat Angst. Nur, wovor?«
»Vielleicht hat sie ja jemanden bei den Anschlägen verloren«, mutmaßt Geoff.
»Das wird sie uns hoffentlich gleich erklären.« Das ist der Chief.
Oh nein, dass ausgerechnet der dabei sein muss!, durchzuckt es mich, aber es nützt doch nichts.
Bei den letzten Schritten auf die Tür zum Mannschaftsraum zu überlege ich mir eine Strategie. Ganz sicher nicht werde ich mich jetzt wie auf eine Anklagebank führen lassen. Als ich den Raum betrete, verstummen alle und schauen mich an. »Du hast recht«, sage ich zu Tom und setze mich wieder auf meinen Platz. Mo kommt herein und reicht mir eine Tasse Tee.
Ich danke ihr leise, verschränke die Hände um die Tasse und schaue auf das Navajo Tattoo auf meinem Handrücken. Und da weiß ich auf einmal, wie ich es machen kann. »Ihr alle habt mich – mehr oder weniger direkt – gefragt, wie ich zu diesem Zeichen hier gekommen bin.«
Jetzt sind sie verblüfft. Damit haben sie nicht gerechnet. Die lauernde Anspannung weicht ein wenig der Neugier, und das hilft mir. »Ich bin offenbar mit einer Gabe auf die Welt gekommen. Ich kann Dinge spüren in meiner Umgebung, kaum merkbare Signale, die jeder Mensch von sich gibt. Ihr alle habt es bereits gemerkt. Körpersprache, Mimik, wie die Menschen sich ausdrücken, das kann ich alles lesen. Und offenbar auch die etwas unsichtbareren Strömungen. Keine Gedanken oder so, denkt das nicht. Die Navajo, die haben dieses Talent erkannt und mich um Hilfe gebeten bei einem ihrer Probleme, und ich konnte ihnen tatsächlich helfen. Es war ein Ritual. Dies hier ist ihr Dank und eine Ehrbezeichnung dafür.« Ich verstumme, sammle Kraft. Trinke einen Schluck Tee, lasse ihn ganz bewusst die Kehle herabrinnen.
»Aber was hat das denn mit…?« Toms erhobene Hand bringt Mo zum Verstummen. Ich mag ihn nicht anschauen, denn ich weiß, wenn ich jetzt seinem Blick begegne, dann breche ich zusammen.
Tief Luft holend und die Tasse abstellend, spreche ich weiter: »Dieses Talent war in meinen jüngeren Jahren noch nicht so ausgeprägt, es ist erst mit der Zeit stärker geworden. Nennt es Erfahrung, ich weiß es nicht. Hätte ich von Anfang an diese Stärke gehabt, dann wäre vielleicht vieles anders geworden. Denn ich bin schon einmal dem Tod begegnet.« Jetzt schaue ich Jimmy an, und er zuckt förmlich zurück. Ich bin ihm unheimlich, und wie!
»Nein, sag nicht…« Toms Hand legt sich auf meinen Arm, aber ich ziehe ihn zurück. Er ahnt es bereits, natürlich tut er das. Er weiß ja, von woher ich stamme.
Ich richte den Blick wieder auf meine Hände, auf die Tätowierung. »Ich weiß nicht, ob Tom euch erzählt hat, woher ich komme. Aus Deutschland, sicher, aber ich bin in der Nähe von Hamburg aufgewachsen, und dort habe ich auch studiert genauso wie mein späterer Mann, und wie das so ist, sind wir da auch viel auf Partys unterwegs gewesen.« Jetzt merke ich bei dem einem oder anderen die Anspannung. Der Name Hamburg lenkt die etwas mehr im Thema drin Steckenden natürlich gleich in die richtige Richtung.
Ich spreche weiter: »Ich hatte eine Kommilitonin, oder besser eine Freundin, Ariya. Sie war Kurdin und etwas ganz Besonderes, ein bildschönes Mädchen, nett, aufgeschlossen, und sie hatte eine eigene Wohnung für sich. Das war schon ungewöhnlich, denn die meisten von uns wohnten entweder noch zuhause oder in WGs, etwas anderes konnten wir uns gar nicht leisten. Sie aber war zudem noch Muslima, die wohnen für gewöhnlich so jung und unverheiratet nicht allein, aber sie tat es, es ging nicht anders, denn ihre Familie lebte in einer anderen Stadt, und sie hatte nun mal hier ihren Studienplatz gefunden. Einen Samstagabend, da rief sie mich an. Sie war ein wenig in Panik. Sie hatte zu einer Party eingeladen, nur ein paar Leute, aber offenbar hatte sich das herumgesprochen, und auf einmal kamen viel, viel mehr, als sie es beabsichtigt hatte. Heute würde man so etwas eine Facebook Party nennen.«
»Oh je«, sagt Mo. »So etwas kann übel enden.«
»Wem sagst du das«, erwidere ich. »Sie flehte uns an, ihr zu helfen, denn die Dinge begannen bereits aus dem Ruder zu laufen. Also sind wir mit unserer gesamten Clique hingefahren. Doch es war bereits zu spät. Laute Musik dröhnte durch den gesamten Block, Massen von Leuten. Wir haben uns in ihre Wohnung durchgekämpft und fanden dort ein regelrechtes Besäufnis vor. Die Mädels tanzten bereits auf den Tischen, und das nicht unbedingt sittsam bekleidet, jedenfalls nicht für Ariyas Verhältnisse. Uns war klar, wir würden das beenden müssen. Also habe ich meinen Freund und seine Kumpels losgeschickt, die Musik auszudrehen und die Leute wegzuschicken, und ich habe mich auf die Suche nach Ariya gemacht. Es gab eigentlich nur zwei Orte, wo sie sein konnte.«
Mo weiß es sofort. »Das Klo oder die Küche.« Sie ignoriert die finsteren Blicke der anderen, versucht mir offenbar zu helfen. Dafür bin ich ihr wirklich dankbar.
»Genau. Ich fand sie in der Küche. Und da war sie auch nicht allein.« Jetzt setze ich mich anders hin. Ich schlinge die Arme um meine Schultern. Eine Schutzhaltung, das ist mir klar, aber es ist mir egal, ob die anderen das sehen. Tom neben mir spannt sich gut spürbar an.
»Ihr Freund war da und noch eine ganze Reihe anderer Typen, fast alles Jungs, alles Ausländer. Günni – das ist - war ihr Freund, er heißt eigentlich Günnyar – hatte sie im Arm, und sie war das heulende Elend. Als sie mich sah, flehte sie mich an, die Leute rauszuschmeißen. Ich habe erstmal die Tür zugemacht und ihr gesagt, dass ich meine Jungs mitgebracht hätte, sie würden sich kümmern. Das ist alles die Schuld von dieser dämlichen Amerikanerin, schniefte sie, und ich wusste genau, von wem sie redete, denn das Mädel war mir schon an unserer Uni aufgefallen. Feierwütig und ziemlich aggressiv gegen alles, was nicht ihrem way of life entsprach. Überheblich, das war sie. Wie bist du denn an die rangekommen?, fragte ich erstaunt, und sie sagte, irgendjemand hätte sie mitgebracht, ganz am Anfang, und dann hätte sie angefangen, alle möglichen Leute anzurufen, vom Anschluss der Wohnung aus, auf Kosten von Ariya. Weil die Stimmung so lahm war. Ich hasse sie!, heulte sie, und ich spürte die Missbilligung um mich herum. Sorry, Mo. Soll keine Verallgemeinerung sein.«
»Nein, nein, schon gut. So etwas macht man einfach nicht, nicht auf fremden Partys. Das muss ja ein echtes Miststück gewesen sein«, sagt sie.
»Das war sie, oh ja. Drüben gab es denn auch mächtig Aufruhr, aber das haben wir ausgesperrt. ‚Ich koche dir erstmal einen Tee, und dann beruhigst du dich wieder‘, sagte ich zu Ariya. ‚Wir bekommen das schon hin.‘ Ich wollte nach einem ihrer Kräutertees greifen, da stand einer der Typen – er war der einzige, der noch ein Mädchen dabeihatte – auf und sagte: ‚Nein, nein, nicht der. Sie braucht jetzt ein Stück Heimat.‘ Und er griff zu dem arabischen Tee und zeigte mir, wie man diesen starken, süßen Tee mit Minze kocht, ein echtes Originalrezept. Das fand ich total nett von ihm, irgendwie süß. Wir kamen ins Erzählen, ich fragte ihn, woher sie denn alle stammten, denn sie sprachen zwar Deutsch, aber mit starkem Akzent. Er käme aus dem Libanon, und die anderen waren von überall her, Ägypten, Saudi-Arabien, aus aller Herren Länder. Das war ganz normal an der Uni, es war eine internationale, mein Freund hat da auch studiert und hatte viele ausländische Kommilitonen. So erzählten wir ein wenig, und ich bekam Ariya langsam wieder beruhigt. Drüben wurden die Leute jetzt weniger, und die Lage entspannte sich ein wenig.
‚Du feierst wohl nicht so?‘, fragte einer, der war mir schon vorher aufgefallen, denn er saß in der Ecke mit einer Miene, die war wie versteinert.
Ich sagte zu ihm: ‚Doch, das tue ich, aber nicht wie die da. Glaube ja nicht, wir wären alle so. Das stimmt nicht.‘
Der andere, der mir den Tee gekocht hat, guckte mich an und meinte: ‚Damit machst du dich nicht unbedingt beliebt, was?‘
Da habe ich spöttisch gelacht. Ich habe gesagt: ‚Das ist mir egal. Auf Anerkennung von einer wie der kann ich verzichten. Ich tue, was mir passt, und wenn mir die Nasen da draußen nicht gefallen, gehe ich halt woanders hin. Es leben anderthalb Millionen Menschen in der Stadt, da finden sich immer welche, die zu mir passen. So wie meine Freunde, die ich mitgebracht habe.‘
Er lachte und wollte wohl noch etwas sagen, doch in dem Moment hörten wir draußen Sirenen. Die Nachbarn hatten die Polizei gerufen. Verdammt, sagte ich, und Ariya brach wieder in Tränen aus. Von dem Typen in der Ecke kam ein kurzer, schneller Satz auf Arabisch, es klang wie ein Befehl, und sie alle standen unisono auf und verließen den Raum ohne ein weiteres Wort. Bis auf er…«
Ich halte kurz inne und schließe die Augen. Rufe mir die Szene wieder ins Gedächtnis. Ich spüre, wie sich jemand neben mir auf der Lehne des Sessels niederlässt und mir den Arm um die Schultern legt. Schlank. Parfüm. Mo.
Die nächsten Worte wollen mir kaum über die Lippen, aber es hilft ja nichts. »In der Tür drehte er sich noch einmal um. Seine Miene war nach wie vor unbeweglich, aber auf einmal war da ein Feuer in seinen Augen, es war dunkel und ließ mir irgendwie einen Schauder über den Rücken laufen. ‚Wir achten Menschen, die gegen alle Widerstände ihren eigenen Weg gehen‘, sagte er, hielt kurz inne, und dann: ‚Du solltest zu uns gehören.‘ Dann drehte er sich um und ging raus.«
»Scheiße, Sanna, das waren doch wohl nicht…«, entfährt es Sean, und Jimmy neben ihm sieht aus, als stünde er kurz davor zu explodieren. Mo hat mich längst losgelassen, als hätte sie sich verbrannt, und Tom, der hat sein Gesicht in den Händen vergraben.
»Da hast du ganz richtig geraten. Derjenige, der mir den Tee gekocht hat, das war Ziad Jarrah, der hat die Maschine in Shanksville abstürzen lassen. Flug 93. Und der in der Tür, das war Mohammed Atta. Auch genannt Atta oder Mohat. Studiert hat er aber mit einem ganz anderen Namen an der Uni. Nur wusste ich das damals noch nicht. Er war es, der deinen Vater umgebracht hat, Jimmy, als er die Maschine in den Nordturm des World Trade Centers steuerte. Es tut mir leid.«
»Verflucht noch eins, das muss…«, fängt der Chief an zu knurren, doch ich unterbreche ihn einfach.
»Pfeifen Sie ihre inneren Truppen zurück, Chief! Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, noch lange nicht«, sage ich scharf, doch ich selber werde jetzt auch unterbrochen.
»Ich will nichts mehr davon hören!«, faucht Jimmy mich an, springt auf und stürmt hinaus.
»Aber ich.« Tom packt meinen Arm, zwingt mich, ihn anzusehen. »Ich will es wissen. Weiter.« Seine Miene ist zu Stein geworden, die Augen stechend. Genau das habe ich befürchtet. Ich schlucke, und er schüttelt mich leicht. »Sprich!«
»Lass mich los, sofort!«, warne ich leise, und etwas in meinem Tonfall lässt ihn augenblicklich gehorchen. Ich rücke ein Stück von ihm ab, was Mo von meiner anderen Seite vertreibt. Sie setzt sich wieder zu Sean. »Diese Typen waren so schnell verschwunden, dass es mich gewundert hat«, fahre ich fort. »Ich machte die Tür wieder zu und fragte Ariya, wer die gewesen waren.
Und sie und das andere Mädchen, die Freundin von dem Teekocher, senkten den Kopf. ‚Das sind Günnis Kumpel, Ziad und Mohat, sagte sie, mit denen hängt er neuerdings immer öfter rum.‘
Und die andere sagte: ‚Sie haben sich verändert, seit sie Mohat kennen. Das macht mir ein wenig Angst.‘
Ich fragte sie, warum. Und sie erzählte mir, dass sie neuerdings eine Moschee auf dem Steindamm in Hamburg besuchten, eine mit keinem guten Ruf. Die meisten Kurden praktizieren eine sehr moderate Form des Islams, und sie wissen, wovon sie reden. Der Steindamm ist so etwas wie die negative Kehrseite von dem berühmten St. Pauli, er wird im Volksmund auch Kinderstrich genannt. Illegale Prostitution, Obdachlose, Drogenabhängige. Damals konnte man sich als Frau nicht alleine dorthin trauen.« Das hat sich inzwischen geändert, ich weiß es, denn das ist die Gegend, wo sich PicX herumtreibt.
Ich sammle meine Gedanken wieder und hole tief Luft. »Naja, die Party wurde dann von der Polizei aufgelöst. Ein übles Nachspiel hatte das für Ariya allemal, denn die Wohnung lief auf den Namen ihrer Familie, und so bekamen die mit, was da abgelaufen war. Das war natürlich eine Schande für die Familie. Keine zwei Tage später zogen Verwandte bei Ariya mit ein, und sie wurde fortan regelrecht überwacht. Ihren Günni, den konnte sie nur noch heimlich treffen, und auch ich verlor sie ein wenig aus den Augen. Jedenfalls… habe ich meinem Freund und seinen Kumpels auf der Rückfahrt von dieser merkwürdigen Kombo in der Küche erzählt, und einer sagte dann:
‚Die kenne ich. Die sind keine Maschinenbauer wie wir, aber jemand hat mir erzählt, die haben sich sogar einen eigenen Raum in der Uni eingerichtet. Die sollen echt radikal sein. Mitten in der Vorlesung verschwinden sie für ihre Verrenkungen.‘ Damit meinte er das Gebet. Ich hatte auf einmal ein ganz mieses Gefühl, nicht nur wegen Ariya und ihrer Freundin.«
Ich halte kurz inne, sortiere meine Gedanken. Es ist ja schon lange her. »Ich habe dir ja erzählt, dass ich gleichzeitig studiert und gearbeitet habe damals«, sage ich zu Tom. »Am Montag dann war ich wieder auf Arbeit. Meine damalige Abteilung bestand fast nur aus Frauen, und mehr als die Hälfte von ihnen war mit irgendwelchen Polizisten oder Staatsdienern verheiratet. Ich habe ihnen von der Party erzählt und diesen Typen. Die eine wurde dann auch gleich aufmerksam und hat ihren Mann angerufen. Wir haben uns in der Mittagspause mit ihm getroffen«, jetzt schaue ich den Chief direkt an, und er setzt sich ein wenig aufrechter hin, »denn die Hamburger Polizeizentrale, auch genannt das Bullenkloster, war nicht weit weg. Ich habe ihm von meinem miesen Gefühl erzählt, und er hat sich Notizen gemacht. Er fragte, ob ich das offiziell anzeigen möchte. Wie soll ich denn jemanden anzeigen, der mich einfach nur schief anguckt?, habe ich ihn gefragt. Da musste er zugeben, das wäre wohl übertrieben. Aber er würde mal eine Akte anlegen mit diesen Angaben, was er dann auch getan hat. Zwei Tage später steckte mir meine Kollegin einen Zettel mit dem Aktenzeichen zu. Das hätte dann das Ende sein können. War es aber nicht.« Ich verstumme und presse die Lippen zusammen.
»Was ist passiert?«, fragt Tom leise, auf einmal gut hörbare Besorgnis in seiner Stimme. Überhaupt ist die ablehnende Spannung im Raum ein wenig gewichen. Alle halten die Luft an.
Ich sehe ihn an. »Ich bin nach einigen Monaten Ariya an der Uni über den Weg gelaufen. Sie war vollkommen verändert, trug jetzt ein Kopftuch, war blass und abgemagert. Ich habe mich richtig erschrocken und sie gleich beiseite genommen. Sie ist in Tränen ausgebrochen und hat mir erzählt, dass Günni seit ein paar Wochen verschwunden war und mit ihm alle seine Kumpel. Angeblich eine Familienangelegenheit, aber ich habe sofort gesagt, da stimmt doch etwas nicht, so viele verschiedene Typen aus all diesen Ländern und dann alle gleichzeitig? Sie hat nur die Schultern eingezogen und ist geflüchtet vor mir.
Ich habe dann den Mann meiner Kollegin angerufen und ihm davon erzählt. Er wurde sofort hellhörig und hat sich bedankt, das wäre eine wichtige Information. Gehört habe ich dann erstmal nichts mehr, bis dann eines Tages Ariya mich anrief, in Tränen aufgelöst. Sie sagte, die Jungs wären wieder da, aber ihr Günni, der wäre nicht zurückgekommen, und sie wüsste nicht, was sie noch tun sollte. Da konnte ich ihr auch nicht helfen, denn sie war ja nicht offiziell mit ihm zusammen. Seine Familie hätte eine Vermisstenanzeige aufgeben müssen, doch Ariya hat sich nicht getraut, sie zu kontaktieren. Dann wäre ihre heimliche Beziehung aufgeflogen. Das ist in solchen Familien wirklich ein Problem. Als Mädchen hast du den Mann zu heiraten, den deine Familie dir aussucht, und ansonsten brav zuhause zu bleiben und Jungs nicht anzufassen. Nicht, dass es nicht trotzdem passiert, und das wissen auch alle, aber wenn das auffliegt, bekommen diese Mädchen echte Probleme, weil die Familie das Gesicht verliert. Das geht hin bis zum Ehrenmord, und davor hatte Ariya wirklich Angst. Ich kann das gut verstehen«, füge ich leise hinzu.
»Ist ihr denn was passiert?«, fragt Mo.
»Oh ja. Nicht das, aber die Geschichte ist nicht gut ausgegangen für sie. Aber das kam später.« Ich muss die Augen zusammenkneifen. Obwohl das so lange her ist, schmerzt es noch sehr. Ich spüre eine Berührung am Arm. Tom drückt ihn auffordernd.
»Ich habe meinen Kontakt bei der Polizei wieder angerufen, wieder hat er es sich notiert, und er sagte, er würde gerne mit Ariya sprechen. Er könne sich mal umhören. Da habe ich gezögert, ihre Nummer weiterzugeben, aber er sagte, ich könne ihr gerne seine geben, das wäre ein Diensthandy. Was ich dann auch getan habe. Ich weiß nicht, ob sie ihn angerufen hat. Unser Kontakt wurde immer seltener. Mein Freund und ich, wir wurden fertig mit dem Studium, sind umgezogen, hin nach Süddeutschland. Das ist für einen angehenden Ingenieur so etwas wie das Silicon Valley in der IT Branche. Alle großen Firmen sind da, Daimler, Bosch, BMW, Porsche, um nur einige zu nennen. Wir wohnten da gerade ein paar Monate, da rief Ariya mich wieder an. Sie musste wohl mal mit jemandem reden. Ihre Familie hätte eine Ehe für sie arrangiert, mit einem entfernten Cousin. Von Günni hat sie immer noch nichts gehört, und dann sagte sie mir, dass sie von ihrer Freundin mitbekommen hätte, dass seine anderen Kumpels gar nicht mehr in Deutschland wären, sondern hier, in Amerika, und dass sie das Fliegen lernen würden. Ich sage, wie bitte? Die hassen die Amerikaner, das war damals gut zu merken, jeder von ihnen hat das mal in einem Satz fallen lassen. Was wollen sie da drüben, und das alle zusammen? Außerdem haben die doch was ganz anderes studiert. Warum wollen sie das Fliegen lernen?«
Ich spüre, wie sich alle anspannen. Jetzt mag ich niemandem mehr in die Augen schauen. »Ich sagte zu Ariya, dass da etwas nicht stimmen würde, und dass wir das endlich melden müssten. Da ist sie in Tränen ausgebrochen. Sie hat mich angefleht, es nicht zu tun. Wenn das herauskäme, dass sie etwas mit denen zu tun hätte, dann würde ihre Familie sie umbringen. Ich war hin- und hergerissen, ich wusste ja, dass mein Kontakt bereits ihren Namen hatte. Also…«
»Also was?«, unterbricht mich Sean scharf.
»Lass sie!«, fährt Mo ihn an.
»Ich hab’s nicht getan.« Auf meine Worte stöhnt nicht nur einer auf.
»Scheiße, Sanna, das darf doch nicht wahr sein!«, ruft Vince aus.
»Wegen ihr«, fahre ich schnell fort, bevor mich noch einer unterbrechen kann. »Ich wollte nicht, dass sie noch mehr zu leiden hatte als eh schon. Aber es ließ mir keine Ruhe, und meinem Freund auch nicht. Wir haben diskutiert und diskutiert, was tun, und er sagte, wir könnten das nicht einfach auf sich beruhen lassen, und ich wusste, er hatte recht. Also habe ich einen anonymen Brief geschrieben an die Polizeidirektion in Hamburg und habe das Aktenzeichen angegeben und alles, was ich wusste. Nur ohne unsere beiden Namen. Damit sollte es genug sein. Ich habe dann nichts mehr von der Sache gehört bis zu jenem Tag. An den erinnert sich wohl jeder Mensch auf der Welt noch, als wäre es heute.«
Ich halte inne und spreche erst mit Verzögerung weiter. »Ich war auf einer Tagung mit meinen Kollegen, ein Hotel mit angeschlossenem Vergnügungspark. Wir sind dann nachmittags rausgegangen, ein bisschen Spaß haben, vielleicht etwas trinken gehen, wie man das so macht. Es war gruselig. Auf einmal war es in dem Park still. Nicht die Fahrgeschäfte, die hat man immer noch gehört. Aber die Menschen waren auf einmal fort, keine Rufe, keine Schreie, wie das sonst so ist. Als wären sie einfach… weg. Nur, dass sie bei euch in New York wirklich weg waren. Einfach ausgelöscht.« Jetzt merke ich, wie mir die Tränen in die Augen steigen. Ich sehe nichts mehr, nur Toms Berührung, die spüre ich immer noch. Seine Hand, warm und stark und fest zupackend.
»Wir wurden dann alle nach Hause geschickt, nur zur Sicherheit. Ich bin hunderte Kilometer Landstraße gefahren, bloß keine Autobahn. Niemand wusste, was als Nächstes passieren würde, denn die großen US Stützpunkte, die in Baden-Baden, Ramstein, Stuttgart, die waren ja nicht weit weg. Würden jetzt Bomben fallen, der dritte Weltkrieg? Aber es ist nichts passiert, ich kam heil zuhause an. Dann haben wir natürlich Nachrichten geguckt, wie alle auf der Welt. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wann sie das erste Mal die Fahndungsbilder brachten.«
Ich muss einen Augenblick innehalten. Das kommt alles wieder hoch. »Ich glaube, ich habe geschrien. Ich weiß es gar nicht mehr, aber meinen Freund, den hat’s förmlich umgehauen. Wir haben sofort die Kumpel angerufen, alle waren in heller Aufregung. Das ging durch die Ehemaligen der Uni wie ein Lauffeuer. Aber noch flogen wir unter dem Radar der Behörden. Das wäre wohl auch so geblieben, vermute ich, hätte nicht Ariya, diese dumme Nuss, mich ein paar Tage später angerufen.«
»Oh Scheiße«, sagt Mo da leise. »Und damit hatten sie dich?«
»Hmm… sie sagte, man hätte sie und ihre Freundin verhört. Viele Stunden lang. Sie sagte, dass ihre Verlobung geplatzt wäre und ihre Familie sie zur Strafe nach Kurdistan zurückschicken würde. Das ist in etwa so, als wenn du als New Yorker Mädchen mit einem Amish zwangsverheiratet wirst. Tiefstes, rückständigstes Land. Sie wusste weder ein noch aus, aber ich konnte ihr nicht mehr helfen. Mein Freund, der ist ausgerastet. Er sagte, wenn die sie überwachen, dann kommen sie auch zu uns. Also haben wir uns vorbereitet. Ich habe den gesamten Ablauf, die Aktennotizen und die Anrufe, einfach alles, nochmal zusammengetragen. Wir haben Zeitungen gekauft, die New York Times, Washington Post und ein paar andere und haben alles gelesen, dessen wir habhaft werden konnten, Tag und Nacht. Alles, was im Internet damals verfügbar war. Der Anruf kam dann ein paar Tage später.« Jetzt spreche ich immer schneller, denn an diesen Teil denke ich noch viel unlieber zurück als an den ganzen Rest.
»Ich wurde freundlich, aber bestimmt in die nächste US Base in Stuttgart bestellt. Wir wussten nicht, was wir davon halten sollten. Thore, das war mein damaliger Freund und späterer Mann, den hatten sie nicht bestellt. Wir waren damals noch nicht verheiratet, die Wohnung lief auf mich. Offenbar hatten sie gar nicht kapiert, dass er der eigentliche Connect zu den Attentätern war, er hat ja mit ihnen an derselben Uni studiert. Ich wolle ihn da unbedingt raushalten, er wollte nicht, dass ich alleine hinfahre. Wir hatten ja alle schon einmal diese Agentenfilme gesehen, mit den Containern in der Halle, wo dann den Befragten eröffnet wird, sie seien hier nicht mehr in Deutschland oder Amerika, sondern auf neutralem Boden, und man könne mit ihnen machen, was man wolle.«
»Du kannst doch nicht allen Ernstes glauben…«, fährt Danny auf.
»Denk, was du willst, aber ich habe es, und es stellte sich leider als allzu wahr heraus«, erwidere ich.
Ein kollektives »Waas?!« ringsherum lässt mich bitter schnauben.
»Ihr habt ja keine Ahnung! Wohl noch nie von Guantanamo gehört, was? Nur, da bin ich nicht gelandet, und dafür gibt es einen Grund. Wir haben uns abgesichert. Wir haben die Zusammenfassung unserer Fakten an unsere Freunde per Mail geschickt und in Papierform an unsere Nachbarn sowie einige Kollegen verteilt. Außerdem war just an dem Tag bekannt geworden, dass sie hier drüben bereits vor Monaten einen der Attentäter verhaftet hatten, es aber versäumt hatten, seinen Computer zu durchleuchten. Alles war da, sie hätten es nur lesen müssen. Das gab mir natürlich Rückendeckung.« Ich schweige einen Moment.
»Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den Rest hören will«, sagt der Chief da. »Es wird unser Land nicht gut aussehen lassen, richtig?«
Ich nicke nur und fange einen Blick von Tom auf, da wird mir ganz anders. Seine Hand klammert sich an meinen Arm, richtig weh tut es. Langsam ziehe ich ihn weg, und er lässt sofort los.
»Ich bin also morgens in die Base gefahren und wurde auch gleich hineingeführt, mit einem Wachmann, der war wie ein Schrank gebaut. Ein Verhörraum, fensterlos, mit einer verspiegelten Wand. Wie im Krimi. Es waren zwei Männer da, ein Deutscher und ein Amerikaner. Ihre Namen habe ich nie erfahren. Vor ihnen lagen zwei Akten, eine dünne und eine dicke. Die dünne trug mein Aktenzeichen. Sie haben mich auf Englisch interviewt, der Deutsche hat übersetzt, wenn ich mit einigen Terms nicht klarkam. Das Ganze ging über Stunden. Dieser Ami, der war ein ganz harter Hund. Eiskalt und rücksichtslos. Er hat versucht mich auszuquetschen, versucht, mir die Worte im Mund herumzudrehen, nur, dass ich das mit mir nicht habe machen lassen. Wenn es zu heftig wurde, habe ich mich einfach hinter Sprachschwierigkeiten versteckt. Ich bin einfach stur bei der Wahrheit geblieben, sie haben es nicht geschafft. Ich spürte, es ging ihm gar nicht um die Wahrheit, sondern darum, einen Sündenbock für diese ganze Geschichte zu finden. Nach Stunden ohne irgendwas zu essen oder trinken merkte ich langsam, wie mir die Kräfte abhandenkamen. Meine Güte, ich war gerade Mitte zwanzig, noch ein Küken, eben mit dem Studium fertig. Irgendwann konnte ich dann nicht mehr.« Ich schlucke bei dem Gedanken daran.
»Ich bin aufgesprungen und habe mich zu ihnen über den Tisch gebeugt. Ich habe ihnen gesagt, dass jetzt Schluss wäre. Dass ich ihnen nichts mehr sagen könne, und dass sie lieber in ihren eigenen Reihen nach den Versagern suchen sollten, denn sie haben versagt, die deutschen Behörden und die amerikanischen. Dass sie die Attentäter schon gehabt hätten und versäumt, die Puzzleteile zusammenzubringen. Und dann habe ich demonstrativ auf die Uhr geschaut und gesagt, wenn ich nicht in einer halben Stunde hier raus wäre, würden alle meine Freunde und Bekannten die Details dieser Geschichte an die Presse schicken. Das würde dann übel für sie ausgehen. Ich kenne ja jetzt ihre Gesichter und die Aktenzeichen, und das wäre jederzeit nachprüfbar. Da hat der Typ doch tatsächlich seine Hand auf die Akten gelegt und sie verdeckt. Ich habe ihn ausgelacht. Ich habe ihn gefragt, für wie blöde er mich denn hielte, dass ich mir innerhalb von den Stunden, wo wir hier gesessen haben, nicht einmal diese zwei Nummern merken könne. Er könne sie ja gerne verdecken, aber sie wären auf ewig in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich würde sie mir auf die Haut brennen lassen, dann müsste er mir den Kopf abhacken und die Haut abziehen, um sie zu tilgen. Da… da… ist er ausgerastet. Und der Deutsche, der hat zugeschaut und nicht eingegriffen.«
Bleierne Stille folgt auf meine Worte. Ich mag den Blicken der anderen nicht mehr begegnen, stehe jetzt auf und stelle mich an die Wand, die Arme verschränkt. Ich sehe Jimmy in der Tür lehnen, die Augen voller Tränen. Den möchte ich jetzt gar nicht anschauen. Ich hole das Handy heraus, löse es aus der Hülle. Dahinter kommen mehrere Fotos zum Vorschein. Eins ist von Thore und mir, eines von den Kids, eines von meinen Eltern. Die stecke ich wieder ein, aber das letzte, das behalte ich in der Hand.
»Es wurde so schlimm, dass sich schließlich die Zuschauer auf der anderen Seite des Spiegels eingeschaltet haben. Er wurde zurückgepfiffen und ich ohne ein weiteres Wort der Entschuldigung wieder rauseskortiert. Ich bin zum Schluss fast getaumelt, doch dann hat mich der Wachmann, der die ganze Zeit mit im Raum gewesen ist, in einen stillen Winkel gezerrt, mir etwas Wasser gegeben und einen Schokoriegel. ‚Gut gemacht‘, hat er zu mir gesagt, ‚der Mann ist ein Fucker. Das hat er verdient, er hat versagt, nicht du.‘ Und dann hat er mich bis zum Auto gebracht und noch gefragt, ob ich mich denn in der Lage fühlte, selber zu fahren. Ich habe ihm gedankt und ihn weggeschickt und dann bestimmt eine Viertelstunde hinter dem Lenkrad gesessen, ohne etwas zu denken, konnte nur noch zittern.«
»Dem kann ich mich nur anschließen. Du hast dich gegen die Feds behauptet? Gut gemacht!«, sagt der Chief anerkennend.
»Feds, FBI, CIA, Secret Service, Homeland, wer weiß, von welcher Truppe der war. Das spielt keine Rolle mehr.« Ich kann mich über dieses Lob nicht freuen, dabei war die Reaktion des Chiefs meine größte Angst gewesen gleich nach der von Tom. »Als ich wieder halbwegs bei mir war, habe ich Thore eine SMS geschickt, dass ich draußen wäre, und bin losgefahren. Auf dem Weg in die Stadt bin ich dann an einigen Geschäften vorbeigekommen. Nicht nur eines davon war ein Tattoo Studio, davon gibt es eine ganze Reihe rings um die US Bases. Ich dachte, warum mache ich nicht aus der Drohung eine Wahrheit? Ich habe in dem Studio einen pensionierten Army Sergeant getroffen. Ich war so fertig, dass ich ihm die ganze Geschichte prompt erzählt habe, und er hat mich getröstet und wieder ein wenig auf die Beine gebracht. Dann hat er mir die Tattoos umsonst gestochen. Eines für die deutsche Akte«, ich schiebe den linken Ärmel meines Kleides nach unten, »und eines für die amerikanische.« Jetzt folgt der rechte Ärmel, bis alle die Nummern auf meinen Oberarmen sehen können. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie sich Tom langsam aus seinem Sitz erhebt. Ich weiche ein wenig zurück aus Furcht, was er gleich tun könnte. »Ich habe ein Bild aufgehoben von uns beiden, als Erinnerung, und er auch. Hier ist es.« Ich werfe es auf den Tisch, aber es kommt umgedreht dort zum Liegen. Keiner hebt es auf. »Wir stehen heute noch in Kontakt miteinander und schreiben uns von Zeit zu Zeit.«
»Was… was ist dann passiert?«, fragt Mo atemlos. »Haben sie dich in Ruhe gelassen?«
Ich schüttele den Kopf und ziehe meine Ärmel wieder hoch. »Als wir einige Tage später von der Arbeit nach Hause kamen, da war etwas anders in unserer Wohnung. Es war nur ganz unmerklich, ein leicht fremder Geruch, aber ich habe es trotzdem sofort gemerkt. Jemand war da drin gewesen. Wir haben dann Wanzen gefunden, Audio und Video, sogar im Bad und auf der Toilette, diese Schweine. Aber einem deutschen Ingenieur machen die nichts vor, er besaß ja einiges an technischem Spielzeug und hat sich etwas gebastelt, womit er sie aufspüren konnte. Wir haben sie ausgebaut und anderweitig verteilt. Im Klo runtergespült, an die Hühner und Kühe auf einem nahen Bauernhof verfüttert, sie auf LKWs geworfen, solche Dinge. Das Ganze passierte dann noch zwei- oder dreimal, dann hörte es auf. Das war, als eure Armee in Afghanistan einmarschiert ist. Offenbar brauchte man diese Kräfte, um sich mit den wirklich bösen Buben zu beschäftigen anstatt mit uns. Wir sind dann bald da weggezogen, zurück in die Heimat. Seitdem haben wir nichts mehr davon gehört.«
Jetzt schaue ich zu Tom, der dasteht, die Miene regungslos, der Blick finster. Ich wusste, dass es so kommen musste. Ich habe ihm die ganze Zeit meine Verbindung zu dem schlimmsten Ereignis in seinem Leben verschwiegen. Was muss er sich verraten vorkommen nach dem, was wir alles geteilt haben! Vielleicht ist es besser so. Vielleicht lassen wir es hier und jetzt enden.
Aber eines möchte ich ihm noch sagen: »Ich habe lange Jahre gezögert, in die USA zu reisen. Was, wenn sie mich bei der Einreise verhaften? Als wir dieses Fotoprojekt planten, habe ich mir extra einen neuen Pass besorgt, neue Karten, neues Handy, Email und alles, und dann erst das Visum beantragt. Über die Botschaft in Berlin. Wenn da bereits etwas schief gegangen wäre, dann hätte ich es gelassen. Aber es ging alles glatt. Es ist, als hätte es den Fall nicht gegeben. Nur dies hier beweist es noch.« Ich hebe die Schultern. Neben mir spüre ich eine Bewegung. Jimmy ist näherkommen, aber ich halte ihn mit einer unmerklichen Bewegung zurück.
Stattdessen schaue ich Tom direkt in die Augen. »Als Jimmy mir erzählt hat, wer ihr seid, dass ihr bei den Anschlägen auf die Türme dabei gewesen wart, war das ein Schock für mich. Ich bin einfach umgefallen. Du weißt es, du hast mich gefunden, aber ich konnte dir nichts sagen. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, warum habe ich dich da oben in den Bergen aufgelesen? Warum habe ich mich so verpflichtet gefühlt, dir zu helfen, habe dich mitgenommen auf meine Wanderung und vor den Navajo beschützt, die dich von ihrem Land werfen wollten, habe dich selber gesund gepflegt, anstatt dich ins Krankenhaus zu bringen? Vielleicht ist das meine Sühne dafür, dass ich in jenem Moment eine falsche Entscheidung getroffen habe. Hätte ich nicht auf Ariyas Flehen gehört oder diesen Brief nur einen Tag eher abgeschickt, vielleicht wäre Jimmys Vater noch am Leben und so viele andere auch. Vielleicht wärest du da oben in den Bergen gar nicht gelandet«, sage ich und merke, wie mir eine Träne herunterläuft. »Ich habe mich nicht getraut, dir das zu sagen. Euch. Was müsst ihr jetzt von mir denken? Was…«
»Du gibst dir jetzt nicht die Schuld daran!«, kommt es leise von Jimmy.
»Die anderen haben versagt, nicht du. Du hast ihnen alles gegeben, was sie wissen mussten, und dennoch haben sie es nicht kapiert. Das ist nicht deine Schuld«, ergänzt Mo.
»Ja, das sagt sich so leicht. Doch so fühlt es sich nicht an. Es… es tut mir leid.« Auf einmal halte ich die Blicke nicht mehr aus, besonders Toms nicht. »Ich glaube, ich brauche mal einen Moment für mich.«
Ich dränge mich an Jimmy vorbei aus der Tür, seine ausgestreckte Hand beiseite wedelnd. Weit gehe ich indes nicht, nur bis an das Fenster am Ende des Flurs. Dort lehne ich mit der Stirn an der kühlen Scheibe und schaue den Schneeflocken zu, die jetzt dicht zu Boden fallen. Ein Rettungswagen kehrt zurück, er fährt langsam auf den Hof der Wache, dahinter ein PKW, beide mit ausgeschalteten Scheinwerfern. Oh nein, jetzt kommen auch noch die anderen vom Einsatz zurück…
Hinter mir werden Stimmen laut, und dann höre ich Mo: »Ach du Scheiße, schaut euch das mal an! Sie hat ja richtige Hämatome im Gesicht!« Es folgen zahlreiche Flüche und ein ganz, ganz tiefes Grollen…
Es ist kein bewusster Entschluss. Ich flüchte einfach die Treppe hinunter, durch die Gerätehalle hinaus ins Freie. Die kalte Luft, die Schneeflocken sind mir gerade recht. Ich laufe bis zu der niedrigen Mauer, die den Hof begrenzt. Dort stehe ich zitternd im fallenden Schnee, die Arme eng um mich geschlungen, doch die Kälte, die kommt nicht von außen, die kommt von innen. Ich will hier weg. So schnell wie möglich. Fort von den Blicken, fort von…
Der Angriff erfolgt so schnell, dass ich keine Zeit habe zu reagieren. Ich werde nach vorne gestoßen und so brutal gegen die halbhohe Mauer geschubst, dass mir einen Moment die Luft vor lauter Schmerz wegbleibt. Jemand ist hinter mir, jemand, der sich mit seinem ganzen Körpergewicht auf mich presst. Meine Rippen jaulen förmlich auf vor Schmerz.
»Wen haben wir denn hier?«, raunt eine fremde, tiefe Stimme. Ich rieche Schweiß und ungewaschenen Körper, eine Hand schiebt sich unter meinen Rock und weiter hoch. Ich versuche mich zu befreien, trete nach hinten aus, doch er lacht nur. »Wir werden uns jetzt amüsieren, oder warum bist du sonst alleine hier draußen, he?« Er liegt so schwer auf mir, dass ich keine Chance habe. Durch die Tränen in meinen Augen erkenne ich nur undeutlich, was vor mir ist, aber einen winzigen Moment klärt sich meine Sicht, ich sehe Baumaterial hinter der Mauer, Paletten und Rohre. Als seine Finger sich in unschwer zu deutender Absicht zwischen meine Beine bohren, packe ich eines der Rohre und schlage mit aller Kraft nach hinten aus.
Ich habe gut getroffen. Der Kerl fällt in sich zusammen wie ein gefällter Baum. Hastig springe ich von der Mauer weg, rutsche auf den hochhackigen Stiefeln über den Schnee, das Rohr hoch erhoben in der Hand, und verpasse ihm noch einen Schlag zwischen die Beine, doch er ist kaum mehr bei Bewusstsein, um das noch merken. Keuchend ringe ich nach Luft und stehe gekrümmt da. Wo kam der her? Ich bin unter einer Lampe, nur undeutlich sehe ich den Krankenwagen im Schneegestöber. Ist da noch jemand? Ich muss aus dem Licht raus. Rasch mache ich ein paar Schritte aus dem Lichtkegel, doch es ist zu spät.
Eine weitere Gestalt löst sich aus dem Schatten des Krankenwagens. »Cooler Schlag, Mädchen, aber jetzt wirf mal das Rohr weg.« Als er näherkommt, sehe ich eine dürre Gestalt, einen ungepflegten Bart und zottelige fettige lange Haare und genauso dreckige Klamotten, wie der andere sie anhatte. Und er spricht mit einem Akzent, der kommt mir doch sehr, sehr bekannt vor. Ich hebe das Rohr, da sehe ich den Gegenstand in seiner Hand. Er hat eine Pistole!
Panik will mich überwältigen. Mit aller Kraft reiße ich mich zusammen und gifte ihn auf Deutsch an: »Was macht ein Schluchtenscheißer wie du hier im Wilden Westen mit einer solchen Knarre in der Hand? Willst du Cowboy und Indianer spielen, oder was?« Wenn er die Pistole nur eine Winzigkeit senken würde… Ich packe das Rohr fester.
»Ah geh, da schau einer an!« Er antwortet im breitesten österreichischen Akzent. »Ein echter Fischkopp! Was hast du denn hier verloren? Lass das Rohr fallen! Sofort!« Er wird nicht laut dabei, aber dass er die Sicherung gelöst hat, das wirkt dennoch. Mit einer ausholenden Bewegung pfeffere ich das Rohr in Richtung Halle. Hoffentlich hören das die anderen oben, bitte, bitte, flehe ich innerlich. Er ruckt mit der Pistole. »Und jetzt komm her. Du wirst mit mir kommen. Um den da ist es nicht schade, und wir beide, wir werden…«
Oben wird das Fenster aufgerissen. »Sannaaa!!«, brüllt jemand, und ich höre entsetzte Rufe.
Mein Gegenüber reißt die Pistole herum, feuert. »Nein!«, schreie ich los und stürze mich auf ihn. Der erste Tritt landet an seiner Hand. Die Pistole fliegt in hohem Bogen durch die Luft, ein weiterer Schuss löst sich. Zwei schnelle Schläge ins Gesicht, dann ein Tritt in den Bauch und ins Gemächt. Mir bleibt die Luft weg vor lauter Schmerz, den meine Rippen aussenden. Wie durch einen Nebel höre ich Rufe und polternde Schritte auf der Treppe. Die Pistole, denke ich noch und will zu ihr, aber ich rutsche auf diesen dämlichen hochhackigen Schuhen aus. Da packt mich mein Gegner bei den Füßen, und ich verliere das Gleichgewicht, schlage mit der Seite und dem Kopf auf dem Boden auf. Den schmerzhaften Riss an meiner Schläfe merke ich nur nebenbei. Alles, was ich denken kann, ist, dass er nicht an die Pistole gelangen darf, denn dann sind die anderen in höchster Gefahr. Ich trete nach hinten aus, trete und trete auf ihn ein, bis die Schatten kommen und ich von ihm weggezerrt werde.
»Hör auf, hör auf jetzt, er ist fertig!«, ruft Tom und hält mich fest. Nur noch halb bei Bewusstsein sehe ich den Chief, wie er den Angreifer überwältigt und ihm Handschellen anlegt. Plötzlich ist alles voller Leute, alle rufen durcheinander. Ich werde hochgehoben und getragen, hinein ins halbwegs Warme. In der Halle setzen sie mich auf eine Bank, es wird hell, als sie das Licht einschalten, kreisende Lichtblitze vor meinen Augen, und auf dem Boden… wo kommt denn all das Blut her?, frage ich mich benommen.
»Ist sie angeschossen? Um Himmels Willen…« Das ist Mo. Ich spüre Hände auf mir, sie tasten mich hastig ab. Prompt schießt der Schmerz durch mich hindurch, und ich schreie auf.
»Tut mir leid, tut mir leid…«, flüstert Tom. »Halt sie mal aufrechter, Danny.« Ich werde unter den Achseln gepackt und ein wenig hochgezogen. Es tut weh, so weh, dass ich leise stöhne, als er mich weiter abtastet. Mo erscheint in meinem Gesichtsfeld, sie drückt mir eine Kompresse auf die Schläfe, neuer Schmerz. »Nichts gebrochen, soweit ich feststellen kann, aber das muss nochmal geröntgt werden. Du musst ins Krankenhaus und…«
Draußen werden Rufe laut. »Holt die Sanitäter!«
»Tom, komm schnell!«
Mit einem Fluch werde ich Danny in die Arme gedrückt, und hastig rennende Schritte folgen Tom hinaus. Ich schließe die Augen. Danny lässt mich vorsichtig wieder auf die Bank herunter, eine Bewegung, die meine Rippen mit neuen Schmerzen quittieren. Mo tupft an meiner Stirn herum. »Das muss genäht werden. Du musst wirklich ins Krankenhaus.«
»Nein«, protestiere ich schwach. »Bitte, kann das nicht einer von euch machen? Jetzt gleich? Ich will nicht…«
»Aber Sanna…«, will Danny wiedersprechen und versucht, mich auf die Bank zu legen, doch ich schiebe ihn weg.
»Ich gehe in kein Krankenhaus. Tu es, Mo. Oder einer von den anderen. Ihr habt das doch gelernt, oder nicht? Macht es jetzt, solange ich kaum etwas spüre.« Ich schlage die Augen auf, und langsam wird mein Blick klar. Danny hockt neben mir auf der Bank, er hält mich fest im Arm. Mo kniet auf dem Boden, neben sich einen aufgeklappten Erste Hilfe Koffer. Von den anderen ist nichts zu sehen, sie sind alle draußen.
»Bist du sicher?«, fragt sie leise.
»Tu es einfach. Noch merke ich nicht viel. Die Spritzen sind doch genauso ätzend. Ich hasse Spritzen.«
Mo presst die Lippen zusammen, sie wechselt einen kurzen Blick mit Danny, der gut spürbar an meiner Seite die Schultern hebt. »Na gut. Aber jammere nicht rum, dass es wehtut. Und beschwer dich hinterher nicht, wenn du eine Narbe behältst. Ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht.«
»Ist mir egal. Viel verschandeln kannst du da eh nicht mehr. Tu es einfach.«
»Halt ihren Kopf fest, Danny.« Mo packt Nadel und Faden aus, während Danny meinen Kopf umfasst. Immerhin, sie nimmt Eisspray, das betäubt wenigstens etwas, aber es tut trotzdem scheußlich weh, als sie beginnt, den Faden durchzuziehen. Um ja keinen Laut von mir zu geben, beiße ich mir auf die Lippen und konzentriere mich auf Dannys Hände, die meinen Kopf sanft, aber dennoch fest umfasst halten. Überrascht stelle ich fest, diese Nähe stört mich nicht. Bei allen anderen, bei Jimmy, Sean und Vince, wäre das ein Problem. Doch bei ihm nicht. Wie kommt das nur?, frage ich mich verwundert.
Es sind nur ein paar Stiche, aber sie kommen mir vor wie eine halbe Ewigkeit. »So, fertig.« Mo klebt mir einen Verband auf die Schläfe.
»Tapferes Mädchen«, sagt Danny und lässt mich wieder los. Mo nimmt ein Tuch, feuchtet es an und wischt mir das Blut aus dem Gesicht.
Jetzt, da die Anspannung langsam nachlässt, spüre ich, mir wird kalt. Ich fange an zu zittern, langsam aber sicher kommt der Schock, das merke ich. »Himmel, du musst ins Warme, es ist ja eiskalt hier.« Danny nimmt von Mo eine Decke entgegen und legt sie mir um die Schultern. »Kannst du selber laufen? Ich glaube nicht, dass ich dich tragen sollte bei der Prellung an den Rippen.«
»Wird schon gehen.« Ich beiße mir auf die Lippen, als er mich hochzieht.
Langsam, Schritt für Schritt, hilft er mir die Treppen hoch. Mo hält uns die Türen auf. »Am besten legen wir dich in meinen Raum, da hast du Ruhe. Komm, es sind nur noch wenige Schritte.«
Sie verfrachten mich auf Mo’s Liege, eine harte Pritsche, wohl nicht wirklich zum Schlafen gedacht. Danny schiebt mir einen Stapel Decken unter die Beine und deckt mich fest mit einer weiteren zu. »Geht es? Brauchst du etwas gegen die Schmerzen?«, fragt er besorgt.
Ich spüre in mich. Meine ganze Seite pocht wie verrückt. Noch tut es nicht weh, aber ich habe bestimmt eine hübsche Prellung an der Hüfte und auch an der Schulter. »Ja, wäre gut.«
Gleich darauf ist Mo wieder mit einem Glas Wasser und zwei Tabletten in der Hand zurück. Danny hebt meinen Kopf an, ich würge sie irgendwie herunter, mein Hals ist wie zugeschnürt. Dabei fällt mein Blick auf das Kleid. Es ist zerrissen und blutdurchtränkt.
»Oh nein. Tut mir leid, Mo, das Kleid ist hin. Wirklich. Hätte ich meine Klamotten angehabt, der Typ hätte keine Chance gehabt. Diese verdammten Stiefel! Ich war zu langsam.«
»Mach dir keinen Kopf«, erwidert Mo und lauscht mit halbem Ohr nach draußen. Es sind immer noch die Rufe der Männer zu hören, und in der Ferne hört man jetzt auch Sirenen. »Kann ich…?«
»Geh nur, guck, was los ist«, flüstere ich und schließe die Augen.
Danny jedoch bleibt bei mir, er hält weiter meine Hand. »Du hast ihn fertig gemacht, Champ«, sagt er leise.
»Nicht wirklich«, flüstere ich, und ich merke, wie mir die Tränen kommen. Auf einmal schlägt alles über mir zusammen. »Danny, es tut mir leid. Bitte, seid mir nicht böse. Ich wollte euch ganz bestimmt nicht…«
»Schscht, nicht.« Er streicht mir über den Kopf. »Denke nicht, wir seien dir böse. Du hast nur so eine Art, das Unterste zuoberst zu kehren, die ist einfach unglaublich.«
»Es ist Tom. Seit ich ihn kenne, kommt alles wieder hoch, ich kann da nichts daran machen, gar nichts«, schluchze ich und schließe die Augen. »Je mehr er zu sich zurückfindet, desto mehr wird alles in mir aufgewühlt. So wie eben. Ihr habt mich angegangen, und wie! Dabei wollte ich euch nur helfen! Warum nur? Oh, warum nur?«
Und gerade passiert es wieder, ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Deshalb will ich mich von ihm fortdrehen, doch das jagt eine neue Schmerzwelle durch meine Seite, sodass ich es sein lasse, aber nicht verhindern kann, dass ich aufstöhne dabei.
»Nicht. Bleib ruhig liegen. Du hast ganz schön was einstecken müssen. Es ist nicht…«
Doch ich will seine Erklärungen nicht hören. »Ich habe ihn euch zurückgebracht. Eigentlich solltet ihr mich dafür auf Händen tragen, verdammt! Stattdessen geht ihr mich an, jeder auf seine Weise, wo ihr nur könnt. Was habe ich euch nur getan? Was nur?« Ich kann meine Wut darüber nicht im Zaum halten. Am liebsten hätte ich gesagt: Ich hasse euch, lasst mich in Ruhe, allesamt! Doch das wäre kindisch gewesen und stimmt zudem nicht. Sonst würde es nicht so wehtun. »Ihr macht mich kaputt. Fast sollte man meinen, das wäre Absicht. Bin ich euch zu nahegekommen? Ist es das?«
Die Hand auf meinem Kopf wird abrupt zurückgezogen. Er schweigt. Vorsichtig mache ich die Augen wieder auf. Er hat den Kopf abgewandt, die Kiefermuskeln gut sichtbar angespannt. Sofort merke ich, ich bin auf der richtigen Fährte. Die Schmerzen werden in den Hintergrund gedrängt. »Meine Güte.« Das bringe ich nur flüsternd heraus. »Kann das sein? Ihr seid eifersüchtig auf mich? Wegen meiner Nähe zu ihm?« Sein Kopf fährt zu mir herum. Ich lese leises Erschrecken in seiner Miene. Mein Zorn kocht wieder hoch, ich kann nichts dagegen machen. »Habt ihr das immer so gemacht? Sobald eine euch, ihm, zu nahegekommen ist, sie gezielt aus eurer Mitte vertrieben? Jimmy gräbt sie an, oder Sean, dann ein wenig Drama, und huch, das war’s dann?«
Treffer, erkenne ich sofort. Oh man, Sanna, warum kannst du nicht deine Klappe halten? Mir kommen die Tränen, ich kann nichts dagegen tun. »So ist das also.« Ich schlage die Hände vors Gesicht, will ihn das nicht sehen lassen. »Fahrt zur Hölle, allesamt! Fahrt einfach nach Hause, fahrt so schnell wie möglich, und nehmt ihn mit. Ich will euch nicht mehr sehen. Geht einfach, geht!!!« Das letzte Wort schreie ich heraus, und ich reiße die Hände vom Gesicht, schubse ihn von mir weg. Er fängt sich gerade noch rechtzeitig ab, dann bringt er sich mit einem Sprung an die Tür in Sicherheit.
Mein Schrei muss wohl unten zu hören gewesen sein, denn gleich darauf erscheinen Mo und Geoff hinter Danny. »Was ist denn hier los?«, ruft Mo und drängt sich an ihm vorbei.
»Nichts.« Danny schaut mich aus weit aufgerissenen Augen an, dann schüttelt er den Kopf und sucht das Weite.
Ich selber reiße auch die Augen auf. Wie sehen Mo und Geoff denn aus? Ihre Kleidung, alles blutverschmiert. Das stammt nicht von mir, kann es gar nicht. »Oh Gott, was ist da draußen passiert?«
Mo presst die Lippen zusammen. Sie setzt sich zu mir »Es ist schlimm. Der eine, der, den du mit dem Rohr platt gemacht hast, ist ein entflohener Schwerstverbrecher. In Vegas haben er und sein Kumpel anscheinend eine Bank überfallen, und dann haben sie hier auf der Flucht diesen Unfall verursacht. Ihr Fahrzeug war Schrott, also haben sie sich auf die Lauer gelegt und auf unsere Leute gewartet. Haben auf die Einsatzfahrzeuge geschossen und auf sie…« Mo kommen die Tränen.
»Himmel, ist jemandem etwas passiert?!« Sofort werden meine eigenen Sorgen in den Hintergrund gedrängt.
Geoff nickt mit grimmiger Miene. »Sechs verletzt, zwei kritisch. Wir warten auf den Rettungshubschrauber. Die Rettungshubschrauber, wir brauchen alles, was verfügbar ist. Denn die Unfallopfer sind auch schwer verletzt, und sie hatten zwei Geiseln im Kofferraum, die sind in wirklich schlimmem Zustand. Eine Frau und ein Mädchen, noch kein Teenie.«
»Oh Gott.« Mir wird ganz anders. »Er wollte mich vergewaltigen. Der Dicke.«
»Sanna!«, ruft Mo entsetzt aus.
»Hat er aber nicht geschafft. Training sei Dank. Es war knapp. Sehr knapp… he, ist ja gut.« Jetzt bin ich es, die Mo tröstet. Sie bricht in Tränen aus, bei der sonst so taffen Rettungsfrau ein ungewöhnliches Bild. »Nicht, beruhige dich. Du wirst gebraucht, also nimmt dich zusammen.« Sie nickt und atmet tief durch. Geoff streicht ihr beruhigend über die Schulter, was sie wieder zu sich bringt.
»Der Chief will dich sehen, so schnell wie möglich. Er braucht deine Aussage, denn die Feds kommen her, und er will sie von dir fernhalten«, sagt sie.
Ich muss schlucken. »Scheiße!«, entfährt es mir.
»Außerdem will er, dass du dich mal mit dem einen Kerl unterhältst, der mit der Pistole. Er schweigt, tut so, als verstünde er kein Englisch. Ist wohl ein Landsmann von dir...«, ergänzt Geoff.
Ich schnaube verächtlich. »Pah, der ist Österreicher, und natürlich spricht der Englisch.« Ich gehe in mich. Fühle ich mich stark genug dafür? Die Schmerzen verschwinden langsam unter einer betäubenden Decke. »Also gut. Hol mir mal einen Tee, Mo, und etwas Brot. Ich muss was essen, sonst stehe ich das nicht durch. Und was anderes anzuziehen, das wäre auch nicht schlecht.«
Nach dieser Stärkung und einer kleinen Ruhepause geht es mir etwas besser. Mein Kreislauf war wohl vollkommen im Keller, doch jetzt kommt er wieder in Schwung. Damit leider auch die Schmerzen, die jetzt deutlich zu spüren sind, trotz Tabletten, besonders als ich in einen Arbeitskombi von der Feuerwehr schlüpfe. Aber das ignoriere ich. Wäre ja noch schöner, wenn dieses Arschloch etwas merkt.
Die Treppe herunter schaffe ich es alleine, obschon Geoff mich vorsichtshalber beim Arm nimmt. Sie führen mich zu einer Durchgangstür, die in einen schmalen Flur mündet, der hinüber zum Polizeitrakt der Wache geht. Die nächste Tür ist aus klarem Glas. Getroffen bleibe ich stehen. Der Empfangsbereich der Polizeiwache sieht aus wie ein Kriegsgebiet. Verletzte auf Tragen, Sanitäter und Feuerwehrleute überall. Draußen vor der Tür eine große Anzahl Einsatzfahrzeuge, so viele auf einem Haufen habe ich noch nie auf einer Reise gesehen, außer bei dem Feueralarm am JFK Flughafen in New York. »Wo… wo kommen all die Leute her?«, flüstere ich entsetzt.
»Es war ein Reisebus.« Mo schlingt mir den Arm um die Taille. »Sie haben einen Teil der Verletzten in die Klinik gebracht, aber sie ist zu klein. Nur die schlimmsten Fälle sind dort, die anderen sind hier. Wir haben alles angefordert, was im Umkreis verfügbar ist.«
Geoff knurrt. »Das haben die Fucker geplant! Sie haben den Bus an einer Stelle verunglückt, wo es kein Netz gibt, und unsere Jungs dann so schnell überwältigt, dass sie keine Verstärkung anfordern konnten. Dann sind sie hierher und wollten offenbar wieder ein Fahrzeug stehlen oder Geiseln nehmen oder wer weiß was. In unserer Wache. Aber das hast du verhindert. Ich glaube, dass der Chief den Fall wasserdicht haben will, bevor die Feds übernehmen. Er hasst die Feds. Wirst du ihm helfen?«
»Oh ja.« Das ist für mich keine Frage. Nicht, nachdem ich dies hier gesehen habe. Langsam ziehe ich die Tür auf, und augenblicklich schlägt mir der Lärm entgegen, die Rufe, die Befehle, das Stöhnen der Verletzten, der Geruch von Blut und Desinfektionsmittel. Geoff und Mo führen mich rasch durch den Bereich hindurch nach hinten in die Wache. Auch da herrscht hektische Betriebsamkeit, obschon nur wenige Schreibtische besetzt sind. Die meisten sind mit Sicherheit draußen im Einsatz. Als sie mich kommen sehen, halten sie einen Moment inne und stehen dann auf. Es ist fast, als stünden sie Spalier für mich, als Mo und Geoff mich zum Büro des Chiefs führen.
Auch der Chief hat Blut auf seiner Kleidung. Er hängt am Telefon, das Handy bereits in der Hand. »Es ist mir egal, ob die Maschine gewartet ist oder nicht! Schickt sie einfach los, und zwar schnellstens!«, blafft er in den Hörer und drückt erbost den Ausknopf. Dann sieht er mich, deutet auf den Stuhl und schickt Mo und Geoff mit einer Handbewegung zurück an die Arbeit. Bevor ich etwas sagen kann, hebt er den Finger und nimmt einen Anruf auf dem Handy entgegen. »Ja«, sagt er und schnappt sich Zettel und Stift. Er schreibt eine lange Liste herunter. »Alle erfasst? Keiner fehlt? Aha…« er notiert sich noch ein paar Dinge. »Okay, danke. Kommt so schnell wie möglich wieder her… ja. Bis später.«
Als er aufgelegt hat, bleibt er einen Moment mit zusammengekniffenen Augen sitzen. Dann schüttelt er sich und schaut zu mir auf. »Wie geht es dir? Ich darf doch du sagen, nach alledem?«
»Das ist Okay. Ich bin halbwegs in Ordnung. Mo hat mir ein Schmerzmittel verpasst. Was kann ich für Sie… dich tun?«
»Nenn mich Jeff. Wir brauchen deine Aussage und deine Papiere, und wenn du dich gut genug fühlst, dann möchte ich, dass du dem Arschloch da in der Zelle auf den Zahn fühlst. Ich könnte mir vorstellen, dass dir das ganz gut gelingen wird.«
Ein Teil von mir will das ablehnen, aber ein anderer wetzt bereits die virtuellen Messer. »Ich kann’s ja versuchen. Viel auszusagen gibt es eh nicht, es waren ja nur ein paar Minuten. Also, wer macht das mit mir? Du hast doch sicherlich Besseres zu tun.«
»Oh ja. Komm mit.« Er will mir die Tür aufhalten, hält inne. »Das war Tom eben. Sie haben unseren Captain über den Haufen geschossen, und wie es scheint, hat er die Rolle einfach übernommen. Deine Jungs, die haben uns sehr geholfen, allen voran er. Tun sie immer noch. Ein Glück für uns, dass sie hier sind!«
Ich nicke nur und sage nichts. Meine Jungs… mir wird kalt. Das Gefühl kann ich nicht abschütteln, ganz egal, wie behutsam ein älterer Deputy meine Aussage aufnimmt, sie mich mit Tee und einer Decke versorgen, weil sie sehen, dass ich friere. Ich zwinge mich, die Konzentration auf die anstehenden Dinge zu lenken.
Die Aussage ist in der Tat schnell erledigt. Sie fragen mich, ob ich Anzeige wegen versuchter Vergewaltigung gegen den Dicken erstatten will. Ich entscheide mich dagegen. Das Strafregister dieses Typs ist eh schon so lang, dass er mehrfach lebenslänglich ins Gefängnis wandern wird, und so habe ich keine Scherereien mit dem amerikanischen Staat, hoffe ich.
Dann bringen sie den Gefangenen in den Verhörraum. Er wehrt sich nach Kräften, doch das ficht die Deputies nicht an. Er ist ein Wicht, erkenne ich, und er hat Angst, das ist selbst auf diese Entfernung gut zu sehen. Schwitzt wie verrückt. Vielleicht auch abhängig? Damit kann ich doch arbeiten.
Der Chief kommt zu mir. »Wir lassen dich nicht mit ihm allein. Es wird einer von uns mit dir im Raum sein, und hinter der Scheibe schauen wir zu. Wir lassen einen Recorder mitlaufen, aber versuche trotzdem, ihn zum Englischen zu bewegen, ja? Sonst müssen wir das noch offiziell übersetzen lassen, und das ist echt ätzend. Alles klar?«
Ich überlege. »Ist es nicht besser, wenn ich erstmal so tue, als würde ich mich heimlich zu ihm schleichen? Dann macht er nicht sofort dicht. Er wird mir schon nichts tun, er ist ja gefesselt, oder nicht?«
Das schmeckt dem Chief ganz und gar nicht. »Bist du sicher, dass du es so machen willst?«
»Hmm… ja. Ein Versuch wäre es wert. Aber schaut bitte nach, ob ihr irgendwelche Drogen in seinen Sachen oder im Fahrzeug findet. Er sieht aus, als wäre er auf Entzug. Kann mich aber auch täuschen.«
»Also schön.« Er seufzt. »Wir haben ungefähr eine, vielleicht auch zwei Stunden, bis die Feds aufschlagen. Eventuell sind sie auch schneller hier, wenn sie mit einem Heli kommen. Guck einfach, was du aus ihm rausbekommst, und wenn nicht, dann sind wir halt mal wieder die unfähigen Hinterwäldler.« Er spuckt beinahe aus. Oha, scheint, als hätte er da bereits so seine Erfahrungen gemacht.
Also wird der Deputy aus dem Raum beordert und der Gefangene dort einige Zeit sitzen gelassen. Der Chief weiß seine Karten wohl zu spielen. Mit lauter Stimme gibt er Alarm und jagt alle nach draußen zum Einsatz; das ist in dem Raum bestimmt zu hören. Er selber schlüpft dann leise mit noch einem Mann in den anderen Raum hinter der verspiegelten Glasscheibe.
Nun bin ich dran. Einmal tief Luft holend, drücke ich langsam die Tür auf und schaue zögerlich hindurch.
»Na, schau einer an, wen wir da haben. Willste noch ne Runde?«, zischt der Gefangene sofort, doch er ist bleich im von Schrammen und blauen Flecken übersäten Gesicht. Der Eindruck von eben verstärkt sich, er schwitzt wie verrückt. Der ist tatsächlich auf Entzug, man sieht es.
»Schicker Kombi, Madl! Nur mit deiner Schminke, da musste noch üben!« Er mustert mich von oben bis unten und grinst anzüglich.
Leise drücke ich die Tür zu und lehne mich ihm gegenüber an die Wand. »Ich wollte mal gucken, wie dir die Handschellen stehen, Schluchtenscheißer. Ihr habt da draußen ja für mächtig Aufruhr gesorgt. Das überfordert sie hier kolossal. So schnell wird sich mit dir keiner beschäftigen können!«
»Ah geh! Denen habe ich nichts zu sagen. No comprende, si?« Er spuckt aus.
Ich schnaube nur. »Als wenn dir das jemand abnehmen würde. Der andere ist im Krankenhaus, und wenn der erstmal anfängt zu singen, brauchen die dich gar nicht mehr. Dann wanderst du einfach in irgendein finsteres Loch. Die machen Hackfleisch aus dir, in einem Bundesgefängnis allemal.«
Er wird bleich. »Waas?! Bundes… wie kommst du denn da drauf? Red’ doch keinen Schmarrn!«
»Der Chief hat gesagt, die Feds werden dich einkassieren. FBI, Mulder und Scully, falls dir das was sagt. Ihr seid über die Staatengrenze rüber, du Blödmann, das hier ist Arizona. Deshalb sind sie jetzt zuständig und nicht mehr diese Hinterwäldler. Junge, Junge, ich kann dir gar nicht sagen, wie mich das freut.«
Ich stoße mich von der Wand ab und setze mich auf die Ecke des Tisches, sorgsam auf den Abstand zu ihm achtend. Nicht, dass er mich doch noch angreift. Aber die Ketten sehen stabil aus, sie sind im Boden verankert. Gut so!
»Gerade stelle ich mir dich in Orange vor und wie du dann als Fickvorlage für die richtig schweren Jungs in einem FBI Knast dienst. Die stehen auf solche kleinen Ärsche wie dich. Das wird bestimmt nett.« Meine Stimme trieft nur so vor Verachtung. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das hier wirklich so gehandhabt wird, aber warum nicht damit pokern? Er hat offenbar noch weniger Ahnung als ich. »Und wenn die Feds dich erstmal in die Mangel nehmen, dann hast du eh nichts mehr zu lachen. Dagegen ist das hier ein Spaziergang. Soll ich dir sagen, was sie mit dir machen werden? Ich habe das nämlich schon einmal durchgemacht.« Jetzt beuge ich mich vor, und er weicht doch tatsächlich ein Stück zurück. »Die verstehen mit Ausländern keinen Spaß. Für ihre eigenen Leute gelten ja gewisse Regeln, aber für dich… da werfen sie alles über Bord. Bis du deine diplomatische Vertretung angerufen hast, haben die dich längst in einem finsteren Loch verschwinden lassen, und keiner weiß, wo du bist. Und dann kommen sie dich Tag und Nacht besuchen.«
Er keucht jetzt leise. »Du verdepparst mich doch…«
»Nope.« Ich setze mich ihm gegenüber auf den Stuhl. »Obwohl… vielleicht machen sie das auch nicht. Denn hier, so viel steht fest, gibt es noch eine richtige Todesstrafe, und sie wird regelmäßig angewandt. Je nachdem, ob dort draußen alle überleben oder nicht, seid ihr – oder du – dann eh fällig.« Jetzt wird er leichenblass. Ich nicke bekräftigend. »Also, so, wie ich das einschätze, hast du nur zwei Möglichkeiten: Entweder du spielst weiter den blöden Aussie, der nix versteht. Dann passiert das, was ich dir bereits gesagt habe. Oder aber du machst gegenüber den Hinterwäldlern deine Aussage, jetzt gleich, und zwar vollständig, bevor dein Kumpel dich belasten kann. Die werden dich nicht allzu hart anfassen, denn die sind eher gutmütig hier. Obwohl der Sheriff echt sauer auf dich ist. Dann kannst du dich gegenüber den Feds auf das Papier berufen, und sie gehen dich vielleicht nicht zu hart an. Aber du musst ihnen schon etwas liefern. Ansonsten wird es übel für dich ausgehen. Überleg es dir also gut, was du tust.«
Seine Hände zittern immer mehr. Er hat ganz kleine stechende Pupillen in blassgrauen Augen, wie bleiche Fischaugen sehen sie aus. Mir wird übel von diesem Anblick, von seinem Geruch. Ich wünschte, ich hätte ein Glas Wasser mitgebracht. So langsam merke ich, wie sich bohrender Kopfschmerz in mir breit macht. Doch das zwinge ich zurück.
»Also? Was wirst du tun? Wie wäre es, wenn du mir zunächst deinen Namen gibst. Dann kann ich ja beim Sheriff etwas bessere Stimmung verbreiten. So ist der nicht gut zu sprechen auf dich. Ihr wart echt bescheuert, euch ausgerechnet eine vollbesetzte Wache auszusuchen. Was hat euch nur geritten? Alles voller Cops und Rettungskräfte…«
»Die sollten beim Unfall sein. So hat sich Dickie das ausgedacht«, spuckt er aus, und er windet sich unruhig.
»Aha. Und wie kommt ein kleines Würstchen wie du dazu, sich mit so einem Fettwanst wie Dickie zusammenzutun und eine Bank zu überfallen? Ach, vergiss es! Ich will’s gar nicht wissen.« Ich stehe auf. Der Raum verschwimmt kurz vor meinen Augen, was ich jedoch verdränge. »Ich merke schon, du hast es nicht kapiert. Bist wahrscheinlich zu dumm. Tja, da kann man nix machen. Aber eines ist sicher: Ich werde auf jeden Fall da hinter dem Spiegel stehen, wenn sie dich so richtig auseinandernehmen. Das gönne ich mir einfach.«
Ich will zur Tür, da keucht er plötzlich los und zerrt wie verrückt an den Ketten. »Du Miststück, du verdammte Trutschn! Dickie hätte dich durchnehmen sollen, solange, bis du nicht mal mehr deinen Namen weißt!«
»Pah!« Ich schaue mit verschränkten Armen auf ihn herab. »Das hätte der nie geschafft. Selbst in Stelzen hab’ ich ihn noch platt gemacht! Und du mit deiner Knarre… du hast es ja nicht mal geschafft, ein Fenster offen wie ein Scheunentor zu treffen! Was seid ihr bloß für Amateure! Was ist? Du hast anscheinend keine Ambitionen. Denn ich interessiere dich nicht mal annähernd! Stehste auf Jungs? Oder etwa…« Mir fällt ein, was Mo gesagt hat, über die Opfer im Kofferraum.
»Oh jaaahh… die Kleine, die hat’s mir angetan.« Er grinst mich an und reibt sich den Schritt. »Dem guten Toni kam ein solcher Leckerbissen gerade recht. Willsta’n ma sehn?« Er nestelt an seinem Hosenstall herum.
Mir wird schlecht. »Nee, lass dein Würstchen mal stecken. Wahrscheinlich viel zu klein für eine richtige Frau.« Seine Hand zuckt zurück, er schaut mich böse an. »Toni, soso! Also Anton. Und weiter?« Jetzt habe ich ihn, das spüre ich. »Na komm schon, spuck’s aus. Nachname!«
Er fletscht die Zähne. »Herrleitner.«