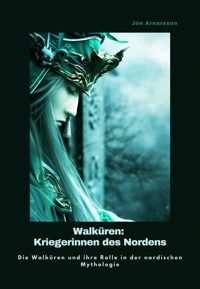
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In den Legenden der nordischen Völker sind sie furchtlos, mächtig und geheimnisvoll – die Walküren. Sie durchqueren die Schlachtfelder, wählen die tapfersten Krieger aus und begleiten sie in Odins prächtige Halle Walhall. Doch ihre Rolle geht weit über das Schlachtgetümmel hinaus: Als Symbol für Tod, Schicksal und göttliche Ordnung stehen die Walküren im Zentrum der nordischen Mythologie. Jón Arnarsson führt die Leser:innen auf eine faszinierende Reise in die Welt dieser mythischen Kriegerinnen. Mit fundierten Einblicken in alte Sagen und die Edda, ergänzt durch archäologische und historische Perspektiven, enthüllt das Buch die vielen Facetten der Walküren: ihre Verbindung zu den Göttern, ihre Funktion als Schicksalsweberinnen und ihre Darstellung in Kunst und Literatur. Für alle, die sich für Mythologie, Geschichte und die zeitlose Faszination starker Frauenfiguren interessieren, bietet dieses Buch eine packende Erkundung der nordischen Sagenwelt – eine Welt, in der Mut und Magie miteinander verschmelzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walküren: Kriegerinnen des Nordens
Die Walküren und ihre Rolle in der nordischen Mythologie
Jón Arnarsson
Ursprung und Bedeutung der Walküren in der nordischen Mythologie
Die Rolle der Walküren in der Schöpfungsgeschichte
In der nordischen Mythologie nehmen die Walküren eine zentrale Rolle nicht nur in der Kriegertradition, sondern auch in der Schöpfungsgeschichte ein. Ihre Funktionen und ihr Einfluss reichen weit über das Schlachtfeld hinaus, tief hinein in die kosmologischen Geflechte der nordischen Weltanschauung. Die Walküren, jene majestätischen Wesen, die das Schicksal von Menschen und Göttern gleichermaßen lenken, sind integraler Bestandteil der Mythen, die die Frühzeit und das kosmische Gefüge der nordischen Sagen gestalten.
Der Beginn der Welt, wie in der nordischen Mythologie beschrieben, ist untrennbar mit der Genesis von Ordnung und Chaos verbunden. Die Walküren dienen als Scharnier zwischen diesen beiden entgegengesetzten Kräften. Ihre Funktion als „Chooser of the Slain“ ist nicht bloß ein Gremium für das Sortieren toter Krieger, sondern viel mehr ein Akt kosmischer Balance. In der Poetic Edda, insbesondere im „Völuspá“, wird das Gleichgewicht zwischen den Mächten des Lichts und der Dunkelheit als ein ständig wandelnder Prozess beschrieben, bei dem die Walküren eine entscheidende Rolle spielen.
Des Weiteren haben Walküren auch eine bedeutende Aufgabe in der Ahnenverehrung und der Seelenreise, welche in der Schöpfungsgeschichte wichtig ist. In vielen nordischen Erzählungen wird angenommen, dass die Walküren nicht nur die Seelen der Krieger nach Walhall bringen, sondern dass sie auch als Vermittler zwischen den Welten fungieren. Dies ist insbesondere in der Beziehung bemerkenswert, die sie zu den Nornen, den Schicksalsweberinnen, teilen. Während die Nornen die Lebensfäden spinnen und zerschneiden, sind die Walküren die aktiven Ausführenden dieses Schicksals auf der Erde.
Ein weiterer Aspekt der Schöpfungsgeschichte, in der Walküren ihre Autorität ausspielen, liegt in der Funktion der göttlichen Ordnung. In der „Gylfaginning“ wird die Herausforderung beschrieben, die Götter angesichts des kommenden Ragnarök darin sehen, die Ordnung in einer Welt zu bewahren, die ständig vom Chaos bedroht ist. Die Walküren sind dabei die Waffen der ewigen Ordnung - von ihnen heißt es, sie kämpfen stets an der Seite von Odin im Tuniertanz um Ragnarok entgegenzutreten und die neue Welt nach der Alten zu formen. Ihre Präsenz und ihr Eingreifen bei der Auswahl der Gefallenen für Odins Armee stellt sicher, dass nur die würdigsten Krieger von der alten Welt den Übergang zur neuen Welt begleiten.
Ein weiteres spannendes Element in der Schöpfungsgeschichte und den Walküren ist die Vorstellung von ihrer Existenz als Metaphern für die Naturgewalten. In der „Hávamál“ erscheinen sie bei heraufziehenden Stürmen, sichtbar durch ihre prächtigen Rüstungen und flatternden Umhänge, ein Bild, das die gewaltige Naturkraft verkörpert, die bei der Erschaffung der Welt am Werk ist. Ihre Verbindung mit den Nordwinden, den Nornen und anderen Naturgeistern hebt die Rolle der Walküren als ewige Kräfte der Natur hervor, die so beständig wie die kosmischen Gesetze selbst sind.
Insgesamt sind die Walküren nicht nur begleitende Figuren in der Saga der Schöpfung, sondern sie sind aktive Gestalterinnen einer Welt, die die Balance zwischen Chaos und Ordnung sucht. Diese Mythen betonen die tief verwurzelte Verbindung der Walküren mit der schicksalhaften Machtstruktur der nordischen Weltordnung, und sie zeichnen ein vielfältiges Bild dieser mystischen Kriegerinnen, die weit mehr sind als nur Begleiter der Kriegerseelen. Ihre Rolle in der nordischen Schöpfungsgeschichte offenbart ihre zentrale Bedeutung als Trägerinnen der Ordnung, als Diplomatinnen zwischen den Reichen und als Hüterinnen der kosmischen Balance.
Die etymologischen Wurzeln des Begriffs „Walküre“
Die Erforschung der etymologischen Wurzeln des Begriffs „Walküre“ ist ein faszinierender Ausflug in die sprachlichen und kulturellen Entwicklungen der alt-nordischen Welt, die uns ein tieferes Verständnis dieser mystischen und ikonischen Figuren gibt. Im Altisländischen, der Sprache der Edda, wird der Begriff „Valkyrja“ verwendet, dessen Ursprung aus zwei Wortteilen besteht: „valr“ und „kyrja“.
Der erste Bestandteil, „valr“, bezieht sich auf die Gefallenen oder die Erschlagenen. Dieses Wort selbst ist in der altnordischen Literatur und Mythologie tief verwurzelt. Es entspricht dem Gotischen „walus“, das auch die gleiche Bedeutung trägt, und wird benutzt, um die Leichen derer zu beschreiben, die im Kampf gefallen sind. „Valr“ findet seine Parallelen im Althochdeutschen „wal“, das auch auf Schlachtopfer zurückgeht. Dieses Wort verdeutlicht den besonders engen Zusammenhang der Walküren mit dem Krieg und mit dem Kampfesfeld als Ort ihrer Tätigkeit.
Der zweite Bestandteil, „kyrja“, leitet sich von dem altnordischen Verb „kjósa“, was „wählen“ oder „aussuchen“ bedeutet, ab. Dies spiegelt die Funktion der Walküren wider, die über die Seelen der Gefallenen entscheiden. Ihre Aufgabe ist es, diejenigen auszuwählen, die nach Walhall, die Halle der Gefallenen bei Odin, gelangen, und bietet somit eine direkte Verbindung zu Schicksalsfunktionen, die den Walküren traditionell zugeschrieben werden.
Bereits hier tritt das einzigartige Charaktermerkmal der Walküren zutage: Sie sind nicht nur Kriegerinnen auf dem Schlachtfeld, sondern auch Richterinnen über das Schicksal der Krieger. Diese doppelte Motivik von Tod und Schicksal wird durch die Etymologie ihres Namens symbolisiert und durch verschiedene Skaldengedichte und Prosa-Eddas thematisch bekräftigt. In Richard Cleasbys altisländischem Wörterbuch und den Textanalysen von Snorri Sturluson sind Hinweise auf diese Bedeutungszusammenhänge vielfach auffindbar.
In philologischen Untersuchungen, wie sie z. B. durch Jan de Vries in „Altnordisches Etymologisches Wörterbuch“ durchgeführt wurden, wird aufgezeigt, dass die Konzeption der Walküren wahrscheinlich eine Entwicklungslinie aufweist, die von früheren keltischen und germanischen Todesgöttinnen beeinflusst worden sein könnte, welche ähnliche Funktionen hatten. In dieser Hinsicht könnte Vergleiche mit den irischen Morrígan oder den germanischen Nornengöttinnen ziehen, deren Rollen im Mythos oft Parallelen zu den Walküren aufweisen.
Die Transformationsreise des Begriffs „Walküre“ veranschaulicht, wie bedeutungsvolle mythologische Namen von ihren ursprünglichen sprachlichen Wurzeln beträchtliche semantische Bedeutungen erhalten, die weit über das hinausgehen, was im reinen Wortursprung suggeriert wird. Die lexikalische Tiefe des Begriffs fügt den nordischen Sagen eine zusätzliche Dimension von mythischer Komplexität hinzu, was sie für Leser und Forscher gleichsam faszinierend macht.
Abschließend lässt sich sagen, dass sowohl die Etymologie als auch die semantische Entfaltung des Begriffs „Walküre“ eng mit der Kriegerkultur der skandinavischen Völker und deren Geisteshaltung verbunden ist. Diese Verbindung zu Krieg, Tod und Schicksal – symbolisiert durch die Namenswurzeln – hebt die Walküren als einzigartige Figuren in der Welt der mythologischen Wächterinnen hervor, die sowohl als Seeltenführerinnen als auch als entscheidende Schicksalsverwalterinnen agierten.
Darstellung der Walküren in verschiedenen Edden und Sagas
Die nordische Mythologie ist reich an faszinierenden Gestalten, von denen die Walküren eine wesentliche Rolle spielen. Diese mythischen Kriegerinnen, bekannt als wagemutige Kampf- und Schicksalsbestimmerinnen, finden ihre Erwähnung in zahlreichen nordischen Texten, darunter die "Poetische Edda" und die "Prosa-Edda" sowie verschiedene Sagas. Durch die Jahrhunderte hinweg haben diese Schriften uns geholfen, die facettenreiche Bedeutung und Funktion der Walküren im nordischen Kosmos zu verstehen.
In der "Poetischen Edda", einer Sammlung von altnordischen Gedichten aus dem 13. Jahrhundert, erscheinen die Walküren als alltägliche Begleiter von Odin, dem Allvater der Götter. Eines der bekanntesten Gedichte, die "Völuspá", beschreibt die Walküren als Schicksalsweberinnen, die die tapfersten Krieger nach Walhall führen. Die Notwendigkeit, sie als mächtige und ehrfurchtgebietende Wesen zu charakterisieren, lässt sich an Sätzen wie "Fährt zu gehen, um zu würdigen die Wahl" erkennen. Dieser Begriff "Wahl" bezieht sich auf die Auswahl der gefallenen Krieger, die in der Schlacht ehrenvoll gestorben sind und nun unter Odins Schutz nach Walhall ziehen dürfen.
Die Darstellung der Walküren in der "Prosa-Edda", die von dem isländischen Gelehrten Snorri Sturluson verfasst wurde, schärft ihr Bild weiter. Snorri beschreibt sie als wunderschöne, aber furchterregende junge Frauen, die auf Pferden reiten und metallische Rüstungen tragen. Sie sind eine Verkörperung der Kriegsfurien, die nicht nur den Verlauf von Schlachten beeinflussen, sondern auch das Nachleben der Krieger bestimmen. Dieses Werk unterstreicht die Dualität der Walküren als sowohl göttliche Kriegerinnen als auch als sanfte Schicksalsgöttinnen, ein Aspekt, der ihre Ambivalenz und Komplexität in der Mythologie unterstreicht.
In den Sagas, die heroische Geschichten und historische Berichte über die nordischen Völker vermitteln, gewinnen die Walküren eine zusätzliche Dimension. Besonders in der "Helgakviða Hundingsbana", einer der Heldenlieder der Edda, wird die romantische Seite der Walküre thematisiert. Brunhild, eine Walküre, verliebt sich in den Helden Sigurd. Ihre Geschichte illustriert die Kombination aus Verletzlichkeit und unermesslicher Stärke, die die Walküren charakterisiert. Durch diese persönlichen Einblicke in ihre Beziehungen gewinnen sie eine menschliche Tiefe, die in den Eddas weniger greifbar erscheint.
Auch in der "Saga von Hrólf Kraki" werden Walküren als Kampfbegleiterinnen dargestellt, die über Leben und Tod entscheiden können. Die Saga suggeriert, dass Walküren sowohl göttliche Wesen mit eigenen unabhängigen Agenden sind, als auch loyale Diener der Kriegerkultur ihrer Zeit. Sie spiegeln damit den tief verankerten Respekt und die Faszination der nordischen Kultur für die Verbindung von Krieg und Schicksal wider.
Zusammenfassend offenbaren die Darstellungen der Walküren in diesen Texten ein vielschichtiges Bild jener Gestalten, die sowohl gefürchtet als auch verehrt wurden. Ihre funktionelle Ambivalenz – sowohl als Kriegermädchen, die den Ausgang der Schlachten vorausahnen, als auch als Schicksalsweberinnen, die das Nachleben lenken – bleibt ein faszinierendes Element ihrer Darstellung. Während die Eddas ihre Funktion innerhalb der göttlichen Ordnung betonten, erforschten die Sagas ihre Beziehungen zu Menschen und verdeutlichten so die Interaktion zwischen mythischer und sterblicher Welt.
Die Verbindung der Walküren zu den nordischen Göttern
Die Beziehung der Walküren zu den nordischen Göttern ist ein faszinierender Aspekt der nordischen Mythologie, der die Rollen und Funktionen dieser mystischen Kriegerinnen beleuchtet. Walküren, deren Name sich etymologisch von den altnordischen Begriffen "valkyrja" ableitet, was übersetzt "Wählerin der Erschlagenen" bedeutet, sind eng mit den kriegerischen und schicksalshaften Aspekten des nordischen Pantheons verwoben. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Seelen tapferer gefallener Krieger ins Walhall zu geleiten – die prächtige Halle des Gottes Odin.
Odin, der Allvater, ist eine zentrale Figur, wenn es um die Walküren geht. Er ist der Gott, der Wissen, Weisheit, Krieg und Poesie verkörpert und eine besondere Vorliebe für jene zeigt, die im Kampf fallen. In der mythologischen Vorstellung fungieren die Walküren als Odins Sendboten und Gefährtinnen, die auf seinen Befehl hin das Schlachtfeld durchstreifen, um die tapfersten Krieger auszuwählen, die nach ihrem Tod ins Walhall gelangen sollen. Dort erhalten sie die Ehre, an Odins Tafel zu sitzen und sich auf die Ereignisse von Ragnarök, dem Schicksalsgötterdämmertag, vorzubereiten.
Die Verbindung der Walküren zu Odin ist nicht nur funktional, sondern auch symbolisch von Bedeutung. Sie repräsentieren den Willen Odins und sind Manifestationen seiner Macht und Weisheit. Diese Beziehung wird in verschiedenen Eddas und Sagas eindrücklich beschrieben. So schreibt die Prosa-Edda zum Beispiel über die Aufgaben der Walküren und hebt ihre Autonomie und ihre Rolle als starke weibliche Figuren hervor, die zugleich Odins Helfer und seine Krieger sind.
Der Einfluss der Walküren geht jedoch über ihre Verbindung zu Odin hinaus. Sie sind ebenso mit anderen Mitgliedern des Asen-Geschlechtes verbunden. Freyja, die Göttin der Liebe, des Krieges und des Todes, wird in manchen Überlieferungen als Anführerin der Walküren genannt. Diese Darstellung impliziert eine ähnliche Seelenführerrolle, da die Hälfte der gefallenen Krieger, die von den Walküren ausgewählt werden, in das Reich von Freyja, Folkvangr, gelangt.
Ein weiteres Mitglied des göttlichen Pantheons, das mit den Walküren in Verbindung steht, ist die Göttin Skadi, eine Jägerin und zugleich die Göttin des Winters und der Jagd. Obwohl die direkte Verbindung zu den Walküren weniger offensichtlich ist als die zu Odin oder Freyja, teilen sie dennoch eine Kriegernatur, die sich in der mythologischen Erzählung widerspiegelt.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Walküren eine Schlüsselrolle in der nordischen Mythologie spielen, indem sie eine Brücke zwischen den sterblichen Kriegern und den Göttern bilden. Ihre Verbindung zu den Göttern, insbesondere zu Odin und Freyja, zeichnet ein Bild von komplexen und dynamischen Charakteren, die sowohl Kriegerinnen als auch göttliche Agentinnen sind. Die symbolischen und realen Interaktionen der Walküren mit den göttlichen Mächten heben ihre Bedeutung in den Erzählungen hervor und zeigen die Tiefe der nordischen Mythenwelt.
Wie bereits von John Lindow in Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs diskutiert, repräsentieren die Walküren ein Konzept von Schicksal und Vorbestimmung, das tief in der nordischen Kultur verwurzelt ist. Diese Themen sind essenziell, um die Beziehung der Walküren zu den nordischen Göttern nicht nur als hierarchische, sondern auch als symbiotische Beziehung zu verstehen.
Mythische und historische Ursprünge der Walkürenvorstellung
Die mystische Gestalt der Walküren hat ihre Wurzeln tief in der nordischen Mythologie und ist bereits in den ältesten schriftlichen Überlieferungen ersichtlich. Doch um die wahre Bedeutung und den Ursprung dieser faszinierenden Wesen zu verstehen, ist es notwendig, sowohl die mythischen als auch die historischen Kontextualisierungen zu beleuchten. Die Walküren sind nicht nur Kriegerinnen, die über Leben und Tod entscheiden, sondern auch Symbolfiguren mit einer komplexen und oft widersprüchlichen Natur.
In den nordischen Sagen treten die Walküren als geheimnisvolle Wesen auf, die auf Odins Befehl hin die gefallenen Krieger vom Schlachtfeld zum Walhall geleiten. Diese Kriegergöttinnen sind nicht nur Begleiterinnen, sondern auch Richterinnen, die das Schicksal der Krieger besiegeln. Ihre ursprüngliche Funktion scheint jedoch tiefer und verwobener zu sein, als es die erzählerischen Darstellungen vermuten lassen. Die frühesten Überlieferungen deuten darauf hin, dass sie eng mit dem Konzept von Wyrd, dem nordischen Schicksal, verbunden sind. Skandinavische Traditionen behandeln das Schicksal oft als ein unabänderbares Gewebe, und die Walküren sind die Weberinnen dieses Schicksals. Somit sind sie nicht nur Überbringerinnen des Todes, sondern Schöpferinnen des Schicksals.
Historische Untersuchungen legen nahe, dass die Vorstellung von eigenständigen, kriegerischen Frauen möglicherweise auf reale Gestalten zurückzuführen ist. Die archäologischen Funde von Kriegerinnen-Gräbern in Skandinavien aus der Wikingerzeit unterstützen die Theorie, dass Frauen tatsächlich eine militärische Rolle in der nordischen Gesellschaft gespielt haben könnten. Diese Entdeckung bereichert das Verständnis der Walküren erheblich: Es ist denkbar, dass die Sagen und Mythen über Walküren eine symbolische Darstellung solcher realen Kriegerinnen liefern, die in den Legenden eine übernatürliche Aura verliehen bekommen haben.
Darüber hinaus weisen Parallelen mit anderen indoeuropäischen Traditionen darauf hin, dass die Walküren möglicherweise auf älteren mythischen Ideen basieren. Die Intersectionierung von Krieg und Tod mit weiblichen göttlichen Figuren ist weit verbreitet, etwa bei den Morrígan in der irischen Mythologie oder den Römerinnen von Bellona. Diese Vergleiche erlauben uns, die Walküren im Rahmen eines größeren mythologischen Kontextes zu begreifen, und offenbaren, wie die nah verwandte Mentalität und Kultur in verschiedenen Regionen Europas ähnliche Mythen hervorgebracht haben.
In vielen Geschichten erscheinen Walküren nicht nur als übermenschliche Wesen, sondern auch als Auftraggeberinnen mächtiger Artefakte und als Hüterinnen verborgenen Wissens. Sie verkörperten erotische und zugleich furchteinflößende Aspekte, eine dualistische Symbolik, die sowohl Respekt als auch Ehrfurcht hervorrief. Diese Kombination deutet auf eine mythologische Funktion hin, die über die einfachen Rollen von Krieg und Tod hinausgeht und tiefergehendere menschliche Ängste und Hoffnungen widerspiegelt.
Die Walküren der nordischen Sagen sind somit keine monolithischen Figuren, sondern komplexe Verkörperungen kultureller und spiritueller Anliegen, die über Jahrhunderte hinweg die Menschen faszinieren und beeinflussen. Ihre Bedeutung oszilliert zwischen Realität und Mythos, und die Kombination aus mythischen und historischen Ursprüngen macht sie zu einem der reichhaltigsten und faszinierendsten Themen der nordischen Mythologie.
Symbolik der Walküren: Tod, Schicksal und Krieg
Die nordische Mythologie ist reich an Symbolen und Figuren, die den uralten Kampf zwischen Leben und Tod sowie die geheimnisvollen Mächte des Schicksals illustrieren. Inmitten dieser faszinierenden Bilderwelt stehen die Walküren, deren Symbolik ein weites Spektrum menschlicher Erfahrung und Erkenntnis umspannt. In diesem Unterkapitel widmen wir uns der tief verwurzelten Bedeutung der Walküren in Bezug auf Tod, Schicksal und Krieg, zentralen Themen der nordischen Sagenwelt.
In der nordischen Mythologie verkörpern die Walküren eine facettenreiche Natur. Ihr Name, abgeleitet vom altnordischen „valkyrja“ – „die Leichenwählerin“ oder „die zum Schlachtfeld Gehende“ –, deutet bereits auf ihre Verbindung zum Tod hin. Sie sind untrennbar mit der Vorstellung vom heroischen Tod verknüpft, einer Ehre, die den Kriegern zuteilwurde, die auf dem Schlachtfeld ihr Leben ließen. Diese Krieger wurden von den Walküren auserwählt und nach Walhall, die Halle der Gefallenen, gebracht, um dort an der Seite Odins, des Allvaters, für den bevorstehenden Endkampf, Ragnarök, zu trainieren.
Die Walküren sind nicht nur Todesengel, sondern auch Machtverwandler. Sie sind die Mittler zwischen den Ebenen des Lebens und des Todes. Ihre Rolle als Schicksalsfrauen manifestiert sich in der Vorstellung, dass sie nicht nur den Ausgang von Schlachten, sondern auch das individuelle Schicksal der Krieger bestimmen. Dieses Ambivalent-Verknüpfte wird in der Edda und anderen skandinavischen Sagen deutlich, die die Walküren als Teil von Odins Gefolge darstellen. Der verhängnisvolle Einfluss der Walküren erinnert an die Nornen, die Schicksalsgöttinnen der nordischen Mythologie, was ihren Status als Vermittlerinnen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterstreicht.
Die Bedeutung des Krieges in der Symbolik der Walküren spiegelt die Wertschätzung der Wikinger für den Kampf wider. Walküren werden oft als kämpferische und furchteinflößende Frauen dargestellt, die in goldstrahlender Rüstung reiten, bewaffnet mit Speeren und Schilden. Sie sind nicht nur stille Beobachterinnen, sondern aktiv Teilnehmende am Geschehen. Diese Darstellungen sind durchdrungen von der wiederkehrenden Metapher des Krieges als Theater des Ruhms und des Heldentums, in dem die Walküren sowohl als psychologische Mentoren als auch als metaphysische Akteure auftreten.
Diese mehrdeutige Symbolik ist tief in den kosmologischen und metaphysischen Weltanschauungen der nordischen Kultur verankert. Der Krieger von der Walküre begleitet zu werden ist eine Darstellung der Unausweichlichkeit des Schicksals und eine Ehrung der Verbundenheit zwischen den Lebenden und den Ahnen. Der Einfluss der Walküren erstreckt sich jedoch über die Schlachtfelder hinaus: Ihre Verbindung zum Schicksal erstreckt sich auf Kunst und Dichtung der mittelalterlichen nordischen Welt, wo sie als Archetypen weiblicher Macht, Weisheit und Autorität geehrt werden.
Zusammenfassend lassen sich die Walküren als Symbole sehen, die weit mehr umfassen als die reduktionistische Sichtweise einer reinen Kriegsmythologie. Ihre Präsenz in der nordischen Mythologie ist eine vielschichtige Durchdringung von Tod, Schicksal und Krieg, die die kulturellen Einflüsse und kollektiven Vorstellungen der nordischen Völker über Jahrhunderte hinweg widerspiegeln. Sie stehen als Zeugen einer Welt, in der das Schicksal unausweichlich ist, der Tod eine Ehre und der Krieg eine Bühne der göttlichen Bestimmung. Die Walküren als solche bieten ein tiefes Verständnis der mythologischen und kulturellen Werte, die das Leben in der Wikingerzeit prägten.
Transformationen der Walkürenbilder im Laufe der Zeit
Die Darstellung der Walküren hat sich im Laufe der Jahrhunderte deutlich verändert, was sowohl auf kulturelle Einflüsse als auch auf die sich wandelnden literarischen und künstlerischen Ausdrucksformen zurückzuführen ist. Ursprünglich in den altnordischen Quellen als göttliche Wesen beschrieben, die auf dem Schlachtfeld agierten, werden die Walküren meist als Botinnen Odins dargestellt, die ausgewählte Krieger nach ihrem Tod nach Walhall führen. Diese Erscheinungsform ist insbesondere in den Werken der älteren Edda und der jüngeren Edda prominent vertreten.
Mit der Zeit setzte jedoch eine Transformation ein, die Walküren von der Rolle strenger, kriegerischer Todesboten zu komplexeren Figuren werden ließ. In späteren Sagas und Skaldengedichten weisen sie menschlichere Züge auf und werden mit Geschichten von Liebe und Rache verwoben, die ihnen eine emotionale Dimension verleihen. In der „Völsunga saga“, beispielsweise, tritt die berühmteste Walküre, Brynhildr, in Erscheinung, deren Geschichte von Verrat und unerfüllter Liebe im Fokus steht (Byock, Jesse. "The Saga of the Volsungs", Penguin Classics, 1999).
Eine weitere bemerkenswerte Veränderung in der Darstellung der Walküren zeigt sich in der mittelalterlichen Literatur des skandinavischen Raumes. Hier begannen die Autoren, sich von den rein kriegerischen und schicksalsbestimmenden Rollen zu lösen, und portraitierten Walküren als Beschützerinnen und Liebesobjekte. Diese Narrative verweisen auf eine Anpassung der Walküren an die gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen der unterschiedlichen Epochen. So zeigt etwa die „Nibelungenlied“-Adaption der Geschichte von Kriemhild deutlich die Entwicklung von martialischen zu romantischen Motiven.
Interessant ist zu beobachten, dass diese Veränderungen nicht isoliert stattfanden, sondern oft mit ähnlichen Entwicklungen in der künstlerischen Darstellung einhergingen. Malereien und geschnitzte Reliefs aus dem Mittelalter zeigen Walküren mit Attributen von Weiblichkeit und Schönheit, die dem glorifizierten Ideal der Jungfrau und der Kriegerin gleichermaßen entsprechen. Die Transformation war hierbei nicht nur eine Frage der Darstellung, sondern spiegelte auch den sozialen Wandel und die neuen narrativen Akzente der Erzähltraditionen wider.
Der Einfluss des Christentums auf die nordischen Länder trug ebenfalls zur Transformation der Walkürenbilder bei. Mit der Verbreitung der neuen Religion, die germanische Mythen als heidnisch und teils dämonisch betrachtete, verloren einige Aspekte der Walküren ihre vormals verehrten Rollen und wurden umgedeutet oder marginalisiert. Dies führte oft dazu, dass die Walküren von mystischen Kriegerinnen zu mythologischen Figuren mit eher feenhaften oder hexenhaften Zügen wurden, was heute noch in verschiedenen Volksmärchen und Legenden nachvollziehbar ist.





























