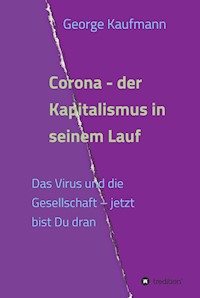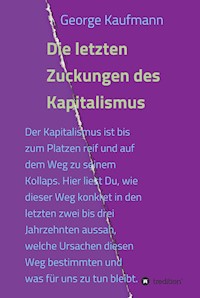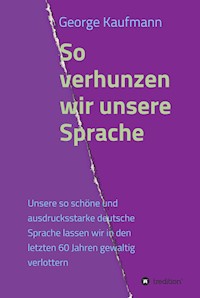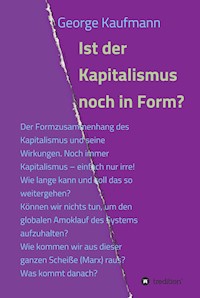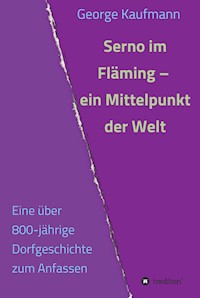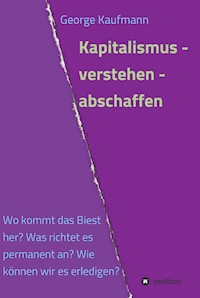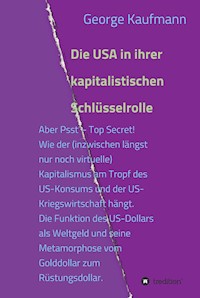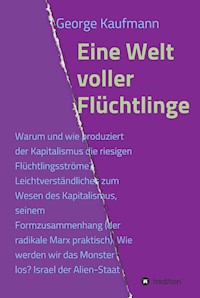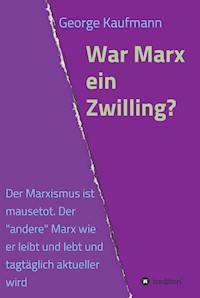
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Obwohl die Auflagen seiner Bücher an die Verbreitung der Bibel heranreichen, ist Karl Marx heute aus den Buchhandlungen fast ganz verschwunden. Eine Marx-Auswahl-Auswahl fehlt daher und könnte doch nützlich sein, vielleicht nicht zuletzt für eine junge Generation in Ost und West, die mit keiner Marx-Lektüre und keiner Marx-Diskussion mehr aufgewachsen ist, sich aber endlich einmal selber mit dem authentischen Marxschen Denken auseinandersetzen will, das angeblich beinahe die Weltgeschichte ruiniert hätte. Es hat schon viele Editionen Marxscher Texte gegeben, wobei meistens ein Verständnis stille Voraussetzung war, das Marx mit dem "Marxismus" der sozialistischen Arbeiter- und Staatsparteien indentifizierte. Heute ist dieser Sozialismus ebenso mausetot wie die Arbeiterbewegung. Die Formeln des "Standpunkts der Arbeit" und des "Klassenkampfs" sind altertümlich geworden; sie lösen keine positiven oder negativen Leidenschaften mehr aus und reizen nur noch zum Gähnen. Lass Dich überraschen von der Radikalität und Logik des "anderen" Marx, der bis an die Innere Schranke des Kapitalismus dachte und sogar darüber hinaus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
www.tredition.de
George Kaufmann
War Marx ein Zwilling?
Der Marxismus ist mausetot. Der „andere“ Marx wie er leibt und lebt und tagtäglich aktueller wird.
www.tredition.de
© 2015 George Kaufmann
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7323-7939-2
Hardcover:
978-3-7323-7940-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Ein Vorwort
Einführung
Das Schicksal des Marxismus – Marx lesen im 21. Jahrhundert
Marx und der postmoderne Abgesang auf die „Großtheorie“
Nach dem Jahrhundert der Arbeiterbewegung
Die innere Ungleichzeitigkeit des Kapitalismus
Die Arbeiterbewegung in der „nachholenden Modernisierung“ des 19. Jahrhunderts
Die Zwillinge: Der exoterische und der esoterische Marx
Marx und die Arbeiterbewegung: keine Liebesheirat
Der Marxismus und die nachholende Modernisierung im 20. Jahrhundert
Die Verwurstung des Marxismus im Kalten Krieg
Die 68er Bewegung als Johannistrieb des exoterischen Marx
Die große Irritation nach dem Ende des Marxismus
Marxistische Totenbeschwörungen
Die kategoriale Krise und die Tabuzone der Moderne
Der Fetischismus als stumme Dimension und der große Sprung der Geschichte
Postmoderne Mogelpackungen als letztes Wort der Moderne
Sie wissen es nicht, aber sie tun es:Die kapitalistische Produktionsweise als irrationaler Selbstzweck
Das fremde Wesen und die Organe des Hirns:Kritik und Krise der Arbeitsgesellschaft
Die unwahre Erscheinung einer eingebildeten Souveränität:Kritik der Nation, des Staates, des Rechts, der Politik und der Demokratie
Aus allen Poren blut- und schmutztriefend:Der hässliche Kapitalismus und seine Barbarei
Die wahre Schranke der kapitalistischen Produktion ist das Kapital selbst:Mechanik und historische Tendenz der Krisen
Jagd über die ganze Erdkugel, die Konkurrenz rast:Globalisierung und Fusionitis des Kapitals
Die Mutter aller verrückten Formen und die Brut von Börsenwölfen:Zinstragendes Kapital, spekulative Seifenblasen und die Krise des Geldes
Universelle Aneignung einer Totalität von Produktivkräften:Kriterien für die Überwindung des Kapitalismus
Kurz lesen
War Marx ein Zwilling?
Ein Vorwort
Obwohl die Auflagen seiner Bücher an die Verbreitung der Bibel heranreichen, ist Karl Marx heute aus den Buchhandlungen fast ganz verschwunden. Eine Marx-Auswahl-Auswahl fehlt daher und könnte doch nützlich sein, vielleicht nicht zuletzt für eine junge Generation in Ost und West, die mit keiner Marx-Lektüre und keiner Marx-Diskussion mehr aufgewachsen ist, sich aber endlich einmal selber mit dem authentischen Marxschen Denken auseinandersetzen will, das angeblich beinahe die Weltgeschichte ruiniert hätte. Es hat schon viele Editionen Marxscher Texte gegeben, wobei meistens ein Verständnis still Voraussetzung war, das Marx mit dem „Marxismus“ der sozialistischen Arbeiter- und Staatsparteien indentifizierte. Heute ist dieser Sozialismus ebenso mausetot wie die Arbeiterbewegung. Die Formeln des „Standpunkts der Arbeit“ und des „Klassenkampfs“ sind altertümlich geworden; sie lösen keine positiven oder negativen Leidenschaften mehr aus und reizen nur noch zum Gähnen.
Aber dabei handelt es sich lediglich um eine bestimmte Lesart der Marxschen Theorie und um einen bestimmten Strang seiner Argumentation, der in der Tat an eine jetzt vergangene (wenngleich noch ganz und gar unbegriffene) Epoche gebunden und daher heute nichts als Theoriegeschichte ist. Das ist allerdings bloß der halbe Marx, gewissermaßen nur der eine der Zwillinge. Den wenigsten ist heute noch bekannt, dass Marx von sich selbst gesagt hat: „Ich bin kein Marxist“. Denn er spürte durchaus, dass seine theoretischen Erkenntnisse ziemlich eindimensional, verengt, verhunzend und ignorant geistig verarbeitet und verbreitet wurden. Und dazu trug er sogar selbst, einmal der bestehenden Lage entsprechend und zum anderen wegen seiner eigenen inneren Widersprüchlichkeit, bei. Denn es gab auch immer schon von Anfang an den in der Versenkung verschwundenen und ganz unausgeleuchteten Ansatz radikal kritischer Theorie eines „anderen“ Marx, der dem „Arbeiterbewegungsmarxismus“ bis heute ebenso fremd und unheimlich geblieben ist wie den sozialistischen Rechtfertigungsideologen in den Jahrzehnten des Kalten Krieges. Bis jetzt ist noch nicht versucht worden, eine Edition speziell dieses unbekannten Marx und seiner ganz anderen Kapitalismuskritik gewissermaßen aus seinen hinterlassenen erheblichen Textmassen heraus zu präparieren. Solange sich die Marx-Rezeption im Wesentlichen auf den Kontext der bisherigen Modernisierungsgeschichte beschränkte, bestand dazu auch gar keine Veranlassung. Im Gegenteil hat man hüben wie drüben nur allzu gern alles an der Marxschen Theorie verdrängt oder versteckt gelassen, was sich für die Erfordernisse der politischen Auseinandersetzung und der Legitimation von Interessenpositionen als zu sperrig erwies. Es ist jedoch gerade dieses ins Dunkel getauchte Alter ego des ganzen, sozusagen janusköpfigen Marx, das für die Zukunft noch bedeutend werden kann.
Die Marxtexte, auf die in diesem Lesebuch an den verschiedenen Stellen verwiesen wird, sind deshalb bewusst aus dem Zusammenhang mit der arbeiterbewegungsmarxistisch kompatiblen Marxschen Textmasse herausgeschnitten. So wird vielleicht der Vorwurf nicht ausbleiben, die hier zur Lektüre vorgeschlagenen Texte seien eben aus dem Zusammenhang gerissen. Deshalb gleich vorweg das Geständnis: Genau darin besteht auch die Absicht, nämlich die aus der offiziellen Debatte weitgehend herausgehaltene „andere“, viel radikalere Kapitalismuskritik des unbekannten Marx aus dem Zusammenhang des gegenstandslos gewordenen Partei- und Arbeiterbewegungs-Marx herauszureißen, kenntlich zu machen und damit zuzuspitzen.
Natürlich kann das nur unvollkommen und ansatzweise gelingen; auch kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Manchmal lässt es sich einfach nicht vermeiden, dass auch der „offiziöse“ Marx in dieser Auswahl erscheint, seine Ausdrucksweise zweideutig, unvollständig oder widersprüchlich wirkt. Umgekehrt, wer ein Interesse am ganzen, in seiner Widersprüchlichkeit unverkürzten Marx hat, und eine „wissenschaftlich“-philologische Lektüre bevorzugt, der sei auf die herkömmlichen Marx-Editionen verwiesen, insbesondere auf die berühmten „blauen Bände“ der MEW (Marx-Engels-Werke) der ehemaligen DDR (ein Tipp für junge Wissbegierige: Mal nachfragen, was die 68er „Realo“-Väter und -Mütter – oder sind es langsam schon die Großeltern? – so alles im Keller deponiert haben), oder gleich auf das allerdings noch lange nicht abgeschlossene Jahrhundertprojekt der MEGA (Marx-Engels-Gesamtausgabe), das trotz des verständlichen Desinteresses der „Siegerideologen“ mit internationaler Unterstützung weitergeführt werden kann. Wenn Du Dir „Marx lesen“ von Robert Kurz, Eichborn-Verlag, 2001, die wichtigsten Texte von Karl Marx… im Internet (meist gebraucht) beschaffen kannst, schätze Dich glücklich. Das vorliegende Heft beinhaltet alle kommentierenden Texte von Robert Kurz aus seinem genannten Buch. Lesebücher zur Einführung hingegen sind heute mehr als dünn gesät, und sie genügen vor allem nicht den Erfordernissen einer qualitativ neuen Marx-Renaissance für das 21. Jahrhundert. Deshalb ist die mit diesem Lesebüchlein vorliegende Auswahl nachzuschlagender Marx-Texte für Leserinnen und Leser gedacht, die weniger ein akademisches, philologisches Interesse an Marx haben, sondern ihn als kritischen Theoretiker kennen lernen wollen, der auch nach dem Ende von Arbeiterbewegung und Realsozialismus noch etwas zu sagen hat – und vielleicht jetzt erst das Entscheidende. Auch wenn diese Marx-Texte und ihre Argumentationen Mosaiksteinchen sind – es ist immer noch der originäre Marx, der hier spricht. Freilich nicht mehr so sehr der Marx des „Klassenkampfs“, sondern der Marx einer Kritik an der Irrationalität des modernen warenproduzierenden Systems, nicht mehr der „Klassentheoretiker“, sondern der „negative Systemtheoretiker“. Und natürlich ist von vornherein klar, dass ein solches Lesebuch keine „heiligen Schriften“ mehr präsentiert. Man muss es endlich einmal zugeben: Marx ist nicht nur widersprüchlich und ein „doppelter Marx“, also gewissermaßen Zwillinge, er kann auch ein unglaublicher Langweiler sein. Über weite Textstrecken entwickelt er mit äußerster Umständlichkeit Argumentationen, die man kürzer und klarer formulieren könnte. Und oft verbeißt er sich derart in eine langatmige Polemik gegen längst vergessene kleine Lichter, dass man ihm zurufen möchte: Nun mach mal ein Ende, der Gegner liegt doch längst am Boden. Diese eigentümliche Weitschweifigkeit, Redundanz und Verbissenheit ist vielleicht einer Ahnung geschuldet, dass seine Theorie auf etwas verweist, was uneingelöst bleiben musste und bis heute noch unentbunden in der Hülle des 19. Jahrhunderts schlummert. Gerade dort aber, wo Marx‘ Kritik explizit über seine Epoche hinausweist, verändert sich sogar sein Stil: er wird messerscharf, apodiktisch, wuchtig, unwiderstehlich, eben weil er an uneingestandene Tabugrenzen der Moderne rührt und sich darüber hinwegsetzt. Es sind diese Formulierungen des Zur-Sprache-Bringens von innerkapitalistisch Unsagbarem, die noch heute Herzklopfen verursachen, weil sie auch nach 160 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes „unerhört“ klingen und das Selbstverständliche, Verinnerlichte in Frage stellen.
Natürlich muss die kritische Theorie des 21. Jahrhunderts über Marx hinausgehen. Das ist zwar schon oft gesagt worden. Aber im Zuge eines positiven Bezugs auf die bisherige Modernisierungsgeschichte entpuppte sich dieses vollmundige Postulat regelmäßig als ein kläglicher Rückfall hinter Marx, als Versuch, seine kritische Theorie mit positivistischer Methodologie zu verballhornen, sie in die Volkswirtschaftslehre einzuvermeinden, die Kritik der politischen Ökonomie durch eine „marxistische“ Politökonomie zu ersetzen und an die Erfordernisse parlamentarischer Politik anzupassen, mit einem Wort: jede Erinnerung an den unangenehmen „anderen“ Marx loszuwerden und sich mit allzu bescheidenen alternativen Konzepten mitten im Kapitalismus pudelwohl (oder im Staatskapitalismus elend) zu fühlen. Um überhaupt jemals über Marx hinauszukommen, ist es dagegen unabdingbar, gerade an die verpönte und mit verlegenem Gestammel weggeschobene Seite seiner Theorie anzuknüpfen. Um Marx wirklich überwinden zu können, muss man auf seinen Schultern stehen können, statt ihm bloß den Buckel runterzurutschen.
Es gibt längst Hinweise darauf, wo es nach Marx weitergehen muss. So zeigt sich im Geschlechterverhältnis ein wesentlicher Aspekt kapitalistischer Vergesellschaftung, zu dem „der Mann Marx“ wenig oder nichts gesagt hat. Im Zusammenhang damit wird eine kritische Theorie zu entwickeln sein, wie heute kapita- listische Individuen und ihre Subjektivität hergestellt werden. Auch die Kritik an der Zerstörung der Naturgrundlagen durch die betriebswirtschaftliche Externalisierung von Kosten, bei Marx immerhin schon kurz angedeutet, harrt ihres konsequenten begrifflichen und analytischen Bezugs auf die Formen kapitalistischer Rationalität. Das Ausbrennen der „Arbeitsgesellschaft“ und die damit verbundene Krise des Geldes, wie sie in großen Weltregionen bereits das dramatische Ende der Moderne eingeläutet hat, setzen das Weiterdenken der noch längst nicht erledigten Marxschen Krisentheorie auf die Tagesordnung. Es wird immer offensichtlicher, dass die großen Fragen der kommenden Jahre und Jahrzehnte zwar jenseits des Marxismus von Arbeiterbewegung und Staatssozialismus liegen, aber trotzdem innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsformen niemals zu bewältigen sein werden. Der Anschluss an die verdrängte radikale Kritik des anderen Marx kann sich gerade in dieser Hinsicht als fruchtbar erweisen.
Das vorliegende Lesebüchlein wendet sich daher als erste Hilfe an alle, die auf diese erratische Gestalt trotz ihrer antiquierten Vollbärtigkeit wieder neugierig geworden sind und die noch einmal etwas Neues vom alten Marx lernen wollen. Es kann ein Wiedereinstieg für die Älteren sein, denen das Bedürfnis nach theoretischer Reflexion noch nicht abhandengekommen ist und die sich, vielleicht zögernd, doch noch zu einer kritischen Aufarbeitung ihrer „marxistischen“ Vergangenheit und Jugendsünden entschließen möchten, anstatt sie einfach zu entsorgen. Und es kann ein Einstieg sein für die Jüngeren und Jüngsten, von denen unsereins wenig weiß, die sich aber ganz unbelastet von irgendwelchen marxistischen Vergangenheiten ganz frisch und historisch unschuldig eine radikale Kritik aneignen können, die womöglich ihrem wirklichen Lebensgefühl mehr entspricht als die Angebote des kapitalistischen Medienbetriebs.
Der Mensch hat immer noch den Fehler, dass er denken kann. Und so ist dieses Heft auch mit der vagen Hoffnung verbunden, dass es geistige Nahrung liefert für eine soziale Bewegung, die noch verborgen im Schoß der näheren Zukunft schlummert. Es ist die Hoffnung, dass es bereits heute jede Menge Menschen gibt, die trotz allen Geredes von der „Alternativlosigkeit“ der herrschenden Weltordnung den Kapitalismus mit seinen verrückten Anforderungen bis oben hin satthaben.
Schau Dir also zunächst in den einzelnen Textabschnitten die dort aufgeführten Marx-Schriften an und sieh zu, ob und dass Du sie Dir auf irgendeine Weise verfügbar machen kannst; ausleihen wäre z.B. prima. Aber selbst dann, wenn Du das nicht schaffst, wird Dir die Lektüre der hier folgenden, Marx jeweils kommentierenden Texte ein Wissen vermitteln, das Dich in die Lage versetzt, zu erkennen, wie irreal, um nicht einfach zu sagen, wie verrückt die kapitalistische Vergesellschaftung der Welt ist. Darüber hinaus wirst Du wissen, welche Vielfalt radikaler Änderungsmöglichkeiten besteht.
Lass uns hier starten mit der Einführung:
Das Schicksal des Marxismus – Marx lesen im 21. Jahrhundert
Totgesagte leben länger. Karl Marx wurde als kritischer und wirkmächtiger Theoretiker schon mehr als einmal totgesagt, und jedes Mal ist er dem historischen und theoretischen Tod von der Schippe gesprungen. Das hat einen einfachen Grund: Die Marxsche Theorie kann in Frieden nur sterben zusammen mit ihrem Gegenstand, der kapitalistischen Produktionsweise. Dieses gesellschaftliche System ist „objektiv“ zynisch, strotzt geradezu von derart unverschämten Verhaltenszumutungen an die Menschen, erzeugt zusammen mit einem obszönen und geschmacklosen Reichtum derartige Massenarmut und ist in seiner blindwütigen Dynamik von solch unerhörten Katastrophenpotenzen gezeichnet, dass seine schiere Weiterexistenz unvermeidlich stets von neuem Motive und Gedanken radikaler Kritik hervortreiben muss. Und das A und O dieser Kritik ist nun einmal die kritische Theorie jenes Karl Marx, der schon vor über 160 Jahren die destruktive Logik des kapitalistischen Akkumulationsprozesses in ihren Grundzügen unübertroffen analysiert hat.
Aber wie für jedes theoretische Denken, das über das Verfallsdatum eines bestimmten Zeitgeistes hinausreicht, gilt auch für das Marxsche Werk: es bedarf immer einer jeweils neuen Annäherung, die neue Seiten entdeckt und alte Interpretationen verwirft. Und nicht nur Interpretationen, sondern auch bestimmte zeitgebundene Elemente dieser Theorie selbst. Jeder Theoretiker hat mehr gedacht, als er selber wusste, und eine widerspruchsfreie Theorie wäre nicht ernsthaft eine Theorie zu nennen. So haben nicht nur einzelne Bücher ihre Schicksale, sondern auch große Theorien. Es entwickelt sich immer ein Spannungsverhältnis zwischen einer Theorie und ihren Rezipienten, Anhängern wie Gegnern, in dem sich der innere Widerspruch der Theorie entfaltet und damit erst Erkenntnis befördert.
Marx und der postmoderne Abgesang auf die „Großtheorie“
Statt sich dem Problem der historischen Prozesshaftigkeit von Gesellschaftstheorie am Anfang des 21. Jahrhunderts neu zu stellen, möchte das sogenannte postmoderne Denken die Dialektik von Theoriebildung, Rezeption und Kritik einfach stillstellen. Gerade die Marxsche Theorie wird nicht mehr anhand ihrer Inhalte überprüft, in ihren historischen Bedingungen analysiert und damit weiterentwickelt, sondern a priori in ihrem Anspruch als sogenannte „Großtheorie“ verworfen. Diese falsche Bescheidenheit, die das große Ganze der kapitalistischen Vergesellschaftungsformen nicht mehr als solches in den Blick nimmt, sondern bloß verdrängt, fällt unter das Niveau gesellschaftstheoretischer Reflexion überhaupt. Die Vogel-Strauß-Politik eines derart freiwillig reduzierten und abgerüsteten Denkens verkennt, dass die Problematik sogenannter Großtheorien und Großbegriffe nicht von ihrem realen gesellschaftlichen Gegenstand zu trennen ist. Die Anmaßung, das Ganze erfassen zu wollen, wird durch die gesellschaftliche Realität geradezu provoziert. Das negative Ganze des Kapitalismus hört in seiner Realexistenz nicht zu wirken auf, nur weil es begrifflich ignoriert wird und weil wir nicht mehr hinschauen sollen: “Die Totalität vergisst euch nicht“, wie zu Recht der englische Literaturtheoretiker Terry Eagleton höhnte.
Die postmoderne Kritik der Großtheorie, von vielen Ex-Marxisten dankbar als vermeintlich entlastende Denkfigur aufgenommen, verweist nicht so sehr auf ein affirmatives, apologetisches Denken im herkömmlichen Sinne, sondern eher auf die Verzweiflung einer Gesellschaftskritik, die aus der Bahn geworfen ist und vor einer Aufgabe zurückscheut, die ihr bisheriges Fassungsvermögen übersteigt. Es handelt sich um ein Ausweichmanöver, das nur vorübergehenden Charakter haben kann; das kritische Denken wird unerbittlich wieder zurückgeführt in der Hürde, die es zu überspringen hat. Und diese Hürde ist offenbar vor allem deswegen so schwer zu nehmen, weil das bisherige marxistische Denken dabei auch über seinen eigenen Schatten springen muss. Man könnte diese etwas seltsam klingende Metapher auch durch eine andere ersetzen: Der Marxismus hat eine Leiche im Keller, die nicht länger versteckt gehalten werden kann. Mit anderen Worten: Der Widerspruch zwischen der Marxschen Theorie und ihrer Rezeption durch die alte Arbeiterbewegung sind ebenso wie die Widersprüche innerhalb der Marxschen Theorie selbst am Anfang des 21. Jahrhunderts so weit herangereift, dass die Reaktivierung dieser Theorie, ihre erneute Aktualisierung, nicht mehr in der bisherigen Weise zu haben ist.
Nach dem Jahrhundert der Arbeiterbewegung
Wenn der voreilig totgesagte Marx in der Vergangenheit immer wieder quicklebendig auf der Matte stand, dann fanden diese Auferstehungen jedes Mal im Binnenraum einer Epoche statt, die man das „Jahrhundert der Arbeiterbewegung“ nennen könnte. Es scheint heute evident, dass diese Geschichte abgeschlossen ist. Ihre Motive, theoretischen Reflexionen und sozialen Handlungsmuster sind in gewisser Weise unwahr geworden. Sie haben ihre Zugkraft verloren, das Leben ist aus ihnen entwichen, und sie bieten sich uns dar wie unter Glas. Dieser Marxismus ist nur noch ein langweiliges Museumsobjekt. Aber damit ist noch lange nicht geklärt, warum das so ist. Die eilige Abwendung der ehemaligen Anhänger hat daher etwas Verlogenes an sich, der voreilige Triumphalismus der ehemaligen Gegner etwas Albernes. Denn mit dem unbegriffenen Ende einer unaufgearbeiteten Epoche haben sich die in dieser Geschichte herangereiften Probleme ja nicht in Wohlgefallen aufgelöst, sondern im Gegenteil auf eine neue, noch unerkannte Weise dramatisch zugespitzt. Fast scheint es so, als wäre diese vergangene Epoche nur das Verpuppungsstadium oder die Inkubationszeit einer qualitativ neuen weltgesellschaftlichen Großkrise gewesen, deren Natur man in theoretischer Hinsicht auch nur mit entsprechenden Großbegriffen und in praktischer Hinsicht nur mit einer entsprechend grundsätzlichen gesellschaftlichen Umwälzung beikommen kann. Die allenthalben grassierende, alle möglichen Versatzstücke vermengende Religion eines marktwirtschaftlich-demokratischen „Pragmatismus“ wirkt angesichts der realen Lage wie der Versuch, auf Aids mit Klosterfrau Melissengeist oder auf die Explosion eines Atomreaktors mit einem Löschzug der freiwilligen Feuerwehr zu reagieren.
Verräterisch ist, dass der Zentralbegriff dieser pragmatischen Quacksalber-Philosophie von Wissenschaft, Politik und Management, nämlich die rituelle Beschwörungsformel der „Modernisierung“, kaum weniger unglaubwürdig, leer, tot und museal erscheint als die Großbegriffe des alten Arbeiterbewegungsmarxismus. Das Ende der Kritik ist auch das Ende der Reflexion, und im reflexionslos dahinwurstelnden postmodernen Kapitalismus hat das Mantra „Modernisierung“ den Stellenwert einer hohlen Götzenbeschwörung angenommen. Der Begriff der Modernisierung ist nicht nur ebenso unwahr geworden wie die Begriffe des Arbeiterstandpunkts oder des Klassenkampfs. Dieser Beiden gemeinsame Bedeutungsverlust verweist auch auf ein gemeinsames Wesen und einen gemeinsamen historischen Ort des alten Marxismus und der kapitalistischen Welt. Es ist die verborgene innere Identität der verbissenen Kontrahenten, die immer dann zum Vorschein kommt, wenn sich der immanente Konflikt allein deswegen überlebt hat, weil das gemeinsame Bezugssystem brüchig wird. So gesehen kann nicht der Marxismus als integrales Moment der Modernisierung tot sein und gleichzeitig der Kapitalismus lebendig und unbeirrt eben diese Modernisierung endlos fortsetzen. Vielmehr kann es sich dann nur um ein Scheinleben in einem Zwischenreich handeln, also um eine Art Zombie-Veranstaltung ohne wirkliches Leben im Leib.
Darauf deutet auch der technologische Reduktionismus dieses von allen ursprünglich sozialen, gesellschaftsanalytischen und ökonomiekritischen Inhalten abgelösten Modernisierungsbegriffs hin. Wenn der Zugriff auf Internet und Biotechnologie schon alles sein soll, dann ist das gar nichts, weil Naturwissenschaft und Technologie nicht für sich stehen und keinen isolierten Fortschritt hervorbringen können, sondern immer nur im Kontext einer gesellschaftlichen, sozialökonomischen Entwicklung wirksam sind, die frühere Zustände überwindet. Eine bloß noch technologische Modernisierung, die den Status quo der gesellschaftlichen Ordnung nicht mehr antasten will und mit Marktwirtschaft und Demokratie das Ende der Metamorphose gesellschaftlicher Formen gekommen sieht, disqualifiziert sich selbst. Solche Überlegungen geben schon einen Fingerzeig, auf welche Weise das Ende des Arbeiterbewegungsmarxismus einzuordnen wäre. Wenn die neue, in ihren Konturen allmählich deutlich werdende Weltkrise des 21. Jahrhunderts gerade darin besteht, dass die gemeinsamen Grundlagen der bisherigen Modernisierungsgeschichte obsolet werden, dann ist damit gleichzeitig gesagt, dass sich der Marxismus der politischen und gewerkschaftlichen Linken samt seiner theoretischen Reflexion selber noch innerhalb der kapitalistischen Formen bewegt hat. Seine Kapitalismuskritik bezog sich also nicht auf das logische und historische Ganze dieser Produktionsweise, sondern immer nur auf bestimmte, jeweils durchlaufene und zu überwindende Entwicklungsstufen. Insofern war die marxistische Bewegung der Arbeiterklasse in ihrem Jahrhundert noch gar nicht der Totengräber des Kapitalismus (so die bekannte Marxsche Metapher), sondern ganz im Gegenteil die vorwärtstreibende innere Unruhe, der Lebensmotor und gewissermaßen der Entwicklungshelfer kapitalistischer Vergesellschaftung. Das marxistische „Noch nicht“ im Sinne des Philosophen Ernst Bloch bezog sich daher gegen dessen Intention in Wahrheit keineswegs auf die Emanzipation vom Kapitalismus, von seinen repressiven Formen und Grundzumutungen, sondern vielmehr auf die positive Anerkennung im Kapitalismus und auf einen Fortschritt zur Modernisierung in der kapitalistischen Hülle. Das „Noch nicht“ bezeichnete die innere Spannung des Kapitalismus selbst, aber eben noch nicht den Blick darüber hinaus, der erst an seinen historischen Grenzen möglich wird.
Die innere Ungleichzeitigkeit des Kapitalismus
Die Perspektive der immanenten „Ungleichzeitigkeit“ in der Herausbildung des modernen gesellschaftlichen Systems lässt sich auf verschiedenen Ebenen darstellen. So war die noch junge kapitalistische Produktionsweise in jenem Zeitraum des 19. Jahrhunderts, der die Lebensspanne von Karl Marx (1818 – 1883) ausmachte,