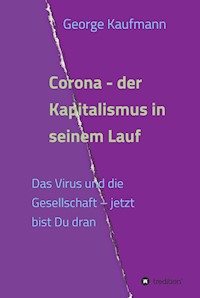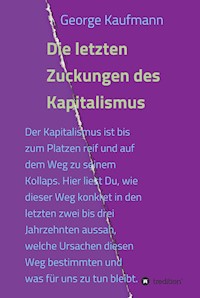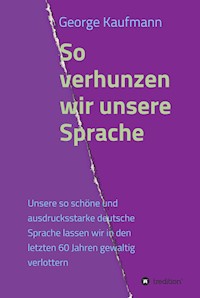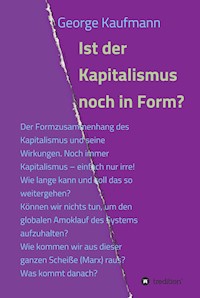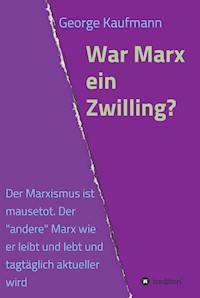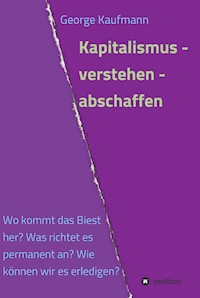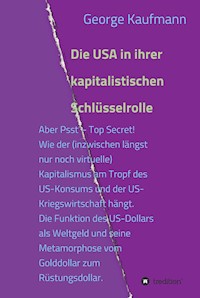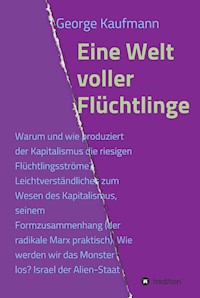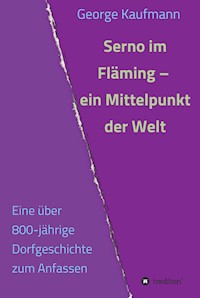
6,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses kleine Dorf befindet sich am Südrand des Flämings (Land Sachsen-Anhalt) und wurde schon vor langer Zeit als dessen Perle bezeichnet. Der Ort kam zweimal zur Welt; zunächst Anfang des 13. Jahrhunderts bis ihn die Raubritter niedermachten. Anfang des 16. Jahrhunderts erfolgte eine neuerliche Gründung. Obwohl die Entwicklung dieses Fleckchens einzig ist, unterlag sie dennoch stets dem Einfluss des Gesamtlaufs der europäischen Geschichte. Der Autor stellt die Ortsentwicklung über die vergangenen 8 Jahrhunderte sehr plastisch dar und zeigt dabei vor allem die Menschen wie sie wurden was und wie sie heute sind. Und es ist erkennbar kein Zufall, dass die Sernoer mit ihrem Dorf durchaus ein Beispiel setzen für die heutige Lage der Menschen in sehr vielen weiteren Orten. Nicht zuletzt aus dieser Sicht stimmt der Buchtitel "ein Mittelpunkt der Welt".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
George Kaufmann
Serno im Fläming – ein Mittelpunkt der Welt
Eine über 800-jährige Dorfgeschichte zum Anfassen
© 2020 George Kaufmann
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-03915-5
Hardcover:
978-3-347-03916-2
e-Book:
978-3-347-03917-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Ein Vorwort
Serno? Hä? Noch nie gehört! Was ist das denn? Ein Dorf? Wo soll das denn sein? Es ist (nicht ganz) einfach, hierauf Antworten zu finden. Denn soo geheimnisvoll ist der Ort auch wieder nicht. Obwohl…
Ich habe in Serno (erzwungenermaßen) meine Kindheit verbracht. Sie war schwer, zugleich wunderbar und für mein gesamtes weiteres Leben im positiven Sinne prägend. Das sage ich, inzwischen vollgepfropft mit Erfahrungen, heute (2020) als alter Knacker mit fast 79 Jahren. Lass Dir von mir diesen Ort und seine Menschen vorstellen, denn er ist/sie sind im besten Sinne besonders. Und genau das wiederum macht ihn mit tausend anderen Orten und sie mit allen Menschen gemein. Ich will versuchen, für Dich stets das jeweils Besondere mit dem jeweils Allgemeinen zu verbinden. Manche würden es Dialektik nennen. Schließlich wird‘s wohl eine tiefe Verbeugung vor all „meinen Leuten“ in Serno und ein besonderer Blick durch eine ebenso besondere Lupe, die auch ihnen noch Neues und Interessantes über ihr eigenes Leben zeigt.
Zunächst möchte ich mich aber bei „meinen“ Sernoern ganz herzlich bedanken. Seit sie von meinem Buchvorhaben wussten, erfuhr ich ihre Unterstützung. Es war mir das reinste Vergnügen, mich nach über 65 Jahren immer wieder mit ihnen zu treffen und in die fernere und nähere Vergangenheit ihrer Dorfgeschichte abzutauchen, sowie die vielfältigen Ereignisse auszubuddeln und zu beleuchten. Stellvertretend für alle nenne ich hier: Balzers Günter; Brockhausens Margitta und Exners Sieglinde mit ihren Familien; Glöckners Otto; Hennigs Lieselotte, Wilfred und ihren Sohn Bernd; Herdens Stephan; Hörnickens Inge und Hans mit ihrer Familie; Hollwitzns Manfred; Markgrafs Horst; Michalskis Ute; Nösslers Klaus, Bernd und Peter mit ihren Familien; Preiß‘ Jutta; Schubotz‘ Willi; Steinigs Günter.
Inhalt
Ein Vorwort
Kleine Einstimmung
Das Große und Ganze in der Gründungs-Zeit Sernos im Fläming
Die Gründer Sernos (Zernov)
Die Namen unserer Zernover
So etwa erfolgte die Gründung als Zernov
Zernov und seine sprachliche Entwicklung
So bestritten sie ihren Lebensunterhalt
Und so siedelten sie
Ein Blick in die Persönlichkeit unserer Zernover
Ihre Ernährung
Die Mühle, der Sernoer Namensgeber
Doch Zernov kam zu Tode
Wie konnte es mit Zernov soweit kommen? Was waren Ritter für Leute? Woher kam das Rittertum überhaupt?
So entstand Sernowe; gewissermaßen als „Zernov“ 2.0
Das Geld übernimmt die Herrschaft
Der erste „Bürgermeister“
Das Sernoer Sprech
Was können wir heute über Sernowe sagen?
Steinmetze für die Mühlensteine?
Die Jagdfron
Die Strafen der frühesten „Stasi“
Die Sernower und ihre Tiere
Die Erfindung der „Arbeit“
Kriege ohne Ende
Berühmte Sernoer Sehenswürdigkeiten
Saustein, Krisenstein und Tränkepuhl
Die Sernoer Kirche
Das Vorwerk konkret, sein Ende und der darauf folgende Häuserbau-Mut der armen Schlucker
Die Sernoer und der 1. Weltkrieg
Die Zwischenkriegszeit und ihr Resultat für Serno
Der Mensch Gerhard Krämer
Serno, die Flüchtlinge und ich
Motte
Unser Kindergarten
Die „Russen“ und meine Glatze
Entwicklung von vier Sernoer Familien seit Ende des 2. Weltkriegs
Familie Hennig
Familie Bücher
Familie Hörnicke
Familie Nössler
Im Laufe der Jahre
Serno und viele neue Wörter
Serno und seine LPG
Das politische Serno nach dem Krieg und in der DDR-Zeit
Was trieb die „Freunde“?
„Freie Wahlen“
Aufbau der Infrastruktur des Ortes
Serno wird „elektrisch“
Telefonanschluss
Straßenbau
Bahnanschluss
Busverkehr
Feuerwehr Serno
Das Sernoer Schwimmbad
Wasserleitung
Vereinsleben in Serno
Sportverein
Volkssolidarität
Der Sernoer Kleintierzüchter-Verein
Der Sernoer Heimat- und Traditionsverein e.V.
Knutfest
Kinderfasching
Osterfeuer
Pfingstfest und Pfingstgelege
Schwimmbadfest
Oktoberfest
Kranzniederlegung zum Volkstrauertag
Weihnachtsmarkt
Preisskat
Sernoer Bürgermeister
Förster in Serno
Brauchtum und Traditionen
Kinder- und Dorffeste auf dem Hurraplatz
Schlachtefeste
Frauentag in Serno
Eine Sernoer Hochzeit in den 1940er Nachkriegsjahren
Die Sernoer Jugend-Kapelle
Der Sernoer Männerchor
Gewerbe in Serno
Teerofen
Gewerbe im vorigen Jahrhundert
Die heutigen Gewerbe
Bohrungen
Kleines Fazit
Splitter
Otto Glöckner
Der Lehrer Molli
Ein Verdacht
Die Schnauze voll
Serno-Sprech
Oma Hensel
Wessen Opfer
Der Schmied Schmidt
Die Lichtenburg
Opa Emil
Ernst im Krieg
Brandkatastrophe im Sommer 2018
Einwohnerverzeichnis 1911
Einwohnerverzeichnis des Landkreises Zerbst 1919/20
Einwohnerverzeichnis des Landkreises Zerbst 1934
Literatur
Kleine Einstimmung
Serno ist ein kleines Dorf mit heute 240 Einwohnern.1 Es befindet sich am Südrand des Flämings, dieser herrlichen, etwas hügeligen Waldlandschaft. Rings um Serno wachsen seit Jahrhunderten Kiefern, Buchen und Eichen. Natürlich auch Birken, das „Unkraut des Waldes“.
Die „schöne“ deutsche Amtssprache informiert über Serno so:
Koordinaten: 52° 0′ 11″ N, 12° 25′ 20″ O. Höhe: 118 m.
Das zu 80 Prozent von Wald bedeckte Gebiet der Gemarkung Serno im Hohen Fläming erstreckt sich von der Landesgrenze zu Brandenburg bis zum Tal der oberen Rossel. Serno liegt zwischen Coswig (Anhalt) und Wiesenburg/Mark. Unweit des Nachbarorts Göritz erreicht das Geländerelief 181 Meter Höhe.
Am 1. Juli 2007 wurde die ehemals selbstständige Gemeinde Serno aufgrund einer Kreisgebietsreform vom ehemaligen Landkreis Anhalt-Zerbst in den Landkreis Wittenberg eingegliedert. Serno ist seit dem 1. Januar 2009 ein Ortsteil der Stadt Coswig (Anhalt) im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt (Deutschland).
Das Dorf hat sogar ein Wappen. Das wurde am 19. März 2008 durch den Landkreis genehmigt und im Landeshauptarchiv Magdeburg unter der Wappenrollennummer 9/2008 registriert. Die Blasonierung dieses Wappens liest sich so: „Geteilt von Silber und Grün, oben ein schwarzer Eber mit roten Hauern, unten zwischen zwei dem Schildrand nachgestellten silbernen Eichenblättern balkenweise drei silberne Längsschindeln, die mittlere verlängert.“ Blasonierung meint in der Wappenkunde (Heraldik) die fachsprachliche Beschreibung eines Wappens.
Serno führte bis Anfang der 90er Jahre ein Bildsiegel, dass einen Eber (Wildschwein) vor einem Baum zeigte. Dieses Siegelbild konnte danach in dieser Form nicht mehr für ein Wappen herhalten, weil das Motiv bereits vergeben war (Wörlitz 1994, Roxförde 1996). Da es Wunsch der Gemeinde war, sich an das alte Siegelbild so anzulehnen, dass es genehmigungsfähig ist, war eine Neugestaltung nötig, die der Magdeburger Kommunal-Heraldiker Jörg Mantzsch vornahm. Der Eber blieb zentrale Figur im Wappen. Außerdem wurden im Sinne pars pro toto Eichenblätter und die Besonderheit Sernos – das Stabgeläute der Kirche, ein technisches Meisterwerk – hinzugefügt.
Die Flagge ist Grün–Weiß gestreift. Das Gemeindewappen ist mittig auf die Flagge aufgelegt.
Ein wirklich sehr ungewöhnliches Baudenkmal ist dieses Stabgeläute der 1830 eingeweihten St.-Jacobus-Kirche. Es war eine kostengünstige Alternative zu teuren Glocken, die sich die damaligen Bewohner – Teerschweler, Köhler und Gutsarbeiter – nicht leisten konnten.
Östlich von Serno führt die Bundesstraße 107 (Coswig (Anhalt)–Wiesenburg/Mark) vorbei. Der Autobahnanschluss Köselitz der Bundesautobahn 9 (Berlin–München) ist nur wenige Kilometer von Serno entfernt. Der nächste Bahnhof befindet sich in dem sechs Kilometer entfernten Ort Jeber-Bergfrieden (Bahnlinie von Dessau-Roßlau nach Potsdam – Bahnstrecke Wiesenburg–Roßlau).
(So kannst Du das heute im Internet lesen).
Der Ort hat eine Nord-Süd-Längenausdehnung von gerade mal einem Kilometer; jeweils in Richtung Göritz, Stackelitz und Weiden gibt es kleine Stummel-Abzweige.
Der Anhaltiner2 Heimatforscher Max Kühlewind war oft mit Stock, Trinkflasche, Brotbüchse und Rucksack in den Flämingdörfern unterwegs und stöberte in Orts- und Kirchenarchiven. Über Serno schrieb er etwa 1936: „Wegen seiner schönen Lage, rings von Wald umgeben, ist Serno ein beliebtes Wanderziel für Naturfreunde. Von der Eisenbahnhaltestelle Jeber-Bergfrieden erreicht der Fußgänger das Dorf in etwa einer Stunde und vom Sitz des Amtsgerichts Coswig ist er 3 Stunden entfernt. Die meisten Bewohner des Dorfes sind auf Erwartungsmöglichkeiten aus der Forstwirtschaft angewiesen, denn die Erträge aus der kleinen Feldflur sind nur gering. Die Männer arbeiten den größten Teil desJahres als Holzfäller und auch die Frauen und Kinder tragen durchden Erlös der in den Wäldern eifrig gesammelten Beeren und Pilze zum Lebensunterhalt der Familie mit bei.“ Quelle: Stadtarchiv Coswig
1 Unter 18 Jahren: 28 Ew.; Zwischen 18 und 50 Jahren: 70 Ew.; Zwischen 50 und 65 Jahren: 83 Ew.; Zwischen 65 und 80 Jahren: 40 Ew.; Über 80 Jahre: 19 Ew. Diese Angaben stammen von 2015.
2 Die Bewohner Anhalts bezeichnen sich selbst oft als Anhalter. Mit gehörigem Augenzwinkern wird bekundet, dass dieser Begriff schon aus der Zeit der Völkerwanderung stammt. Er bezeichnete, eben augenzwinkernd, die Fußkranken der Völkerwanderung.
Das Große und Ganze in der Gründungs-Zeit Sernos im Fläming
Ehe wir uns Serno direkt anschauen, will ich Dir zunächst noch etwas zu seiner weiteren Umgebung (Fläming) und vor allem über die geschichtlichen Umstände in der Gründungszeit dieses Ortes vermitteln.
Der Fläming entstand mit der sogenannten zweiten Eiszeit (teils auch Saale-Eiszeit genannt) durch die enormen Kräfte des Eises, das sich von Skandinavien nach Süden schob und Massen von Steinen und Geröll vor sich herschob. Das geschah, nach dem was wir heute wissen, vor mehr als 300.000 Jahren und dauerte nicht weniger als 200.000 Jahre, eher noch etwas länger. Daraus konnte sich dann im Verlauf tausender von Jahren die wunderschöne Waldlandschaft entwickeln, an der wir uns noch heute erfreuen können und die wohl überhaupt die unmittelbare Ursache für die Gründung solcher Orte wie Serno war.
Naive Gemüter könnten nun vielleicht annehmen, dass dieser (herrenlose?) Wald vor über 800 Jahren für die damaligen Menschen (sie waren nach heutigem Kenntnisstand weit überwiegend slawischen Ursprungs) Anreiz gewesen sein könnte, sich mit ihm anzufreunden und von und in ihm zu ernähren. Etwa so: Irgendein pfiffiger Mensch hatte die Idee, sich mit seiner Familie und weiteren Bekannten in den tiefen Wald zu begeben, dort Rodung zu betreiben und den gewonnenen Acker zu bestellen, um von den Früchten zu leben. Das ist natürlich weit gefehlt und wir wissen es heute besser. Denn auch damals schon war in deutschen Landen jedes Fleckchen Land im Besitz verschiedener Herrscherhäuser. Die Ländereien im und um den Fläming gehörten damals weit überwiegend dem Anhaltischen Fürstenhaus und zu Teilen auch dem Deutschen Orden (Ballei3 Sachsen, die ihren Einfluss bis nach Buro und dessen Umgebung hatte); und zwar mit Mann und Maus. Das heißt, die einfachen Menschen gehörten quasi als Bestandteil zu dem Land, dass sie bewohnten und beackerten.
Wurde das Land verkauft oder verschenkt, wurden es zugleich mit dem Land auch die Menschen. Sie hatten nicht die geringste Wahl, etwas daran zu ändern; sie waren Hörige, also willenlose Unterworfene.
Für sie selbst war das von Gott gegeben.
Heute wissen wir, dass im 12. Jahrhundert überhaupt erst die bäuerliche deutsche Ost-Siedlung begann. Bis dahin gab es in diesem Raum östlich Magdeburgs kaum bäuerlichen Ackerbau. Dieser erste Schub der Ost-Siedlung umfasste in der West-Ost-Ausdehnung im Durchschnitt ungefähr 150 km (etwa Magdeburg bis Berlin) und in seiner Nord-Süd-Ausdehnung den Raum von Oldenburg an der Ostsee über Brandenburg, Leipzig, Chemnitz bis nach Hof und Eger. Im folgenden 13. und auch noch im 14. Jahrhundert weitete sich die Besiedlung nach Osten immer weiter aus.
Diese mittelalterliche Kulturausweitung und der Landesausbau durch Schaffung neuer Siedler- und Bauernstellen war allgemeineuropäisch. Er geschah aufgrund des Bevölkerungswachstums im weiter westlich gelegenen sogenannten Altsiedelland und setzte, nach einer Frühphase seit dem 7. Jahrhundert, verstärkt ab Mitte des 10. Jahrhunderts zunächst in Katalonien ein. In zeitlichen Schüben wurde diese agrarische Besiedlung immer weiter bis nach Osteuropa vorgeschoben; um die Mitte des 14. Jahrhunderts kam sie wegen verschiedener krisenhafter Erscheinungen (Pestepidemien, Naturkatastrophen, Unruhen) im Wesentlichen zum Stillstand.
Als Teil dieser Entwicklung bezeichnet der historiographische Begriff „Ostsiedlung“ den Prozess der Besiedlung und Akkulturation (Hinzuführung zu einer Kultur), der in den Gebieten östlich der damaligen Reichsgrenze des ausgehenden 11. Jahrhunderts bis zum Finnischen Meerbusen, zum Schwarzen Meer und zur Save stattfand und vornehmlich durch die Ansiedlung deutscher Bauern, Handwerker und Kaufleute getragen wurde. Während der Hauptphase der Ostsiedlung von der Mitte des 12. bis zum Ende des 14. Jahrhunderts (also genau auch zu der Zeit der Gründung „Zernovs“) ist der deutsche Siedlungs- und Sprachraum um mehr als ein Drittel erweitert worden. Dieser hochmittelalterliche Landesausbau, an dem neben deutschen Siedlern (coloni,Theutonici) auch Landfremde (zum Beispiel Flamen, Reichsromanen, Dänen), vor allem jedoch die einheimische Bevölkerung (Slawen, Balten) beteiligt waren, bewirkte eine Um- und Neugestaltung der Wirtschafts-, Rechts- und Verfassungsentwicklung des östlichen und südöstlichen Mitteleuropa. Die Ostsiedlung verlief zwar partiell auch in Verbindung mit Eroberung und Missionierung (Gebiet zwischen Elbe und Oder, Ordensland Preußen), zum größten Teil jedoch friedlich auf Weisung der landsässigen Landes- und Grundherren.4
Insgesamt haben wir für die Zeit um 1200, also der Gründungszeit von „Zernov“, auch folgende Zahlen zur Verfügung:
Die Erdbevölkerung betrug damals lediglich etwa 360 bis 450 Millionen Menschen. Im Gebiet des heutigen Deutschlands lebten zu dieser Zeit um die 8 Millionen Menschen. Diese vermehrten sich bis etwa um 1340 auf 14 Millionen. Wir wissen heute, dass im sogenannten Spätmittelalter in den wenigen Jahren zwischen 1347 und 1353 (Pestzeit) in Europa mehr als 25 Millionen Menschen dahingerafft wurden. Dies und damit einhergehende Hungersnöte bewirkten einen Bevölkerungsrückgang. So lebten um 1470 in den deutschen Landen lediglich wieder ca. 10 Millionen Menschen. Es gab kaum einen Ort, der nicht in Mitleidenschaft gezogen war. Erst Ende des 15. Jahrhunderts erreichte die Bevölkerungszahl wieder den Stand der Zeit um 1340.
Die Einwohnerzahl in den damaligen Dörfern war sehr unterschiedlich. Es gab kleine Ansiedlungen mit fünf Höfen und etwa dreißig Bewohnern und große Dörfer mit 40 Höfen und etwa 250 Einwohnern. Die Durchschnittsgröße dürfte damals bei 10 bis 12 Höfen und etwa 70 Einwohnern gelegen haben.
Um 1150 lebten in den erst 200 deutschen Städten etwa 2 Prozent der Bevölkerung. Um 1400 waren es in den bis dahin immerhin bereits etwa 3.000 Städten schon 12 Prozent. Zum Ende des Mittelalters lassen sich die etwa 4.000 Städte in den deutschen Landen ihrer Einwohnerzahl entsprechend folgendermaßen gliedern:
2.800 Städte mit weniger als 1.000 Einwohnern
900 Städte mit 1.000 bis 2.000 Einwohnern
250 Städte mit 2.000 bis 10.000 Einwohnern
12 Städte mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern
8 Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern
(Köln, Danzig, Lübeck, Nürnberg, Straßburg, Ulm, Bremen, Magdeburg).
Von einer heutigen Millionenstadt konnten die Menschen damals noch nicht einmal träumen. Die durchschnittliche Lebenserwartung zu dieser Zeit war nicht mit unserer heutigen vergleichbar. Alt zu werden war aufgrund der kaum entwickelten medizinischen und dazu noch der abergläubischen Praktiken alles andere als leicht. Anhand von Steuerlisten können wir feststellen, dass im 14. und 15. Jahrhundert die Frauensterblichkeit im Lebensalter zwischen 20 und 40 Jahren wesentlich höher als bei den Männern war. Durch die vielen Schwangerschaften und Geburten – 20 Niederkünfte in einer Ehe waren keine Seltenheit – und die schweren körperlichen Haus- und Feldarbeiten, lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei den Frauen nur bei 29,8 Jahren. Denn Empfängnisverhütung wurde ebenso wie die Abtreibung durch den Einfluss der Geistlichen mit dem Tode bestraft. Zudem war noch die Hochzeit der Hexenverfolgungen.
Die männlichen Kinder dagegen waren wie auch heute noch besonders in den ersten zwei Jahren ihres Lebens leicht anfällig für Krankheiten. Wenn sie diese kritische Zeit überwunden hatten, erreichten sie als Männer ein Lebensalter zwischen 40 und 60 Jahren. Die hohe männliche Sterberate bei Kleinkindern drückte die durchschnittliche männliche Lebenserwartung aber auf 28,4 Jahre.
Eines von zwei geborenen Kindern starb bereits im ersten Lebensjahr. Auch in guten Zeiten starb jedes fünfte Kind, bevor es zwei Jahre alt werden konnte. Von den 20 Kindern einer damaligen Mutter erreichten letztendlich nicht mehr als 1 bis 2 Kinder das Heiratsalter. Die mittelalterliche Bevölkerung war jung. Wahrscheinlich war etwa die Hälfte der Bevölkerung jünger als 21 Jahre, vielleicht sogar ein Drittel jünger als 14 Jahre. Wir können heute gewiss zutreffend annehmen, dass die bäuerliche Ansiedlung „Zernov“ in vollem Maße Bestandteil dieses Gesamtgeschehens war.
Allerdings wissen wir nicht, was genau dazu führte, mitten im Wald am Südrand des Flämings Menschen siedeln zu lassen. Übrigens hatte der Fläming von den bereits vor mehreren hundert Jahren hier angesiedelten Flamen seinen Namen. Er bezeichnete also das Land, in dem Flamen lebten. Möglicherweise befand sich an diesem Ort auch bereits eine weilerartige Siedlung, die es damals üblicherweise gab. In ihnen herrschte zum Beispiel die Grasfelder-Wirtschaft vor; ebenso spielte Viehzucht und sogenannte aneignende Wirtschaft (Jagd, Fischerei, Bienenzucht) eine wichtige Rolle.
Seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts (hierin fällt wohl auch die Ansiedlung slawischer Bauern am Ort des später „Zernov“ genannten Dorfes) bemühten sich die Landes- und vereinzelt auch bereits Grundherren in einer zweiten Phase des Landesausbaus vorwiegend um eine wirtschaftliche Evolution ihrer Länder und Besitzungen und eine Vermehrung der Bevölkerungszahlen zur Steigerung ihrer Einkünfte.5 Das erreichten sie teils mit einheimischen Kräften durch Verbesserungen im System der bäuerlichen Frondienste und teils durch Ansiedlung von sogenannten Freien Gästen (hospites). Die damit einhergehende Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche war von einer Intensivierung und Spezialisierung der Agrarproduktion begleitet. Hierfür ersann die Wissenschaft inzwischen den Begriff „Vergetreidung“.
Höchstwahrscheinlich waren es also wohl im weitesten Sinne ökonomische Gründe, die es den damaligen Landeigentümern (ob nun konkret Anhaltisches Fürstenhaus oder Deutscher Orden) nötig erscheinen ließen, den Wald und das Land, auf dem er wuchs, zur Reichtums-Bildung in noch höherem Maße zu nutzen. Wie wir alten Dokumenten entnehmen können, hatten sie stets die konkreten Eigenschaften der Ländereien im Blick. Es ging um die Gewinnung von Holz, die Nutzung von Weiden, die Gewinnung und Nutzung von Äckern, die Verarbeitung der Ernten, das Betreiben von Fischerei, die Landgestaltung zu wirtschaftlichen Zwecken (Sümpfe trockenlegen, Moorland besiedeln und urbar machen…), Ausbeutung von Steinbrüchen, Wildbeute, Tierzucht usw.
Hier möchte ich Dir einmal den realen Vorgang einer Landveräußerung aus dieser Zeit und in der Gegend von Serno zeigen: Am 13. Dezember 1258 verschenkte Graf Bernhard I., der seit 1258 mit Sofie von Dänemark verheiratet war, das Kirchdorf Buro an den Deutschen Orden „cum omnibus attinenciis“ – (mit allem Zubehör). Heute können wir salopper sagen: „Mit Mann und Maus“. Solch ein Vorgang war damals keine Seltenheit. Das gehört auch zu der sehr spannenden Geschichte, wie die christlichen Kirchen zu ihren horrenden Besitztümern kamen. Das soll uns aber hier nicht weiter beschäftigen.
Bernhard I. (um 1220-1287, „Albrecht der Bär“ war sein Urgroßvater) war der erste Graf von Anhalt-Bernburg. Mit ihm beginnt die ältere Linie der askanischen Fürsten. Die Überlassungsurkunde ist die älteste bekannte schriftliche Erwähnung des Dorfes Buro und hat sinngemäß folgenden Wortlaut: „Bernadus, durch die Gunst Gottes Hofmeister von Anhalt, grüßt alle die dieses Schriftstück lesen werden. Da die Vergesslichkeit alles vernichtet, wenn sie nicht durch augenscheinliche Urkunden bekräftigt wird, haben wir beschlossen, diese als wahr bestätigten Akten der Nachwelt in ehrlichen Zeugenaussagen zu überliefern. Hier ist nun, was wir untersucht und im vorliegenden Schriftstück bezeugen, weil wir durch die Eingebung Gottes und zur Ehre der gesegneten Jungfrau Maria und außerdem zur besonderen Freude der Brüder des Hauses der Teutonen in Buro ein Landgut mit allem Zubehör übergeben und dieses von nun an - anstatt uns und unserenErben - unseren geliebten, oben genannten Brüdern zuschreiben. Damit dieses aber stärker und kräftiger erscheinen möge, wollen wir das mit unserem Siegel bekräftigen. Die Zeugen dieser Schenkung sind:
Herr Zabel Makecherve,
Herr Everardus von Warmestorp,
Herr Johannes von Alneborhe,
Herr Bodo,
Herr Scerfo,
der Schreiber Richardus und viele andere.
Die Akten sind hier in Berneborch, im Jahre 1258, am Tage der gesegneten Lucia (13.Dezember).
Die Brüder Graf Bernhards I. von Anhalt
Hermann, Domprobst zu Halberstadt; (+1289)
Magnus, Domprobst zu Lebus; (+1264)
Heinrich II. Graf von Aschersleben (Ascharien) traten dieser Schenkung bei.
Der 5. Bruder, Siegfried I. Graf von Anhalt (+1298), schloss sich erst am 23. Februar 1259 zu Griebo dieser Widmung an. (Griebo gehörte zu seinem fürstlichen Erbteil.)
Die Deutschordenskomturei in Buro war gegründet worden.
Curia cruciferum in Burowe, Teutonica domus in Burowe, fratres hospitalis Jerosolimitani s. Marie de domo Teutonicorum in curia Burowe, die bruder vamme Duschen hus van dem spyttale s. Marien tu Jerusallem tu dem hove tu Burow.“
(Das Siegel der Komturei in Buro soll in den Wirren des 2. Weltkrieges abhandengekommen sein.)
In ihrer Schenkungsurkunde bezeichneten sie das Objekt noch näher, nämlich „das Landgut Buro mit allem, was dazugehört, selbstverständlich auch mit den Weiden, Gehölzen, Wiesen, Fischteichen, den bebauten und unbebauten Äckern und allen Rechten, die nun bestehen". Ausdrücklich wird das mit der Schenkung verliehene Patronat über die Kirche in Buro hervorgehoben. Zwar nicht erwähnt, unterlagen die Dorfbewohner selbstverständlich ebenfalls dieser Schenkung. Als Zeugen treten in Graf Siegfrieds Urkunde die Ritter Tidericus und sein gleichnamiger Sohn aus dem Geschlecht von Burow auf. Dieses Geschlecht hatte demnach vom nun verschenkten Dorf seinen Namen.
An dieser Stelle meiner Darlegungen möchte ich Dich, um des größeren Verständnisses wegen, mit den damals über die Mark Brandenburg Herrschenden etwas bekanntmachen.
3 Ballei (historisch auch Balley) bezeichnete etwa ab dem 13. Jahrhundert einen Verwaltungsbezirk oder eine Ordensprovinz eines Ritterordens, mit meist mehreren Prioraten (Komtureien und Kommenden). Die Ballei ist wahrscheinlich der Verwaltungsorganisation Siziliens nachempfunden und hat ihre Wurzeln im Beamtenstaat der Normannen.
4 vgl. Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
5 Für uns will ich hier klarstellen: Begriffe wie „Wirtschaft“, „Ökonomie“ und „Einkünfte“ im Sinne von Geld gab es zu dieser Zeit noch gar nicht. Es sind erst später mit der kapitalistischen Entwicklung entstandene Begriffe, also heutige Begriffe. Ich verwende sie, weil sie den Text gewissermaßen mit den heutigen Lesegewohnheiten vermitteln.
Die Gründer Sernos (Zernov)
Zunächst ist hierfür „Albrecht I. von Brandenburg zu nennen. Er lebte um 1100 bis zum 18. November 1170 und wurde auch „Albrecht der Bär“ oder „Albrecht von Ballenstedt“ genannt. Er kam aus dem Geschlecht der Askanier, wurde 1134 zum Markgrafen der Nordmark ernannt und gründete im Jahre 1157 die Mark Brandenburg, deren erster Markgraf er dann war. Albrecht trieb die deutsche Ostsiedlung entscheidend voran; durch ihn kam die im Großen Slawenaufstand 983 verloren gegangene Nordmark als Mark Brandenburg faktisch wieder zum römischdeutschen Reich zurück.
Albrecht war seit 1125/1126 mit Sophie von Winzenburg, einer Schwester der Äbtissin Beatrix II. von Quedlinburg verheiratet. Sie starb zehn Jahre vor ihm. Das Paar hatte drei Töchter und sieben Söhne. Unter den wahrscheinlich zehn (möglicherweise dreizehn) Kindern waren:
• Otto I. von Brandenburg (1128–1184), Albrechts Nachfolger als Markgraf von Brandenburg.
• Hermann I. von Weimar-Orlamünde
• Erzbischof Siegfried von Bremen und Brandenburg
• Hedwig von Ballenstedt († 1203) ∞ 1147 Otto der Reiche, Markgraf von Meißen
• Adalbert von Ballenstedt († 1173)
• Dietrich von Werben († 1183)
• Herzog Bernhard von Sachsen (1140–1212)
• Gertrud ∞ 1153 Děpold, böhmischer Fürst aus dem Geschlecht der Přemysliden
Laut heutigem Kenntnisstand hatte Otto I. zwei Söhne aus erster Ehe, Otto und Heinrich und einen dritten Sohn aus zweiter Ehe, Albrecht:
• Otto II. wurde sein Nachfolger als Markgraf von Brandenburg 1184–1205.
• Heinrich, Graf von Gardelegen
• Albrecht II. wurde Markgraf von Brandenburg nach dem Tod des Bruders Otto II. 1205–1220.
Otto I. starb im Jahre 1184 und wurde in dem von ihm gestifteten Kloster in Lehnin beigesetzt.
Albrecht II. von Anhalt-Zerbst war beim Tode seines Vaters noch minderjährig, weshalb sein Onkel Markgraf Waldemar I. von Brandenburg, über ihn und seinen Bruder Waldemar die Vormundschaft übernahm. Später regierten beide Brüder gemeinschaftlich, so dass Waldemar II. in Dessau lebte und Albrecht jeweils in Zerbst oder Köthen.
In Gemeinschaft erwarben die Brüder beim Erlöschen des askanischen Stammes in Brandenburg (1320) die Oberhoheit über Zerbst, die Mark Landsberg und die Pfalz Sachsen, während Brandenburg selbst, auf welches das anhaltische Haus berechtigte Ansprüche geltend machen konnte, von Kaiser Ludwig an seinen gleichnamigen Sohn verliehen wurde.
Als später der sogenannte „falsche Waldemar" auftauchte, schien den beiden anhaltischen Brüdern die Gelegenheit günstig, ihre Ansprüche nun endlich zur Geltung zu bringen. So beteiligten sie sich auf das lebhafteste an dem Unternehmen, diesem Mann, der sich als ihr Onkel ausgab, zum Besitz der Mark zu verhelfen. Doch scheiterten ihre Bemühungen am Wankelmut und der Untreue des Kaisers Karl IV. Für ihre aufgewendeten Kriegskosten wurden ihnen jedoch einige brandenburgische Städte verpfändet. Der von allen verlassene sogenannte „falsche Waldemar“ lebte bis zu seinem Tod, von den Brüdern weiterhin stets als ihr „Onkel“ behandelt, bei ihnen in Dessau. Was wir insgesamt hieraus entnehmen können, ist, dass wir, wann immer es sich um die Kategorie „Eigentum“ handelt, zugleich auch die Kategorien „Ränkespiel“, „Betrug“, „Verrat“, „Böswilligkeit“, „Hinterlist“, „Gewalt“, „Mord“ und „Totschlag“ als Normalität vorfinden.
Der „falsche“ Waldemar war ein tapferer, unternehmender Fürst, der seine Besitzungen durch „glückliche“ Kriege mit den Nachbarn vergrößerte, durch die Bändigung des Adels seine Macht befestigte und sich im Übrigen als ein kluger, freigiebiger und prachtliebender Herr zeigte. Nachdem alle brandenburgischen Nebenlinien bis auf seinen unmündigen Vetter Heinrich den Jüngeren ausgestorben waren, rief er diesen, da er selbst keine Söhne hatte, zu sich, um neue Ränke zu schmieden, starb jedoch, noch ehe dieser mündig wurde, im Jahre 1319.
Die nun folgenden Entwicklungen sind in unserem Zusammenhang von hier ab nur noch in ihrer Allgemeinheit von Bedeutung; die Namen der sich ständig bekriegenden Fürstengeschlechter, aus welcher Verbindung gingen welche Nachkommen hervor, wer führte von wann bis wann gegen wen und warum Krieg, spielen nahezu keine Rolle mehr.
Bedeutend für uns ist jedoch, dass etwa ab dem 11. Jahrhundert, mit der Zunahme der Bevölkerung, auch die Siedlungen wuchsen und mit ihnen die durch Rodung erweiterten Anbauflächen. Es entstanden unter anderen sogenannte Reihen-, Straßen-, Anger-, Haufen- und Rundlingsdörfer. Für die Bewohner entwickelte sich diese Siedlungsform zum sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Mittelpunkt ihrer Lebensbedingungen. Die erste Ansiedlung am späteren Ort Serno erfolgte genau dort, wo heute noch die kleine Straße „Sernoer Winkel“ darauf schließen lässt, dass es sich wohl zunächst um ein Rundlingsdorf handelte, das rings um die Wasserquelle gebaut war. Genau zu bestimmen ist das wohl heute aber nicht mehr.
Wir können annehmen, dass Serno entweder eine Gründung des Anhaltischen Fürstenhauses (unter Albrecht I. der Bär -1134 bis 18. November 1170- ; oder Otto II. -1184 bis 1205- ; oder seinem Nachfolger Albrecht II. -1205 bis 1220-) oder des Deutschen Ordens war, um entweder das massenhaft vorhandene Holz zu nutzen oder Wald zu roden und Äcker zu gewinnen, um Getreide anzubauen und zu verarbeiten. Letzteres scheint eher plausibel, wenn wir uns die Wortbedeutung „Zernov“ (Mühlenstein) anschauen. Wahrscheinlich kam es dem Landbesitzer zumindest zunächst darauf an, dort bestimmte Möglichkeiten zu nutzen, Ackerland zu gewinnen, darauf Getreide anzubauen, um schließlich Mehl und daraus Brot herzustellen, um eine gewisse Zahl Menschen sozusagen als „Brückenkopf“ für eine weitergehende Erschließung oder zu seinem Vergnügen (Jagd) anzusiedeln.
Die Namen unserer Zernover
Diese Menschen trugen lediglich einen Namen (das, was wir heute „Vorname“ nennen). Denn zu dieser Zeit, etwa auch schon um das Jahr 1000, für uns heute war es das sogenannte Mittelalter, hatten nur ganz wenige Leute bereits einen „Nachnamen“ oder „Familiennamen“. Das war damals deshalb so, weil die meisten Menschen in kleinen Siedlungen (manchmal bereits Dörfer) auf dem Land lebten und alle in der Regel einen anderen (Vor-)Namen hatten. Stell dir vor, ein Dorf hieß beispielsweise Kleinfelden. In Kleinfelden lebten vielleicht 100 Menschen. Unter ihnen gab es einen namens Günter. Wenn Günter nun in das nächste Dorf ging, um etwas hinzuschaffen, brauchte er dort keinen weiteren Namen („Nachnamen“). Alle Leute im Nachbarort wussten, dass dies der Günter ist und dieser Günter kommt von Kleinfelden herüber. Hier und da hatten die Menschen auch noch Beinamen wie „Günter mit der Laute“ oder „Günter der Große“, die auf bestimmte Eigenschaften der Person hinwiesen. Angenommen, Günter wäre in eine größere Stadt gezogen. Dort gab es schon viele andere Männer mit dem Namen Günter. Zur Unterscheidung hätte man ihn wahrscheinlich nach seinem Herkunftsort oder nach einer seiner auffälligen Eigenschaften benannt: vielleicht Günter Kleinfelder oder Günter Lautenträger. Ein anderer Günter in der Stadt besaß vielleicht eine Mühle. Und sein Name? Höchstwahrscheinlich Günter Müller. Erst so um 1300 (die Siedlung „Zernov“ gab es bereits etwa 100 Jahre) kam aus Italien, Frankreich und der Schweiz schließlich die Mode, sich selbst von vornherein einen festen Nachnamen zum Vornamen zu geben. Erst ab ungefähr 1600 wurde die Führung eines Nach- oder Familiennamens und bei Ehepaaren die Führung eines gemeinsamen Ehenamens gesetzlich vorgeschrieben. In Deutschland ist es Ehepaaren seit 1994 erlaubt, ihre bisherigen Nachnamen weiterzuführen. Nur bei den Kindern besteht nach wie vor die Pflicht, sich auf einen gemeinsamen Nachnamen mit der Mutter oder dem Vater zu einigen.
Um 1200 war die materiellökonomische Reproduktion der Menschen auf das Hauswesen von Bauern, Handwerkern und Gutsbesitzern konzentriert. In diesem Kontext hatten die Geschlechter abgegrenzte, mehr oder weniger gleichberechtigte Aufgabengebiete; das patriarchalische Muster beschränkte sich damals insbesondere auf die äußere Repräsentanz dieses Hauswesens. Deshalb habe ich auch im obigen Namensbeispiel eben Günter in den Nachbarort gehen lassen und nicht seine Frau, die vielleicht Martha hieß und im Wesentlichen die Hauswirtschaft führend organisierte.
Schau Dir mal an, welche Namen den Kindern damals relativ häufig gegeben wurden. (Quelle: www.beliebtevornamen.de)
Fangen wir mit den weiblichen an: (Namensformen und Varianten mit gemeinsamer Herkunft habe ich zusammengefasst. Die jeweiligen Namensformen stehen in Klammern hinter dem geläufigsten Namen)
• Magdalen (Madalena, Madlen, Magdalen, Magdalena, Madalen, Magdalin, Magdelen)
• Applonia (Apell, Appel, Apel, Appolonia, Apolonia)
• Ursel (Ursell, Ursula)
• Otilia (Otily, Otilien, Ottilia, Othilia, Ottilg, Ottilig)
• Walburg (Walpurg, Walpurgk, Walppurgen)
• Adelhaid (Adelhait, Adelhayt, Adelheit, Alheyt, Alhayt, Alheitt)
• Geras (Jeras, Gera, Ger, Geryß, Gerhaus, Gerhauß)
• Brid (Bridlin, Brida, Breide)
• Irmel (Yrmel, Ermel, Yrmell, Irm, Irma, Irmla)
• Genefe
• Ella (Ell)
• Agatha
• Brigitta (Brigita, Brigida, Birgitta)
• Eva
• Juliana
• Affra
• Clara (Clar)
• Cecilia (Cecilie, Cecilien)
• Helena (Elen)
• Alladt (Alheit, Allet)
• Marlein
• Mechthilt (Mechthild, Mächthilt, Mecht, Mechttelt)
• Gerlin
• Metze (Metzlerlin)
• Nopricht
• Reusin (Reuss, Reussen, Reuß)
• Agth (Agt, Ägtlin)
• Duretta (Dorell, Durettea)
• Endlein
• Fronicka (Fronica, Fronicka)
• Martha (Marth)
• Gerdrud (Gertrudt)
• Jonata (Jonatha)
• Martsch
• Nopurg
• Peternella (Petternel)
Und so sah das bei den männlichen Namen aus:
• Hans (Hanns, Hanß, Hannß, Hanncz, Hancz, Hannes, Hansman, Henselman, Henslein, Henßlein, Hanss, Hansz, Hanle, Henn, Hennsel, Hennslein, Hensell, Hennsel, Heslein, Henslin, Henßlin, Hennßlin, Hennslin, Hanßlein, Hensin, Hennlin)
• Kuntz (Cuncz, Kuncz, Kuncz, Cuntz, Cuntze, Kunczlein, Cuntzlein, Contzlin, Cuntzlin, Conlin, Cunlin, Conczlin, Conczin, Concz, Conncz, Conntz, Conz, Contz, Conntz, Kunrhadt, Cunrad, Cunrat, Cunradt, Conrad, Conrade, Cunradus, Conrat, Conrle)
• Heinz (Heintz, Heincz, Heintze, Haincz, Haeincz, Haintz, Haints, Hainncz, Hantz, Henntz, Heintzlin, Haintzlin, Henrich, Heynrich, Heinrich, Hainrich, Hanrich, Hainricis, Hein, Haini)
• Fritz (Friderich, Fridrich, Fridlein, Friedlein, Frietz, Fricz, Frytz, Fritze, Fricz, Frics, Frix, Fridel)
• Jörg (Jorg, Jorgen, Jorge, Jerg, Georg)
• Peter (Petter, Petterlen, Peyr, Pett)
• Ulrich (Ullrich, Ullrych, Ulrych, Ul, Ullin, Ull, Ulle, Ullen, Ullein, Urrich)
• Claus (Klaus, Clauß, Clos, Clas, Klas, Clawß, Claws, Claslen, Claß, Cleuslin, Closlin, Klaß, Class, Klos, Nickel, Nickell, Nickles, Nicklas, Nicklaß, Niclas, Niclaß, Niclaus, Niclauß)
• Michel (Michell, Miche, Mychel, Mickel)
• Linhart (Lenhart, Lienhart, Lennhart, Linlein, Lenhartt, Lennhardt, Leonhart, Linhartt, Linhardt, Lynhart, Lynhardt, Lynhartt, Linhard)
• Herman (Hermon, Hermann, Hermo, Hermen, German)
• Jacob (Jackob, Jacopp, Jacobin)
• Endres (Enders, Enderes, Enderß, Endreß, Endereß, Ennders, Enndres, Enndris, Enderlin, Enderis, Andres, Enderlein, Enderlen, Endris, Enndreß)
• Martin (Mertin, Mertein, Merten, Marten, Mertten, Marte, Merte, Mertlin, Merthein, Mertlein, Marthes)
• Steffan (Steffen, Stepffan, Stephen, Steppfan, Steffann)
• Erhardt (Erhardt, Erhart, Erardt, Erharddt)
• Lorentz (Lorenntz, Laurencz, Laurentz, Lorencz, Lornencz, Lorncz)
• Paulus (Paul, Pauluß, Paulin, Paule, Pauls, Paulß, Pawll)
• Mathes (Mates, Mades, Madtes, Madthes, Mathews, Matheys, Mattehes, Matthes, Mathis, Matheß, Mathiß, Matthiß, Mathias, Matthis, Mathÿs, Mathes)
• Eberhart (Eberhardt, Eberardt, Eberhartt, Eberle, Eberlen, Eberlin, Eberlein, Ebberlein, Eberla, Berlein)
• Thomas (Thoman, Toman, Thomen, Tomen, Thoma, Thomo, Thomon)
• Caspar (Casper, Kasper)
• Wendel (Wenndel, Wendell)
• Bartholomeus (Bartholmes, Bartholome, Bartellmeß, Bartholomes, Bartholmeß, Barthelmus, Bartlmes, Bartelmes, Bertelmeß, Bartlmes, Parttelmes, Partelmeß, Bertholmes, Barthel, Bartlen, Bart
• Bernhard (Bernhart, Bernhardt, Bernnhart, Pernhardt, Pernhardt, Bernhardt, Bernhart, Bernhartt)
• Albrecht (Albrecht, Albretch, Abrecht)
• Wilhelm (Wilhalm, Wille, Wylhelm, Wilhem, Will, Willin)
• Ott (Ot, Ottel, Ottin)
• Berchtold (Bechtolt, Bechtol)
• Burckhart (Burckart, Burkart, Burkhart, Burk, Búrklin, Burcklin, Purckhart)
• Simon (Symon, Siman, Syman)
• Jobst (Job, Jobßlin)
• Marx
• Diether (Dieterich, Ditrich, Dietrich, Dieterlin, Diettrich, Dietz, Ditz, Dietzlin, Ditz, Ditzlin, Dyetz, Dytz, Dicz)
• Sebolt (Sebalt, Sebald, Sebatt, Sebbolt)
• Auberlin (Aulber, Auberli)
• Cristoff (Cristoffel, Cristoffell, Kristoff, Stoffel, Stoffelin, Stoppfflin)
• Sixt (Six, Syxt)
• Wolfgang (Wolffgang, Wolffganng, Wolfganng, Wollffgangk, Wolffgangk, Wolfganng)
• Johannes (Johans, Johann, Johan, Johanneß, Johanns)
• Ludwig (Ludwich, Ludwige)
• Sewolt
• Utz (Uz, Ucz)
• Wolff (Wolf, Wolfflin, Wölfflein, Wolffel, Wollff, Wolfflein)
• Veit (Veyt, Vit, Veytt, Veitt, Veyd)
• Cristan (Cristinan, Cristin, Cristman, Crista, Crist, Cristle, Krist)
• Jost (Jos)
• Sebastian (Sebastion, Sebestianus, Sewastian)
• Engelhart (Engelhart, Enngelhart, Engalhardt)
• Antoni (Anthonius, Anthenius, Anthoni)
• Gilg (Gilig, Gillg, Gilge, Jylge)
• Merckel (Mercklin, Merklin)
• Adam
• Bentz (Benlin)
• Jecklin (Jecklein, Jeck)
• Kilian (Killian, Kylian, Kylion)
• Craft (Crafft, Krafft)
• Seytz (Seytz, Seicz, Seycz, Seitz, Seyfridt, Sifridt)
• Balthasar (Balthasars, Baltasar, Balthassar, Balthaser, Baltsar, Baltsar)
• Jeronimus (Jheranimus, Jeremias)
• Frantz (Francken, Franck, Franciscus, Frank, Frencklein)
• Melchior (Melchor)
• Ewalt
• Philips (Phillips, Philipp, Philip)
• Georig (Georien)
• Lucz (Luczin, Lutzen, Lutzin, Lux)
• Ekarius (Eucharius, Eukarius, Ewkarius)
• Oswald (Oßwalt, Oßwald, Oswalt))
• Sigmund (Sygmund)
• Wernher (Wirnher, Wern, Wernlin, Wernlein)
• Alexander (Allexander, Allexannder, Sander)
• Bertholdt (Pertolt, Perttoldt, Perttolt)
• Gabriel (Gabriell)
• Bestlin (Best)
• Hug
• Lentz
• Lucas
• Seitz
• Walther (Walter, Waltter)
• Benedict (Benedickt, Benedick, Benedic)
• Eckhart (Eckart)
• Hartman (Hartmann, Haman)
• Karl (Karel, Karle, Karll)
• Augustin (Augustein)
• Blesy
• Gallus (Gall)
• Moritz (Mauricius)
• Reinhart (Rein, Reynnhart)
• Rudolf (Rudolff)
• Urban
• Urschel
• Alba
• Clewin
• Erasmus (Eraßmus)
• Felix
• Gut (Gutman)
• Honn (Honlin, Hönnlin)
• Max
• Pesolt (Pessolt)
• Ruprecht (Rueprecht)
• Schultheiß (Schulthen, Schultheß)
• Seyfrid (Sewfrid, Seuffridt)
• Vallentin
• Volckel (Wolckel)
• Wentzel
• Wernhart
• Wilbalt (Wilbolt)
• Zacharias (Zacharas)
Wie wir wissen, konnten unsere armen Siedler weder lesen noch schreiben. Und so gab es auch keine gedruckten Namenlisten, aus denen man sich einen passenden Namen für seinen Nachwuchs aussuchen konnte. Die Druckkunst wartete auf ihre Erfindung durch Johannes Gutenberg noch etwa 250 Jahre. Namen sprachen sich damals gewissermaßen herum. Beim Besuch in den Nachbarsiedlungen hörte man dies und das und auch manchen Namen, den man dann toll fand und den eigenen Kindern verpasste. Aber mal ehrlich: sind das nicht zwei prima Listen mit vielen gut auch wieder heute passenden schönen und besonderen deutschen Namen. Gewissermaßen ein Fundus, aus dem wir gut schöpfen könnten. Damit ließe sich der über uns aktuell hereingeschwappte und devot hingenommene Ami-Schwachsinn von Kevin und Co. prima vermeiden.
So etwa erfolgte die Gründung als Zernov
Die Organisationsform der ersten hier am späteren Ort „Serno“ angesiedelten Menschen war wohl die eines Vorwerks. Das ist ein landwirtschaftlicher Gutshof oder ein gesonderter Zweigbetrieb eines solchen. Der Begriff hat sich im Laufe der Geschichte mehrfach in seiner Bedeutung geändert und kann daher auf verschiedene Art verwendet werden. Ursprünglich lagen die zugehörigen landwirtschaftlichen Güter meist außerhalb von Befestigungsanlagen oder Burgen und unmittelbar davor und wurden daher häufig als „Vorwerk“ (frühere Schreibweise häufig: „Vorwerck“) bezeichnet. „Zernov“ lag also der Bernburg vorgelagert und hatte damals wohl die Aufgabe für deren Schutz und Ernährung zu sorgen. Später wurde die Bezeichnung „Vorwerk“ bis ins 18. Jahrhundert allgemein üblich für Gutshöfe mit Gutsbetrieb oder auch einzelne Meierhöfe verwendet. Auf größeren Gütern mit umfangreichen Landflächen gab es oft neben dem Hauptbetrieb kleinere und auch entfernter liegende Zweigbetriebe. Diese wurden gegen Ende des 18. Jahrhunderts hin ebenfalls häufig als „Vorwerk“ bezeichnet; im 19. Jahrhundert wurde der Begriff nur noch in diesem Sinne verwendet.
Wir wissen heute nicht genau, wie es zu dieser Ortsgründung kam, haben aber eine zumindest ungefähre Vorstellung davon, seit wann es diesen kleinen Ort schon gibt.
Serno wurde erstmalig 1213 urkundlich als „Zernov“ erwähnt, übrigens 24 Jahre früher als Berlin. Wohl erst später, im 16. Jahrhundert, nannten sie den Ort „Sernove“. Somit ist er heute (2020) 807 Jahre alt. An irgendetwas müssen wir uns ja halten. Also wurde es für uns Menschen allgemein üblich, die erste feststellbare schriftliche Erwähnung gewissermaßen als Geburtsdatum von Ortschaften anzunehmen. In den meisten Fällen ist das aber nicht exakt, denn die Orte existierten in der Regel bereits einige Zeit, ehe über sie urkundliche Einträge gemacht wurden.
Natürlich fragen wir, wie die „Gründer“ darauf kamen, ihren Ort eben gerade so zu nennen. Schauen wir uns zugleich auch die Namen einiger Nachbarorte an und deren Ursprünge, können wir etwa ableiten, was für unsere ferneren Vorfahren bedeutend war und wie sie ihr Leben bestritten:
Vgl.: Bily, Inge (1996): Ortsnamenbuch des Mittelelbegebietes, Akademie-Verlag
Außer den hier aufgeführten Wörtern mit slawischem Wortstamm sind auch nachweislich die folgenden für die Namensgebung von Ortschaften benutzt worden: grip (Schwamm, Pilz), breza (Birke), dych (Atem, Hauch), nat (Kraut, Blattwerk), werp (Aufgeworfenes, Damm), krak (Flussarm), gryza (Geröll).
Und da die deutsche Ostsiedlung in den folgenden zwei Jahrhunderten (13. und 14. Jh.) noch weiterging, sich also immer weiter nach Osten dehnte, ist es nicht verwunderlich, dass wir im heutigen Tschechien ebenfalls einen Ort Žernov (deutsch: Schernow) finden. Er wurde 1375 erstmals urkundlich erwähnt. Das Dorf gehörte in seiner Gründerzeit zur Herrschaft Riesenburg. Nachdem die Burg jedoch im 16. Jahrhundert aufgegeben worden war, kaufte Zikmund Smiřický von Smiřice im Jahre 1600 die gesamte Herrschaft Riesenburg mit allen acht zugehörigen Dörfern und schloss sie der Herrschaft Nachod an.
Aber so weit nach Osten müssen wir auf der Suche nach einem weiteren Serno gar nicht schauen. Vielen Bernburgern ist der Name „Zernitz“ noch heute ein Begriff. An der Brücke bei Aderstedt, wo die L65 die Wipper überquert, steht die „Zö(e)rnitzer Mühle“ und erinnert uns daran, dass sich in der Nähe ein Dorf namens „Zernitz“ befand. Um diesen Ort gab es sogar eine gewisse Verwirrung darüber, dass es dort offensichtlich zwei Siedlungen mit dem Namen „Zernitz“ gab, die beide in Nachbarschaft zu Aderstedt auf den gegenüberliegenden Ufern der Saale lagen. Es scheint so, dass es erst während der Entwicklung des Namens beider Siedlungen zur Vereinheitlichung der Schreibweise kam. Ursprünglich handelte es sich aber vermutlich um zwei unabhängige Plätze, deren Namen zwar ähnlich, aber nicht identisch waren. Beim „Grönaer“ Zernitz am östlichen Saaleufer erscheint die Herleitung vom urslawischen Wort für „schwarz“ (Cernik; cern) plausibel. Eine solche Deutung reiht Zernitz in eine Kette von Siedlungsnamen in der Nähe ein, die auf Brandrodungen schließen lassen, als man ab dem frühen Mittelalter den Wald auf den Hochflächen östlich der Saale in Ackerland umwandelte. Der Name der Siedlung Zernitz an der Wippermündung wird in der Forschung ebenso begründet. Vielleicht deutet aber die Bezeichnung der westsaalischen Siedlung auch auf einen anderen Ursprung, wenn man eine Herleitung vom altsorbischen Wort für „Mühle“ in Betracht zieht (zern, zrn). Zum Vergleich: Tschechisch zernov ‚Mühlstein‘, zerna ‚Handmühle‘; polnisch zarnow ‚Mühlstein‘; russisch serno ,Getreide‘). Eine Mühle wird an diesem Ort bereits 1170/80 erwähnt. Besonders aber die zweitälteste Nennung des Ortes im Jahr 1331 als „Cernquitz“ lässt dann auch an die Möglichkeit „Mühlenkiez“ denken, eine Siedlung bei der Wippermühle. An dieser Stelle möchte ich für Dich einmal herausfinden, wie sich die Sprechweise von Zernov über Sernowe bis zum heutigen Serno entwickelte.
Zernov und seine sprachliche Entwicklung
Wie bereits ausgeführt, ist unser Ortsname slawischen Ursprungs. Allein an der Endung „-ov“ oder auch „-ow“ ist das gut erkennbar. Solche Ortsnamen- und Familiennamen-Endungen finden wir heute noch vor allem in Nordostdeutschland. In Russland, der Ukraine und Polen haben wir das „-ow“, während in Tschechien und der Slowakei das „-ov“ verwendet wird. In diesen Sprachen wird der Konsonant im Auslaut auch gesprochen. In unserem nordostdeutschen Sprachraum sind Namen die auf „-ow“ enden relativ häufig. Mithin in Mecklenburg, Vorpommern, weiten Teilen Brandenburgs (in der Lausitz seltener), dem Norden und Osten der Altmark, dem Wendland und Teilen des früheren Herzogtums Lauenburg. Bei den slawischen Ortsnamen, die auf „-ow“ enden, kann es sich um unterschiedliche Bezugnahmen handeln. Hierzu ein Beispiel: obersorbisch bur (der Bauer) → burja (die Bauern) → burow (der Bauern) → deutsch Burow. Ein solcher Familienname hat demnach die Bedeutung „von den Bauern abstammend“ oder als ein Ortsname die Bedeutung „Bauernort“. Es kann aber auch etwa bei Buckow bedeuten, dass es ein Ort ist wo Rotbuchen wachsen. Ein Teil der auf „-ow“ endenden Ortsnamen in der brandenburgischen Region ist jedoch germanischen Ursprungs. Hier wurden Namen mit der Endung „-au“ (in der Bedeutung von Aue) an die dominante Schreibweise der Namen auf „-ow“ angepasst. Mehr als 400 untersuchte, auf „-ow“ endende Ortsnamen im Land Brandenburg lassen sich wie folgt klassifizieren:
• slawische Ortsnamen, von einem Personennamen abgeleitet (184 Namen, darunter zum Beispiel Bagow oder Bochow).
• slawische Ortsnamen als sogenannte Gattungsbezeichnung (166 Namen, darunter Buckow oder Grabow).
• deutsche Ortsnamen ursprünglich auf „-au“ endend (34 Namen, darunter Lindow).
• slawische und deutsche Namen, denen die Endung „-ow“ nachträglich angehängt wurde (42 Namen, davon 30 ursprünglich slawisch, zum Beispiel Thyrow).
• slawische Namen, wo „-ow“/ „-ov“ keine Endung, sondern Teil des Stammes ist (19 Namen, zum Beispiel Sacrow und eben auch Zernov bzw. Sernowe in Anhalt).
• ein Ortsname, nämlich Parlow, wurde erst später im 19. Jahrhundert von einem Familiennamen abgeleitet.
Ähnlich wie im letzten Beispiel (nur umgekehrt) sieht es mit den Ortsnamen in Mecklenburg-Vorpommern aus. Hier gibt es von Personennamen abgeleitete slawische Ortsnamen, die auf „-ow“ enden (Malchow, Torgelow, Dassow, Grabow), mit einem -„ow“ als Teil des Stammes (Wustrow) sowie einige wenige Namen ursprünglich deutschen Ursprungs auf „-au“ (Hagenow). Das stumme „w“ in diesem „-ow“ wirkt jeweils als Dehnungszeichen. Dadurch wird das vorangehende „o“ zu einem sogenannten Phonem /o:/ verlängert. Die meisten heutigen Ortsnamen, die auf „-au“ enden (von althochdeutsch ouwa: Insel, Aue) sind in frühen Quellen „-ow“, „-owe“ oder „-ouwe“ geschrieben. Dasselbe gilt für die Landschaftsbezeichnungen mit der Endung „-gau“, vor allem im südwestdeutschen und alemannischen Sprachgebiet verbreitet.
Beispiele für (historische) Schreibungen auf -ow, -owe und -gowe:
• Hanowe (Hanau), Heidenowe (Heidenau), Swabowa (Schwaben).
• Cochengowe (Kochergau), Monichgowe (Maingau), Northuringowe, Schöngowe, Sundgowe (Sundgau), Finsgowe (Vinschgau).
Das Geschlecht von Hagenau hieß eine Zeitlang Hagenowe. Wilhelm von Nassau in der niederländischen Hymne wurde Wilhelmus van Nassouwe beziehungsweise im Akrostichon Willem van Nazzov geschrieben. Der Name von Nassau an der Lahn, der ehemalige Herrschaftssitz des Hauses Nassau, erschien im Jahre 915 erstmals als Nassova. Auch eine Reihe von Orten, die auf -au enden, stammt von ursprünglich slawischen mittelalterlichen Namen auf „-ow“ ab. Die sächsische Stadt Glauchau hieß bei ihrer Ersterwähnung Gluchow. Das slawische Wort wustrow oder ostrov (Insel) wurde zu Wustrow, Wustrau oder Ostrau, wie bei der tschechischen Stadt Ostrava. Ähnlich wurde auch der deutsche Name Krakau gebildet für polnisch Kraków.
Ortsnamen, die man noch im 19. Jahrhundert häufig mit „-ow“ schrieb, wurden in der amtlichen Schreibweise zum Teil in das deutsche Suffix „-au“ geändert. So wurden die heutigen Berliner Stadtteile Spandau und Stralau bis ins letzte Viertel des 19. Jahrhunderts offiziell Spandow und Stralow geschrieben. Nicht nur in Gegenden, die bis 1815 zum Kurfürstentum Sachsen (vormals Mark Meißen) gehörten, verschwand das stumme „-w“ aus einigen Ortsnamen. Statt „-ow“ wird seitdem lediglich „-o“ geschrieben: Grabo (bei Wittenberg und bei Jessen), Dubro, Ostro, sowie mehrere Dörfer nördlich von Roßlau, zu denen auch Serno gehört. Ebenso gibt es in der Niederlausitz eine Reihe von Orten mit dieser Schreibweise, beispielsweise Meuro, Sauo oder Horno. (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/-ow)
Was können wir nun hieraus für unser kleines Dorf Serno schlussfolgern? In der Zeit seiner Erstgründung um 1200 wurde der Name Zernov wohl auch vollständig so bis zum „v“ gesprochen; zumindest im Anhaltischen Fürstenhaus, das für diese Ansiedlung sorgte. Hinsichtlich des „Z“ können wir annehmen, dass unsere Leute auch damals bereits mit den Zischlauten ihre Probleme hatten, was ja auch heute noch so ist. Schau Dir eine der häufigen Kochsendungen im Fernsehen an. Dort hörst Du immer wieder, dass selbst ein erheblicher Teil der sogenannten Sterne-Köche dass stimmlose „ß“ im Wort „Soße“ nur stimmhaft sprechen kann, ähnlich wie bei „soso“. Ob jedoch unsere armen Siedler das „Z“ als solches sprachen oder eher als „S“ oder gar als „Sch“ wissen wir nicht. In diesem Sprechzusammenhang ist auch interessant, wie damals ein Datum benannt wurde. Ein Beispiel für einen Brief aus dem Jahr 1314: „Dieser Brief ist gegeben am Hof zu Bernburg, nach der Geburt unseres Herrn Tausend Jahre, Dreihundert Jahre, in dem 14. Jahre am Dienstag vor Himmelfahrt unseres Herrn“. Wenn wir nach dem „Ewigen Kalender“ annehmen können, dass Himmelfahrt in diesem Jahr auf einen Donnerstag, den 24. Mai fiel, war der Dienstag vor Himmelfahrt der 22. Mai. Der Brief ist also vom 22.5.1314. Heute können wir mit großer Gewissheit annehmen, dass unsere Zernover auf die Frage nach einem Datum nichts hätten sagen können. Sie wussten entweder gar nicht, wovon die Rede ist, oder verwiesen uns an die „gelehrte“ Obrigkeit oder Geistlichkeit, denn derart abstrakte Dinge, wie ein Datum, spielten für sie wohl keine Rolle. Ihre zeitliche Orientierung erfolgte nach dem natürlichen Verlauf der Jahreszeiten. Die Beobachtung und Beachtung von Sonne, Mond, Tageslicht, Wetter… waren für sie existentiell. Und selbstverständlich hatten sie auch die zeitlichen Vorgaben des Fürstenhauses genauestens zu befolgen.
Für die zweite Ansiedlung im 16. Jahrhundert und den dafür überlieferten Ortsnamen Sernowe ist zu vermuten, dass die Endung „-owe“ wie in vielen anderen Fällen entweder ebenfalls als „-au“ gesprochen wurde, woraus dann später durch eine gewisse Nachlässigkeit in der Aussprache nur noch ein „-o“ blieb oder, dass das eigentlich stumme „w“ in diesem „-owe“ wie oben beschrieben wie ein Dehnungszeichen wirkte und dadurch das vorangehende „o“ zu einem sogenannten Phonem /o:/ verlängert wurde. Letztlich wurde dann etwa ab dem späten 18./frühen 19. Jahrhundert nur noch das einfache Serno gesprochen, wie es heute noch üblich ist.
Besiedelungsgeschichtlich bedingt ist die Basis des heute noch hier gesprochenen Dialekts die sogenannte Unterschichten-Sprache „Platt“. Etwa entlang der Städte Wernigerode – Aschersleben – Schönebeck – Roßlau existiert eine gedachte Sprach-Trennlinie. Diese Linie wird im Volksmund auch ikich-Linie genannt. Südlich davon werden mitteldeutsche Dialekte gesprochen. Westlich der Saale handelt es sich dabei um Thüringisch, östlich davon um Obersächsisch. Die Dialekte Sachsen-Anhalts gehören zu den sogenannten „Appel-Dialekten“. So sagt beispielsweise ein Dessauer Mundartsprecher zwar „ich“, aber anstelle des Wortes „Apfel“ verwendet dieser das unverschobene „Appel“. Noch heute sehen wir eine sehr differenzierte Aussprache des G-Lautes in der Region: Nicht nur die Magdeburger, sondern auch unsere Sernoer sprechen das G auf fünf verschiedene Arten, aber G ist jedes Mal überhaupt nicht dabei! Diese fünf Arten kommen zum Beispiel in der Wortgruppe „Vogelgesang in Magdeburg“ vor. (Sprich: Voreljesank in Machteburch. Das „r“ steht hier nicht für einen „gerollten“ Laut, sondern für einen sogenannten Frikativ, wie das niederländische „g“, das erste „ch“ ist am weichen Gaumen, das zweite „vorn“ (am harten Gaumen) zu sprechen.
Die ik/ich-Linie ist, nebenbei gesagt, die berühmteste Sprachlinie des deutschsprachigen Raumes. Sie spaltet Sachsen-Anhalt quer in zwei Hälften: von Benneckenstein über Hasselfelde, Gernrode, Aschersleben, Brumby, Calbe/Saale bis Coswig und Wittenberg. Nördlich der Linie sagen die Menschen „ick“, südlich davon „ich“.
Und so siedelten sie
Wie waren nun unsere Leute, als sie diesen Ort zu besiedeln hatten. Denn auch diese Ansiedlung geschah, wie damals gar nicht anders möglich, auf Anweisung des Anhaltischen Fürstenhauses, also entweder durch Otto II., seinen Nachfolger Albrecht II. oder sogar bereits wesentlich früher durch Albrecht I. den Bären. Wir können durchaus annehmen, dass es dort möglicherweise bereits einen Weiler, also wenigstens ein paar Leute gab. Da hier ein ausgedehntes Waldgebiet mit reichlichem Wildbestand vorhanden war, kam der große herrschaftliche Tross vom Bernburger Fürstenhaus bestimmt gerne zu großen, vergnüglichen Jagden hierher, zu denen er jeweils wohl auch noch viele fürstliche und geistliche Gäste mitbrachte. Dabei vergnügte man sich beim Feuer und tat sich an gebratenem Wild und berauschenden Getränken gütlich. Es war einfach nur günstig, dort an Ort und Stelle ein paar Leute zu halten, die auf die umfangreichen Jagdutensilien und deren Wartung, Getränke, Geschirr, Jagdhunde… aufpassten, um solche Dinge nicht immer aufs Neue in erheblichem Umfang die lange Strecke mitten durch den Wald von Bernburg her und wieder zurück schleppen zu müssen; ordentliche Straßen über Land gab es ja noch nicht.
Dieser Weiler war in erster Linie eine Wohnsiedlung, die aus nur wenigen Gebäuden bestand. Ein Weiler an sich ist kleiner als ein Dorf, aber größer als eine Einzelsiedlung. Für unseren Weiler können wir annehmen, dass er aus ein oder zwei Wohngebäuden (wahrscheinlich Holzhütten, wie ich Dir noch zeigen werde), ein paar Ställen für Kleinvieh und Hunde, diesen und jenen Schuppen für die gräflichen Jagdutensilien, Holz und Werkzeug, sowie ein paar kleinen Anbauten und einem Keller zur Aufbewahrung von Lebensmitteln, Gefäßen usw. bestand. Es mögen höchstens 10 Menschen gewesen sein, die hier auf diese Weise ihr Dasein fristen mussten.
Das Wort Weiler leitet sich aus der Form wiler (mittelhochdeutsch) ab und ist die eingedeutschte Form des Wortes villare (mittellateinisch), was „Gehöft“ bedeutet. Dieses Wort für eine kleine Ansiedlung geht auf die Tatsache zurück, dass die nahe der herrschaftlichen Landhäuser (villa) erbauten Unterkünfte für das Personal ebenfalls zur villa gerechnet wurden und das Wort letztlich das gesamte Gebäude-Ensemble benannte.
Unsere Ansiedlung gehörte also, obwohl relativ weit von Bernburg entfernt, von Anfang an direkt zum Eigentum des Herrschaftshauses Bernburg, wenn wir annehmen, dass dieser Flecken im Wald dem Deutschen Orden nicht oder zumindest noch nicht vermacht worden war. Denn hierüber ließen sich bisher keine schriftlichen Belege finden, wie zum Beispiel eine Schenkungsurkunde wie weiter oben für den Ort Buro gezeigt. Im Zuge des ersten Schwungs der ebenfalls schon beschriebenen allgemeinen Ostsiedlung hatte es sich natürlich in allen Fürstenhäusern herumgesprochen, dass mit einer Ausdehnung der landwirtschaftlichen Anbauflächen noch wesentlich mehr Reichtum anzuhäufen war. Also überlegte auch der Anhaltische Adel, wo in seinem Herrschaftsbereich Voraussetzungen bestünden, neue Siedlungen zu schaffen, die eine möglichst große Ausdehnung landwirtschaftlicher Produktion bewirkten. Nicht zuletzt war damit auch eine entsprechende Machtausweitung möglich. Und zu den Orten, die man dafür auswählte, gehörte auch unser Weiler. Denn eine Erweiterung ist stets einfacher als eine komplette Ur-Erschaffung. Nur wenige Menschen mehr mussten angesiedelt werden, um zunächst Teile des Waldes zu roden. Eine ganz wesentliche Voraussetzung für solchen Standort war sicherlich bereits vorhanden: Wasser für Mensch und Tier. Da es weder einen Fluss, einen See oder wenigstens einen Bach in der Nähe gab, konnten die Insassen des Weilers nur mit einem Brunnen, der das Grundwasser anzapfte, für ausreichendes Wasser sorgen. Bohrgestänge, Bodenbohrer, Metall-Wasserrohre für Leitungen… gab es damals noch nicht; aber die Menschen konnten seit langem bereits Schächte ins Erdreich graben, zum Beispiel im Bergbau. Das taten auch unsere „Weilerianer“ und ebenso die später zusätzlich angesiedelten Fürsten-Knechte. Sie gruben mit Hacken und Schippen Löcher so tief in den Boden, bis sie auf Grundwasser stießen. Damit die Schachtwände nicht einstürzten, versteiften sie diese mit Reisig-Geflecht, Holzstämmen, Holzbohlen, exakt gesetzten Feldsteinen oder später auch mit vermauerten Ziegelsteinen. Dieser Brunnen bekam oben einen Holz-Überbau zur Verhinderung einer Wasserverschmutzung und zur Unterstützung der Wasserentnahme. Sie erfolgte mit einem angeseilten Gefäß, das eventuell über einen Rundbalken oder sogar bereits über eine Rolle abgeseilt wurde oder auch durch einen sogenannten Schwengel, eine kranartige Konstruktion, der ebenfalls ein am Seil befestigtes Gefäß ins Wasser hinabließ und dann mit Wasser gefüllt hochhievte. Beide Varianten bezeichnen wir als Ziehbrunnen.
Wasser gab es also bereits und mit steigendem Bedarf durch die Vermehrung von Mensch und Tier mussten unsere Vorfahren wohl noch einen zweiten (oder gar dritten?) Brunnen bauen. Während ich das schreibe, kommen mir etliche Zweifel über die Anzahl der Brunnen. Denn ein Brunnen musste von der Obrigkeit genehmigt, gewissermaßen gnädigerweise angewiesen werden und unterlag einer strengen Benutzungs-Ordnung – nicht jedem Siedler war die Benutzung des Brunnens erlaubt und für die Wasserentnahme mussten Abgaben an den Grundherrn geleistet werden. Wie die Wasser-Umstände damals wirklich in Zernov waren, werden wir nicht herausbekommen; klar ist aber nach den Überlieferungen, dass sie Wasser hatten.