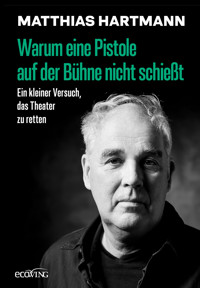
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von der Liebe zum Theater und einem handfesten Skandal Matthias Hartmann war der Shootingstar der deutschsprachigen Theaterwelt. Er war Intendant am Schauspielhaus Bochum, am Schauspielhaus Zürich und am Wiener Burgtheater. Sein Buch ist eine Liebeserklärung an das Theater und sein Publikum und es steckt voller Theatergeschichten. Es ist aber auch die Geschichte eines Skandals, der eines der legendärsten Theater, die "Burg", in die Krise stürzte. - Matthias Hartmanns Weg auf die Bühne: eine Künstlerbiografie, die Lust auf Theater macht - Warum ist Theater wichtig? Seine politische und gesellschaftliche Bedeutung heute - Hintergründe zum aufsehenerregenden Bilanzskandal am Wiener Burgtheater mit Fakten und Belegen des Investigativ-Journalisten Rainer Fleckl - Lust auf Theater? Autobiografie und erzählendes Sachbuch für alle, die die Bühne lieben Die Fantasie trainieren: Wie sich Theater wiederbeleben lässt Immer weniger Menschen gehen ins Theater. Während Konzerte oder Sportveranstaltungen nach den Lockdowns wieder regen Zulauf haben, bleiben die Schauspielhäuser oft leerer als erhofft. Matthias Hartmann geht in seinem Buch der Faszination des Theaters und seiner Wirkung auf die Vorstellungskraft nach. Und er fragt nach dem Theater als Gegenmittel zu Populismus und Manipulation. Der Finanzskandal am Burgtheater Wien war für den damaligen künstlerischen Direktor eine Ernüchterung. Aus seiner Erfahrung liefert er nicht weniger als zehn Punkte zur Rettung des Theaters. "Erst mit dem Theater die Fantasie retten und dann mit der Fantasie die Welt retten, das ist auch eine politische Dimension des Theaters." Das Buch liest sich wie ein Krimi!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
MATTHIAS HARTMANN
Warum eine Pistoleauf der Bühne nicht schießt
Ein kleiner Versuch, das Theater zu retten
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger
Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren beziehungsweise
Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
© 2024 ecoWing Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – Wien, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Cover- und Umschlaggestaltung: www.b3k-design.de, Andrea Schneider, diceindustries
Coverfoto: Helge Kirchberger Photography
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Palatino, Resolve Sans
ISBN: 978-3-7110-0355-3
eISBN: 978-3-7110-5370-1
»Ich glaube an die Unsterblichkeit des Theaters. Es ist der seligste Schlupfwinkel für diejenigen, die ihre Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt und sich damit auf und davon gemacht haben, um bis an ihr Lebensende weiter zu spielen.«
MAX REINHARDT
Inhalt
Rette es, wer kann
Hereinspaziert
Warum eine Pistole auf der Bühne nicht schießt
Aus Ich wird nix
Doppelt sein
Eine Bar in der Karibik
Von außen nach innen
Glück ist hinter der Tür
Angekommen. Hase.
Alles, weil ich Porsche fahre
Boy Gobert, Tod in Wien
Der Programm-Bulldozer
Expedition Probebühne
Der Werkzeugkasten des Tragischen
Ein eigenes Haus
Der Nackte mit dem Mikrofon im Blecheimer
Das bürgerliche Publikum, eine Liebeserklärung
Wohin?
Der Bedeutungsmarkt, eine Kryptowährung
Ja, wohin denn nun?
Der Beißreflex
Macht Papa
Noch mal die fucking Geschichte mit der Burg
Villa am See
Das Wespennest
Die liebe Silvi
Kleine Nachhilfestunde im Erstellen falscher Bilanzen
Hallo, die Hasenjäger sind wieder da
Stille
Eine Milchmädchen-Rechnung und 10 Punkte zur Rettung des Theaters
Anhang (von Rainer Fleckl)
Über den Autor
Rette es, wer kann
Für das Theater braucht man eine Person, die zuschaut, und eine, die spielt. Das war’s dann schon. Wenn einer fehlt, gibt’s kein Theater – sollte man meinen.
Damit die Person, die zuschaut, weiter zuschaut, muss es interessant sein. Dann kommen immer mehr. Darum geht’s. Aber es gehen immer weniger Menschen ins Theater, seit Jahrzehnten schon, der Lockdown hat das Ganze nicht einfacher gemacht. Die Menschen kamen begeistert zurück in die Fußballstadien, sie gingen wieder ins Konzert, in die Oper und in Museen, als wäre eine große Seelennot von ihnen abgefallen, aber die Theater taten sich schwer. Liegt’s an Social Media? Sitzen alle vor Netflix? Was passiert, wenn das so weitergeht? Ist es dann vorbei mit dem Theater? Kann schon sein. So wie wir es kennen jedenfalls. Das Theater an sich kann man genauso wenig eliminieren wie Löwenzahn auf einer stillgelegten Autobahnbrücke, es kommt immer wieder hervor.
Ich stelle mir vor, dass sich in irgendeiner Garage wieder ein Spinner finden wird, der nicht anders kann und neu anfängt. Er wird einen anderen Spinner finden, der ihm zuschaut, und schon geht’s wieder los. Die begabteren Spinner werden sich durchsetzen und ihr Publikum davon überzeugen, dass man ohne einander nicht mehr leben kann. Sie schärfen ihre Instinkte an der Sehnsucht des Publikums. Sie werden von ihrer Lust auf Wirkung getrieben, von ihrer Musikalität und ihrem Gestaltungswillen und der Kunst, zu verblüffen und zu verführen. Sie brauchen das Echo des Publikums, so wie das Theater das Publikum zum Überleben braucht.
Hereinspaziert
Das erste Jahr in Bochum war bald rum, und es lief immer noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, ich wurde ungeduldig. Ich hatte lauter sensationelle Schauspieler mit den rosigsten Versprechen nach Bochum gelockt. Sie hatten mir geglaubt, waren mir gefolgt, hatten andere Jobs aufgegeben. Hatten Wohnungen gemietet, ihre Kinder eingeschult und Jahre ihres Lebens mit mir zusammen verplant. Am zweiten Abend nach der Eröffnung des Theaters stand ich schwitznass im Garderobenflur, weil kaum Zuschauer gekommen waren. Wie erklärt man das? Ich sagte, ihr geht da jetzt raus, der Vorhang geht hoch, und es sind leider kaum Leute da.
Nun war das erste Jahr also fast vorbei, alle noch im Aufbruch, ich wollte jetzt alles richtig machen. Ich versammelte Theater-Superstar-Granaten wie Traugott Buhre und Margit Carstensen, um den Dürrenmatt-Schlager Die Physiker zu spielen. Das konnte nicht schiefgehen. Die Rechnung ging auch auf. Schullektüre. Die Leute kamen. Allerdings war die Aufführung nichts Besonderes. Sie hatte keinen Pfiff. Nach der Vorstellung, es war ein lauer Frühlingsabend, stand ich zufällig auf dem Hans-Schalla-Platz vor dem Theater. Das Publikum verteilte sich in kleine Gruppen.
Ich mache das gerne, mich unter die Leute zu mischen und ihnen heimlich zuzuhören. Niemand sagte etwas, womit ich etwas anfangen konnte. Gehst du noch zum Orlando? … Wir gehen noch in den Livingroom … Ich muss morgen früh raus. … Niemand sprach über die Aufführung. Das war verdächtig.
Ein mitteljunges Pärchen lief schweigend die Saladin-Schmitt-Straße hoch. Ich folgte ihnen, ganz nah, nur um ein paar Worte zu erhaschen. Nur die beiden und ich. Ich drohte aufzufliegen, wollte gerade abdrehen, da sagte sie schließlich: Schau, ist doch besser, als jeden Tag vor der Glotze zu sitzen. Das hatte so etwas Tröstendes. Wahrscheinlich hatte sie sich bei ihm beschwert, dass er nur noch mit immer träger werdendem Gemüt und Arsch zu Hause vor dem Fernseher sitzt. Also hatte er sich aufgemacht und sie mit Theaterkarten überrascht. Am Schauspielhaus solle ja jetzt ein frischer Wind wehen, er kaufte an der Theaterkasse Karten für ein Stück, dessen Titel ihm vertraut vorkam. Der Abend war dann auch ganz okay, aber eben nicht sensationell. Jetzt gingen sie heim, sie tröstete ihn, weil es doch so nett von ihm gemeint gewesen war. Ist doch besser, als …
Das war mein Albtraum. Ich wollte funkeln und begeistern. Am nächsten Tag nahm ich das Stück vom Spielplan. Frau Käding schrie: Unser bestverkauftes Stück! Sie bettelte, aber ich litt und fand, dass es keinen Sinn macht, wenn wir das Publikum mit einem populären Titel ins Theater locken und drei Stunden langweilen. Nichts ist schlimmer, als ein Versprechen zu geben, das man nicht halten kann. Bis wir diese Leute noch einmal überreden können, einen Besuch bei uns zu riskieren, können fünf Jahre vergehen. Ich meine jetzt nicht diese unerbittlich geduldigen Theater-Nerds, die sich immer und alles anschauen, dieser kleine Haufen trotzig Ausdauernder, die heute das Rückgrat des deutschen Sprechtheater-Publikums bilden. Die auf Festivals zu den Publikumsdiskussionen kommen und von früher erzählen, einen am Arm festhalten und dabei weinen. Ich meine auch nicht die Theaterwissenschaftsstudenten, die nur deswegen kommen, weil sonst niemand da ist, damit sie sich als Teil einer missverstandenen intellektuellen Elite fühlen können. Ich meine wirkliches, echtes Publikum. Menschen, denen man etwas zumuten kann, wenn man sie mitreißt. Die etwas erleben wollen. Die kein populäres Stück brauchen und auch keinen Trost. Ich meine Leute, die sich sogar eine kryptische Sprachpartitur von Jon Fosse mit dem Titel Todesvariationen anschauen. Das Stück war dann in Bochum bis zum letzten Tag ausverkauft.
Warum eine Pistole auf der Bühne nicht schießt
Theater ist das Fitnesscenter für die Fantasie. Manchmal beobachte ich aus der obersten Loge das Publikum beim Hereinkommen, bevor die Vorstellung beginnt. Wie sie sich hinsetzen, erwartungsfroh und bereit, sich zurechtruckeln, im Programmheft stöbern. Das Theater hat beim Publikum erst einmal einen Bonus. Es ist bereit, dem zu glauben, was auf der Bühne gespielt wird. Es weiß ja, wenn es ins Theater geht, dass da nicht die Wirklichkeit auf sie wartet. Dass ihre Fantasie gefragt ist, ihre Kraft, sich eine andere Welt vorzustellen. Deswegen ist es ja immer ein bisschen lächerlich, wenn jemand auf der Bühne mit einer Pistole droht. Würde sie wirklich losgehen, käme jemand zu Tode.
Wenn ich mir aber einen Film anschaue, einen Thriller, dann nehme ich eine Pistole ernst. Filme sind Illusionen der Wirklichkeit, ich brauche keine Fantasie, um mir vorzustellen, was ich sehe. Im Theater glaubt das Publikum den herrlichsten Unsinn. Ich liebe es, damit zu spielen. Dass ein einfacher Sessel, aus dem der Schauspieler gerade aufsteht, das Land England sein soll. Und dass der weiße Kreidestrich drumherum das bedrohliche Meer ist. Hätte das Publikum keine Lust, so einen Unsinn zu glauben, würde es nicht ins Theater gehen. Das war immer so, schon in der Antike oder bei Shakespeare. Das Publikum hat Freude daran, eine neue Welt auf der Bühne und auch in ihren Köpfen entstehen zu lassen. Arbeitet das Publikum nicht mit, entsteht nichts. Gelingt es, dann ist es hingerissen. Hingerissen von sich selbst. Und dann feiert es nicht nur die Aufführung, sondern auch sich selbst. Es ist dann so begeistert, dass alle Versuche, dem Theater eine moderne Daseinsberechtigung zu geben, lächerlich erscheinen. Wenn die Zusammenarbeit mit dem Publikum in der Fantasie gelingt, braucht es keine äußerlichen Zutaten. Man kann, aber man muss keinen Rap spielen, um für ein junges Publikum modern zu sein. Man muss auch nicht Texte aus der aktuellen Kriegsberichterstattung mit einer antiken Tragödie verschränken, um zeitgemäß zu sein. Auch das kann man gerne machen, und dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden. Aber Theater braucht keine Legitimation, um modern zu sein. Das Spiel mit der Fantasie ist das Geheimnis.
In alten Filmen mit Liselotte Pulver wurde Freude mit einem freudigen Lächeln ausgedrückt und bei Trauer flossen Tränchen. Beim Method Acting des berühmten Schauspiel-Lehrers Lee Strasberg lernten Hollywood-Stars, dass man Gefühle nicht eins zu eins ausdrückt. Man spielt nicht das Gefühl, man spielt, wie man die Gefühle beherrscht. Am Grab des verstorbenen Sohnes kämpfen die Eltern tapfer mit den Tränen. Mit dem Ausdruck der Tapferkeit kann man sowieso am besten spielen, wie viel Gefühl man hat. Ganz gleich, ob Trauer oder Glück. Verabschiedet sich die Mutter im Film vor dem Greyhound von ihrem neunjährigen Sohn, der zum ersten Mal für zwei Wochen ins Schullandheim fährt, presst sie tapfer die Lippen aufeinander. Kommt der Bub nach zwei Wochen wieder, beherrscht der Vater seine Gefühle über das glückliche Wiedersehen tapfer mit aufeinander gepressten Lippen. Als mir das zum ersten Mal auffiel, sah ich es plötzlich überall. Barbra Streisand und Robert Redford scheinen das tapfere Lippenaufeinanderpressen zum Haupt-Stilmittel ihres Schauspiels gemacht zu haben. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird, sieht man ihn überwältigt von Gefühlen mit zusammengepressten Lippen vor der Nation stehen. Es hat eine Art Rückkopplung vom Film ins Leben gegeben. Alle spielen das Gleiche. Er trennt sich von ihr, Lippen werden tapfer gepresst. Sie besteht die Führerscheinprüfung: Lippen pressen. Tapferkeit als Gefühlsübersetzung ist zum alltäglichen Habitus geworden. Ganz Amerika hat eine standardisierte Gefühlsäußerung. Das Massenmedium Film bewirkt, dass alle immer ähnlicher und fantasieloser werden. Alle haben die gleichen Gefühle, die gleichen Träume, Ängste und huldigen den gleichen Werten. Ein Eldorado für manipulative Politiker und den Gott des Konsums.
Fantasie ist ein ziemlich schwacher Muskel unserer Seele geworden. Sie wird nicht gebraucht und nicht trainiert. Muskeln, die man nicht regelmäßig braucht, werden schlaff. Fantasie auch. Ohne Fantasie kann ich mir nicht vorstellen, wie ich oder die Welt anders sein könnte. Anders friedlich, anders gerecht, anders durch mich.
Fantasie ist wichtig, wenn wir uns gegen die Bedrohungen durch Populisten, Despoten und vielleicht bald künstliche Intelligenz wappnen wollen. Mit Fantasie kann ich die Vorstellung von mir als einem selbstbestimmten Individuum erzeugen. Oder umgekehrt: Wenn ich mich nur als ein Teil einer Masse begreife, die im Gleichklang und im Gleichschritt in die gleiche Richtung marschiert, dann habe ich keine Fantasie für mich als jemanden außerhalb der Masse. Dann bin ich ein Teil der Masse. Wer Teil der Masse ist, hat keine Vorstellung davon, wie es außerhalb der Masse sein könnte.
Erst mit dem Theater die Fantasie retten und dann mit der Fantasie die Welt retten, das ist auch eine politische Dimension des Theaters.
Theater wandelt sich mit den Zeiten und erfindet sich als Spiegel der Gesellschaft immer neu. Das Wichtigste für mich ist die Frage, was das Theater im Kern ausmacht. Was kann das Theater, was andere nicht können? Was ist es, was am Theater immer gültig bleibt? Nur weil sich Menschen zusammen in einem Saal versammeln, um gemeinsam etwas zu erleben, wird noch kein Theater daraus. Es sei denn, Popkonzerte und Gerichtsverhandlungen sind auch Theater. Es geht doch um das, was Theater von den Zuschauern braucht, um überhaupt erlebt zu werden.
Schon die alten Griechen haben drei Jahrhunderte vor Christus in Epidauros ein Theater gebaut, in dem die Kranken genesen sollten. Weil das, was Zuschauer mit ihrer Vorstellungskraft tun, um Theater für sich erlebbar zu machen, sie selbst verändert. Es war dem Äskulap gewidmet, dem Gott der Heilung. Wir kennen ihn als Statue, um deren Wanderstock sich eine Schlange windet. Das antike Theater war ursprünglich eine kultische Veranstaltung, später bekamen die Zuschauer sogar Geld, um ins Theater zu gehen, die Teilnahme am Chor war zuweilen Bürgerpflicht. Erst der große deutsche Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing entwickelte aus den Ideen der griechischen Tragiker und den Stücken Shakespeares eine grundlegende Theorie des deutschen Dramas samt Gebrauchsanleitung. Er wollte, dass das »bürgerliche Theater« (Achtung, das bekommt später noch eine Liebeserklärung von mir!) eine »Schule der Menschlichkeit, des Gefühls und der moralischen Welt« wird, und Friedrich Schiller schließlich entwarf das Modell der Schaubühne als moralische Anstalt. Und den Rest schwänze ich.
Das Problem ist das Theater der Wohlmeinenden. Für sie ist die gute Absicht schon der Beweis für Qualität. Wer gesellschaftliche Missstände adressiert, produziert kostbare und bedeutende Beiträge zum öffentlichen Diskurs. Das Theater der Wohlmeinenden und das Publikum der Wohlmeinenden sind sich einig, dass Machtmissbrauch und Korruption hochaktuelle, die Gesellschaft belastende Themen sind. Aber sind gute Romane vielleicht deswegen spannend, weil ich als Leser keine schnellen Antworten bekomme, sondern herausgefordert werde, die unterschiedlichsten Standpunkte anzunehmen, auch wenn es noch so schmerzt, sich plötzlich mit dem Teufel zu identifizieren? Bei Shakespeares Richard III. hat das auch schon funktioniert. Die modernen Serienerzählungen haben daraus eine Kultur gemacht. Walter White in Breaking Bad als Drogendealer und Frank Underwood als korrupter amerikanischer Präsident in House of Cards sind Schurken, aber ich will, dass sie gewinnen. Das fordert mich heraus, macht mich zu einem mündigen Zuschauer, der seinen moralischen Kompass immer wieder neu ausrichten muss.
Das gute Theater diskutiert, bespricht Kontroversen, schafft Paradoxien, es führt ins Ungewisse, macht das Publikum gleichzeitig orientierungslos und mündig, weil es herausgefordert wird, eigene Entscheidungen zu treffen, und weil es mit seinen Entscheidungen zuweilen im Stich gelassen wird. Das gute Theater schafft Perspektiven. Weder sollte Theater dem Publikum erzählen, wie und was es zu denken und zu meinen hat, noch ist der Inhalt dessen, was Theater erzählt, ein Parameter für die Qualität der Aufführung. Sonst wird Theater ein Versteck für Dilettanten, die sich hinter wohlmeinendem Konsens verschanzen. Das überrascht und verführt kein Publikum. Niemand wird angezündet. Kein Fremder kommt. Nur diejenigen, die sich nach Solidarität sehnen, nach Konsens und sich irgendwie politische Hygiene erhoffen. Das verstehe ich ja. Aber sie machen das Theater zu einer Insel, auf der außer ihnen bald niemand mehr wohnt.
Geht’s dem Theater wie der sogenannten »Neuen Musik«? Wird es eine ehrenwerte Randerscheinung? Bei der Neuen Musik arbeitet ein Komponist oft jahrelang an einer hochkomplexen Partitur, Opernhäuser rühmen sich, dass sie etwas zur Entwicklung zeitgenössischer Musik beitragen. Dann gibt’s zwei Aufführungen und es wird nirgendwo nachgespielt. Keiner hört’s, keiner sieht’s. Insel-Kultur.
Der Stadt Bochum beispielsweise fehlt Geld, um Klassenzimmer anzustreichen, da sind 34 Millionen für ihr Schauspielhaus ein ganz schön großes Stück vom Kuchen. Kommt dann kein Publikum, wird es schwer, zu erklären, dass man das Theater braucht, um die Welt zu retten.
Aus Ich wird nix
Die meisten Eltern versuchen, ihre Kinder in bürgerliche Berufe zu leiten, bei mir war es umgekehrt. Meinen Eltern war immer klar, dass ich Künstler werde. Ich selbst wollte das nie. Höchstens Popstar, wenn man die noch zu Künstlern zählen kann. Wenn ich nach der Schule zu meiner Mutter in den 2CV kletterte, wo sie selbst Kunst unterrichtete, sie trug einen bolivianischen Poncho und Stirnband, dann wäre ich lieber zu der Dame mit Frisur in den Range Rover gestiegen und zu Fritz nach Hause gefahren, wo es einen Swimmingpool gab und Hauspersonal. Ich wollte mich immer an die Oberfläche retten. Kunst war gratis, nichts, worauf man stolz sein oder sich etwas einbilden konnte. Alles Künstlerische führte mich an seelische Abgründe und ungeahnte Schründe. Bei jedem Sonnenuntergang musste ich sofort heulen und Gedichte schreiben. Alles Künstlerische zog mich abwärts. Ich wollte da nicht hin. Wenn ich schrieb oder Musik machte, war der Preis ein Schmerz. Warum ich dennoch am Theater gelandet bin?
Ich war ein schlechter Schüler. Die Wirklichkeit, das echte Leben, spielte sich für mich in einer Parallelwelt ab. Ich hatte mich damit abgefunden, dass ich das »Draußen«, die Welt außerhalb meiner Vorstellungsräume, nie richtig verstehen würde. Wenn ich versuche, mich zu erinnern, ist alles in einem merkwürdigen Licht. Als wäre es ein Film. Unwirklich. Als hätte ich nicht mitgespielt und nur ab und zu vorbeigeschaut. Meistens habe ich irgendwas geträumt. Einmal habe ich eine gute Note bekommen. Das war ein Beschwerdebrief an unseren Deutschlehrer. Er war begeistert, dass ich endlich mal einen strukturierten Aufsatz geschrieben hatte. Meine Eltern wussten nicht, wohin mit mir. Weil ich mich unbeliebt gemacht, alle gegen mich aufgebracht hatte, musste ich die Schule wechseln. Ich wollte immer der Chef sein, konnte die Rolle aber nicht ausfüllen. Chef war der sehr vernünftige und fleißige Steffen Schaf, der Cello spielte und der von allen gemocht wurde und auch zu mir immer freundlich blieb und deswegen zu Recht Klassensprecher war. Ich konnte noch so viel angeben und behaupten, dass mein Vater das schnellste Auto fuhr, ich kam nicht an Steffen heran. Steffen stürzte mit 18 Jahren in den Dolomiten zu Tode. Irgendjemand aus dem anthroposophischen Umfeld meiner Eltern sagte damals, Steffen sei ein besonderer Mensch gewesen, der mit den Aufgaben dieser Welt schon fertig gewesen sei. Na, wenn das so ist, das war mir damals schon klar, dann hatte ich ja noch eine ganz lange, steinige Lebensstrecke vor mir.
Doppelt sein
Als er 13 war, flogen die Whiskygläser durch die Fenster, die Trennung drohte, und so schickten die Eltern ihn aus pädagogischer Verantwortung und zu seinem eigenen Schutz auf ein englisches Internat. Dieser Junge ist wie ein Fremder für mich. Jemand, den ich schon lange kenne, aber immer noch nicht verstehe. Natürlich wollte er nicht ins Internat. Wie der mir beim Schreiben schon wieder auf die Nerven geht, sein Jammern und sein Wehren, mit Händen und Füßen. Aber es half nichts, die Mutter beherrschte die Kunst der Manipulation und sagte: Na gut, du darfst dir eins aussuchen. Dass sie ihm die Wahl gab, ließ ihn glauben, es sei seine Entscheidung. Er entschied sich für ein Internat, wo man keine Schuluniformen tragen musste. Schlau war der Junge nicht, aber leutselig. Ein paar Tage schien es immerhin zu gehen. Er schrieb Briefe, in denen eine Sarah vorkam. Es tat ihm gut, der Große, Tolle und Neue zu sein. Aber bald schrieb er furchtbare Briefe. Er hatte es sich wieder bei allen vermasselt. Die Mutter identifizierte sich immer mit seinen Niederlagen. Sie selber war ungestüm, völlig egozentriert, vereinnahmend und vor allem rasant. Sie hatte sich für ihn gewünscht, dass das jetzt eine neue Chance sein würde. Sie wusste genau, wovon sie sprach. Ihr ganzes Leben hatte sie sich daran wund gestoßen, die Große, Tolle und Neue sein zu wollen.
Schnell wurden seine Briefe bedrohlich. Wenn ihr mich nicht holt, weiß ich nicht, was ich mache! Der Vater fuhr hin. In Der gute Mensch von Sezuan von Brecht spielte der Junge den dritten Gott. Er hatte die meisten Lacher. Na, geht doch, dachte der Vater, ist doch alles nicht so schlimm. Die Leute lachen doch. Der Junge verstand das nicht, warum war das jetzt plötzlich etwas Besonderes? Wollte man ihn trösten, weil alles sonst immer schiefging? Auf den Erfolg angesprochen, zuckte der Junge nur mit den Achseln. Er meinte, man müsse halt doppelt sein. Niemand verstand seinen Satz. Er selbst auch nicht.
Nach vier Jahren England kam der Junge zurück, ohne je einen Abschluss bestanden zu haben. Fragten seine Eltern, was er jetzt machen wollte, träumte er von großen Autos. Der Vater meinte: Wetten, der will immer noch Popstar werden. Aber nicht wegen dem Pop in der Musik, sondern wegen dem Star.
Nach einigen Monaten Maschinenschlosser-Ausbildung meldete sich die Vermieterin des Jungen bei den Eltern, er sei verschwunden. Sie hörten eine Zeit nichts mehr von ihm. Die Mutter hatte sich seine Schwester vorgeknöpft. Die wusste von einer Freundin aus Schottland, die er auf einem internationalen Schülertreffen kennengelernt hatte. Durch Edinburgh führt die Princess Street. Von ihr aus enden die Straßen immer oben im Himmel oder unten in irgendeinem Park. Die Straßen gleißen, wenn die Sonne unter dem schwarzen Himmel einschießt. Kurze Regenschauer, Kniestrümpfe, Marks & Spencer, unendlich viele Pubs, grüne, hünenhafte Berge, die sich am Ende der Straße aufbauen. Als der Junge eines Morgens über diese Straße streunte, stand plötzlich seine Mutter vor ihm. Stellst du mir deine nette Freundin vor? Was habt ihr denn für Pläne? Sie wollten nach Korsika, mit Maurice. Maurice wolle in Korsika auf einer Farm Kinofilme machen und Selbsterfahrung anbieten. Maurice war schon 23 und wusste viel über Filme. Die Mutter fand die Idee super, vielleicht könne sie Maurice und das Projekt ja auch finanziell unterstützen. Am Abend besuchten sie Maurice in seiner bunten Wohnung. Die Mutter fragte ihn über seine Filmografie aus und über Korsika und ob es schon etwas Spruchreifes gäbe. Maurice war hingerissen. Was für eine coole Mutter du hast! Bist du verrückt, wieso bist du denn abgehauen?
Nein, er hatte selber noch keinen Film gemacht, aber er hatte einen sehr guten Freund, der hatte bei einem Projekt als Locationscout gearbeitet. Ach ja, sagte die Mutter.
Der Junge beobachtete Maurice, wie er versuchte, seiner coolen Mutter zu imponieren. O weh. Maurice schrumpfte in seinen Augen zu einem blöden Angeber, und 24 Stunden später saß er mit seiner Mutter im Flieger zurück nach Osnabrück. Wieder einmal Osnabrück, dem einzigen Ort bisher.
Der Vater hatte sich mit dem geklauten Schmuck seiner bösen Tante als Teenager in den Nachkriegsjahren zwei Jahre lang im Rotlichtviertel von Marseille herumgetrieben. Sein Junge konnte nicht einmal vernünftig abhauen. Der braucht doch einen Schulabschluss, sagte die Mutter. Der weiß doch nicht, sagte der Vater, ob man während mit h schreibt und wie viele Bundesländer die BRD hat, der kann weder auf Französisch konjugieren noch Dezimalbrüche. Jetzt will er nicht Popstar, sondern Schallplattenproduzent werden. Hockt in den Studios kleiner Plattenlabels, himmelt coole Leute an, die Gras rauchen, an E-Gitarren und Bandmaschinen hantieren. Aber, sagte der Vater, auch Schallplattenproduzenten sind Kaufleute, die müssen auch ihr Geschäft kennen.
Er vermittelte den Sohn an einen Freund, der einen Öko-Laden am Bodensee besaß. Nach sechs Monaten brach der Junge die Lehre ab. Er durfte das Korn abwiegen. An die Käsetheke hätte er aus Gründen der Hygiene erst im dritten Lehrjahr gedurft. Die Eltern waren entsetzt, als er eine zweite kaufmännische Lehre anfing. Warum denn schon wieder? Das hat dich schon beim ersten Mal zu Tode gelangweilt. Aber der Junge wollte kein Sonderfall mehr sein. Er wollte endlich so werden, wie es andere Menschen sind. Dieses Mal versuchte er es bei einem Groß- und Außenhandelsbetrieb in seiner Heimatstadt. So ein echtes Routine-Gesicht wollte er haben, wie die Kollegen, die in der Morgendämmerung ihre Opels auf dem Parkplatz abstellten. Die Schultern hochgezogen, die fröstelnden Hände in den Ärmeln, wenn sie darauf warteten, dass der Betrieb aufgeschlossen wurde. Später könne man dann erzählen, dass man etwas von der Pike auf gelernt und durchgehalten hatte. Die stupide Arbeit in den Hallen unter den Neonlampen, Kartons auspacken, Pullover sortieren und umsortieren – das könne er auch. Wöchentliche Berufsschule, Bilanzen lesen, Zehnfinger-Schreibmaschine. Normal.
Der Seniorchef erwischte ihn mit den Händen in den Hosentaschen. Er antwortete, dass der Juniorchef gerade mit den Händen in den Hosentaschen vorbeigeschlendert sei. Der Seniorchef schrie. Der Junge brach die Lehre ab, so normal ging dann doch nicht.





























