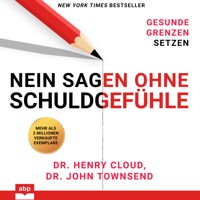Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der bekannte Psychologe und Führungsexperte Henry Cloud hat durch seine bahnbrechenden Bücher und seine Arbeit als Coach für Führungskräfte Millionen von Menschen beeinflusst. In seinem aktuellen Buch nimmt Henry Cloud die Leser mit auf seine eigene bewegende Lebens- und Glaubensreise. Er beschreibt seine frühen Kämpfe mit Krankheit und Depression und berichtet, wie der Glaube an einen lebendigen Gott sein Leben verändert hat und wie er durch das persönliche Erleben von Wundern, zu Heilung und zu seiner Berufung als Psychologe gefunden hat. Ein bewegendes, persönliches Buch, das auf besondere Weise wissenschaftliche Erkenntnisse mit den Grundlagen des christlichen Glaubens verbindet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henry Cloud
Warum ich glaube
Gedanken eines Psychologen über Leid, Wunder, Wissenschaft und Glaube
Copyright © 2024 by Henry Cloud
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel:
„Why I Believe – A Psychologist’s Thoughts on Suffering, Miracles, Science, and Faith“
Bei Worthy; Hachette Book Group; 1290 Avenue of the Americas, New York, NY 10104
worthypublishing.com
This edition published by arrangement with Grand Central Publishing, a division of Hachette Book Group. Inc., New York, NY, USA. All rights reserved.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Die Bibeltexte sind folgenden Übersetzungen entnommen:
Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Elberfelder Bibel © 1985/1991/2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH
Witten/Holzgerlingen
© der deutschen Ausgabe: 2025 Brunnen Verlag GmbH, Gießen
Gottlieb-Daimler-Str. 22, 35398 Gießen
www.brunnen-verlag.de; [email protected]
Die Nutzung von Bild-, Sprach- und Textdaten für sog. KI-Trainings und ähnliche Zwecke ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung erlaubt.
Umschlagfoto: Daley Hake
Umschlaggestaltung: Jonathan Maul
ISBN Buch: 978-3-7655-3350-1
ISBN E-Book: 978-3-7655-7756-7
Für alle, die aufrichtig suchen
Über den Autor
Dr. Henry Cloud ist ein bekannter Leadership-Experte, klinischer Psychologe und Autor von New-York-Times-Bestsellern. Seine fünfundvierzig Bücher, darunter das bahnbrechende Boundaries, sind weltweit fast zwanzig Millionen Mal verkauft worden. Neben seiner jahrzehntelangen klinischen Arbeit ist er in großem Umfang als Coach für Führungskräfte und Leadership Consultant tätig und verbringt heute den größten Teil seiner Zeit mit der Arbeit mit CEOs, Leadership-Teams und Führungskräften, um die Leistung, die Leadership-Fähigkeiten und die Kultur in ihren Organisationen zu verbessern.
Inhalt
Über den Autor
Vorwort
Einführung
Teil
I
Wie ich zum Glauben an Gott kam
1
Kleine geistliche Anfänge
2
Suchet, so werdet ihr finden
3
Der Anruf
4
Runter in den Abgrund und raus aus Ägypten
5
Ein Glaubenswagnis
Einfach gehorsam sein
Teil
II
Wie es dazu kam, dass ich an Wunder glaube
Der nackte Pastor
Gott als GPS
Der Beschützer
Der Versorger
Wiedersehen mit Jesus
Gottes perfekte Therapeutin für mich
Mein größtes Wunder
Unterschreib das nicht
Die Kniescheibe
Eine helfende Hand
Alltag mit Jesus
Teil
III
Wie ich durch Wissenschaft zum Glauben kam
6
Die Wahrheit ist wahr
7
Dynamische Spannung und das Denken des Glaubens
8
Wissenschaft als Glaubenshindernis
Die Wissenschaft von den Ursprüngen – wo kam alles her?
Nicht zufällig, sondern von einer ordnenden Hand präzise gestaltet
Auf dem Boden der Tatsachen
9
Kann ich der Bibel vertrauen?
Können wir der Bibel als dem inspirierten Wort Gottes vertrauen?
Wunder
Die wichtigste Tatsache in der Bibel
10
Jesus, bitte erklär mir deine Anhänger
Was mir geholfen hat
Wenn Christen andere verurteilen
Die Heuchler
Nicht nur schwarz oder weiß
Die wahren Gläubigen
11
Das größte Hindernis
Mein schwerwiegendster Einwand:Wie kann ein guter Gott Leid und Böses zulassen?
Freiheit
Zeiten der „Gottverlassenheit“
12
Psychologie und Glaube
Heilung und Wachstum durch Veränderung in einem offenen System
Eine gesunde Integration der beiden Triebkräfte, die uns zu Menschen machen: Liebe und Aggression
Schlussgedanken und eine Einladung an Sie
Dank
Anmerkungen
Vorwort
Ich habe ein Problem … und dieses Buch ist mein Versuch, es zu lösen.
Dieses Problem habe ich schon seit meinem zehnten Lebensjahr, und obwohl inzwischen manches besser geworden ist, bin ich innerlich immer noch nicht damit fertig. Es geht um meine Freunde. Ich werde euch hier nicht namentlich nennen, aber vielleicht findet ihr euch auf diesen Seiten wieder. Und diejenigen von Ihnen, die ich nicht kenne und die dieses Buch lesen – wenn die Beschreibung meiner Freunde auch auf Sie zutrifft, dann kommen Sie einfach mit auf die Reise. Wenn wir uns kennen würden, wären wir wahrscheinlich sowieso Freunde. Aber nun erst einmal genug von Ihnen – kommen wir zu mir und meinem Problem.
Kurz gesagt ist es so: Ich liebe Gott, und ich habe nicht den Schatten eines Zweifels, dass es ihn wirklich gibt. Das hat er mir über Jahrzehnte hinweg immer wieder bewiesen. Das ist nicht mein Problem.
Mein Problem ist, dass ich auch meine Freunde liebe und dass viele von ihnen Gott nicht kennen, zumindest nicht so, dass sie mir je davon erzählt hätten. Das Problem ist also Folgendes: Ich möchte, dass sie ihn kennenlernen und erfahren, dass er real ist. Ich möchte, dass sie eine Beziehung zu ihm haben und erleben, wie unfassbar das ist.
Warum ist das ein Problem? Ganz einfach – ich weiß oft nicht, wie ich es ihnen sagen soll.
„Moment mal“, sagen Sie vielleicht. „Sie haben in Vorträgen, in Büchern und Medien schon Millionen von Leuten von Gott erzählt. Wie kann das sein, dass Sie nicht wissen, wie Sie mit Ihren Freunden über ihn reden können?“
Die Antwort ist wiederum einfach: Mein Publikum lässt sich bewusst darauf ein zu hören, was ich über Gott denke. Meine Freunde nicht.
Sie lassen sich nur darauf ein, mit mir befreundet zu sein. Und das finde ich wunderbar. Deswegen lasse ich mich ja auch auf sie ein. Sie sind der Hammer – meine Freunde sind die coolsten Leute auf der Welt. Sie sind klug, witzig, talentiert – viele von ihnen vollbringen erstaunliche Dinge in ihren Berufen, in ihren Familien oder in irgendeinem anderen Bereich ihres Lebens. Andere sind einfach nur ganz normale Leute und wunderbare Menschen. Eine Sache allerdings haben sie alle gemeinsam: Sie haben ein riesengroßes Herz. Sie sind ehrlich, engagiert und echt. Ich bin gern mit ihnen zusammen. Und aus irgendeinem unerklärlichen Grund geben sie sich auch gerne mit mir ab.
Damit sind wir beim Punkt. Wenn wir Zeit miteinander verbringen, dann nicht um über Gott zu reden. Sie kommen einfach nur, damit wir zusammen sind – um Golf zu spielen, zusammen zu essen, uns übers Leben zu unterhalten. Mein Problem ist also, dass ich sie nicht nerven oder in die Enge treiben will, indem ich ihnen erzähle, was ich ihnen über Gott gerne mitteilen möchte. Vor allem will ich auf keinen Fall, dass sie sich so unangenehm berührt fühlen, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben wollen – weil sie denken, ich wollte sie irgendwie „bekehren“, wie ein guter Freund von mir einmal sagte. (Heute lachen wir darüber – aber einmal auf einer Party erzählte er ein paar Leuten, wie er mich googelte, als er mich vor zwanzig Jahren kennenlernte, und dabei neben meiner Tätigkeit als Autor und Psychologe auf diesen ganzen „Glaubenskram“ stieß. Er dachte: „Oh nein – so einer ist das, der will mich bestimmt bekehren.“) Doch als er diese Geschichte kürzlich einem anderen Freund bei einer Party bei mir zu Hause erzählte, sagte er: „Mit der Zeit merkte ich, dass er [gemeint war ich] eigentlich ganz normal war und so etwas gar nicht vorhatte.“ Er und ich und die anderen, die zuhörten, lachten nur.
Das war ein witziges Gespräch – und ich möchte auf keinen Fall irgendjemanden unter Druck setzen oder dass jemand sich wegen seiner eigenen Überzeugungen unbehaglich oder peinlich berührt oder angeprangert fühlt. Aus all diesen Gründen habe ich immer wieder dieses Problem: Auch wenn sie sich nicht komisch fühlen wollen und ich ihnen dieses Gefühl nicht vermitteln will, möchte ich doch, dass meine Freunde wissen, dass Gott real ist, und ich möchte, dass sie ihm begegnen.
Und damit habe ich zu kämpfen.
Aber damit bin ich auch nicht gerade ein guter Freund – ein guter Freund würde seinen Freunden auf jeden Fall alles erzählen, was sie interessieren könnte, oder? Aber ich tue das oft nicht. Und was weiß ich schon? Könnte ja sein, dass sie sogar wissen wollen, was ich über Gott denke.
Also habe ich beschlossen, mein Problem zu lösen. Ich schreibe einfach ein paar meiner Gedanken über Gott auf – für meine Freunde. Gedanken über etwas, über das ich nie mit ihnen gesprochen habe. Und das Buch nenne ich dann: „Warum ich glaube“.
Einführung
Eines Abends, als Zehnjähriger auf einem Feriencamp in North Carolina, spürte ich einen Schmerz und eine Unruhe in meinem Innern, die mich seither nie wieder verlassen haben. Es war ein ganz normaler Camp-Abend. Wir saßen mit unseren Betreuern am großen Lagerfeuer und taten all das, was man auf so einem Camp eben tut. Eine Sache weiß ich noch, die ein bisschen ungewöhnlich war – wir aßen eine Klapperschlange, die irgendein durchgeknallter Betreuer erlegt hatte. Aber sonst war alles ganz normal, bis auf eine Art „Andachtszeit“. Das Camp war schon ein bisschen christlich geprägt, aber es war keines von diesen hyperreligiösen Camps, wo einem das fromme Zeug mit Druck und Seelenmassage eingetrichtert wird. Hauptsächlich bestand es aus vier schönen Wochen voller Sport und Naturerlebnissen. Und dann waren da noch die Bemühungen der Betreuer, etwas für die spirituelle und charakterliche Entwicklung der Kinder zu tun, die vermutlich von ihren Eltern dorthin geschickt worden waren, weil sie sich entweder eine Pause vom Erziehungsstress oder eine verbesserte Version ihrer Sprösslinge wünschten. Meine Eltern erhofften sich vermutlich beides.
Während dieser Wochen war meine Liebe zu Gott auf eine schwer erklärbare Weise intensiver geworden. Gott war schon seit meiner frühen Kindheit in meinem Bewusstsein immer sehr präsent gewesen – ich wusste irgendwie, dass er da war. Er zeigte sich mir auf alle möglichen Arten, die ich nicht richtig erklären kann – ich spürte einfach seine Gegenwart und wusste, dass er real war. Doch während jener Wochen im Camp führte mich mein Weg während einer Wanderung zu einer kleinen Kapelle in den Bergen, wo ich ein Erlebnis hatte, an das ich mich heute noch erinnere, als wäre es gestern gewesen. Ich stapfte in den Blue Ridge Mountains in North Carolina herum und fühlte mich plötzlich in dieses kleine Gebäude gezogen. Während ich schweigend dort saß, packte mich eine starke innere Bewegung. Ich spürte, wie er mich zu sich zog – es haute mich um, aber auf eine gute Art. Ich spürte in mir eine unglaublich starke Liebe zu ihm. Ich saß dort und sagte ihm, ich würde mit meinem Leben alles tun, was er wollte. Ich war bewegt von einer unsichtbaren Kraft, und ich wusste, sie war real und voller Liebe. Dessen war ich mir sicher.
Das erinnerte mich an einen besonderen Abend. Ich hatte die „evangelistische“ Botschaft, die dort verkündet wurde schon vorher gehört: dass Gott uns alle liebte und dass Jesus gestorben war, um die Strafe für alles zu bezahlen, was wir je falsch gemacht hatten, um so ein für alle Mal für jeden von uns Vergebung zu erwirken. Geglaubt hatte ich das schon als kleines Kind, aber wahrscheinlich hatte ich es noch nie so gut verstanden wie an jenem Abend. Aus irgendeinem Grund traf mich das Erlebnis in der kleinen Kapelle noch tiefer.
Ich kann mich nicht mehr an alle Einzelheiten der Andacht erinnern, aber das Wesentliche steht mir noch klar vor Augen. Das Evangelium, sagte der Betreuer, sei eine einfache Botschaft, und sie laute so: Stell dir vor, du hast ein Verbrechen begangen, wirst vor Gericht gestellt und vom Richter für schuldig befunden. Du stehst vor der Richterbank, und der Richter spricht das Urteil: „Schuldig im Sinne der Anklage“. Und dann verkündet er das Strafmaß, das Bußgeld. Du weißt genau, dass du es nicht bezahlen kannst, aber es steht unzweifelhaft und unverrückbar vor dir: Du bist schuldig, und du bist verurteilt. Du musst die Strafe bezahlen. Und gleichzeitig weißt du, dass du den Betrag unmöglich aufbringen kannst.
Dann, genau in diesem Moment, sagt der Richter: „Ich komme jetzt von der Richterbank herunter und stelle mich an deinen Platz und bezahle die Buße für dich, wenn du möchtest. Du kannst frei nach Hause gehen, wenn du mein Angebot annehmen willst.“ Dann sagte der Betreuer: „Genau das hat Jesus für uns getan. Er hat unsere Strafe bezahlt, und wenn wir seine Bezahlung annehmen, seinen Tod für uns am Kreuz, können wir als freie Menschen gehen und werden für ‚nicht schuldig‘ erklärt.“ Wir können ein für alle Mal von Gott Vergebung empfangen für alles, was wir je getan haben oder jemals tun werden. Es ist bezahlt, wenn wir es annehmen.“
Irgendwie packte mich die Schlichtheit dieser Botschaft anders als je zuvor. Mir wurde klar, dass die Liebe, die ich von Gott gespürt hatte, von einem liebevollen Vater kam, der nicht wütend auf mich war, weil ich „böse“ gewesen war, und der nicht darauf wartete, mich beim kleinsten Fehltritt mit einem Blitz zu erschlagen. Alles ergab auf einmal einen viel tieferen Sinn.
Aber wenn es doch so gute Nachrichten gab, woher kam dann der Schmerz, den ich an diesem Abend spürte?
Mir tat es weh zu wissen, dass mein bester Freund Gott nicht kannte – dass er nicht wusste, dass es jemanden gab, der ihn so sehr liebte. Jemand, mit dem er eine Beziehung haben konnte. Ich wollte, dass er das auch erfuhr. Aber es war mir peinlich, mit ihm darüber zu reden. Schließlich ging es bei uns mehr darum, cool und taff zu sein und Wettkämpfe und Trophäen zu gewinnen als darum, einer von diesen komischen frommen Typen zu werden. Deswegen hatte ich nie mit ihm darüber geredet. Und an jenem Abend heulte ich mich deswegen vor dem Kamin in unserer Hütte bei meinem Betreuer aus. Ich musste wissen, wie ich aus diesem Dilemma herauskam – aus dem Dilemma, einerseits eine so unfassbare Wirklichkeit mit mir herumzutragen, von der ich wusste, dass er bestimmt davon erfahren wollte, und andererseits nicht den Mut zu haben, mit ihm darüber zu reden.
Seit damals ist viel passiert. Und ich habe inzwischen noch viel deutlicher erlebt, wie real Gott ist und wozu er imstande ist. Dieses Buch ist mein Versuch, meinen Weg mit Gott in Worte zu fassen – zu einem einzigen Zweck: Ich möchte, dass meine Freunde erfahren, dass Gott real ist. Seit jener Zeit habe ich zwar mit vielen meiner Freunde über Gott gesprochen, aber für sie und andere, mit denen ich nicht geredet habe, möchte ich das alles noch einmal zusammenhängend aufschreiben nach dem Motto: „Vielleicht haltet ihr mich für verrückt, aber das sind die Gründe, warum ich an Gott glaube und warum ich mir wünsche, dass ihr auch eine Beziehung zu ihm findet.“ Bevor Sie weiterlesen, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, dass sich manches, das ich in diesem Buch berichte, für Sie wahrscheinlich ziemlich verrückt anhören wird. Aber es ist alles wahr.
Freilich gibt es viele Hindernisse für den Glauben. Das habe ich selbst erlebt, nachdem ich mich später in meinem Leben entschieden hatte, meinen Glauben ernsthafter auszuleben. Ich kann also gut verstehen, wenn andere viele Fragen haben. Mir ist es auch nicht leichtgefallen, zufriedenstellende Antworten auf meine Fragen zu finden, denn ich konnte als gläubiger Mensch ja nicht mein Gehirn in einem Safe wegschließen. Mein erstes Ziel mit diesem Buch ist also, Ihnen meine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte von Gottes Realität in meinem Leben. Und das zweite: Ich möchte zeigen, wie sich die vielen herausfordernden Fragen für mich geklärt haben. In meinem Herzen und in meinem Kopf. Ich möchte Ihnen die Antworten weitergeben, die ich gefunden habe und die mir selbst geholfen haben.
Das Leben bringt so viele Herausforderungen mit sich, dass es uns schwerfällt, an einen guten Gott zu glauben. Noch dazu sind die Leute, die mit der Botschaft von Gott unterwegs sind, manchmal so verschroben und verrückt und abstoßend, dass wir zwangsläufig denken: „Wenn dieser Glaube wirklich die Wahrheit wäre, dann wären die Christen sicherlich keine so unattraktiven Nervensägen.“ Ich selber dachte früher immer: „Ich mag Gott; aber seine Freunde kann ich nicht leiden.“
Natürlich sind nicht alle Christen „so welche“. Unzählige von ihnen sind großartige Leute, die Unfassbares leisten. Sie setzen ihre Zeit, ihre Talente und ihre Mittel dafür ein, viel Gutes in der Welt zu bewirken, Armut und Leiden zu lindern und vieles mehr. Viele von ihnen sind Menschen mit einem makellosen Charakter. Das habe ich rund um die Welt immer wieder bestätigt gefunden. Doch wenn ich mit Leuten rede, die meinen Glauben nicht teilen, höre ich immer wieder, dass es gerade Erlebnisse mit manchen superfrommen Christen sind, die für sie ein großes Hindernis sind, Gott näherzukommen. Aber ich habe etwas Faszinierendes festgestellt: Genau mit diesen Superfrommen, die Ihnen und mir zu schaffen machen und die wir nicht ausstehen können, kam Jesus auch nicht gut aus. Ich werde Ihnen noch zeigen, was er tatsächlich über gewisse strenge, enge, narzisstische und manipulative religiöse Typen zu sagen hat. Hoffentlich kann ich Ihnen damit helfen, etwas zu entdecken, was ich gelernt habe: dass „die“ nämlich überhaupt nicht das sind, worum es ihm oder dem Glauben geht, und dass solche Leute oft genau das Gegenteil von dem tun, was er uns aufgetragen hat, auch wenn sie diese Dinge „in seinem Namen“ tun.
Mehr davon später.
Und nun lassen Sie mich Ihnen von meinen Erlebnissen erzählen, von meinen Fragen und von den Antworten, die ich gefunden habe und die meine Zweifel ausgeräumt haben. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Ich glaube nicht, dass meine Antworten die allerbesten sind, die jeden überzeugen. Sie sind lediglich mein von Herzen kommender Versuch, ehrlich davon zu erzählen, wie meine eigenen Fragen beantwortet wurden. Dabei geht es um viele unterschiedliche Bereiche – unter anderem um die Wissenschaft. Bei der Beschäftigung mit diesen unterschiedlichen Feldern habe ich etwas entdeckt: Es gibt kluge Köpfe auf beiden Seiten, unter Glaubenden und Nichtglaubenden, und das zeigt mir, dass weder Intelligenz noch Wissenschaft, Philosophie oder irgendeine andere Disziplin darüber entscheiden, ob jemand glaubt oder nicht. Wenn aber jemand glaubt, dann findet er in der Wissenschaft Unterstützung für seinen Glauben, und wie ich noch darlegen werde, können viele der genialsten Physiker, Biologen, Astronomen und anderen Wissenschaftler das bezeugen.
Legen wir also los. Zuerst erzähle ich von meinem Weg zum Glauben und dem, was ich dabei erlebt habe und wie manche schwierigen Fragen für mich beantwortet wurden.
Teil iWie ich zum Glauben an Gott kam
1 Kleine geistliche Anfänge
Mir geht es hier nicht darum, meine Lebenserinnerungen niederzuschreiben – das wäre viel zu langweilig und banal, als dass irgendjemand seine Zeit damit verbringen würde, das zu lesen. Was ich allerdings versuchen möchte, ist, die Geschichte meines geistlichen Lebens so aufzuschreiben, dass Sie mit mir gemeinsam einige meiner Schlüsselerlebnisse und Lernprozesse nachvollziehen können und so verstehen, wie ich über Gott denke.
Ich bin in Vicksburg in Mississippi aufgewachsen, einer Kleinstadt am Ufer des Mississippi. Der Ort war wunderbar für einen Heranwachsenden und bot alle Vorzüge einer kleinen Stadt. Es war so eine Art Zwischenwelt: eigentlich eine Stadt, aber nur einen Steinwurf entfernt vom ländlichen Leben am Beginn des Mississippi-Deltas. Aktivitäten im Freien wie Jagen, Fischen, Wasserski, Reiten, Golf und dergleichen gehörten zum Alltag. In der Stadt gab es eine enge Gemeinschaft von Familien und Freunden. Meine Eltern betrieben dort über vierzig Jahre ein kleines Geschäft. Ich wuchs in einer Familie auf, die in diesem kleinen Ort sehr gut eingebunden war.
Meine Eltern machten mich schon früh mit dem Glauben bekannt. Sie engagierten sich in einer Methodistengemeinde am Ort. Einen großen Teil ihrer Zeit und Kraft setzten sie für Bedürftige ein. Darüber hinaus brachten sie mir bei, dass unser Leben immer unter den Augen Gottes stattfindet. Sie taten das auf eine ziemlich unauffällige, traditionelle Weise: Sonntags gingen sie in die Kirche und zeigten ihren Glauben im Alltag, indem sie anderen dienten und gute Mitbürger waren. Bei uns zu Hause sah der Glaube so aus, dass wir schon früh in die Sonntagsschule gingen und insgesamt versuchten, gute Nachbarn zu sein. Es war nicht aufdringlich, wohlgemerkt, aber auf eine stille Art vielsagend. Ein guter methodistischer Südstaatenclan waren wir. Dabei hatte ich nie das Gefühl, wir wären eine „fromme“ Familie – es war einfach eine normale Südstaatenfamilie, in der der Glaube uns Orientierung gab, ohne irgendwie bedrückend oder anmaßend zu sein.
Jeden Abend sprach meine Mutter mit mir ein Nachtgebet ganz nach der Tradition von „Müde bin ich, geh zur Ruh“. Meinen Vater sah man in der Bibel lesen und regelmäßig in die Kirche gehen, aber so etwas wie Familienandachten oder gezielte „Unterweisung im Glauben“ gab es bei uns nicht. Das blieb den Sonntagsschullehrern überlassen. Über den Glauben wurde nicht viel geredet; er wurde einfach gelebt und vorausgesetzt.
Mein Vater war ein typischer Haudegen, viel unterhaltsamer als manche der „frömmeren“ Eltern meiner Freunde. Als Veteran des Zweiten Weltkriegs war Daddy ein ziemlich harter Bursche, aber er war auch liebevoll und konnte unglaublich witzig sein. Er konnte einen in jeder Situation zum Lachen bringen. Trotzdem wusste man immer, dass er für gewisse Dinge einstand, er hatte feste Überzeugungen, und eine davon war sein Glaube. Damit war es ihm sehr ernst, auch wenn er es nicht laut hinausposaunte. Er hatte Freunde aus den verschiedensten sozialen Schichten. Das schätzte ich sehr an ihm. Er heizte genauso gern mit Arbeitern den Grill an, wie er sich in Chefetagen herumtrieb, wahrscheinlich sogar noch lieber.
Insofern wuchs ich also durchaus in einer christlichen Familie heran, wenn auch nicht in einem übertriebenen Sinne.
Bei uns zu Hause trafen sich die unterschiedlichsten Leute. Meine Eltern waren ausgesprochen nett und allseits beliebt. Es kam nicht selten vor, dass sie für ihren gesellschaftlichen Einsatz belobigt wurden. In dieser Hinsicht blickte ich zu ihnen auf und ging davon aus, alle Leute seien so wie sie. In unserer kleinen Stadt war es normal, dass man anderen diente und sich um sie kümmerte.
Unter anderem arbeiteten sie ehrenamtlich bei „Essen auf Rädern“ mit. Mein Vater war im Vorstand der Heilsarmee und engagierte sich mit seiner Firma stark dafür, in jener Zeit der scharfen Rassentrennung im tiefen Süden der schwarzen Community auf verschiedenste Weise zur Seite zu stehen. Er war schon älter, als ich geboren wurde, und hatte als Kind die Weltwirtschaftskrise von 1929 miterlebt. Deshalb hatte er immer ein Herz für die Armen und für Menschen, die in irgendeiner Weise benachteiligt waren. Er selbst hatte aus der Armut heraus ein sehr gutes Geschäft aufgebaut und nutzte alle seine Möglichkeiten, um unser Gemeinwesen zu unterstützen. Sein Anliegen war es, junge Männer ohne Ausbildung von der Straße zu holen, ihnen eine Ausbildung rund ums Baugewerbe zu ermöglichen und ihnen so eine berufliche Perspektive zu geben. Viele seiner Angestellten arbeiteten über dreißig Jahre lang für ihn. Etliche hatte er vom Analphabetentum so weit gebracht, dass sie Bauzeichnungen lesen und als Vorarbeiter auf Baustellen tätig sein konnten. Diese Fähigkeit hatte er im Leben und bei der Armee gelernt – er war selbst als armer Straßenjunge von einer Organisation aufgelesen und ausgebildet worden, und nun tat er dasselbe für andere. Als er sich in seinen Sechzigern zur Ruhe setzte, übertrug er seine Firma, statt sie zu verkaufen oder meiner Schwester und mir zu hinterlassen, mitsamt der ganzen Ausrüstung an seine Angestellten, von denen er viele, wie erwähnt, von der Straße geholt und ins Berufsleben geführt hatte. Meine beiden Eltern arbeiteten in der Firma, und ich hatte immer das Gefühl, dass sie sich ebenso sehr als Sozialarbeiter betätigten wie als Unternehmer.
Ich habe eine Lieblingsgeschichte, die zeigt, dass mein Vater seinen Glauben eher auslebte, als darüber zu reden. Er war in seinen Zwanzigern, als der Zweite Weltkrieg begann, und er hatte sich freiwillig zur Armee gemeldet. Dort wurde er einem IQ-Test unterzogen und erzielte ein sehr gutes Ergebnis, obwohl er die Schule in der achten Klasse abgebrochen hatte, um zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Sein Vater war gestorben, und die Familie war sehr arm. Doch die fehlende Schulbildung tat seiner natürlichen Intelligenz keinen Abbruch, sodass er in der Armee bald auf Führungsaufgaben vorbereitet wurde. Man schickte ihn nach Europa und beförderte ihn zum Leiter einer Aufklärungseinheit, die Modelle für die Feldzüge General Pattons herstellte.
Das Interessante an dieser Gruppe war, dass alle seine Leute Künstler, Bildhauer und Set-Designer aus Hollywood waren – Zivilisten, die angeworben worden waren, um die Modelle zu bauen, anhand derer Generäle wie Patton ihre Schlachten planten. Da es damals noch keine Computermodelle gab, bauten sie ganze Räume voller Berglandschaften, Städte und anderer topografischer Szenerien nach, mit denen die Strategien ausgearbeitet wurden.
So verbrachte mein Vater seine erste Zeit in Europa als junger Sergeant, der aus Filmleuten Soldaten machte. Die jungen Männer unter seinem Kommando waren in England gestrandet, weit weg von zu Hause, von ihren Familien getrennt, und sie waren einsam und fühlten sich oft verloren. Hier waren sie mit einem echten Krieg konfrontiert und hatten vermutlich große Angst inmitten der Bombardements und der Zerstörungen in Europa, zumal sie keine Soldaten waren. Und mein Vater, der seit seinem neunzehnten Lebensjahr beim Militär war, hatte Mitleid mit ihnen. Er war hart, manchmal sogar schroff, aber er hatte ein gutes Herz.
Eines Abends ging mein Vater in die Stadt und ließ sich auf ein Würfelspiel ein (wie gesagt, er war Christ, aber nicht übermäßig fromm). Er hatte eine Glückssträhne und gewann im Lauf des Abends eine beträchtliche Summe. Dann überlegte er, was er mit dem vielen Geld anfangen sollte.
Er liebte gutes Essen und war die Armeeverpflegung gründlich leid. Gleichzeitig fühlte er mit seinen jungen Soldaten mit, die weit weg von zu Hause waren und auch nichts Anständiges zu essen bekamen. So zog er in der folgenden Woche los und kaufte insgeheim ein Restaurant in Henley-on-Thames, wo sie stationiert waren. Er bezahlte es in bar.
Da es ihm als ausländischem Militärangehörigen nicht erlaubt war, in England ein Geschäft oder ein Grundstück zu besitzen, machte er ein älteres Ehepaar ausfindig, das bereit war, das Restaurant zu betreiben und so zu tun, als gehörte es ihnen. Niemand sollte erfahren, dass er der Besitzer war. Auf diese Weise konnte er seinen geheimen Plan umsetzen.
Tee und andere Lebensmittel waren in Teilen Englands rationiert. Auf dem Stützpunkt hatte er diese Güter reichlich zur Verfügung und konnte sie als Tauschware bei Geschäften mit den Bauern in der Umgebung nutzen. Also fuhr er jede Woche hinaus aufs Land und tauschte bei den Bauern Tee gegen Hühner und Kartoffeln ein. Diese brachte er dann zu dem alten Ehepaar und sagte den beiden, sie sollten am Samstagabend das Restaurant schließen und für die US-Soldaten eine Party mit Brathähnchen und Pommes frites geben. Alles war umsonst, und die Soldaten konnten sogar noch jemanden mitbringen. Einfach nur als Zeichen der Wertschätzung eines alten englischen Paares an die amerikanischen Soldaten. Und niemand erfuhr je, was dahintersteckte: mein Vater, der illegale Restaurantbesitzer. Und der Knaller? Als er England verließ, um an der Befreiung Frankreichs teilzunehmen, übergab er den alten Eheleuten das Restaurant als Geschenk für alles, was sie getan hatten.
Diese Geschichte hatte ich als Kind von ihm und seinen Kriegskameraden oft gehört. Zur Feier meines College-Abschlusses reisten wir dorthin und er zeigte mir das Städtchen: den Jachtclub, wo die Cambridge-Oxford-Regatta stattfand und der ihr Hauptquartier gewesen war, und das Restaurant selbst. Ich werde das nie vergessen. In meinem Arbeitszimmer hängt ein Gemälde von dem Jachtclub.
Die Geschichte zeigt, wie mir als Kind von meinen Eltern der Glaube vermittelt wurde. Er war echt und präsent und er zeigte sich eher in großzügiger Fürsorge für andere als durch demonstrativ religiöses Gebaren. Meine Mutter war genauso. Sie setzte sich ständig für andere ein – Senioren, die nicht mehr aus dem Haus kamen, konnten sich immer darauf verlassen, dass sie vorbeikam und nach ihnen schaute. Um zwei Witwen kümmerte sie sich, bis sie mit über neunzig Jahren verstarben. Sie achtete stets darauf, dass ich sie mindestens einmal in der Woche besuchte, um nach ihnen zu sehen und ihnen ein wenig Gesellschaft zu leisten.
Außerdem brachte sie armen Kindern das Lesen bei, versorgte Menschen mit Essen und betreute in unserer Kirchengemeinde zwanzig Jahre lang die Babys und Kleinkinder während des Kindergottesdienstes. Und das sind nur einige der vielen guten Werke, die ich meine Eltern während meiner gesamten Kindheit vollbringen sah. Sie wollten sich damit nicht religiös hervortun, sondern es war ein echter Ausdruck ihrer Güte und ihres Glaubens.
Diese Art Glauben war nichts Ungewöhnliches in unserer Kleinstadt im Süden. Glaube war etwas ziemlich Privates und Praktisches, aber er war echt. Abgesehen davon, dass wir regelmäßig in die Kirche gingen, war bei uns zu Hause die vielleicht vordergründigste geistliche Praxis das Tischgebet und das Frühstückstreffen für Männer am Dienstagmorgen, zu dem mein Vater mich immer mitnahm.
Die längste Zeit meiner Kindheit und Jugend war auch mein Glaube so – persönlich und still, aber für mich dennoch real. Ich glaubte immer an Gott. Verstärkt wurde das durch die Sonntagsschule, wo ich einiges über Gott und ein wenig über die Bibel erfuhr und alles einfach als wahr akzeptierte. Die Sonntagsschule vermittelte uns eher soziales Bewusstsein als theologische Grundlagen, aber zumindest erinnerte sie uns immer wieder daran, dass wir nur durch Gott auf der Welt waren, auf eine Weise, die wir wohl nie wirklich verstehen würden.
Für mich war das insofern ein Geschenk, als ich schon sehr früh einfach irgendwie wusste, dass Gott da ist – in manchen Momenten konnte ich ihn sogar spüren. Er schien immer in der Nähe zu sein. Manchmal war er mir auch zu nahe, fand ich, wenn ich „böse“ war. Ich weiß noch, wie ich einmal etwas angestellt hatte, als ich noch ziemlich klein war. Ich ging in den Keller und sagte ihm: „Gott, ich weiß, dass ich böse bin, aber du hast mich gemacht. Also bist du es, der mich böse gemacht hat – aber ich kriege deswegen Ärger. Das ist nicht fair.“ Es kam mir wirklich nicht fair vor, aber ich nahm es hin und ließ es hinter mir. Mal war ich „böse“ und bekam Ärger wegen aller möglichen kindlichen Delikte, mal versuchte ich, „brav“ zu sein. Ich war mir nie sicher, welche Seite die Oberhand hatte.
Darüber war ich immer verwirrt und nie sicher, ob ich ein „böser“ oder ein „guter“ Junge war. Das hatte viel damit zu tun, dass ich eigentlich gut sein wollte, aber gleichzeitig häufig in verbotene Regionen vorstieß. So sah mein frühes Glaubensleben aus. Als ich später Psychologe wurde, erfuhr ich, dass diese Schuldgefühle und Verurteilungen zu einem großen Teil nicht von Gott, sondern von anderen Stimmen kamen: mal von meiner Mutter, die sehr versiert darin war, Schuld und Scham als Erziehungswerkzeuge anzuwenden, mal von meinem Vater, dem Hauptfeldwebel, dessen strenge Strafen mir bisweilen eine Heidenangst einjagten.
Sagen wir einfach, dass ich schon sehr früh ein starkes Bewusstsein von Gott hatte, manchmal verbunden mit einer ungesunden Dosis Verwirrung im Hinblick auf unsere Beziehung zueinander. Dabei spielten auch meine Freunde und die Leute, mit denen ich gern zusammen war, eine große Rolle. Zur Clique der „Normalen“ fühlte ich mich viel stärker zugehörig als zu den „Kirchentypen“. Ich machte zwar nicht bei allem mit, was manche von ihnen anstellten, aber sie waren diejenigen, die ich am besten leiden konnte (später fand ich heraus, dass ich das mit Jesus gemeinsam hatte – auch er hing lieber mit den coolen Typen ab, als sich mit den frommen Leuten abzugeben).
Ich redete viel mit ihm – ich sah ihn in allem, besonders in der Schönheit der Natur und der Schöpfung. Es leuchtete mir schon immer ein, dass jemand die Schönheit der dunklen Wälder erschaffen hatte, in denen ich jagen und reiten ging; die Seen, in denen ich schwamm, fischte und Wasserski fuhr; und die Düfte des Frühlings, besonders den Geruch des Grases nach einem Regenguss. Ich habe schon als kleines Kind Golf gespielt, und ich werde immer den Geruch von frischem grünem Gras tief in meiner Seele tragen, besonders, wenn es geregnet hat. Ich wusste, dass Gott das erschaffen hatte. Ebenso auch die Gewitter. Kein Zweifel, die erschreckenden Donnerschläge kamen von ihm und sorgten manchmal vielleicht dafür, dass ich auf dem rechten Weg blieb.
Besonders, wenn ich allein war, redete ich viel mit ihm. Und ich war viel allein. Meine Mutter arbeitete in der Firma meines Vaters mit, sodass ich als Kind viele Tage allein verbrachte, wenn ich nicht gerade draußen mit Sport oder Spiel beschäftigt war. Im Wald, beim Reiten, auf meinem Fahrrad, beim Jagen oder Fischen oder besonders auf dem Golfplatz. Ich verbrachte viel Zeit allein und mit Gott und redete mit ihm über das Leben. Manche meiner stärksten geistlichen Erfahrungen hatte ich als Kind, wenn ich allein mit meinem Pferd durch den Wald ritt und einfach nur zu Gott sprach.
Ich weiß noch, wie ich als ganz kleines Kind allein im Garten saß, im Gras spielte oder mit meiner kleinen Schaufel herumbuddelte. Wenn dann ein Vogel vorbeiflatterte oder ich ein Auto bemerkte, das plötzlich meine Aufmerksamkeit auf sich zog, stand ich unversehens vor einem frühen geistlichen Dilemma: der freie Wille einerseits, andererseits die Einflüsse von außen. Wenn der Vogel meinen Blick auf sich lenkte und ich zu ihm aufschaute und merkte, dass meine Aufmerksamkeit nun in eine andere Richtung ging als vor der Ablenkung durch den Vogel, saß ich in einer Zwickmühle: Wäre der Vogel nicht vorbeigeflogen, würde ich nicht dorthin schauen. Ich würde in eine ganz andere Richtung schauen, und mein Tag wäre anders verlaufen. Eine einzige Handlung, die ich nicht verursacht hatte, hatte eine Kette von Ereignissen ausgelöst, die das Potenzial hatten, mein Leben für immer zu verändern.
Und ich fragte Gott: „Okay, wenn ich diesen Vogel oder dieses Auto nicht gesehen hätte, würde ich immer noch auf die Schaufel schauen. Und jetzt tue ich etwas völlig anderes, habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen; ich buddele nicht mehr in der Erde, sondern schaue den Himmel oder die Bäume an. Wegen dieses Vogels läuft mein Leben nun anders ab. Habe ich mein Leben unter Kontrolle oder nicht? Hast du das verursacht? Lenkst du mein Leben oder ich? Oder der Vogel oder das Auto? Das war nicht meine Entscheidung – es ist einfach passiert, und jetzt bin ich hier.“ Eine ziemlich rätselhafte Frage, und ich weiß noch, wie ich Gott immer wieder bat, er möge mir helfen, das zu verstehen. Wer steuert, was passiert und wo führt uns das hin? Ich schätze, ich wurde damals schon darauf vorbereitet, einmal Psychologe zu werden. Solche Gespräche mit Gott hatte ich oft. Er war mir immer im Bewusstsein, und wir hatten immer eine Beziehung zueinander. Ich wusste einfach, dass das real war. Nicht so, wie ich es heute weiß, da diese Gewissheit damals noch nie auf die Probe gestellt worden war, aber ich hatte einfach schon als kleines Kind das Gefühl, dass er real war.
Eine andere geistliche Frage, mit der ich immer wieder kämpfte, war die Frage nach der Zeit und meinem Platz darin. Ich saß etwa im Garten und richtete meine Aufmerksamkeit auf das, was ich im „Jetzt“ tat, und dann konnte ich mich daran erinnern, was ich zuvor getan hatte, am Morgen zum Beispiel. Und dann konnte ich mich ans Frühstück erinnern oder sogar an den vergangenen Tag. Noch weiter zurück jedoch verschwamm das Bild. Warum konnte ich mich nicht an mein ganzes Leben erinnern, bis ganz an den Anfang, wenn ich doch noch genau wusste, was an diesem Morgen passiert war? Und wie konnte es passieren, dass dieser Moment des „Jetzt“ genauso verloren gehen würde wie meine „Vergangenheit“? Wieso war nicht mein ganzes Leben gleichermaßen gegenwärtig und als „Jetzt“ verfügbar? Erst viele Jahre später, als ich mich mit Neurowissenschaften, Nahtoderfahrungen, Quantenphysik und Relativitätstheorie beschäftigte, wurde mir klar, wie komplex diese Fragen waren. Das war nur ein weiteres Beispiel für meine beständigen Gespräche mit Gott. Irgendwie dachte ich immer, er müsse doch eine Antwort auch auf meine kniffligsten Fragen haben, und so redete ich viel mit ihm über meine frühen Lebensfragen.
Mein „geistliches Leben“ als Kind war geprägt vom Verhalten meiner Eltern und von meinen vielen Fragen, die ich direkt an Gott richtete. Als ich älter wurde, fiel mir etwas auf, das mich beunruhigte: Es gab zwei Gruppen von Leuten, zu denen ich nicht passte, weil mein „geistliches Leben“ so war, wie es war.
Erstens waren da die eingefleischten Kirchgänger, mit denen ich gar nichts gemeinsam hatte und die auch ganz anders waren als meine Familie. Bei ihnen gab es offenbar jede Menge Regeln – zum Beispiel, dass man nicht zum Tanzen oder ins Kino ging, nicht Poker spielte oder Wetten auf Golfspiele abschloss. Manche meinten sogar, man dürfe sonntags nicht Golf spielen. Ich fühlte mich immer ein bisschen schlecht in ihrer Nähe und spürte ihre Missbilligung. Gleichzeitig spürte ich, dass wir durch den Glauben an Gott eine Gemeinsamkeit hatten. Ich gehörte also einerseits zu ihrem Club dazu, andererseits aber auch wieder nicht. Ich glaube, ich war wie mein Vater. Er liebte Gott, aber über die übertrieben frommen Typen machte er sich gerne ein bisschen lustig. Aber – irgendwie waren wir auch wie sie.
Zweitens gab es die Leute, die mit Gott nichts am Hut hatten. In mancher Hinsicht konnte ich mit ihnen auch etwas anfangen, bisweilen sogar noch mehr als mit den frommen. Sie machten all das, was auch mir Spaß machte, und waren viel lockerer. Sie gingen sogar sonntags Wasserski fahren! Aber als ich älter wurde, merkte ich, dass diese Leute auch Dinge machten, von denen ich wusste, dass meine Eltern sie nicht gut fanden und ich zum Teil auch nicht. Ich mochte es, mit ihnen unterwegs zu sein. Zum Beispiel bei Konzerten mit den Allman Brothers oder Led Zeppelin; nur nahm ich keine Drogen, wie sie es taten.
Im Laufe der Zeit bekam ich immer mehr den Eindruck, dass ich zu keiner der beiden Gruppen so richtig dazugehörte. So „böse“, wie meine Freunde manchmal waren, schien ich nicht zu sein, aber auch nicht so „gut“ wie die Leute aus der Kirche. „In der Mitte verirrt“ wäre wohl eine passende Beschreibung für meinen persönlichen geistlichen Standort damals. Dieses Gefühl hielt lange an – in mancher Hinsicht bis heute.
Das Dilemma, dass ich tief im Herzen spirituell war, mich aber gleichzeitig nicht völlig mit der „Religion“ oder den „kirchlichen Typen“ identifizieren konnte, war das vorherrschende Thema meiner frühen Jahre. Ich hätte gerne mit meinem besten Freund, der ein ziemlich zügelloser Bursche war, über Gott geredet, aber ich fürchtete, dann würde er mich für „einen von denen“ halten. Ich wusste nicht, wie ich mit Freunden wie ihm umgehen sollte, und wie gesagt, manchmal weiß ich das bis heute nicht. Ich hielt im Geheimen an meinem geistlichen Leben fest, ohne wirklich einer von diesen „frommen Typen“ zu sein, und hatte das Gefühl, nirgendwo landen zu können, wie ein geistlicher Wanderer ohne echtes Zuhause. Also blieben Gott und ich meistens mit uns allein. So verlief mein geistliches Leben bis zum College. Ich hatte eine Beziehung zu Gott und dabei immer das Gefühl, nicht so geistlich zu sein, wie ich eigentlich sein sollte.
Aber es gab einen unverkennbaren „Gottesmoment“ in meinen frühen Jahren. Ein Erlebnis, das mir half, meine eigene geistliche Entwicklung zu verstehen, und das für mich zu einer Art Anker wurde, an dem ich festmachte, dass Gott wirklich in meinem Leben war. Eines Sonntagmorgens, als ich knapp vier Jahre alt war, saß ich in der Sonntagsschule auf dem Fußboden, als ich plötzlich starke Schmerzen im linken Bein bekam. Es wurde immer schlimmer, bis schließlich meine Eltern gerufen werden mussten. Ich weiß noch, wie sie mit mir nach Hause fuhren und dann große Hektik ausbrach, während sie Ärzte anriefen und sich bemühten herauszufinden, was zu tun sei. Ich erinnere mich lebhaft an das äußerst bedrohliche, finstere Gefühl, das mich damals überkam. Ich saß draußen auf dem Rasen und wartete darauf, dass die Ärzte kamen und Entscheidungen getroffen wurden. Mein Bein tat fürchterlich weh, und mir wurde deutlich bewusst, dass mein Leben sich irgendwie verändert hatte. Es fühlte sich richtig finster an.
Ich hatte keine Ahnung, wie recht ich damit hatte.
Noch am selben Tag kam ich ins Krankenhaus, und die Ärztinnen und Ärzte machten sich an die Arbeit, um herauszufinden, was mit mir nicht stimmte. Meine Eltern erzählten mir später, dass ich etliche Nächte vor Schmerz schreiend verbrachte und dass ihnen das große Angst machte. Ich litt heftige Qualen, und sie mussten es hilflos mit ansehen. Die Ärzte führten alle nur erdenklichen Tests an mir durch, und ich blieb eine ganze Weile im Krankenhaus – ungefähr einen Monat, glaube ich. Ich erinnere mich dunkel an Besuche von Leuten, an jede Menge Blutentnahmen, Röntgenaufnahmen. An Frauen und Männer in weißen Kitteln, die an mir herumstocherten, und an die große Furcht, die ich in dieser Zeit spürte. Manchmal saßen im Krankenhaus nachts Leute bei mir, die ich nicht kannte, und ich fühlte mich ängstlich und allein. Ich glaube, das war mit das Schlimmste – das Gefühl, allein zu sein.
Nun zu meinem „Gottesmoment“: Irgendwann zogen die Ärzte eine Amputation meines Beins in Erwägung. Beim nächsten Termin in der Klinik hatte meine Mutter ihre beste Freundin Emmett mitgebracht. Emmett war wie eine zweite Mutter für mich, und sie war die Mutter meines besten Kinderfreundes Ike. Sie waren meine Zweitfamilie, und sie ging mit uns durch diese ganze Krise wie auch ihr Mann, der Arzt und Chef des Krankenhauses war, in dem ich behandelt wurde. Der behandelnde Arzt verspätete sich bei dem Termin, und wir mussten eine ganze Weile auf ihn warten. Währenddessen hörte meine Mutter eine Stimme, die zu ihr sagte: „Geh hier weg und bring ihn in die Ochsner-Klinik in New Orleans.“ Die Ochsner-Klinik war das große Ausbildungskrankenhaus im Süden, damals so etwas wie die Mayo-Klinik oder die Cleveland-Klinik des Südens. Dort ging man hin, wenn alle anderen Behandlungsversuche gescheitert waren.
Meine Mutter wandte sich zu Emmett und sagte: „Komm, wir fahren.“ Emmett musste wohl ziemlich verdutzt gewesen sein, aber wegen der Stimme, die sie deutlich gehört hatte, war meine Mutter sich ihrer Sache ganz sicher. Sie fuhr mit mir nach Hause und überzeugte meinen sonst sehr nüchtern denkenden Vater irgendwie davon, einer Stimme zu gehorchen, die sie aufforderte, 225 Meilen zu fahren – ohne Arzt, ohne Plan, ohne Überweisung –, einfach nur aufgrund einer Anweisung direkt „von Gott“.
So brachten sie mich in die Ochsner-Klinik. Dort wurde ich „wahllos“ einer neuen orthopädischen Chirurgin namens Dr. Mary Sherman zugeteilt. Wie sich herausstellte, war diese Zuweisung alles andere als wahllos.
Ich kam in ihr Behandlungszimmer und erinnere mich noch lebhaft daran, wie sie mich untersuchte, mich zum Röntgen schickte und dann mich und meine Eltern wieder hereinbat. Mir kam sie vor wie eine Märchengestalt – sehr offen, sehr hübsch, so zuversichtlich und so freundlich. Sie sah meine Eltern an und sagte: „Wir werden nicht amputieren. Ich weiß genau, was das ist und wie es behandelt wird.“ Dann erklärte sie die Erkrankung meiner Hüfte und den Ablauf der Behandlung, die nun erfolgen würde. Eine Weile lang würde ich im Rollstuhl sitzen, dann für längere Zeit – bis zu zwei Jahren – Beinschienen und Gehhilfen benötigen. Und dann – „ist er wieder gesund“.
Das Erstaunliche war, dass Dr. Sherman von Chicago nach New Orleans gekommen war. In Chicago war sie speziell in der neuesten Behandlungsmethode für diese Erkrankung geschult worden, und zwar von den Ärzten, die sie entwickelt hatten. Sie war zu dieser Zeit weltweit eine der angesehensten Knochenspezialistinnen. Wie sich herausstellte, war sie die Einzige, die diese Krankheit so gut behandeln konnte. Meinen Eltern war klar – und das haben sie mir auch immer gesagt –, dass die Stimme, die meine Mutter gehört hatte, die Stimme Gottes gewesen war. Er hatte sie geführt, ihre Gebete beantwortet und ihnen gezeigt, was sie tun sollten, als sie nicht mehr weiterwussten. Sie waren in einer Sackgasse gelandet, hatten eine Stimme gehört und sich den Experten widersetzt. Die Stimme hatte sie ausdrücklich zu einem ganz bestimmten Krankenhaus geschickt, wo ich „wahllos“ einer von vielen möglichen Ärztinnen zugewiesen wurde, auf die ich in einer so großen Ausbildungsklinik hätte treffen können. Der einzigen Ärztin, die über die richtigen Kenntnisse verfügte. Punktlandung. Kein Zufall.
Im Rückblick kann ich nicht mehr genau sagen, welche Rolle dieses Ereignis für meinen Kinderglauben spielte. Ich wusste nur von meinen Eltern, dass Gott in mein Leben eingegriffen hatte. So wurde seine Fürsorge Teil meiner Lebensgeschichte – dass Gott da ist und sich in schweren Zeiten um uns kümmert. Wir können uns jederzeit an ihn wenden. Ich hatte früh erfahren, was ein Trauma ist – eben war ich noch ein knapp vierjähriger Wildfang gewesen, im nächsten Moment wurde mir gesagt, dass ich im Rollstuhl sitzen würde! Und das aus heiterem Himmel. „Warum darf ich nicht mehr laufen?? Lasst mich laufen!“ Ich weiß noch genau, wie chaotisch sich das anfühlte und wie wütend ich wurde.
Es war eine wirklich schwere Zeit, die fast zwei Jahre lang andauerte. Wenn ich das kranke Bein auch nur ganz leicht belastete, wurde ich sofort zurechtgewiesen. Ich erinnere mich an die starken Schmerzen. Da ich gehbehindert war und nicht mehr spielen durfte wie zuvor, blieb ich bei fast allem, was meine Freunde unternahmen, außen vor. Bei Geburtstagspartys saß ich an der Seitenlinie, während die anderen Kinder herumtobten, und kam mir vor wie ein Ausgestoßener. Ich war irgendwie anders – fehlerhaft. Peinlich. Ich erinnere mich, wie ich mit meinen Gehstützen und Beinschienen versuchte, ein paar Stufen hinabzusteigen, und dabei stolperte und die ganze Treppe hinunterfiel. Die Bruchstücke meiner Schienen bohrten sich in meine Beine, und ich lag blutend vor der Treppe zum Postamt. Oder die Blicke, wenn ich mit meinen Gehstützen in den Bus stieg und die Leute mein Kindermädchen fragten: „Was hat denn das kranke Kind?“ Oder wie andere mich „Krüppel“ nannten und wie mich später immer wieder die Erinnerungen an riesige, beängstigende Röntgenapparate und medizinische Prozeduren überfielen.
Es war eine schwierige Phase für mich und für unsere ganze Familie, die in meinem Leben psychische und emotionale Nachwirkungen hinterließ. Aber diese Zeit prägte mich auch geistlich. Ich wusste, dass Gott da ist, wenn etwas Tragisches passiert und das Leben nicht mehr so ist wie zuvor.
Zwei Jahre später war ich wieder gesund und konnte ins normale Leben zurückkehren. Ich wollte nicht mehr an all das denken. Ich wollte kein „Krüppel“ mehr sein und stürzte mich kopfüber ins andere Extrem: Jetzt war ich verrückt nach Sport. Wahrscheinlich wollte ich die verlorene Zeit aufholen und versuchte deshalb, meine körperliche Unsicherheit überzukompensieren; jedenfalls machte ich bei allen erdenklichen Sportarten mit. Ich musste ja beweisen, dass ich nicht „minderwertig“ oder nur ein „verkrüppeltes“ Kind war. Fußball, Baseball, Basketball, Golf, Wasserspringen, Karate und vieles mehr. Mit elf oder zwölf Jahren gewann ich die Meisterschaft des Staates Mississippi im Wasserspringen, belegte den dritten Platz bei der Three States Southern Competition und wurde eingeladen, mich von Trainern der Olympiamannschaft coachen zu lassen und darauf hinzuarbeiten, eines Tages als Springer an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Später gewann ich den dritten Platz bei einer Zehn-Staaten-Karatemeisterschaft. Ich war unglaublich getrieben. Doch allmählich schälte sich, da ich für Basketball und Fußball zu klein war, das Golfspiel als mein Sport und meine Leidenschaft heraus, und bald wurde es zu meinem Lebensinhalt.
Mit zwölf Jahren war mir klar, dass ich Golf mehr liebte als alles andere. Ich spielte bei vielen Turnieren mit, schnitt gut ab und gab nach und nach alle anderen Sportarten auf, um meiner Leidenschaft nachzugehen. Daneben beteiligte ich mich an allen anderen Aktivitäten in der Schule, am sozialen Leben, an den typischen Freizeitbeschäftigungen in den Südstaaten wie Jagen, Fischen und Wasserskifahren, und natürlich hatten es mir auch die Mädchen angetan. Mit der Zeit verblassten die Schmerzen und das Trauma wie auch die geistliche Lektion, die ich durch meine Erkrankung gelernt hatte. Das war in einem anderen Leben gewesen. Jenes „verkrüppelte“ Kind hatte ich weit hinter mir gelassen.
Und während ich so mein Leben lebte, behielt ich Gott ganz still für mich – Gott war mein Freund, aber nach außen hin ließ ich mir nicht viel von meinem Glauben anmerken. Ich redete viel mit Gott, versuchte ihm nahe zu bleiben und verbarg das meistens vor allen anderen.
Bis mir keine Wahl mehr blieb.
2 Suchet, so werdet ihr finden
Es war eine aufregende Sache, während meiner Highschool-Zeit in der Junior-Golf-Liga in Mississippi zu spielen. Nicht nur wegen der Turniere, der Reisen und der spannenden Wettkämpfe, sondern auch wegen der Aussichten auf die Zukunft: das College. Ich hatte Angebote von verschiedenen Hochschulen und hatte mich noch nicht entschieden, als der Coach an der Southern Methodist University mich zu einem Gespräch nach Dallas einlud. Ich wusste nicht viel über die SMU abgesehen davon, dass sie ein gutes Fußballteam und eine großartiges Golfteam hatten. Ich nahm die Einladung an, die Hochschule zu besuchen und mit dem Coach eine Proberunde Golf zu spielen.
Bis heute erinnere ich mich lebhaft an die Reise nach Dallas, wo ich auf dem Gelände des Northwood Cricket Club spielte. Dort war auch schon die PGA-Tour gespielt worden, eines der vier großen Golfturniere. Mein Golflehrer begleitete mich, und am Ende dieses Tages bat mich der Coach, dem SMU-Golfteam beizutreten. Ich war begeistert. Der nächste Schritt meines Traums wurde wahr. Im Herbst würde ich nach Dallas ziehen.
Als ich schließlich in Dallas ankam, musste ich feststellen, dass der Coach, der mich engagiert hatte, überraschend zurückgetreten war. Einen neuen Coach gab es noch nicht. Zur Überbrückung wurde ein Ersatzcoach eingesetzt, und da mir fürs erste Semester nur ein Teilstipendium zugesagt worden war und ich erst im zweiten Semester die volle Finanzierung erhalten würde, wollte der Ersatzcoach alles noch einmal von vorn aufrollen und sagte, wir Neulinge müssten uns erst fürs Team qualifizieren. Es war ein Schlag – ich hatte gedacht, alles wäre in trockenen Tüchern, und jetzt musste ich noch einmal von vorn anfangen. Ich hätte auch an mehrere andere großartige Hochschulen wechseln können, aber ich war inzwischen innerlich vollkommen auf die SMU eingestellt. Also erklärte ich mich einverstanden zu bleiben und in der Qualifikation zu spielen. Es gab etliche gute Spieler, die sich qualifizieren wollten, und nur zwei Plätze in der Mannschaft. Meine Zukunft in diesem College hing gänzlich von diesem Qualifikationsturnier ab. Wenn ich es nicht schaffte, würde ich auf eine andere Hochschule wechseln, wo ich sicher im Team mitspielen konnte.
Es gelang. Ich blieb bei dem Turnier unter Par. Zwei von uns schafften an jenem letzten kalten, regnerischen Tag in Dallas die Qualifikation. Ich war erleichtert, um es milde auszudrücken. Mein Platz im Team war mir sicher.
Einige Zeit später verletzte ich mich am Handgelenk, sodass mein Spiel für den Rest des Jahres beeinträchtigt war. Manchmal spielte ich gut, manchmal klappte gar nichts. Ich suchte mehrere Ärzte auf, doch sie hatten Mühe, eine Diagnose für meine Schmerzen zu finden. Sie dachten, es wäre eine Sehnenscheidenentzündung, und verpassten mir einen Haufen Spritzen. Bis zum folgenden Sommer schien es wieder aufwärtszugehen. Ich bekam Kortisonspritzen, spielte diverse Turniere und kam stetig voran. Der Sommer lief gut für mich; fast hätte ich sogar die Mississippi Open gewonnen. Ich lag zwei Schläge unter Par für das Turnier, mit zwei Schlägen Abstand zur Führung, als das Turnier vor dem letzten Tag wegen Regen abgebrochen wurde. Doch da ich jetzt weniger Schmerzen hatte und im Lauf des Sommers einige andere Turniere gewann, hatte ich große Hoffnungen für mein zweites Jahr an der SMU.
Der neue Coach, der den Ersatztrainer ablöste, war großartig. Earl Stewart, ein ehemaliger Turnierspieler, der in die Texas Hall of Fame