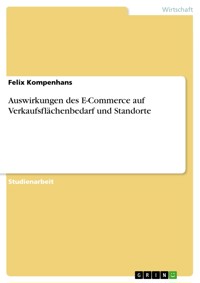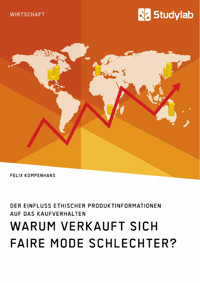
Warum verkauft sich faire Mode schlechter? Der Einfluss ethischer Produktinformationen auf das Kaufverhalten E-Book
Felix Kompenhans
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Modeindustrie stellt heutzutage in kürzester Zeit kostengünstige Massenartikel her. Das funktioniert nur auf Kosten der Umwelt sowie der Produktionsbedingungen. Die Folgen sind Übernutzung der natürlichen Ressourcen, Niedriglöhne und Ausbeutung der Angestellten in Entwicklungsländern. Wie Felix Kompenhans verdeutlicht, nimmt ethische Kleidung in der Modebranche noch immer nur eine Marktnische ein. Dabei gibt es inzwischen zahlreiche Möglichkeiten, um sich als Käufer über die Produktionsbedingungen eines Kleidungsstücks zu informieren. Welchen Stellenwert nehmen ethische Produktinformationen im Rahmen der Kaufentscheidung ein? Welche weiteren Einflussfaktoren sind von Bedeutung? Kompenhans erklärt, warum so wenige Menschen ethische Kleidung kaufen und wie man die größten Hindernisse aus dem Weg räumen kann. Aus dem Inhalt: - Consumer Social Responsibility; - Corporate Social Responsibility; - Fairtrade; - Fair Wear Foundation; - World Fair Trade Organization; - Textilindustrie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Copyright © Studylab 2019
Ein Imprint der GRIN Publishing GmbH, München
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: GRIN Publishing GmbH | Freepik.com | Flaticon.com | ei8htz
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Problemstellung
2 Definitorische Grundlagen
2.1 Begriffsbestimmung ethischer Produktinformationen
2.2 Informationsökonomische Eigenschaftstypologie
2.3 Die Rolle der Bereitstellung ethischer Produktinformationen
3 Das Total Ethical Fashion Quality Model
4 Umfang und Auswirkungen ethischer Produktinformationen auf die Kaufentscheidung
4.1 Label und Prüfzeichen als Träger der Information
4.2 Klassifizierung und Charakteristika der Informationen
4.2.1 Soziale Aspekte entlang der Wertschöpfungskette
4.2.2 Herkunftsland
4.2.3 Umweltpolitische Gegebenheiten
4.2.4 Tierschutz
4.3 Gegenüberstellung von positiv und negativ wahrgenommenen Informationen
5 Implikationen für Händler und Hersteller
6 Fazit und Ausblick
Anhang
Total Food Quality Model
Ausgewählte Label und Prüfzeichen
Rechtliche Rahmenbedingungen
IAO-Kernarbeitsnormen
Artikel 20a des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Die drei Produktdimensionen
Abbildung 2: Konzeptioneller Bezugsrahmen zu ethischen Produktinformationen
Abbildung 3: Means-End-Chain Ansatz am Beispiel ethischer Mode
Abbildung 4: Das TEFQM
1 Problemstellung
Die Übernutzung der natürlichen Ressourcen, das stetige Bevölkerungswachstum und die fortschreitende Digitalisierung tragen ökonomisch, ökologisch und sozial größtmögliche Herausforderungen inne. Dabei spielt ein nachhaltiges Umdenken auf politischer, unternehmerischer und gesellschaftlicher Ebene eine immer fundamentalere Rolle (Otto Group Trendstudie, 2013, pp. 7–9).
Die Modeindustrie hat in den letzten Jahren einen rapiden Wandel erlebt, welcher sich bleibend auf die Umwelt und das alltägliche Leben von Menschen in Entwicklungsländern auswirkt (Jung & Jin, 2016, p. 410). Durch Outsourcing der Produktion und der damit verbundenen Niedriglöhne schaffen Textilunternehmen eine Grundlage, welche es ihnen ermöglicht, in kürzester Zeit Massenartikel herzustellen und kostengünstig anzubieten (Shaw, Hogg, Wilson, Shiu, & Hassan, 2006, pp. 430–433). Während die Modebranche wächst, weiten sich die Umweltschäden, die von ihr ausgehen, immer weiter aus (Greenpeace, 2016a, pp. 3–10). Der Einsturz einer Produktionsstätte im Jahr 2013 in Bangladesch bei dem knapp 1500 Menschen ihr Leben verloren, steht exemplarisch für eine mangelnde staatliche Regulierung in den Produktionsländern, welche inhumane Arbeitsbedingungen zulässt (Günseli & Van der Meulen Rodgers, 2010, pp. 65–70; Maher, 2014). Trotz drastischer Auswirkungen, ausgehend von der Modeindustrie und einem allgemein gesteigerten Bewusstsein der Konsumenten, sowie Zahlungsbereitschaften bezüglich ethischer Produkte, nimmt ethische Kleidung in der Modebranche lediglich eine Marktnische ein (Boulstridge & Carrigan, 2000, pp. 359–361; Schenkel-Nofz & Walther, 2014, p. 217; Trudel & Cotte, 2009, pp. 62–63).
Längst tragen Informationen und deren Bereitstellung in der ökonomischen Literatur eine unbestrittene Wichtigkeit inne (Césare & Salaün, 1995, p. 209; Swinnen, McCluskey, & Francken, 2005, pp. 175–176; Verbeke & Ward, 2006, pp. 453–454). Neben dem Aussehen und dem Preis als wesentliche Indikatoren für die wahrgenommene Qualität eines Produktes, sind Informationen, wie beispielsweise über den Herstellungsprozess, für den Verbraucher zunehmend wichtiger (Salaün & Flores, 2001, p. 24). Im Zeitalter der Digitalisierung und des E-Commerce in dem Konsumenten via mobilem Endgerät schneller denn je ein größtmögliches Spektrum von Informationen über Produkte, Dienstleistungen, und deren Eigenschaften abrufen können, steht eine übersichtliche, strukturierte und zielgruppenorientierte Informationsbereitstellung im Fokus der Händler (Boulstridge & Carrigan, 2000, p. 358; Carrigan & Attalla, 2001, pp. 569–570; Lademann, 2015, pp. 22–25). Da das Wissen der Konsumenten bezüglich ethischer Kleidung als relativ gering zu bewerten ist, ist es für Händler und Hersteller umso relevanter, Produktinformationen in einem verständlichen und attraktivem Wege bereitzustellen und zu übermitteln (Boulstridge & Carrigan, 2000, p. 360; Hiller Connell, 2010, p. 282; Hill & Lee, 2012, pp. 481–488). Der Forschungsschwerpunkt ethischer Produktinformationen bezieht sich in der wissenschaftlichen Literatur maßgebend auf den Konsumbereich von Lebensmitteln, was die Hauptforschungsfrage hinsichtlich der Forschungslücke des Einflusses ethischer Produktinformationen unter Bezugnahme der Modebranche, umso relevanter erscheinen lässt:
Welchen Stellenwert nehmen ethische Produktinformationen im Rahmen der Kaufentscheidung von Kleidung ein?
Um diese Frage beantworten zu können, sind zunächst weitere Unterforschungsfragen zu beantworten: Was ist unter ethischen Produktinformationen zu verstehen?
Es wird dargestellt, inwiefern sich ethische Produktattribute im Rahmen der drei Produktdimensionen „Kernprodukt“, „reales Produkt“ und „erweitertes Produkt“ als letzteres verstehen lassen (Crane, 2001, p. 363; Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2011, p. 589). De jure ist der Begriff des „fairen Handels“ nicht geschützt, sodass er de facto von allerlei Nutznießern verwendet wird (GEPA Fair Trade Company, 2016). Konsumenten werden in ihrer Kaufentscheidung mit etlichen Begrifflichkeiten, wie beispielsweise „nachhaltig“, „ethisch“, „grün“, „öko“ oder speziell auf Kleidung bezogen mit „slow fashion“ konfrontiert, was schnell zu einer Unübersichtlichkeit und Ablehnung der Produkte führen kann (Balineau & Dufeu, 2010, pp. 341–342; Cervellon, Hjerth, Ricard, & Carey, 2010; Hill & Lee, 2012, pp. 481–482). Folglich ist es unabdingbar jene Terminologien voneinander abzugrenzen. Weiterhin werden Such-, Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften differenziert (Balineau & Dufeu, 2010, pp. 340–342; Darby & Karni, 1973, pp. 68–72; Foscht & Swoboda, 2011, p. 22; Nelson, 1970, pp. 327–328). Nach De Pelsmacker & Janssens (2007, pp. 372–375) hat die vom Konsumenten wahrgenommene Qualität der Informationen einen direkten Einfluss auf die Kaufentscheidung, was die zweite Unterforschungsfrage für diese Arbeit umso bedeutsamer macht:
Welche ethischen Produktinformationen beeinflussen das Kaufverhalten und welche weiteren Einflussfaktoren sind von Bedeutung für die Kaufentscheidung?
Die intransparente Vielzahl von Labeln und Prüfzeichen als Träger der Information wirkt sich nachteilig auf die Kaufentscheidung von ethischer Kleidung aus (D`Souza, Taghian, Lamb, & Peretiatko, 2007, pp. 371–374). Sofern ein zu komplexer und unverständlicher Überschuss an Informationen bereitgestellt wird, führt dies unmittelbar zum Desinteresse des Konsumenten (Salaün & Flores, 2001, p. 23; Verbeke, 2008, pp. 283–284). Einerseits hilft Mode ihrem Verbraucher sich zu einer kulturellen Gruppierung zugehörig zu fühlen und schafft einen persönlichen Nutzen, sodass Design, Qualität und Marke einen besonders hohen Stellenwert genießen (Abraham-Murali & Littrell, 1995, p. 66; Auger, Devinney, Louviere, & Burke, 2010, pp. 156–157; Schenkel-Nofz & Walther, 2014, p. 224). Andererseits schafft das nachhaltige Umdenken der Konsumenten eine potentielle Grundlage dafür, dass ethische Kleidung künftig einen höheren Stellenwert in der Modebranche genießen könnte (Fletcher, 2010, pp. 261–265). Um der Relevanz der zweiten Unterforschungsfrage gerecht zu werden, wird das Total Food Quality Model (TFQM) herangezogen und unter Berücksichtigung von ethischer Kleidung konzeptionell angepasst, sowie die wichtigsten ethischen Produktinformationen verdeutlicht (Grunert, Baadsgaard, Larsen & Madsen, 1996, p. 82).
Inwieweit lassen sich Informationsasymmetrien und Handlungshemmnisse des Konsumenten bezüglich der Kaufentscheidung von ethischer Kleidung reduzieren?
Hinsichtlich der dritten Unterforschungsfrage werden Implikationen für eine praxisorientierte Anwendung hergeleitet, die besonders für Unternehmen relevant sind, welche den Vertrieb von ethischer Kleidung in ihrem Angebot implementieren wollen.
2 Definitorische Grundlagen
In den folgenden Unterkapiteln werden zunächst relevante Begrifflichkeiten definiert, voneinander abgegrenzt, sowie deren Relevanz näher beleuchtet. Somit soll eine fundierte Grundlage für das Verständnis der verwendeten Literatur und der weiteren Forschung generiert werden.