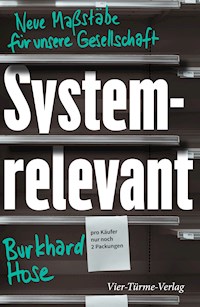16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vier-Türme-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Burkhard Hose ist Priester in einer Kirche, die er selbst inzwischen für tot erklärt. Statt dies zu beklagen, entwirft er eine sehr persönliche Vision davon, wie es mit der Botschaft Jesu weitergehen kann. Dabei entsteht das Bild einer Glaubensgemeinschaft, die nicht das eigene Schrumpfen verwaltet, sondern unkontrolliert wächst, weil sie nicht länger ausgrenzt, in vielerlei Hinsicht. Es ist eine Kirche ohne Klerikalismus, in der Ämter auf Zeit verliehen werden, und die zudem anerkennt, dass es außerhalb ihrer Mauern viel mehr Wahrheiten zu entdecken gibt, als sie bisher zu besitzen glaubte. Eine Kirche, die wirklich in der Gegenwart angekommen ist, weil sie nicht länger Antworten auf Fragen gibt, die niemand gestellt hat, sondern den Anliegen heutiger Menschen wirklich Vertrauen schenkt und sich gemeinsam mit ihnen auf den Weg macht, um nach Lösungen zu suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Burkhard Hose
Warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten
Für eine neue Vision von Christsein
Vier-Türme-Verlag
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie. Detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Printausgabe
© Vier-Türme GmbH, Verlag, Münsterschwarzach 2019
ISBN 978-3-7365-0281-9
E-Book-Ausgabe
© Vier-Türme GmbH, Verlag, Münsterschwarzach 2019
ISBN 978-3-7365-0266-6
Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Erstellung: Dr. Matthias E. Gahr
Lektorat: Marlene Fritsch
Covergestaltung: wunderlichundweigand
Titelfoto: Stefan Weigand / Vier-Türme GmbH, Verlag
www.vier-tuerme-verlag.de
Für Karlheinz Müller,
meinen theologischen Lehrer und Wegbegleiter
»Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt.
Denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher
über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel,
er und das Lamm.«
Offenbarung 21,22
Einleitung: Auferstehung statt Wiederbelebung
»Viele glauben uns nicht mehr.«
Ob dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz wirklich bewusst war, was er da mit einfachen Worten, schnörkellos und ohne unmittelbar mitgelieferte spirituelle Überhöhung sagte? Beim Eröffnungsgottesdienst der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda im September 2018 stand Kardinal Marx mit diesem Satz inmitten der Bischöfe, als stehe er gemeinsam mit ihnen zwischen den Trümmern einer alten, verfallenen Kirche. Ich dachte für einen kurzen Moment an ein häufig gebrauchtes Bild in der Bibel, das Amtsträger in der Kirche gerne für sich beanspruchen. Eigentlich heißt es da im Matthäusevangelium in Anlehnung an ein alttestamentliches Bild: »Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben« (Matthäus 9,36; vgl. Numeri 27,17). Aber statt des Originalzitats ging mir beim Anblick der Oberhirten durch den Kopf: »Denn sie waren müde und erschöpft wie Hirten, die keine Schafe haben.« Und ich hätte in diesem Augenblick tatsächlich darauf gewettet, dass es diese Worte sind, die in der Bibel stehen: erschöpfte Hirten ohne Schafe.
Mir hat sich dieses Bild eingeprägt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, also der Repräsentant einer Institution, die letztlich von nichts anderem lebt als von der Glaubwürdigkeit, sagt in der Mitte seiner Kollegen: »Viele glauben uns nicht mehr.« Auf mich wirkt diese nüchterne Feststellung wie eine Bankrotterklärung. Eine Kirche, der viele Menschen nicht mehr vertrauen, ist am Ende. Sie hat im strengen Sinne aufgehört, Kirche zu sein.
Keine Äußerung, die von Bischöfen nach Bekanntwerden der Missbrauchsstudie zu hören war, hat die Lage der Kirche so auf den Punkt gebracht wie diese wenigen Worte – ausgesprochen übrigens am Grab des Heiligen Bonifatius, der als »Apostel Deutschlands« verehrt wird. Traditionell treffen sich die Bischöfe dort zu Beginn ihrer Herbstvollversammlung zum gemeinsamen Gottesdienst. Diesmal schien es mir fast so, als stünden die Oberhirten und ihnen voran ihr Vorsitzender nicht nur am Grab des Bonifatius, sondern gleichsam am Grab der alten Institution Kirche, erschüttert und erschöpft. Wie Hirten eben, die keine Schafe haben.
Doch in mir regen sich bei diesem Anblick weder Mitleid noch Traurigkeit. Wie viele andere Menschen innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche spüre ich eher Wut und immer noch die Erschütterung über eine Institution, die ihre Glaubwürdigkeit verspielt hat. Gut, dass sie tot ist, denke ich mir. Seltsam, dass sich bei diesem Gedanken in mir aber noch ein anderes Gefühl meldet. Es ist beinahe so etwas wie neue Lebensenergie. Ich schaue auf die Kirche in Trümmern und spüre in mir Lebendigkeit.
In den letzten Jahren habe ich immer wieder einmal etwas flapsig gesagt: »Ich interessiere mich eigentlich nicht mehr so für die Kirche.« Was ich damit gemeint habe: Viel interessanter ist es für mich, mit der Botschaft Jesu außerhalb des Kirchenraumes auf der Straße unterwegs zu sein und danach zu fragen, welche Bedeutung das Evangelium für die gesellschaftlichen Themen hat, die uns gemeinsam umtreiben. Welche Relevanz hat die Botschaft Jesu für Menschen in einer Zeit, die durch existenzielle Verunsicherungen und durch politische Spaltung geprägt ist? Der rasante Klimawandel, eine immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich und die aus all dem resultierenden Flucht- und Migrationsbewegungen stellen auch die Kirchen vor neue Herausforderungen. Es gilt für mich eine Antwort darauf zu finden, ob wir als Christen zu diesen Entwicklungen etwas Positives beitragen können. Die Kirche habe ich in dieser Hinsicht häufig nur noch als Institution wahrgenommen, die vor allem mit einem beschäftigt schien: ihrem eigenen Überleben. Diese Kirche war es, die mich immer weniger interessierte. Und ausgerechnet in dem Moment, in dem diese alte Kirche stirbt, beginne ich mich wieder dafür zu interessieren, was Kirche und mehr noch: was Christsein in Zukunft bedeuten könnte.
Warum ist das so? Ich blicke auf die Trümmer dieser Kirche, in der ich aufgewachsen und in der ich Priester geworden bin. Mir ist im Herbst 2018 bewusst geworden, dass ich in viel größerem Maß Teil dieses Systems bin, das den Missbrauch von Menschen zu verantworten hat, als ich es bis dahin wahrhaben wollte. Wer in der katholischen Kirche arbeitet und ein Amt in ihr bekleidet, kann nicht so tun, als ginge ihn das alles nichts an oder als sei dies nur Angelegenheit der Bischöfe. Ich will nicht einfach wieder nur zuschauen und abwarten, welche Entscheidungen Bischöfe treffen oder welche Papiere mit wohlformulierten und gleichzeitig für die meisten Menschen bedeutungslosen Worten am Ende langwieriger synodaler Prozesse veröffentlicht werden. Nicht nur die Oberhirten, ich selbst stehe inmitten einer Trümmerkirche, die ihre Glaubwürdigkeit verloren hat. Ich habe kein Interesse daran, dieser alten Kirche wieder zu mehr Glaubwürdigkeit zu verhelfen. Ich habe kein Interesse an ein paar Reformen und schon gar nicht an Kampagnen zur Imagerettung der Institution Kirche. Die Schuldbekenntnisse, die ich aus dem Mund der Oberhirten höre, wirken auf mich schal, allzu gewohnt und ritualisiert. Ich glaube den Bischöfen ihre Erschütterung über das Ausmaß des Missbrauchs, aber ich glaube ihnen nicht wirklich, wenn sie von »Erneuerung« der Kirche sprechen. Auf mich wirkt das zu sehr wie ein hilfloser Versuch der Reanimation, der Wiederbelebung eines gestorbenen Systems.
Diese Kirche ist kaputt. Sie ist tot. Ich stehe an ihrem Grab. Ich bin wütend und erschüttert angesichts der Verbrechen, die Menschen in dieser Institution zu verantworten haben und die diese alte Kirche möglich gemacht hat. Aber ich fühle mich nicht erschöpft. Ich fühle mich eher wie in einem Zwischenstadium. Etwas Altes ist gestorben. Fast möchte ich sagen: Gott sei Dank! Es ist gut, dass diese Gestalt von Kirche, die für das Leid so vieler Menschen mitverantwortlich ist, am Ende ist. Das gilt es zu realisieren. Den Bruch, in dem wir uns befinden, gilt es anzuerkennen. Ich erlebe gerade bei vielen, die in der Kirche arbeiten oder sich ehrenamtlich engagieren, so etwas wie Endzeitstimmung. Das Ende der Kirche in ihrer alten Gestalt hat etwas Apokalyptisches, Katastrophales an sich. Es ist das Fanal einer Kirche, deren Repräsentanten in so vielen Fällen das Leben von Menschen zerstört haben. Die meisten in unserer Gesellschaft verbinden mit ihr nur noch eines: den unglaublichen Missbrauch von Macht. Da ist nichts mehr zu retten.
Biblisch lässt sich dieser Zwischenraum, in dem wir gerade kirchlich stehen, am ehesten mit der Situation der Apokalypse vergleichen. Die Enthüllung des Missbrauchs bringt täglich neue Schreckensbilder ans Licht. Es ist wichtig, diesen Schrecken auszuhalten und ihn nicht wieder wegzureden oder zuzudecken.
Mitten in diesem apokalyptischen Szenario wird für mich gleichzeitig etwas Neues sichtbar. Es ist fast so etwas wie eine neue Vision von Christsein, eine Zeitenwende am Ende einer Kirche, die für viele Menschen gestorben ist. In der Bibel ist die Apokalypse ebenfalls mit Bildern und mit Geschichten des Schreckens verbunden. Sie markieren das Ende und gleichzeitig sind sie Anzeichen für den Beginn einer neuen Zeit.
Die neutestamentlichen Autoren bewegen sich genau in diesem Zwischenraum. In diese Endzeitstimmung hinein gehört der Basissatz der Botschaft Jesu: »Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!« (Markus 1,15). Im griechischen Text steht an dieser Stelle das Wort metanoeite. Das bedeutet mehr als nur »umkehren«. Es bezeichnet das Umdenken und den echten Sinneswandel infolge einer Erkenntnis. Ganz wörtlich geht es bei meta-noein um »um-denken« oder »nach-denken« im Unterschied zum »vor-denken« (griechisch: pro-noein).
Dem Aufruf zum »Nach-denken« und damit zum »Um-denken« geht die Feststellung Jesu voraus: »Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.« Es sind die ersten Worte, die Jesus im Markusevangelium spricht. Zu verstehen ist diese Ansage im Sinne von: »Das Maß ist voll. Die neue Welt Gottes ist bereits im Kommen.« Gemeint ist damit nicht einfach eine neue Spiritualität oder eine neue Religion, sondern viel mehr. Es geht um nicht weniger als eine neue Weltordnung. Deren Entstehen setzt in der Bibel aber voraus, dass etwas Altes zerbricht und untergeht. Weltuntergang meint in diesem Sinn: Die bisherige Art, Welt zu sehen und zu gestalten, die alte Weltordnung geht unter.
Wenn ich die jetzige Situation in der Kirche in dieser Weise mit den Augen des biblischen Apokalyptikers anschaue, dann bekommen die programmatischen Worte Jesu in Markus 1,15 einen aktuellen Klang: »Das Maß ist voll. Die neue Welt Gottes ist bereits im Kommen. Denkt um und glaubt an das Evangelium!« Wenn ich mir diese Perspektive wirklich zu eigen mache, geht es nicht um das Überleben oder Wiederbeleben der Kirche, sondern um eine neue Vision von Christsein, um eine Utopie von Kirche, die wirklich etwas von der neuen Welt Gottes für Menschen heute sichtbar macht. Mein Nach-denken verstehe ich deshalb auch nicht als Strategie für das Weiterbestehen der Kirche. Es ist vielmehr meine persönliche Vision davon, wie ich gemeinsam mit anderen das Evangelium in der Gegenwart neu leben kann. Es geht mir nicht darum, etwas Altes wiederzubeleben, sondern etwas völlig Neues, was noch nicht ist, anzudenken. Wer wirklich umkehrt, stellt fest, dass der Weg der Umkehr niemals einfach ein Zurückgehen desselben Weges ist. Es entsteht ein ganz neuer.
Bei seiner Weihe sprach der neue Bischof von Würzburg, Franz Jung, davon, dass er sich in seinem neuen Amt für eine Kirche einsetzen werde, die tatsächlich von der Auferstehung geprägt sei und nicht vom Gedanken der Wiederbelebung des Vergangenen. Mich hat dieses Wort berührt. Ich will es für mich weiter- und durch-denken.
Dabei gibt es für mich eine entscheidende Grundvoraussetzung, die dieses Nachdenken wie ein Vorzeichen bestimmen wird: Wir sollten aufhören, die Kirche zu retten!
Kontrollverlust statt Wächteramt
Nach der ersten Veröffentlichung der Missbrauchsfälle am Berliner Jesuiten-Gymnasium Canisius-Kolleg im Jahr 2010 ging schon einmal eine Schockwelle durch die katholische Kirche in Deutschland. Die Bischöfe sprachen damals immer wieder von Konsequenzen und einer notwendigen »Reinigung« der Kirche. Sie formulierten Schuldbekenntnisse, feierten Bußgottesdienste, ernannten Missbrauchsbeauftragte und ließen Präventionsprogramme in ihren Diözesen entwickeln. Die Zahl von Anwältinnen und Anwälten in Generalvikariaten nahm zu. Diese erarbeiteten rechtliche Sicherungs- und Kontrollsysteme. Von nun an hatten alle Mitarbeitenden in der Kirche, die im Haupt- oder Ehrenamt mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, regelmäßig ein polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen. Die Bischöfe glaubten sich auf einem guten Weg, das verlorengegangene Vertrauen durch die Vielzahl an Maßnahmen wiederzugewinnen. Der Missbrauch wurde als Versagen Einzelner in der Kirche definiert und als Thema isoliert. Der Imageschaden schien beinahe behoben – zumindest in den eigenen Reihen. Menschen, die ohnehin ein kritisches Verhältnis zur Kirche hatten, sprachen weiterhin von den Missbrauchsfällen, aber viele Gläubige gewannen den Eindruck, die Bischöfe hätten nun alles im Griff. Strukturelle Probleme wie der drohende Einbruch von Kirchensteuereinnahmen oder der massive Rückgang der Priesterzahlen traten wieder in den Vordergrund.
Dann kam der Herbst 2018. Die von den Bischöfen in Auftrag gegebene wissenschaftliche Studie zum Missbrauch in der Katholischen Kirche erschütterte die Öffentlichkeit und überrollte in ihrer Wucht auch die Bischöfe. Sie waren auf einmal wie Hirten, die keine Herde mehr haben. Und so erleben wir gerade den Super-GAU der Kirche als Institution. Den Bischöfen traut nun niemand mehr wirklich zu, dass sie die richtigen Konsequenzen aus den Berichten über sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch ziehen werden. Zunehmend sprechen mich auch alte Menschen an, die ihr Leben lang mit der Kirche verbunden gewesen sind, und sagen, sie überlegten, aus der Kirche auszutreten. Der Vorwurf steht im Raum, letztlich sei es vielen Bischöfen nach 2010 mehr um die Behebung des Imageschadens gegangen als um tatsächliche Aufklärung. Kirchliche Parallelstrukturen, die vor oder neben den Staatsanwaltschaften in einem eigenen Rechtssystem agierten, gerieten zunehmend in die Kritik. Das Gezerre um die Herausgabe von Akten an die von den Bischöfen selbst beauftragte Forschergruppe vermittelte den Eindruck, so manchem Bischof sei vor allem daran gelegen, nicht die Kontrolle zu verlieren. Nach wie vor scheint der Schutz der Kirche einigen Oberhirten wichtiger zu sein als die umfassende Aufklärung und damit letztlich der Schutz von Menschen, die unter dem Dach der Kirche zu Opfern gemacht wurden.
Statt die Kontrolle zu behalten, verloren die Bischöfe, was überhaupt die Grundlage ihres Handelns ist: ihre Glaubwürdigkeit. Bei der Pressekonferenz zum Abschluss der Herbstvollversammlung der Bischöfe stellte die Journalistin Christiane Florin eine Frage, die für einen Augenblick die persönliche Verantwortung der Bischöfe in den Mittelpunkt rückte: »Hier sind jetzt über sechzig Bischöfe versammelt. Gab es einen oder zwei, die im Zuge ihrer Beratungen gesagt hätten: Ich habe so viel persönliche Schuld auf mich geladen, ich kann eigentlich diese Verantwortung des Amtes nicht mehr tragen?« Der Vorsitzende der Bischofskonferenz stockte kurz und antwortete mit einem fast trotzigen »Nein«. Bloß die Kontrolle behalten!
Das System, das eigene Rechtsordnungen staatlichen Gesetzen vorordnet und in dem gerade das Schweigen »ganz oben« den Missbrauch möglich machte, wird von einer großen Angst bestimmt: der, die Kontrolle zu verlieren. Dabei ist genau dies jetzt geschehen. Vor der versammelten Presse saß einer, der in diesem Moment vermutlich sehr wohl verstanden hatte, was zuvor beim Eröffnungsgottesdienst der Herbsttagung den Bischöfen am Grab des Bonifatius aufs Gesicht geschrieben stand: Hier stehen Oberhirten, die vor lauter Angst, die Kontrolle zu verlieren, die Menschen verloren haben.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche habe ich den Eindruck, ob und wie es mit dieser Kirche weitergeht, liegt nicht mehr in den Händen der Bischöfe oder des Papstes. Viele Menschen wollen jetzt nicht mehr abwarten, was Bischofskonferenzen oder was ein »synodaler Weg« in ein paar Jahren an Papieren hervorbringt. Immer mehr Gläubige fragen sich: Wie kann ich mein Christsein leben angesichts einer Kirche, deren Glaubwürdigkeit in Trümmern liegt? Und wie könnte eine Gemeinschaft aussehen, in der Menschen miteinander Kirche sein wollen, nachdem die alte Form von Kirche gestorben ist?
Ich stelle mir diese Fragen auch persönlich, 25 Jahre nach meiner Priesterweihe. Und mehr noch als im Jahr 2010 realisiere ich: Mein Amt macht mich zum Teil dieses Systems. Ich trage zwar keine persönliche Schuld, aber ich bin mitverantwortlich dafür, dass wirkliches Umdenken und tatsächliche Umkehr stattfinden. Auch ich will nicht abwarten, was die Bischöfe diesmal entscheiden, denn ich bin kein Zuschauer, ich bin Beteiligter.
Ich stehe mit am Grab einer Kirche, die ihre Glaubwürdigkeit verloren hat. Und gleichzeitig spüre ich, dass es genau jetzt die Möglichkeit der Auferstehung von Christsein in etwas ganz Neues hinein geben kann.
Mir geht ein Bild durch den Kopf: Es ist die Szene, mit der ursprünglich das Markusevangelium endete, bevor später einige Verse hinzugefügt wurden. Vergeblich suchten die Frauen am Ostermorgen Jesus im Grab. Die knappe Information des Engels lässt sie erschrecken: »Er ist auferstanden. Er ist nicht hier« (Markus 16,6). Lukas ergänzt den Markustext um die Frage: »Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?« – eine Frage, die der Evangelist wohl bewusst im Blick auf die christliche Gemeinde, für die er schreibt, einfügte. Er will ihr sagen: Christsein lässt sich nur vorwärts leben, nicht in der reinen Rückschau. Es geht darum, den auferstandenen Herrn an ganz neuen Orten zu entdecken!
In der ersten Fassung des älteren Markusevangeliums endet die Szene sehr abrupt. Der letzte Vers beschreibt das Verhalten der Frauen in dem Moment, als sie begreifen, dass das Grab nicht mehr der Ort ist, an dem sich der auferweckte Herr finden lässt: »Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon; denn sie fürchteten sich.« Auch im Markusevangelium schimmert durch jedes Wort die Situation der Gemeinde hindurch. Was jetzt folgt – nach dem Grab –, bleibt hier offen. Was also die christliche Gemeinde aus der Osterbotschaft macht, wird nicht erzählt. Es ist wie ein Weg ohne vorbestimmtes Ziel. Der Schluss des Markusevangeliums zeigt das Bild einer österlichen Kirche, die losläuft, voller Schrecken, wortlos zunächst. Eine chaotische Situation, die sich hier mit der Osterbotschaft verbindet.
Über die konkrete Gemeindesituation des Markus hinaus steckt der Evangelist mit seinem abschließenden Vers von nun an jede Christin und jeden Christen in die Schuhe der ersten Auferstehungszeuginnen: Ostern heißt Weglaufen vom Grab, ungeordneter Aufbruch. Und zum ersten Mal fällt mir in dieser Deutlichkeit auf, dass nicht erst am Schluss des Markusevangeliums das Bild einer österlichen Kirche entsteht, in der das Handeln Gottes für Menschen mit der Erfahrung von Kontrollverlust verbunden ist. Mit seinem Umkehrruf (Markus 1,15) fordert Jesus ganz zu Beginn Menschen in seiner Nachfolge dazu auf, alte Sicherheiten hinter sich zu lassen, Gewohntes aufzugeben.
Der Anbruch von Gottes neuer Welt verlangt, das Zerbrechen alter Ordnungen zu durchleben und völlig neu zu denken. Und zu diesem neuen Denken gehört wesentlich dazu, sich für das überraschende Handeln Gottes bereitzuhalten. Das Reich Gottes passiert wesentlich ohne Zutun der Menschen und außerhalb ihrer Kontrolle. Ich denke an manche gutgemeinten neuen geistlichen Lieder zurück, mit denen wir in meiner Jugend besangen, wir würden »mitbauen« am Reich Gottes. Diese Lieder waren zwar motivierend, letztlich stehen sie aber im Kontrast zu der Botschaft Jesu vom Reich Gottes, zu dem der Mensch nichts anderes beitragen kann, als sich offenzuhalten für dessen überraschendes Erscheinen in der Welt. Letztlich entsprangen diese Lieder noch einem Verständnis von Kirche, die sich selbst mit dem Reich Gottes verwechselte. Kirche können wir mitbauen, Reich Gottes nicht.
Dies ist eine Botschaft, die religiösen Kontrollinstanzen zur Zeit Jesu vermutlich ebenso Angstschweiß auf die Stirn trieb wie sie Christen in den Kirchen verunsichern sollte. Die Predigt Jesu entwirft programmatisch so etwas wie das Gegenmodell zu einer alles kontrollierenden Institution. Wenn etwas im Grundsatz und fundamental jedes institutionelle Kontrollstreben untergräbt, dann ist es seine Botschaft vom Reich Gottes, das es nicht zu machen, sondern zu entdecken gilt.
Zum ältesten Bestand der Evangelien gehören kleine Erzählungen rund um diese neue Welt Gottes. Es sind Gleichnisse, die mit ihren Bildern an den Alltagserfahrungen der Zeitgenossen Jesu anknüpfen. Jesus erzählt Beispiele aus der bäuerlichen Welt, aber auch aus dem Haushalt entwickelt er Geschichten, die vom Geldverleihen handeln oder vom Schafehüten, vom Brotbacken und vom Hauskehren. Geschichten also, die das alltägliche Leben von Frauen und Männern zum Ort erheben, an dem sich Reich Gottes abspielt. Was sich wie ein roter Faden durch alle diese Texte zieht, ist ein beinahe subversiver Grundgedanke: Wer sich auf das Reich Gottes einlässt, muss bereit sein, Dinge unkontrollierbar geschehen zu lassen. Das ist sozusagen die entscheidende Methode für ein christliches Leben.
Am deutlichsten wird das in den sogenannten Wachstumsgleichnissen, die sich im Markusevangelium aufgereiht im vierten Kapitel finden (Markus 4,1–34). Unter ihnen stechen noch einmal zwei kleine Gleichnisse hervor, die Matthäus und Lukas später aus der älteren Markusvorlage gestrichen haben. Liest man die beiden Texte, versteht man auch sehr schnell, warum sie das taten.