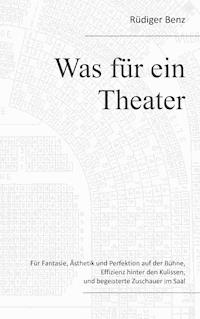
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rüdiger Benz vertritt einerseits die Forderung, dass das öffentlich geförderte Theatersystem finanziell gut ausgestattet bleiben muss, andererseits hält er große Teile dessen aktueller Struktur für marode und sanierungsbedürftig. Anhaltende Forderungen nach öffentlichen Geldern sind nur gerechtfertigt, wenn die subventionierten Theater ihre Mittel effektiv und transparent zum Nutzen der Gesellschaft einsetzen. Dazu bedarf es massiver struktureller, personeller, inhaltlicher und qualitativer Veränderungen an den öffentlichen Bühnen. Das Buch basiert auf persönlichen Theater-Erfahrungen der letzten Jahre und ist eine Sammlung von Standpunkten und Überlegungen zu Lösungsansätzen. Theater ums Theater - das muss sein!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Goethe unterhält sich
Vorspiel
Prolog
Vom Fürstentum ins 21. Jahrhundert
Repertoire? Ja, aber effizient!
Ein Qualitätsraster
Investment und gesellschaftliche Rendite
Publikum? Gefällt mir!
Konkurrenz wenn nötig, Kooperation wenn möglich
Klasse & Masse
Lichtgestaltung – Kunst & Handwerk
Personelle Entwicklung
Epilog
Anhang – Der Repertoire-Block-Ensuite-Betrieb
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Der Autor weist ausdrücklich darauf hin, dass alle Personenbezeichnungen beide Geschlechter einschließen.
Goethe unterhält sich
„Sonntag, den 1. Mai 1825. […] Nichts, fuhr Goethe fort, ist für das Wohl eines Theaters gefährlicher, als wenn die Direktion so gestellt ist, daß eine größere oder geringere Einnahme der Kasse sie persönlich nicht weiter berührt, und sie in der sorglosen Gewissheit hinleben kann, daß dasjenige, was im Laufe des Jahres an der Einnahme der Theater-Kasse gefehlt hat, am Ende desselben aus irgendeiner anderen Quelle ersetzt wird. Es liegt einmal in der menschlichen Natur, daß sie leicht erschlafft, wenn persönliche Vorteile oder Nachteile sie nicht nötigen. Nun ist zwar nicht zu verlangen, daß ein Theater in einer Stadt wie Weimar sich selbst erhalten solle, und daß kein jährlicher Zuschuss aus der fürstlichen Kasse nötig sei. Allein es hat doch alles sein Ziel und seine Grenze, und einige tausend Taler jährlich mehr oder weniger sind doch keineswegs eine gleichgültige Sache, besonders da die geringere Einnahme und das Schlechterwerden des Theaters natürliche Gefährten sind, und also nicht bloß das Geld verloren geht, sondern die Ehre zugleich.“1
1 Eckermann, Johann Peter: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Band 3. Magdeburg 1848, S. 91f.
Vorspiel
Direktor:
Ihr beiden, die ihr mir so oft, In Not und Trübsal, beigestanden, Sagt, was ihr wohl in deutschen Landen Von unsrer Unternehmung hofft?
Diskussionen über künstlerisches Schaffen und volle Häuser sind so alt wie das Theater selbst. Es ist bekannt, dass Goethe in Weimar auch als Theaterdirektor arbeitete. Das Vorspiel zu seinem Faust lässt darauf schließen, wie er selber in der Funktion des Künstlers und Theaterchefs unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat.
Das Vorspiel auf dem Theater2 wird daher im Verlaufe der folgenden Texte mehrfach auszugsweise zu Beginn oder am Ende der Kapitel zitiert. Es unterhalten sich dort ein Theaterdirektor, ein Theaterdichter und eine Lustige Person – offensichtlich ein Darsteller oder ein begeisterter Zuschauer.
Dieses dem Faust vorangestellte Gespräch ist – nach rund 200 Jahren – immer noch ein passender Begleiter für die Überlegungen zur Erneuerung, Optimierung und Vernetzung der subventionierten deutschen Theaterlandschaft.
2 Goethe, Johann Wolfgang von: Aus: Faust. Eine Tragödie. Tübingen 1808, S. 9 ff.
Prolog
Direktor:
Wie machen wir's, dass alles frisch und neu Und mit Bedeutung auch gefällig sei?
Wie viel Theater soll sich Deutschland leisten? In der Berliner Zeitung diagnostiziert Theaterkritiker Dirk Pilz, dass „das gesamte Stadttheatersystem wankt“3. Im Buch „Der Kulturinfarkt “4 fordern Dieter Haselbach, Armin Klein, Pius Knüsel und Stephan Opitz die Schließung der Hälfte aller Kulturbetriebe. Damit wollen sie gegen die „Auswüchse der Subventionskultur“ zu Felde ziehen.
Es können jedoch nicht zu viele Theater da sein. Aber es kann sein, dass zu wenig Menschen ins Theater kommen und es damit obsolet machen. In der Regel sind die Gründe dafür nicht beim Publikum, sondern beim Theater selbst zu suchen.
„Zur Zukunftssicherung der Theaterlandschaft in Deutschland bedarf es einer kritischen Neubetrachtung, konzeptioneller Überlegungen und kompetenten gemeinsamen Handelns“, fordert die Enquete-Kommission Kultur in Deutschland in ihrem 2007 vorgelegten Schlussbericht.5 Tatsächliche Reformen hat diese Forderung bislang allerdings nicht hervorgebracht.
Was bleibt zu tun? Mit möglichst starker, gemeinschaftlicher Stimme weiterhin Investitionen für Theater fordern. Dafür im Gegenzug – und das ist die wesentliche Aufgabe – ein besseres Miteinander von Theater und Gesellschaft mit den zur Verfügung gestellten Subventionen erzielen. Das wird – ausgehend von den „ maroden Strukturen eines Stadttheatersystems, das zu implodieren droht“, wie Dirk Pilz in der Berliner Zeitung zu Recht befürchtet – ein schwieriger und unbequemer Weg.
Soll man dazu die öffentlichen Theater als Wirtschaftsfaktor im Bereich der Kreativwirtschaft sehen und Künste sowie Künstler der Vermarktbarkeit unterwerfen? Das geschieht ohnehin. Theater waren, sind und werden immer der Publikumsakzeptanz ausgesetzt sein. Öffentlich subventioniertes Theater hat Legitimationsbedarf. Egal, wie viele Kosten die Subventionen auffangen: Bleiben wiederholt signifikant Plätze im Theatersaal leer, wird Theaterarbeit sinnlos.
Öffentliche Institutionen müssen radikal umdenken, um Zuschüsse wirkungsvoller zu nutzen. Es geht nicht um simple Einsparungen. Es geht darum, die subventionierte Theater-Szene als Ganze grundlegend zu reformieren, zu stärken und in der öffentlichen Wahrnehmung relevanter zu machen.
„Theater kämpfen um die Existenz. Der Bühnenverein setzt auf symbolträchtige Rettungsaktion: den Status eines Weltkulturerbes“6 – so titelte im Mai 2013 die Südwest Presse. Der damalige Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Klaus Zehelein, stellte im Folgenden fest: „In den vergangenen 15 Jahren ist ein enormer Spardruck an den deutschen Bühnen entstanden […]. Das ist eine Entwicklung, die uns Sorge macht. Die Sparmaßnahmen schlagen immer mehr auf die Personaletats durch.“6
Sparanstrengungen bedrohen also die Existenz öffentlicher Theater und sind gleichzeitig schuld an unangemessener Bezahlung von Künstlern und Mitarbeitern? Wenn Theater bedroht sind, liegt das meist an einem strukturkonservativen Denken und daran, dass ein effizient vernetztes kulturelles Unternehmertum fehlt. Die Theater befinden sich nicht in einer Finanzierungskrise, sondern in einer Struktur- und Inhaltskrise. Für unzureichende Gagen und Gehälter sind daher primär die Personen in den jeweiligen Führungspositionen sowie die von der Politik schon zu lange geduldeten maroden Strukturen verantwortlich. Das Problem ist nicht in erster Linie der vermeintliche Spardruck. Dieser resultiert erst aus ineffizienten Strukturen und unattraktiven Angeboten.
Öffentlich geförderte Theater präsentieren sich gerne als vielfältig. Viele sind es in der Tat. Aber bezogen auf ihre inhaltliche Arbeit, die den Grundstein für den Bestand der Theater und eine wirksamere öffentliche Wahrnehmung legen müsste, trifft dies nicht zu. Die freie und private Szene wirkt häufig innovativer – nur fehlen dort oft die Mittel zur Umsetzung auf hohem Niveau.
Den Status quo als Weltkulturerbe erhalten? Bitte nicht. Das klingt nach Notwehr und Bürokratie. Es ist die Symbiose aus Werken, Künstlern und begeistertem Publikum, die eine lebendige Theaterlandschaft entstehen lässt. Das muss man sich Tag für Tag erarbeiten. So etwas lässt sich nicht bürokratisch schützen.
Wenn alles so träge und schwerfällig bleiben sollte, wie es ist, kann man die Subventionen anderweitig besser einsetzen. Nur wenn es gelingt, Theaterarbeit wieder als kulturpolitischen Auftrag im Sinne der Bürger wahrzunehmen und für die größtmögliche Nutzerzahl interessant zu machen, dann hat das System eine Chance – und seine Berechtigung. Wer nur nach Geld ruft, aber einschneidende Reformen blockiert, legt den Verdacht nahe, dass er lediglich seinem eigenen Selbstverwirklichungstrieb dient.
Theater muss sein! Theater steht hier als Sammelbegriff für Performance, Artistik, Kabarett, Konzert, Schauspiel, Tanz, Oper, Musical, Revue, Figurentheater und viele weitere Darstellungsformen. Theater setzt voraus, dass Menschen einerseits durch kunsthandwerkliche Perfektion, andererseits mit außergewöhnlicher künstlerischer Begabung andere Menschen mit den Möglichkeiten der darstellenden Künste begeistern.
Theater machen, also vor Menschen auf einer Bühne (be-)stehen, ist heute auch wichtiger Bestandteil von Erziehung und (Aus-)Bildung.
Die Diskussionen, wie Theater gemacht und was davon gefördert werden sollte, sind kontrovers. Verbände, Vereine, Stiftungen, Gesellschaften, Genossenschaften, Universitäten, Hochschulen, Akademien, Institute, Kommissionen, Ausschüsse, Konferenzen oder Symposien sind offensichtlich darum bemüht, dem Theater und den Menschen, die dort arbeiten, Gutes zu tun. All diese Aktivitäten kosten ebenfalls Geld. Inzwischen müssten Studien, Forschungsergebnisse oder einfach nur praktische Erfahrungen dafür sorgen, dass konkrete Vorschläge auf dem Tisch liegen, was für den Erhalt oder besser noch für die Stärkung der deutschen subventionierten Theaterlandschaft mit all ihrer sogenannten Hochkultur real getan werden kann. Und tatsächlich, es gibt Forderungen. Von verschiedensten Seiten und in verschiedensten Formen. Die Aussagen unterm Strich ähneln sich stark: Es braucht mehr Geld für den Kulturbetrieb. Bitte – ist man versucht hinzuzufügen.
Theater muss sein! Zu befürchten ist, dass dies noch für lange Zeit der kleinste gemeinsame Nenner der Kulturschaffenden bleibt. Theater muss sein! Aber wie?
Ein genereller Glaube an die Gestaltungskraft des Theaters scheint aus den verschiedenen Blickwinkeln von Politik, Kunst oder Wirtschaft vorhanden zu sein. Diese Überzeugung sollten moderne Theaterschaffende gemeinsam mit mutigen Politikern nutzen und als Basis ausbauen. Um ein System von kreativen und gleichzeitig gesellschaftlich relevanten subventionierten Theatern zu schaffen, muss im Sinne der Nutzer, der Gesellschaft, vor allem eines gelingen: Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, dass verstärkt Begeisterung für Theater in der Öffentlichkeit geweckt wird und dass die Nutzung und somit auch die Finanzierung der kulturellen Infrastruktur spürbar optimiert werden können.
Müssen Theaterorganisationen ihre Arbeit einstellen, bedeutet das für alle Theaterschaffenden einen Verlust. Das betrifft die freie und auch die private Szene. Letztlich lernen und profitieren alle voneinander. Begeisterung fürs Theater fängt bei jedem einzelnen Gast an, der von der künstlerischen Darbietung ebenso bereichert wie berührt nach Hause geht und sich schon auf den nächsten Besuch freut.
3 Pilz, Dirk: Vor der Krise ist kein Theater mehr sicher. In: Berliner Zeitung vom 24.03.2014. URL: www.berliner-zeitung.de/kultur/wiener-burgtheater-vor-der-krise-ist-kein-theater-mehr-sicher,10809150,26643012.html
4 Haselbach, Dieter / Klein, Armin / Knüsel, Pius / Opitz, Stephan: Der Kulturinfarkt. Von allem zu viel und überall das Gleiche. München 2012.
5 Deutscher Bundestag (Hg.), Drucksache 16/7000: Schlussbericht der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“, eingesetzt durch Beschluss des Deutschen Bundestages vom 15. Dezember 2005 (Bundestagsdrucksache 16/196). Berlin 2007, S. 107.
6 dpa: Theaterlandschaft als Weltkulturerbe. In: Südwest Presse, 23.05.2013.
Vom Fürstentum ins 21. Jahrhundert
Direktor:
Ihr wisst, auf unsern deutschen Bühnen Probiert ein jeder, was er mag
Wie im Vorspiel von Goethes Faust der Theaterdirektor, der Theaterdichter und die Lustige Person unterschiedliche Auffassungen vertreten, so sollte ein gut strukturiertes Theatersystem mit höchsten Ansprüchen ebenfalls im Austausch zwischen Management, Kunst und Publikum agieren. Die aus den früheren Fürstentümern hervorgegangene und heute öffentlich subventionierte Theaterlandschaft ist weltweit einzigartig. Einzigartig gut mit finanziellen Ressourcen ausgestattet und daher mit einzigartigen Chancen für hochwertigste Theaterarbeit und hohen Publikumszuspruch versehen. Doch in Deutschland werden Theater oft noch durch Intendantenfürsten beherrscht – prädestiniert dafür, Anforderungen des 21. Jahrhunderts zu verkennen und strukturelle Notwendigkeiten zu ignorieren.
Mit knapp 2,25 Milliarden Euro werden laut Deutschem Bühnenverein die öffentlichen Theater – ohne Festspiele und private Bühnen – jährlich subventioniert. Nur knapp 21 Millionen Zuschauer besuchen die 140 öffentlich getragenen Theater mit ihren 890 sogenannten Spielstätten jährlich. Eine angemessene Auslastung der permanent zur Verfügung stehenden 318.831 Plätze wird dadurch nicht erreicht.7 Dazu wären bis zu 70 Millionen Zuschauer nötig.
Theater sind Unternehmen mit dem Auftrag, eine Dienstleistung für die Gesellschaft zu erbringen und mit dem ihnen anvertrauten Geld gewissenhaft umzugehen. Trotzdem gibt es am Theater keine Position, die tatsächliche Managementkompetenz verkörpert. Es gibt natürlich Kaufmännische Direktoren oder Verwaltungsdirektoren. Diese Positionen verwalten im Wesentlichen, was ihnen vom Intendanten vorgesetzt wird. Sie haben kaum eine Steuerungsfunktion, die sich aus Sicht des Gastes bzw. der Gesellschaft positiv auf die Leistungen des Hauses auswirken könnte.
Im Kultur- und Unterhaltungsunternehmen Theater geht es nicht ausschließlich um Kunst und Bildung. Bevor diese Kernbereiche des Theaters zum Tragen kommen können, geht es um den Service am Gast, das Bemühen um die knapp bemessene Freizeit der Besucher sowie um effektive interne Unternehmensstrukturen, klare Abläufe und fundierte wirtschaftliche Grundlagen. Viele vom künstlerischen Betrieb unabhängige Managementaufgaben fallen im Kulturbetrieb genauso an wie in jedem mittelständischen Unternehmen.
Aber in der deutschen Kulturpolitik muss es den Intendanten geben: Künstler und Manager in einer Person. Allein aus zeitlichen Gründen wird es bei den heutigen Anforderungen nie möglich sein, beide Rollen angemessen auszufüllen. Dass es sich inhaltlich um zwei völlig unterschiedliche Ausbildungswege und Fertigkeiten handelt, sei dahingesellt. Die deutsche Kulturpolitik glaubt an dieses Modell – und zahlt tapfer dafür. Regelmäßige Auseinandersetzungen zwischen Kunst und Management könnten dagegen den Fokus auf das Wesentliche schärfen.
Die deutsche Kulturpolitik scheint bei diesem Thema schlecht beraten. Fast niemand bringt den Mut auf, Kunst und Management konsequent zu trennen. Im hochpreisigen kommerziellen Bühnen-Entertainment, wie es von wenigen namhaften Musical- oder Showveranstaltern geboten wird, sind diese Trennung und die damit verbundenen Auseinandersetzungen unumstößlicher Standard. Dort ist die konsequente Aufgabenteilung zwischen Kunst und Management – u. a. aus Qualitätsgesichtspunkten – lebensnotwendig. Öffentliches Spielgeld für das Ausleben individueller künstlerischer Ambitionen steht dort nicht zur Verfügung.
Auch an öffentlichen Theatern steigen die Management-Herausforderungen stetig – und damit auch der Anspruch an die Verantwortlichen, aktuell meist die Intendanten. Die Außendarstellung einer Institution wird – mit zu Recht zunehmendem Legitimationsdruck – immer wichtiger. Um steigende Kosten des ineffizient organisierten Theaterapparates sowie abnehmende Fördergelder oder unzureichende Ticketeinnahmen zu kompensieren, muss die Theaterleitung sich kontinuierlich um die Einwerbung von Drittmitteln bemühen. Zusätzlich ist die wirtschaftliche Vernetzung der Theaterinstitutionen und die Öffnung für neue Publikumssegmente bzw. deren aktive Erschließung eine Kernaufgabe heutiger Managementpositionen. In einem System der Kompetenzteilung ließen sich solche Vorgänge deutlich besser bewältigen.
Außerhalb Deutschlands wird neidvoll auf die einmalige finanzielle Ausstattung der öffentlichen Theater geschaut. Diese erlaubt es noch, reichlich nationale und internationale künstlerische Profis zu beschäftigen.
Profis braucht das Theater – aber nicht nur auf der Bühne, sondern auch dahinter. Der heutige Arbeitsmarkt bietet Fachleute für alle nötigen Bereiche eines Theaterbetriebs. Warum sollte man nicht für die jeweiligen Aufgaben zwischen Management, Kunst, Marketing, Service oder Gastronomie spezialisierte Experten einsetzen? Weil man sonst die Theaterarbeit behindern würde – so lautet zumindest die Überzeugung des Deutschen Bühnenvereins und offensichtlich vieler Berater der Kulturpolitik. „Die weit reichenden Befugnisse – selbst wenn sie durch einen Verwaltungs- oder Kaufmännischen Direktor eingeschränkt werden – bieten dem Intendanten die Möglichkeit, ein künstlerisches Konzept zu verwirklichen, ohne darin von Dritten behindert zu werden“8. So beschreibt der Bühnenverein das Berufsbild des Intendanten. Müsste also ein Intendant mit anderen kooperativ zusammenarbeiten, würde das unweigerlich zu schlechten Ergebnissen führen?
Umstrukturierung, hin zu gut aufgestellten Theaterbetrieben und weg von verkrusteten Strukturen, beginnt beim Kopf – also mit der Abschaffung des Intendantentums. Es ist zu hoffen, dass dieser institutionelle Bremsklotz nicht als Weltkulturerbe erhalten bleibt.
Theaterbetriebe, die dem öffentlichen Kulturauftrag verpflichtet sind, brauchen eine klare Trennung zwischen professionellem Theatermanagement und Kunst.
In dieser Teilung vertritt der Kulturunternehmer als Produzent, Produktmanager und oberste disziplinarische Instanz eines Hauses nach außen die Sichtweise des Gastes. Er ist gewissermaßen Anwalt des Besuchers, damit er sich im Theater willkommen, verstanden und wohl fühlt. Als Gastgeber und im Sinne eines guten Service verantwortet er alles, von der Akquise über die Anreise bis zum Sitzplatz im Saal. Dazu gehört ebenfalls die Qualitätsüberwachung des eigentlichen künstlerischen Produkts auf der Bühne. Dieser Produzent hat dafür Sorge zu tragen, dass der Gast das bekommt, was ihm in der Ankündigung versprochen wurde.
Hier setzt die Abstimmung und die Auseinandersetzung mit der eigenständigen Leitung des künstlerischen Betriebes eines Hauses an – mit der Kreativdirektion. Gemeinsam mit den Teams aus Marketing, Presse, Vertrieb, Controlling, Vorderhaus-, Gebäude- und Personalmanagement bildet ein Produzent das wirtschaftlich-organisatorische Fundament. Daneben schlägt in der Kreativdirektion das inhaltlich-künstlerische Herz des Hauses. Sie verantwortet im Wesentlichen die Spielplangestaltung sowie die Koordination aller am künstlerischen Produkt beteiligten Gewerke.
Bevor die konkrete künstlerische Arbeit beginnen kann, erfolgt die Abstimmung und, wenn nötig, die Auseinandersetzung mit dem Produzenten. Die Kreativdirektion muss früh in der Lage sein, dem Wesen nach zu beschreiben, was zur Aufführung kommen soll. Der Produzent wird auf Grundlage aller verfügbaren Daten gemeinsam mit Profis aus Marketing, Presse und Vertrieb bewerten, in welcher Weise sich dafür Publikum akquirieren lässt. Durch die Variation von Spielstätten und Aufführungsanzahl lassen sich durchaus auch Konzepte umsetzen, für die nur ein geringes Interesse prognostiziert wird.
Diese Abstimmung und Publikumsprognose ermöglicht es einerseits, gezielt und effektiv zu werben, andererseits kann jeder Produktion so ein passendes Budget zugeteilt werden. Innerhalb dieses Budgets kann sich die Kreativdirektion bewegen, um die Produktionen zu realisieren – sie übernimmt damit Teilverantwortung als Ausführender Produzent. Ein regelmäßiges Controlling stellt die budgetäre Einhaltung sicher.
Wichtig ist bei diesem Modell eine klare Abgrenzung. Die Kreativdirektion bestimmt den Spielplan und kann über das Budget verfügen, das ihr aufgrund ihrer Planungen zugeteilt wurde. Es ist maßgeblich für hochwertige kreative Arbeit, dass die Kreativdirektion Sicherheit und ausreichend Freiraum erhält und damit zu einer attraktiven Position wird. Wichtiger als schriftliche Regelungen ist dabei das gegenseitige Vertrauen der handelnden Personen. Dazu tragen im Tagesgeschäft viele Faktoren bei, wie z. B. die tatsächliche Freiheit bei der Auswahl von künstlerischem Personal wie Darstellern oder Kreativteam-Mitgliedern.
Die Position des Kreativdirektors geht deutlich über die Verantwortung eines bisherigen Oberspielleiters hinaus; er muss – wie im Idealfall ein Intendant bisher – ein breites künstlerisches Verständnis und Wissen über alle Kunstgattungen und kunsthandwerklichen Gewerke besitzen. Seine Aufgabe besteht nicht darin, selbst Werke zu entwickeln oder zu inszenieren, sondern alle kreativen Prozesse zu steuern. Mit dem erklärten Ziel, alle Formen der Bühnenkunst zu vernetzen und verstärkt regionale und überregionale Kooperationen zu fördern, kommt dem Kreativdirektor die komplexe Aufgabe zu, den Spielplan inhaltlich zu gestalten und künstlerische Konzepte zu bewerten.





























