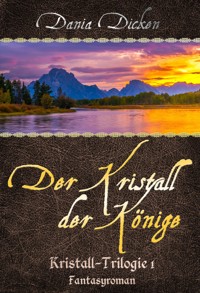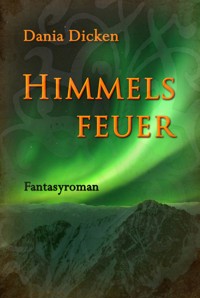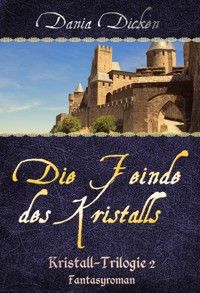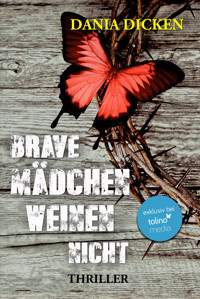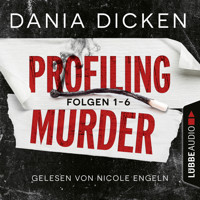4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Schock für FBI-Profilerin Libby Whitman und ihre Familie: Drei maskierte Unbekannte versuchen, Libbys zwölfjährige Schwester Hayley vor einem Einkaufszentrum zu entführen. In letzter Sekunde gelingt es Matt, die Kidnapper seiner Tochter in die Flucht zu schlagen, die unerkannt entkommen können. Doch um wen handelt es sich bei den Tätern?
Während die Polizei eine Neonazi-Gruppierung durchleuchtet, die den Whitmans schon früher Ärger gemacht hat, holt Libby ihre Schwester zu sich ins Tausende Meilen entfernte Virginia, um sie aus der Schusslinie zu bringen. Die beiden erleben eine intensive Zeit zusammen, doch die Gefahr ist noch nicht gebannt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Dania Dicken
Was im Schatten lauert
Libby Whitman 15
Thriller
Rache heißt, um der Vergangenheit willen handeln, sie ist also eine um 180 Grad falsch gedrehte Energie.
Prentice Mulford
Prolog
Die graue Gesichtsfarbe seines Vaters und seine ausgezehrten Wangen erschütterten ihn. Es war kaum zu übersehen, wie sehr der Krebs an ihm zehrte. Mit tränenden Augen versuchte sein Vater, ihn zu fixieren.
„Es tut mir leid, Dad. Ich ... ich bin so wütend, weil sie keine Gnade gezeigt haben. Das ist unmenschlich“, stieß er hervor, während er nach der Hand seines Vaters griff. Sie war eiskalt.
Sein Vater lächelte gütig. „Du hast alles versucht. Du bist ja sogar den ganzen weiten Weg gekommen, um mir die letzte Ehre zu erweisen.“
„Wo denkst du hin, Dad? Natürlich bin ich gekommen!“
„Das bedeutet mir alles.“ Die Stimme seines Vaters klang dünn und hohl. Er machte sich da keine Illusionen – vermutlich sah er seinen Vater gerade zum letzten Mal lebend.
Tränen brannten in seinen Augen, als er zu dem vergitterten Fenster der Krankenstation schaute. Sein Vater hatte mehrmals ein Gnadengesuch eingereicht, um nicht hinter Gittern sterben zu müssen, doch es war jedes Mal abgelehnt worden.
Das war so unwürdig.
Die Hand seines Vaters zuckte unter seiner. „Es gibt aber etwas, das du für mich tun könntest.“
Aufmerksam erwiderte er den Blick des todkranken Mannes. „Was immer du willst.“
„Ich will, dass du Vergeltung übst.“
„Vergeltung?“
Sein Vater nickte langsam. „Das würde sie verdienen für all das, was sie angerichtet hat. Dazu hatte sie kein Recht.“
„Natürlich hatte sie das nicht.“
„Ich will, dass sie ihren Tribut zahlt. Sie hat uns etwas genommen, was uns zustand. Mir zustand.“
„Das stimmt, aber ... was soll ich tun?“
„Es gibt doch sicher etwas, das ihr lieb und teuer ist. Ich will, dass du es ihr wegnimmst.“
Er schluckte hart. „Aber was?“
„Hat sie ein Kind?“
„Das weiß ich nicht.“
„Aber du kannst es herausfinden, oder?“
„Sicher ...“
„Nimm es ihr weg. Wie du mit ihr verfährst, ist mir gleich. Sie soll nur ihre gerechte Strafe für das erhalten, was sie mir und den anderen angetan hat.“
Unsicher erwiderte er den Blick seines Vaters, sagte aber nichts.
„Wirst du das für mich tun? Ich kann in Frieden gehen, wenn ich weiß, dass du mir diesen Wunsch erfüllst.“ Entschlossen packte sein Vater seine Hand und sah ihn flehentlich an, so dass er nickte.
„Natürlich, Vater. Wie du wünschst.“
Sonntag, 5. März
„Mach sie fertig. Denen zeigst du es!“
Grinsend erwiderte Libby Owens Blick. „Ich wünschte, ich könnte deinen Enthusiasmus für Gerichtsverhandlungen teilen.“
„Ich bin da überhaupt nicht enthusiastisch – ich finde es nur gut, dass du einem korrupten Gesetzeshüter das Handwerk legen willst. Bowman beleidigt meinen Begriff von Berufsehre.“
„Da hast du wohl Recht.“ Nachdenklich stand Libby vor dem Kleiderschrank, die Fäuste in die Hüften gestemmt. Konnte sie es riskieren, ihren Hosenanzug in ihren Trolley zu stecken? Kam der nicht völlig verknittert wieder raus?
Sie würde es riskieren müssen, denn sie hatte keine Lust, darin ins Flugzeug zu steigen – zumal das auch nicht garantierte, dass er faltenfrei blieb.
Vorsichtig legte sie ihn zusammen und blickte fragend zu Owen, der sie dabei beobachtete.
„Was ist los?“, fragte sie.
„Ach, ich finde es nur schade, dass ich dich nicht darin sehen werde. Darin siehst du toll aus. Ganz die FBI-Agentin. Zum Anbeißen.“
Libby lachte. „Worauf du so stehst ...“
„Du wirst mir fehlen.“
„Ich bin doch bloß zwei Tage weg.“
„Ja, zum Glück.“ Dennoch klang Owen unzufrieden.
„Was ist los?“, fragte Libby.
„Gar nichts.“
Sie legte den Kopf schief und zog skeptisch eine Augenbraue hoch. „Lüg mich nicht an, Owen Young. Du weißt, ich bin Profilerin.“
„Es ist nichts.“
„Du lügst schon wieder.“
Er holte tief Luft, bevor er zögerlich erwiderte: „Dass das ausgerechnet jetzt sein muss.“
Nun verstand Libby. Sie hatte auch schon darüber nachgedacht – sie würde gerade zu der Zeit im Monat in Kalifornien sein, in der die Wahrscheinlichkeit für sie am höchsten war, schwanger zu werden. Sie hatte für sich schon beschlossen, dass es nicht so schlimm war, weil vermutlich nach ihrer Rückkehr immer noch Zeit war.
Aber sie verspürte denselben Druck, auch wenn sie wusste, dass das nicht gut war. Sie wollte doch keine Chance ungenutzt lassen. Auch im letzten Zyklus war wieder nichts passiert und egal, wie sehr sie mit Michaels Hilfe beschlossen hatte, sich nicht stressen zu lassen – es klappte nicht. Der Gedanke war immer da.
„Mittwoch reicht auch noch“, sagte sie.
„Ich weiß. Aber jetzt weißt du auch, warum ich nichts sagen wollte. Ich wollte nicht schon wieder Druck aufkommen lassen.“
„Ich weiß. Schon gut.“ Sie warf einen Blick auf die Uhr. In drei Stunden musste sie am Flughafen sein.
„Was spricht gegen jetzt? Wir haben noch Zeit“, sagte sie.
Owen grinste unwillig. „Sollten wir genau das nicht tun?“
„Es soll Spaß machen. Macht es doch immer.“ Sie legte ihren Kulturbeutel in ihren Trolley, klappte ihn zu und stellte ihn zur Seite.
„Ich weiß nicht“, brummte Owen.
„Du hast angefangen!“
Jetzt lachte er. „Du hast mich genötigt.“
„Ja, ich weiß. Hast Recht.“ Libby ging zu ihm und blieb vor ihm stehen. Sie sah ihm stumm in die Augen und legte eine Hand auf seine Brust. Während sie ihm immer näher kam, beobachtete sie seine Reaktion.
Ja, es war unromantisch. Das war es die ganze Zeit. Sie beobachtete ihren Körper genau, hatte den Kalender im Blick – so hatte sie sich das alles nicht vorgestellt.
Doch Owen erwiderte ihren Annäherungsversuch, indem er die Arme um sie legte und sie an sich zog. Libby schloss die Augen und küsste ihn. Er hatte sich vorhin rasiert, der leicht holzige Duft seines Aftershaves war noch ziemlich intensiv. Owen erwiderte ihren Kuss überraschend begierig und glitt mit einer Hand unter ihren Pullover.
„Du willst ja doch“, murmelte sie.
„Ich will sowieso immer“, sagte er nicht ganz ernst gemeint und grinste. Libby schlang die Arme fest um ihn und grinste ebenfalls, als Owen sie rücklings an die Wand drückte und erneut leidenschaftlich küsste.
Eigentlich waren sie darin inzwischen ganz gut. Es war auch endlich wieder normal geworden. Owen war unbefangener, seit er nicht mehr ständig Angst hatte, irgendetwas falsch zu machen.
Wortlos zog Libby ihm den Pullover aus, bevor er es ihr gleichtat. Dennoch beschloss sie, vorerst die Zügel in der Hand zu halten, und dirigierte ihn langsam zum Bett, wo sie ihm einen spielerischen Stoß gab und ihn so auf die Matratze beförderte. Stumm legte sie sich daneben und strich ihr Haar aus dem Gesicht, bevor sie ihn erneut küsste. Er machte sich an ihrer Unterwäsche zu schaffen und zog sie ihr aus, ehe sie gänzlich ineinander verschlungen dalagen und die Zärtlichkeiten des anderen genossen.
Libby war so froh und dankbar dafür, dass sie es inzwischen einfach wieder genießen konnte. Es war so ein harter Kampf, sich das zurückzuerobern – ein Kampf, der sich über Monate gezogen hatte. Aber gerade die Zeit war es, die auch dabei half, zu vergessen. Inzwischen, wenn sie Owen nah war, war da nur noch Owen und keine böse Erinnerung mehr.
Es gelang ihr zunehmend, sich einfach fallen zu lassen und es zu genießen. Schließlich glitt Owen vom Bett und kniete sich davor auf den Boden, woraufhin Libby ihm folgte und ganz vorn an die Bettkante rutschte. Sie zog ihn dicht an sich und schloss die Augen, als sie eins wurden. Für einen Augenblick genoss sie dieses Gefühl und den sanften Schauer, der sie überlief.
Sie brauchte diese Nähe. Es hatte ihr wie ein Dorn in der Seele gesessen, als sie nicht dazu fähig gewesen war, es einfach zuzulassen. Zum Glück war das vorbei. Zum Glück waren da nur noch Owen und sie und keine Gespenster mehr.
Sie genoss seine fordernden Berührungen und seine Atemzüge auf ihrer Haut. Er fuhr ihr mit einer Hand durchs Haar und küsste sie ihn die Halsbeuge, woraufhin sie eine Gänsehaut bekam.
Nur er. Nur das Vertrauen. Ihre Liebe. Sie biss sich auf die Lippen, als er sie so berührte, wie sie es am liebsten hatte, und ließ es zu, dass sie allmählich die Kontrolle verlor. Sie glaubte, in seinen Augen zu versinken, als er sie küsste, und hielt sich keuchend an ihm fest. Am liebsten hätte sie ihn gar nicht mehr losgelassen. Seine Nähe war es, die sie brauchte wie nichts sonst.
Die Augen geschlossen, lehnte sie ihren Kopf an seine Schulter und erstarrte für einen Moment am ganzen Leib, als sie das Gefühl hatte, innerlich zu explodieren. Sie stieß einen Schrei aus und klammerte sich an Owen, der sie so fest an sich drückte, dass ihr beinahe die Luft wegblieb. Unter ihren Händen spürte sie, dass er zitterte. Mit einem entrückten Blick sah er sie an und küsste sie leidenschaftlich.
Für einen Moment rührten sie sich nicht. Libby hätte ihn am liebsten nie wieder losgelassen.
„Danke“, sagte er unverhofft, weshalb sie ihn überrascht ansah.
„Wofür?“
„Dafür, dass du das wieder mit mir teilst. Ich bin so froh, dass wir uns nicht verloren haben.“
Das traf sie so unvorbereitet, dass sie für einen Moment hart schluckte und darum kämpfte, die Tränen zurückzuhalten. „Ich liebe dich. Das weißt du.“
„Ja, daran habe ich auch nie gezweifelt. Es macht aber einen Unterschied, es zu spüren.“
Libby wusste nicht, was sie erwidern sollte. Langsam und mit sichtlich weichen Knien stand Owen auf, schnappte sich seine Shorts und verschwand im Bad. Für einen Moment sah Libby ihm nach, bevor sie sich rücklings aufs Bett sinken ließ und liegen blieb.
Das hatte er ihr so noch nie gesagt. Allerdings hatte sie gerade auch das Gefühl gehabt, dass sie einander so nah waren wie selten. Seine Worte hatten sie wirklich tief berührt. Tränen brannten in ihren Augen, aber sie wischte sie scheu weg, bevor Owen aus dem Bad zurückkehrte und ihren Slip vom Boden aufhob, um ihn ihr zu geben.
„Habe ich dich so geschafft?“, fragte er grinsend.
„Schon“, erwiderte sie amüsiert.
Sie beeilte sich nicht mit dem Aufstehen und zog sich nur allmählich wieder an. Ob es jetzt endlich klappte? Sie wünschte es sich so sehr. Inzwischen wirklich. Mit Michael hatte sie wiederholt darüber gesprochen und festgestellt, wie sehr vor allem ihre Abstammung sie blockiert hatte. Ihre Angst vor möglichen Konsequenzen war groß gewesen, doch die hatte Dr. Melrose ihr genommen.
Sie ging ins Bad, um ihre Haare zu bürsten und sich einen Zopf zu binden. Anschließend steckte sie die letzten Dinge in ihren Trolley und folgte Owen nach unten.
Am liebsten wäre sie jetzt bei ihm geblieben, dabei freute sie sich auch auf ihre Familie. Der Aufenthalt in Kalifornien würde sowieso viel zu kurz ausfallen.
Schließlich war es an der Zeit, zum Flughafen zu fahren. Libby würde die Abendmaschine vom Ronald Reagan Airport aus in Richtung San Francisco nehmen. Sie war hin- und hergerissen gewesen zwischen mehr Zeit bei ihrer Familie und mehr Zeit mit Owen, hatte sich dann aber für Letzteres entschieden. Wenn sie ehrlich war, wusste sie auch, warum.
„Ich wünschte, ich könnte mitkommen“, sagte er, als er in der Haltezone stehenblieb.
„Ja, das wäre schön gewesen, aber du kannst gar nichts dazu beitragen.“
„Ich weiß. Du packst das.“
Sie stiegen aus, Owen hob den Trolley aus dem Kofferraum und übergab ihn an Libby. Für einen Moment standen sie einfach nur da und sahen einander an, bevor sie sich umarmten und einen Abschiedskuss gaben.
„Du wirst mir fehlen“, sagte Owen.
„Du mir auch. Bis übermorgen.“
„Bis dann. Und viel Erfolg morgen.“
Libby bedankte sich und ging schließlich ins Terminalgebäude. Hinter der Tür blickte sie zurück und schaute zu Owen, der noch vor seinem Auto stand, doch dann machte sie sich auf zum Check-in.
Glücklicherweise musste sie den kleinen Trolley nicht als Koffer aufgeben, sondern konnte ihn mit ins Flugzeug nehmen. Das Boarding begann pünktlich und ebenso pünktlich startete die Maschine auch um 18 Uhr. Um 21 Uhr Ortszeit würde sie in San Francisco landen.
Die Sonne ging unter, als sie eine Schleife drehten und sich auf den Weg gen Westen machen. Ein Flug mit der Dämmerung. Libby hatte das Glück gehabt, einen Fensterplatz zu ergattern. Neben ihr saß ein junger Geschäftsmann, der zwischendurch ein wenig mit ihr plauderte und sich erkundigte, warum sie an die Westküste flog.
„Ich bin FBI-Agentin und muss zu einer Aussage vor Gericht erscheinen“, erklärte sie wahrheitsgemäß, auch wenn das eine mit dem anderen in diesem Fall gar nichts zu tun hatte.
Erwartungsgemäß staunte er trotzdem. „Wow, nicht schlecht. Sie sehen nicht aus wie eine FBI-Agentin.“
„Meine Kollegen vermutlich auch nicht“, erwiderte sie und lachte. „Und was machen Sie?“
„Ich arbeite im Silicon Valley. Meine Freundin dummerweise nicht, sie ist im Team des kalifornischen Senators und arbeitet jetzt in DC ... im Moment ist es eine Fernbeziehung auf Zeit.“
„Das ist hart“, sagte Libby.
„Schon, ja. Fünf Stunden Flug – das geht nicht an jedem Wochenende. Und wie kommt es, dass Sie in Kalifornien eine Aussage machen müssen? Hatten Sie da einen Fall?“
„Sozusagen, ja. Ich komme auch aus Kalifornien, aber meine Arbeit ist jetzt in Virginia.“
„Gar nicht in DC?“
„Nein, in Quantico.“
„Wow. Nicht schlecht“, sagte er anerkennend und Libby lächelte.
Nachdem sie eine Weile geredet hatten, beschloss er, sich einen Film anzusehen, was Libby ihm gleichtat. Sie schaffte es jedoch kaum, sich darauf zu konzentrieren. Ihre Gedanken waren woanders – bei der Aussage am kommenden Tag und bei Owen. Bei ihren Zukunftsplänen. Vielleicht hatten sie ja diesmal endlich Glück.
Sie hatten, Michaels Ratschlag entsprechend, darüber gesprochen, wie ihr Leben mit Kind weitergehen sollte, und hatten verabredet, sich die elterlichen Pflichten weitgehend zu teilen. Libby wollte ein halbes Jahr mit dem Baby zu Hause bleiben, während Owen sich spontan zur Geburt ein wenig Urlaub nehmen und im Anschluss an Libby ebenfalls ein halbes Jahr freinehmen wollte. Als Behördenmitarbeiter standen sie gar nicht so schlecht da, aber trotzdem war Libby nicht glücklich darüber, auf die familienfreundliche Gesetzgebung in Kalifornien verzichten zu müssen.
Das Flugzeug erreichte San Francisco pünktlich und drehte eine großzügige Schleife über der Bucht, bevor es wie immer plötzlich aufsetzte. Libby hatte nie aufgehört, den Landeanflug auf San Francisco spannend zu finden, bei dem es wirkte, als lande man auf dem Wasser der Bucht.
Beim Aussteigen verabschiedete sie sich von ihrem Sitznachbarn und machte sich auf den Weg in die Ankunftshalle, wo sie schnell ihre Familie entdeckte. Sadies feuerrotes Haar war schon von weitem unverkennbar und Hayley winkte aufgeregt. Libby beeilte sich, zu ihnen zu kommen, und umarmte sie nacheinander, als sie sie erreicht hatte.
„Ist das schön, euch zu sehen“, sagte sie. „Danke, dass ihr mich abholt.“
„Ist doch selbstverständlich“, sagte Matt.
„Wie war dein Flug?“, erkundigte Sadie sich.
„Gut. Wie immer eigentlich. Wie geht es euch?“
„Ich bin so aufgeregt wegen morgen“, gestand Hayley.
„Das glaube ich dir, aber ich weiß, dass du das schaffst. Hast du letzte Woche auch schon. Bist doch meine große kleine Schwester, oder?“
Hayley machte bloß ein missfälliges Geräusch, doch Sadie und Matt lachten. Gemeinsam gingen sie zum Ausgang und zu Matts Challenger, den er im Parkhaus abgestellt hatte. Während der Fahrt ließ Libby die abendlich beleuchtete Bucht von San Francisco auf sich wirken.
„Ist das schön, hier zu sein“, gab sie zu. „Das ist mein Zuhause.“
„Pleasanton?“, fragte Sadie.
Libby nickte. „Ja. Wenn ich mal überlege, wo ich schon überall gelebt habe ... Aber das hier fühlt sich wie Heimat an.“
„Geht uns eigentlich ähnlich, oder?“, sagte Matt.
Sadie nickte. „Stimmt. Ich bin auch froh, dass wir hier unser Zuhause gefunden haben.“
„Wäre doch die BAU nicht in Quantico ... Und Owen mag seinen Job leider auch“, murmelte Libby.
„Das Problem kennen wir, oder? Wobei wir ja nicht sehr lang an der Ostküste waren. Das war kaum mehr als ein halbes Jahr, oder?“, fragte Matt an Sadie gewandt.
„Kann sein, ja. Ich denke nicht so gern daran zurück, um ehrlich zu sein“, erwiderte sie.
In Pleasanton angekommen, brachte Libby ihren Trolley ins Gästezimmer, bevor sie ins Wohnzimmer ging.
„Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit erübrigen können“, sagte Libby, als sie schließlich mit Sadie und Hayley auf dem Sofa saß.
„Ach, das hast du doch ganz prima gelöst, indem du übermorgen erst zurückfliegst. So haben wir morgen den ganzen Tag und übermorgen auch noch ein bisschen.“
„War die stressfreiere Alternative.“
Sadie erwiderte nichts. Während Matt mit den Gläsern in der Küche klapperte, sagte Sadie: „Du bist ziemlich in dich gekehrt heute.“
„Findest du?“
Sadie nickte. „Ist alles in Ordnung?“
Erst überlegte Libby, abzuwiegeln, doch dann gab sie sich einen Ruck. „Es ist noch immer dasselbe Thema – wir warten auf eine Schwangerschaft.“
Sadie nickte verständnisvoll. „Das ist ein Gefühl, das ich nicht kenne – aber ich kann es mir vorstellen. Das muss vereinnahmend sein.“
Libby nickte. „Leider, ja. Auf einmal ist ein Monat so lang. Ich kaue auch immer noch darauf herum, dass Byron mit seiner Freundin eine Verhütungspanne hatte, obwohl die beiden nicht mal ein Kind wollten.“
„Das ist fies“, sagte Sadie mitfühlend. „Du weißt, wenn du reden willst ...“
„Danke. Eigentlich versuche ich gerade, es aus dem Kopf zu bekommen und mich auf morgen zu konzentrieren.“
„Ich freue mich so – endlich wieder eine Aussage vor Gericht“, sagte Matt sarkastisch, während er die Gläser auf dem Tisch abstellte. Libby lachte und suchte seinen Blick.
„Dir bleibt auch nichts erspart.“
„Nein, wirklich nicht. Ich habe das immer schon gehasst und jetzt ...“
„Ich bin so nervös“, sagte Hayley.
„Musst du nicht. Wir werden das rocken.“ Matt zwinkerte seiner Tochter zu.
Montag, 6. März
An diesem Verhandlungstag ging es nicht um Harper Bowman – gegen ihn hatte Hayley bereits in der Vorwoche ausgesagt. Jetzt war sein Vater, Sheriff Hugh Bowman, an der Reihe – und er musste sich wegen versuchtem Mordes in drei Fällen verantworten. Um seine frühere Bestechlichkeit ging es in diesem Verfahren überhaupt nicht, sondern nur um die Dinge, die er unternommen hatte, um Harper vor der Strafverfolgung zu schützen.
Sie warteten gemeinsam vor der Tür. Sadie hatte sie selbstverständlich begleitet, worüber vor allem Hayley sehr froh zu sein schien. Libby versuchte, gelassen zu bleiben, doch sie erschrak trotzdem beinahe, als sie wenig später als erste Zeugin aufgerufen wurde.
Das überraschte sie, sie hatte eigentlich damit gerechnet, dass man Matt nehmen würde – doch dann verstand sie den Grund. Sie war Bundesagentin und damit die stärkste und glaubwürdigste Zeugin. Das machte ihre Anspannung allerdings nicht besser.
Sie durchquerte den Gerichtssaal und betrat den Zeugenstand. Nachdem ihre Identität festgestellt worden war, richtete der Staatsanwalt das Wort an sie.
„Heute geht es schwerpunktmäßig um die Ereignisse am ersten Dezember des vergangenen Jahres“, begann der Mann. Libby berichtete ihm, wie es dazu gekommen war, dass sie mit Matt allein im Wald auf die Suche nach Hayley gegangen war.
„Bei unserem Eintreffen haben wir Adam Draper und Harper Bowman gemeinsam mit meiner Schwester vorgefunden“, fuhr Libby fort.
„Wie hat Harper reagiert?“
„Er war sehr angespannt. Er wollte nicht, dass ich reinkomme, aber ich habe ein wenig mit ihm verhandelt und ihn dazu gebracht, mich reinzulassen.“
„Was haben Sie dann vorgefunden?“
„Auf einem Stuhl saß meine Schwester, sie war mit Klebeband daran gefesselt. Harper stand hinter ihr und hat sie mit einem Messer bedroht. Ich wollte ihn gerade weiter zur Aufgabe überreden, als sein Vater erschien.“
„Als FBI-Profilerin sind Sie für solche Verhandlungssituationen ausgebildet, nehme ich an?“
Libby wusste, dass der Staatsanwalt das als Argument für sie verwenden wollte, und nickte. „Ja. Ich habe schon Geiselverhandlungen geführt. Natürlich war das hier eine besondere Situation, es ging ja um meine Schwester.“
Der Staatsanwalt nickte wohlwollend. „Dann erschien der Angeklagte?“
„Richtig“, stimmte Libby zu und erzählte, wie Sheriff Bowman sie in der Hütte gefesselt hatte, um sie dort zurückzulassen.
„Sie sagten, Ihnen wäre klar gewesen, worauf das hinausläuft. Hat der Angeklagte seine Absicht auch kommuniziert?“, fragte der Staatsanwalt.
Libby nickte. „Ja, er hat sich schließlich umgeschaut und sagte zu Harper, dass er glaubt, es müsse so gehen. Ich weiß noch, wie mein Vater ihm ins Gewissen geredet hat. Bowman sagte dann zu Harper, dass sie losmüssten, denn das Feuer wäre bald da.“
„Und er hat dann sie, Ihren Vater und Ihre Schwester gefesselt in der Hütte zurückgelassen?“
Libby nickte. „Er hat in Kauf genommen, dass – nein, lassen Sie es mich anders formulieren. Es war seine Absicht, dass wir in der Hütte verbrennen, denn das hätte nicht nach Mord ausgesehen.“
„Einspruch“, protestierte der Verteidiger. „Das ist bloß eine Annahme.“
„Stattgegeben“, sagte der Richter.
Doch Libby gab sich nicht damit zufrieden. „Ich kann das untermauern.“
Überrascht sah der Richter sie an. „Wie meinen Sie das?“
„Bowman hatte Handschellen dabei. Die habe ich gesehen. Trotzdem wollte er, dass Harper uns mit Klebeband und dem Seil fesselt, denn beides wäre im Feuer verbrannt und hätte keinerlei Spuren hinterlassen, die auf Fremdeinwirkung hindeuten. Handschellen hätten das Feuer überdauert und außerdem auf ihn hingewiesen.“
„Einspruch!“, protestierte der Verteidiger erneut, doch diesmal schüttelte der Richter den Kopf.
„Abgewiesen. Die Zeugin spricht einen relevanten Aspekt an.“
Mürrisch setzte der Verteidiger sich wieder neben Bowman. Bislang hatte Libby es vermieden, ihn anzusehen, doch jetzt streifte ihr Blick den ehemaligen Sheriff. Er trug einen maßgeschneiderten Anzug und spießte sie schier mit Blicken auf, doch das war ihr egal.
„Hat jemand von Ihnen den Angeklagten und seinen Sohn auf die Gefahrensituation hingewiesen?“, fragte der Staatsanwalt.
„Sicher“, sagte Libby und nickte. „In der Hauptsache mein Vater. Es war klar erkennbar, dass Bowman uns nicht nur im vollen Bewusstsein der Gefahrensituation zurücklässt, sondern auch in der Absicht, dass wir im Feuer sterben. Er war bereit, alles zu tun, um seinen Sohn zu schützen. Zwischendurch sagte er noch, ich hätte besser das Geld genommen, das er mir angeboten hat.“
„Er hat Ihnen Geld angeboten?“, fragte der Staatsanwalt gespielt arglos und Libby berichtete von Bowmans Bestechungsversuch.
„Er hat alles versucht, um uns zu beeinflussen – in der Hauptsache meine Schwester. Sie war alles, was zwischen seinem Sohn und der Freiheit stand. Und am ersten Dezember war er willens, uns bei einem Waldbrand sterben zu lassen“, sagte Libby.
„Was ihm ganz offensichtlich nicht gelungen ist. Haben Sie sich befreit?“
Libby schüttelte den Kopf. „Feuerwehrmänner haben uns gefunden und gerettet. Das Feuer hat die Hütte schon erreicht, als sie kamen, aber ein Löschhubschrauber hat seine Ladung über der Hütte ausgeleert, so dass wir mit den Feuerwehrmännern sicher entkommen konnten.“
„Mit den Männern werden wir auch noch sprechen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Schilderung, Agent Whitman. Ich wäre dann fertig.“
Während der Staatsanwalt zu seinem Platz zurückkehrte, stand Bowmans Anwalt auf und ging nach vorn.
„Agent Whitman“, sagte er gewichtig und warf ihr einen Seitenblick zu. „Sie waren sechzehn Jahre alt, als in Los Angeles der ehemalige Bürgermeister versucht hat, ihrer Familie Scherereien zu machen. Auch dabei ging es um seinen Sohn, der als Mörder verurteilt wurde. Damals kam es zu einer viermonatigen Inhaftierung Ihres Adoptivvaters Matt Whitman – und das aufgrund einer E-Mail, in der Sie ihn schwer belastet haben. Darin berichteten Sie einer Freundin davon, dass er eine Frau getötet hatte.“
„Er glaubte, sie getötet zu haben“, grätschte Libby dazwischen.
„Wie dem auch sei – diese Erfahrung muss Sie geprägt haben.“
„Einspruch“, rief der Staatsanwalt und fügte hinzu: „Was hat das mit dem aktuellen Fall zu tun?“
„Dieser Frage schließe ich mich an“, sagte der Richter.
„Lassen Sie mich fortfahren – ich will darauf hinaus, dass eine Voreingenommenheit bei der Zeugin nicht auszuschließen ist“, sagte der Verteidiger. Libby verdrehte die Augen und bemühte sich gar nicht, es unauffällig zu machen.
„Ihr Vater ist knapp einer Mordanklage entgangen. Sein Verteidiger hat nach vier Monaten schließlich einen Freispruch erwirkt – aber ihr Vater ist während der Haft lebensgefährlich verletzt worden und Ihre Familie hatte enorme finanzielle Probleme. Natürlich, sie mussten allein mit dem Gehalt Ihrer Mutter auskommen und zudem den Anwalt bezahlen. Letztlich führte all das dazu, dass Ihre Eltern beide das FBI verlassen haben und mit Ihnen hierher nach Pleasanton gezogen sind. Würden Sie mir darin zustimmen, dass das ein einschneidendes Erlebnis für Ihre gesamte Familie war?“
Libby nickte. „Ja, das war es.“
„Haben Sie sich die Schuld dafür gegeben, dass das passiert?“
Sie biss sich auf die Lippen und nickte wieder. „Schon, ja. Meine Mail war es, die meinen Vater zu dem falschen Geständnis bewegt hat.“
„Und nun lebt Ihre Familie hier in Pleasanton – und was passiert? Erneut werden Sie mit einer Person des öffentlichen Lebens, in diesem Fall dem Sheriff und seinem Sohn, konfrontiert. Können Sie beweisen, dass mein Mandant versucht hat, Sie zu bestechen?“
Irritiert erwiderte Libby seinen Blick, während der Staatsanwalt aufstand und rief: „Einspruch. Das ist gar nicht die Aufgabe der Zeugin.“
„Stattgegeben“, sagte der Richter. „Was möchte die Verteidigung mit diesem Exkurs bezwecken?“
„Die Zeugin ist voreingenommen“, sagte der Anwalt. „In ihrer Jugend hat sie eine Erfahrung mit einem korrupten Politiker gemacht, die sie geprägt hat, und das überträgt sie nun zu Unrecht auf meinen Mandanten.“
„Einspruch!“, rief der Staatsanwalt erneut. „Das ist nichts weiter als Spekulation.“
„Stattgegeben.“ Der Richter nickte zustimmend. „Dieses Manöver der Verteidigung ist nur allzu durchschaubar.“
Der Anwalt räusperte sich. „Agent Whitman, vorhin haben Sie versucht, meinem Mandanten eine Mordabsicht zu attestieren – in gleich drei Fällen. Hat er denn je wörtlich geäußert, Ihren Tod herbeiführen zu wollen?“
Libby überlegte kurz und schüttelte den Kopf. „Nein, hat er nicht.“
„Wieso glauben Sie dann, dass es so war?“
„Weil der Wald brannte. Überall war Rauch. Es kratzte schon im Hals. Darauf haben wir ihn auch aufmerksam gemacht – ich weiß nicht, wie lang es gedauert hat, bis uns die Feuerwehr in der Hütte gefunden hat. Nicht sehr lang. Ich weiß, dass Bowman und sein Sohn dem Löschzug entgegengekommen sind, und sie wollten die Straße nicht freimachen. Es war also sehr knapp, dass die Feuerwehrmänner uns gefunden und gerettet haben. Bowman muss sich dessen bewusst gewesen sein, dass wir sterben könnten, und ich bin sicher, genau darum ging es ihm auch.“
„Mir hat mein Mandant gesagt, er wollte nur einen ausreichenden Vorsprung sicherstellen, um seinen Sohn in Sicherheit zu bringen. Eine Mordabsicht Ihnen und Ihrer Familie gegenüber hegte er nie. Er wollte ...“
„Das glauben Sie nicht wirklich, oder?“, unterbrach Libby ihn. „Er hat uns gefesselt in einer Hütte in einem lichterloh brennenden Wald zurückgelassen.“
„Wie schon gesagt, er wollte Vorsprung gewinnen.“
„Und er wollte den perfekten Mord begehen. Es wäre doch viel unkomplizierter gewesen, er hätte uns Handschellen angelegt, oder? Er hatte welche dabei. Wäre einfach gewesen – eine um mein Handgelenk, die andere um ein Handgelenk meines Dads, und das am besten so, dass irgendwas zwischen uns steht, das unsere Flucht verhindert. Aber dann hätte man an unseren verkohlten Skeletten gesehen, dass wir nicht einfach nur in der Hütte Schutz vor dem Feuer gesucht haben.“
„Sie spekulieren schon wieder“, sagte der Anwalt.
„Ich bitte die Zeugin, sich zu mäßigen“, sagte der Richter, woraufhin der Anwalt kurz triumphierend grinste.
„Entschuldigung, Euer Ehren“, sagte Libby pflichtschuldig mit Blick zum Richter, stellte aber fest, dass er ihn wohlwollend erwiderte.
„Hat die Verteidigung noch weitere Fragen an die Zeugin?“
„Durchaus“, sagte der Anwalt und nickte. „Sie sind FBI-Agentin in Quantico, Virgina, richtig?“
Libby nickte. „Richtig.“
„Und Sie waren über Thanksgiving bei Ihrer Familie in Kalifornien, als sich die fraglichen Ereignisse zugetragen haben.“
„Auch das ist richtig.“
„Das war also Ihr Urlaub.“
„Genau.“
„Mit welcher Berechtigung sind Sie am ersten Dezember hier in Kalifornien in einen brennenden Wald gelaufen, obwohl die Behörden längst auf der Suche nach Ihrer Schwester waren? Sie haben sich und Ihren Vater nur zusätzlich in Gefahr gebracht, zudem hatten Sie kein Recht, hier mit jemandem zu verhandeln.“
„Das ist wahr“, sagte Libby zur Überraschung aller. „In dem Moment war ich nicht als FBI-Agentin unterwegs, sondern als Zivilperson – als große Schwester. Ich hatte Angst um Hayley. Mein Dad und ich haben gemeinsam beschlossen, die Information hinsichtlich der Jagdhütte so schnell wie möglich zu nutzen und dort nach Hayley zu suchen. Wir durften keine Zeit verlieren.“
„Damit haben Sie deutlich Ihre Kompetenzen überschritten – wie so oft, das zeigt Ihre Personalakte.“
„Einspruch“, rief der Staatsanwalt. „Die Verteidigung verschießt Nebelkerzen.“
„Stattgegeben“, sagte der Richter. „Für mich hat die Zeugin hier als Zivilperson gehandelt und nicht in Ausübung Ihres Amtes als Bundesagentin. Insofern ist Ihre Personalakte hier nicht weiter von Belang. Hat die Verteidigung noch weitere Fragen?“
„Nein, Euer Ehren“, brummte der Anwalt und setzte sich wieder zu Bowman.
„Die Zeugin ist hiermit entlassen“, sagte der Richter. Libby verließ den Zeugenstand und setzte sich in den Zuschauerraum, während Matt aufgerufen wurde. Er wurde im Verlauf seiner Aussage richtig emotional – etwas, das Libby von ihm so gar nicht kannte.
„Auf wen ging die Idee zurück, selbst im Wald nach Ihrer Tochter zu suchen?“, fragte der Staatsanwalt.
„Das war meine“, sagte Matt. „Wir mussten davon ausgehen, dass zwei Halbstarke mit meiner Tochter im Wald sind und sich nicht darum scheren, dass ringsum alles brennt. Libby hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Beschreibung erhalten, wo sich die Hütte befinden sollte, so dass wir kurzerhand aufgebrochen sind.“
„Waren Sie sich der Gefahr bewusst?“
Matt nickte. „Ja, in jeder Sekunde. Aber es ging hier um meine Tochter und der Wald stand lichterloh in Flammen. Hätten wir erst auf die Behörden gewartet, hätten wir wertvolle Zeit verloren – was sich hinterher auch bewahrheitete.“
Der Staatsanwalt stellte ihm noch einige weitere Fragen, bis er schließlich zum entscheidenden Punkt kam. „Haben Sie den Angeklagten auf die Gefahrenlage, der Sie sich ja bewusst waren, aufmerksam gemacht?“
„Natürlich. Ich war anfangs nicht sicher, ob er das nur einfach nicht sehen will oder ob er es sogar billigend in Kauf nimmt, doch es gab spätestens dann keinen Zweifel mehr, als er zu seinem Sohn sagte, dass sie sich beeilen müssten, weil das Feuer kommt.“ Matt holte tief Luft. „Die Flammen waren noch gar nicht da und trotzdem hatte ich das Gefühl, in der Hölle zu sein. Was da passiert ist, beschäftigt mich immer noch. Meine jüngere Tochter hat furchtbar geweint, sie hat uns ihre Todesangst deutlich gezeigt. Ich werfe es mir immer noch vor, dass ich dasaß und meinen beiden Töchtern nicht helfen konnte. Da fühlt man sich als Vater wie ein Versager.“
Libby schluckte, als sie ihn das sagen hörte. Zwar kam das nicht überraschend, aber es tat ihr weh, ihn das sagen zu hören. Ihr war es zwar ähnlich gegangen, aber vergleichen ließ es sich vermutlich trotzdem nicht.
Sein Kreuzverhör fiel kurz und harmlos aus, was Libby erleichterte. Abschließend kam Hayley mit Sadie in den Gerichtssaal und sagte ebenfalls noch kurz aus, während Sadie bei Matt und Libby im Zuschauerraum saß.
Es war schon Mittag, als sie es endlich geschafft hatten und in einer Verhandlungspause den Gerichtssaal verließen. Nach der Pause würde noch einer der Feuerwehrmänner aussagen, aber das wollten sie nicht mehr abwarten.
Sie hatten beschlossen, gemeinsam essen zu gehen und sich für ein mexikanisches Restaurant entschieden. Libby blieb bei ihrer Meinung, dass die mexikanische Küche in Kalifornien authentischer war als in Virginia, deshalb nutzte sie das immer aus, wenn sie zu Hause war.
„Wie lief es denn bei dir?“, fragte Matt, nachdem sie bestellt hatten. „Dich hat der Verteidiger bestimmt fies gegrillt, oder?“
„Er hat es versucht“, sagte Libby. „Wollte darauf hinaus, dass ich voreingenommen bin wegen der Sache mit Evans damals ... und er weiß, dass ich eine unartige FBI-Agentin bin. Hat den Richter nur zum Glück nicht interessiert.“
„Da gibt es auch nicht viel zu verteidigen“, sagte Sadie. „Bowman hat euch wissentlich in einem brennenden Wald zurückgelassen. Absichtlich. Nur gut, dass es nicht funktioniert hat.“
„Ich bin schon sehr gespannt auf das Urteil“, sagte Libby. „Wann soll es gefällt werden?“
„Nächste Woche“, sagte Matt. „Ich bin auch gespannt – vor allem, wie sie im Fall seines Sohnes urteilen.“
„Machst du dir da Sorgen?“
Matt schüttelte den Kopf. „Eigentlich nicht. Wir haben heute ausgesagt, weil Bowman mit allem Mitteln versucht hat, die Wahrheit zu vertuschen. Das ist ja schließlich auch eine Aussage ...“
Da musste Libby ihm zustimmen. Ihre Hoffnung war groß, dass in beiden Fällen gerechte Urteile gesprochen wurden.
Freitag, 17. März
Libbys Hoffnung hatte sich erfüllt. Am Vortag war das Urteil im Fall Harper Bowman gesprochen worden – die Jury verstand da keinen Spaß und hatte Harper wegen Mordes aus niederen Beweggründen schuldig gesprochen. Der Verteidiger hatte versucht, ihn rauszupauken, und darauf plädiert, dass er nur wegen Totschlags im Affekt verurteilt wurde, aber die Vertuschungsversuche von Harpers Vater hatten sich nachteilig ausgewirkt. Da die Jury Hayley Glauben geschenkt hatte, konnten sie sich zu einem harten Urteil durchringen. Harper hatte bloß Glück, dass er noch nicht volljährig war, denn dann hätte ihm sogar die Todesstrafe gedroht.
Jetzt fehlte bloß noch der Urteilsspruch im Fall seines Vaters, doch der wurde für diesen Tag erwartet.
Erheblich länger würde es mit einem Urteilsspruch im Fall David Pearson dauern, das schien sich bereits herauszukristallisieren. Libby und Julie hatten gemeinsam an einem Gutachten gearbeitet, das Davids psychische Verfassung genauestens darlegte und auch detailliert Auskunft über seine fünf verschiedenen Teilpersönlichkeiten gab, von denen nur eine ein Mörder war. Es war ihnen immer noch ein wichtiges Anliegen, die Weichen für David richtig zu stellen – seine Innenperson Max war zwar ein brutaler Mörder, nicht jedoch die anderen. Libby war zwar durchaus der Meinung, dass Max eine Gefahr für die Gesellschaft darstellte und eingesperrt werden musste, doch das Gefängnis war nicht der richtige Ort für ihn. Er benötigte dringend intensive psychiatrische Hilfe, deshalb setzten sie alles daran, in ihrem Gutachten zu begründen, warum bei ihm eine Verbüßung der Haft nur in einem Hochsicherheitskrankenhaus in Frage kam.
Inzwischen lag ihr Gutachten der Staatsanwaltschaft vor und die Prozessvorbereitungen liefen auf Hochtouren, doch Davids Fall war so komplex, dass es bis zu einem Schuldspruch noch dauern würde.
Sie überlegte schon, Feierabend zu machen, als ihr Handy klingelte. Es war Sadie.
„Hey“, begrüßte Libby sie gespannt.
„Wir sind gerade vom Gericht zurück. Bowman kriegt lebenslänglich. Versuchter Mord in drei Fällen, davon an einer Bundesagentin und einem Kind – da versteht das Gericht keinen Spaß. Ganz abgesehen davon, dass er sich bestechlich gemacht hat.“
Libby atmete tief durch. „Das sind gute Neuigkeiten.“
„Ja, hier hat die Justiz wieder einmal funktioniert. Ich bin froh. Ich hatte auch hier den Eindruck, dass die Jury es nicht witzig fand, hier einen Amtsträger vor sich zu haben, der sich korrupt gezeigt hat.“
„Das ist es ja auch nicht“, stimmte Libby zu.
„Wir sind ziemlich erleichtert, wie du dir denken kannst. Vor allem Hayley. Matt aber auch, glaube ich – das hat ihn ziemlich beschäftigt.“
„Das kann ich mir vorstellen ... Du hast seine Aussage ja nicht gehört, aber es hat ihn fertiggemacht, dass er seine Töchter nicht beschützen konnte.“
„Das ist ja auch keine Überraschung“, sagte Sadie. „Also dann, du weißt Bescheid.“
„Ja, danke. Ich werde gleich nach Hause fahren und Owen davon berichten.“
Sie verabschiedeten sich voneinander und Libby erzählte auch ihren Kollegen davon, was sie erfahren hatte. Julie freute sich mit ihr und Nick beglückwünschte sie, bevor er ihr ein schönes Wochenende wünschte und sie sich auf den Weg nach Hause machte.
Es wurde Zeit. Sie freute sich aufs Wochenende – sie hatten sich nichts vorgenommen, was auch mal sein musste. Die letzten Wochen waren ohnehin wieder turbulent genug mit ihrer Reise nach Kalifornien und nun dem ersehnten Urteilsspruch.
Als sie zu Hause ankam, war Owen bereits dort und begrüßte sie hocherfreut.
„Schön, dass du da bist“, sagte er. „Wie war dein Tag?“
„Prima. Vorhin hat Sadie angerufen – Bowman hat lebenslänglich bekommen.“
„Wow“, sagte Owen. „Da hat die Jury sich aber nicht lumpen lassen.“
„Er wollte den Tod einer Bundesagentin und eines Kindes herbeiführen. Das wird teuer“, sagte Libby trocken und grinste.
„Ich denke am besten gar nicht mehr über die Sache nach“, murmelte Owen.
„Ja, da hast du wohl Recht. Zum Glück ist ja nichts passiert.“
„Stimmt. Hast du Hunger? Wir könnten uns was machen.“
„Gute Idee“, sagte Libby. Sie bereiteten sich ein Abendessen zu und nachdem sie sich noch ein paar lästigen Hausarbeiten gewidmet hatten, machten sie es sich auf dem Sofa gemütlich und sahen ein wenig fern.
Darüber merkte Libby, wie sie müde wurde und als schließlich eine Folge vorüber war, schlug sie vor, ins Bett zu gehen. Owen war einverstanden und begleitete sie nach oben.
Sie war gerade fertig im Bad und noch dabei, sich umzuziehen, als das Handy auf ihrem Nachttisch klingelte. Für einen Moment befürchtete sie, dass es Nick war, der einen Einsatz fürs Team hatte, doch auf dem Display stand Matts Name. Fragend runzelte Libby die Stirn und nahm das Handy in die Hand.
„Hey“, begrüßte sie ihn freundlich. „Alles okay bei euch?“
„Entschuldige, ich weiß, wie spät es bei euch ist – aber vorhin hat jemand versucht, Hayley zu entführen“, sagte er atemlos.
„Bitte was?“, entfuhr es Libby.
„Meine Mum wird mich umbringen!“ Brittany biss sich auf die Lippen und kicherte.
„Meinst du?“, fragte Ava, bevor sie noch einen Löffel Schokoladeneis nahm.
„Mit absoluter Sicherheit. Ich hoffe, sie zwingt mich nicht, die Schuhe zurückzubringen ...“
„Ach, macht sie schon nicht.“ Hayley nahm noch einen Schluck von ihrer Eisschokolade.
Nach der Schule waren sie mit dem Bus zur Mall gefahren und ein wenig durch die Geschäfte geschlendert. Dabei hatte Brittany ziemlich teure Schuhe entdeckt, die sie unbedingt haben wollte – und schließlich hatte sie sich die Schuhe auch gekauft. Der Karton lehnte nun in einer Tüte unter ihrem Tisch im Café.
„Meine Mum bringt mich höchstens um, wenn ich gleich keinen Hunger habe“, murmelte Hayley, naschte aber genüsslich weiter an ihrer Eisschokolade.
„Was gibt es denn bei euch?“, fragte Ava.
„Keine Ahnung. In zehn Minuten holt mich mein Dad ab.“ Das war Hayley auch ein Dorn im Auge, aber ihre Eltern wollten nicht zu spät zu Abend essen. Brittany und Ava durften länger bleiben, aber Hayley wusste, wann es sich lohnte, mit ihren Eltern zu streiten und wann nicht. Gerade war Letzteres der Fall.
Als der Kellner kam, bezahlte Hayley ihre Eisschokolade und verabschiedete sich von ihren Freundinnen. Sie hatte sich mit Matt draußen auf dem Parkplatz vor Macy’s verabredet und weil sie wusste, dass er immer pünktlich war, wollte sie lieber überpünktlich sein.
Manchmal war er schon streng, aber sie wusste, warum. Er machte sich Sorgen. Sie konnte auch nur schwer etwas dagegen erwidern, weil das bei ihren Eltern nicht bloß irgendwelche Sprüche waren. Sie hatte nie vergessen, wie sie tatsächlich als kleines Mädchen mal zusammen mit ihrem Dad gekidnappt worden war. An die anschließende halsbrecherische Flucht durch den nächtlichen Wald konnte sie sich erinnern. Und auch das, was ihrer Schwester widerfahren war, bewies, dass das Böse real war.
Hayley hatte ihre neue Messenger Bag geschultert, mit der sie aus der Schule gekommen war, und blieb in der Nähe des Eingangs von Macy’s auf dem Parkplatz stehen. Sie liebte es, mit ihren Freundinnen shoppen zu gehen, und hätte gern mehr Zeit gehabt, aber sie waren an diesem Tag nach der Schule gegangen, weil Brittany mit ihrer Familie am Wochenende wegfuhr. Es war Spring Break und sie hatten ein Ferienhaus unweit der Sierra Nevada. Darum beneidete Hayley sie.
Gelangweilt hielt sie nach dem Auto ihres Vaters Ausschau. Sie war damit groß geworden, dass er Sportwagen fuhr, aber ihre Freunde spiegelten ihr immer wieder, wie ungewöhnlich das war – und wie sehr sie sie beneideten.
Kein Challenger in Sicht. Hayley zog ihr Handy aus der Tasche und schaute auf die Uhr. 17.58 Uhr. Bestimmt kam Dad gleich.
Immer wieder fuhren andere Autos vorüber. Als sie das laute Blubbern eines V8-Motors hörte, drehte sie sich kurz um. Ein weißer Van fuhr langsam vorbei. Sie hatte sich neben einem Schild unweit der Einfahrt hingestellt, so dass Dad sie kaum verfehlen konnte. Das Blubbern hinter ihr war immer noch da, doch Hayley dachte sich nichts dabei – bis sie Schritte hörte. Sie wollte sich noch umdrehen, als sie plötzlich von hinten gepackt wurde. Instinktiv wollte sie schreien, doch da drückte ihr eine Hand mit einem schwarzen Lederhandschuh den Mund zu und erstickte ihren Schrei, bis nur noch ein schrilles Wimmern blieb.
Sie wollte um sich schlagen, doch sie konnte nicht. Da waren Arme, die sie unnachgiebig festhielten. Warum bloß startete der Selbstverteidigungskurs, zu dem sie sich angemeldet hatte, erst nächsten Monat?
Auf einmal erschien ein Mann vor ihr – zumindest vermutete sie, dass es ein Mann war, denn er trug eine schwarze Skimaske aus Wolle, so dass sie nur seine Augen erkennen konnte. Ihre Hände wurden auf ihren Rücken gezogen, an ihren Handgelenken spürte sie etwas, das sich wie Kabelbinder anfühlte. Das Plastik wurde festgezogen – sie war gefesselt.
Die Hand auf ihrem Mund lockerte sich und es gelang Hayley, einen markerschütternden Hilferuf auszustoßen, bevor der maskierte Mann ihr ein Stück Stoff in den Mund steckte und sie böse anstarrte.
„Sei still, Hayley.“
Ihr gefror das Blut in den Adern. Sie wussten, wer sie war?
„Schnell“, sagte der Mann hinter ihr. Sie wollten sie schon packen und zu dem weißen Van schleifen, dessen seitliche Tür offenstand, als sie ein vertrautes Motorengeräusch hörte.
Dad.
Reifen quietschten, dann ging die Alarmanlage des Challengers los und die Hupe ertönte in regelmäßigen Abständen. Hayley wusste kaum, wie ihr geschah, aber sie sah, dass sie den Van fast erreicht hatte. Sie wollte schreien, aber mit dem Stoff im Mund konnte sie nicht.
„Keinen Schritt ...“ begann der maskierte Mann, in dessen Hand ein Messer aufblitzte. Als Hayley den Kopf drehte, erkannte sie ihren Vater. Ohne zu zögern, trat er dem Maskierten das Messer aus der Hand und versetzte ihm einen gezielten Handkantenschlag gegen den Kehlkopf, so dass er röchelnd in die Knie ging. Hayley wimmerte ängstlich, dann sah sie, wie ihr Vater auf dem Boden nach etwas griff und sich wieder aufrichtete. In der Hand hielt er das Messer des Maskierten. Der Mann, der Hayley festhielt, wollte sie schützend vor sich drehen, doch da verpasste Matt ihm einen gezielten Hieb am Arm, so dass er vor Schmerz brüllend losließ. Hayley zögerte keine Sekunde, sondern entwand sich seinem Klammergriff und floh in Matts Richtung. Er fing sie in seinen Armen auf und schob sie mit dem linken Arm hinter sich, während der Maskierte sich hustend in den Van schleppte. Der andere Mann stand zögerlich mit erhobenen Händen da und überlegte, doch dann entschied er, die Flucht anzutreten, und riss die Beifahrertür des Vans auf.
Keuchend stand Matt vor seiner Tochter und beobachtete, wie der Van mit quietschenden, qualmenden Reifen losfuhr. Dabei streifte er vorne links die Stoßstange des Challengers, lenkte abrupt und raste davon. Mit einer Hand hielt Matt Hayley an der Jacke fest und wartete ab, bevor er sich zu ihr umdrehte und sie schützend in die Arme schloss. Der Challenger hupte noch immer.
„Ich bin hier“, sagte Matt. „Es ist alles okay, ich bin bei dir.“
Hayley schluchzte laut und schnappte befreit nach Luft, als Matt ihr den Stoff aus dem Mund zog und mit dem Messer des Mannes ihre Fesseln zerschnitt. Er hielt sie weiterhin mit einem Arm an sich gedrückt, während er sein Handy aus der Hosentasche zog, über die Sprachsteuerung den Notruf wählte und den Lautsprecher einschaltete.
„Notrufzentrale, was möchten Sie melden?“
Er holte tief Luft. „Mein Name ist Matt Whitman. Ich habe gerade die Entführung meiner Tochter verhindert.“
„Sie war mit ihren Freundinnen in der Mall. Ich wollte sie abholen, aber als ich auf den Parkplatz kam, haben zwei maskierte Männer versucht, sie in einen weißen Van zu zerren. Es ist mir irgendwie gelungen, sie in die Flucht zu schlagen, aber du kannst dir sicher vorstellen, wie uns der Schreck in den Knochen sitzt“, berichtete Matt am Telefon.
„Mir jetzt auch“, sagte Libby unverblümt, während sie sich aufs Bett setzte. Fragend musterte Owen sie, doch sie reagierte nicht.
„Wir haben keine Ahnung, wer das war. Ich habe zwar ihr Kennzeichen noch erkannt, aber es ist gestohlen.“
Libby spürte, wie ihr abwechselnd heiß und kalt wurde. „War das ein gezielter Angriff?“
„Hayley hat mir erzählt, dass einer der Männer sie mit ihrem Namen angesprochen hat, deshalb vermuten wir, dass es um sie persönlich ging. Im Moment fällt uns da nur die White Front ein.“
Libby nickte ernst, auch wenn Matt das nicht sehen konnte. „Das ist nicht gut. Dann ist sie immer noch in Gefahr.“
„Ich weiß. Im Augenblick haben wir einen Streifenwagen vor der Tür, aber wie hilfreich das ist, muss ich dir nicht erklären.“
„Wo ist Hayley jetzt? Wie geht es ihr?“
„Sie ist bei Sadie, die Polizei spricht noch mit ihr. Ich habe mich nur kurz abgeseilt, um dir Bescheid zu geben“, erklärte Matt. „Ich bin ehrlich – ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Wie kann ich meine Tochter beschützen?“
Libby holte tief Luft und blickte zu Owen, der sie noch immer fragend ansah. Dann hatte sie eine Idee.
„Ich stelle dich auf Lautsprecher, Matt“, sagte sie, bevor sie sich an Owen richtete. „Vorhin wäre Hayley beinahe entführt worden.“
Der Schock war Owen deutlich anzusehen. „Geht es ihr gut?“
„Den Umständen entsprechend“, schallte Matts Stimme aus dem Lautsprecher. „Hi, Owen.“
„Hi, Matt ... Was war denn da los?“
„Wir wissen es noch nicht, vermuten aber einen gezielten Angriff auf Hayley. Einer der Männer hat sie namentlich angesprochen. Wäre ich nicht im richtigen Moment gekommen ...“
„Ich habe eine Idee“, unterbrach Libby ihn. „Ist nächste Woche nicht Spring Break?“
„Ja ... warum fragst du?“, erwiderte Matt.
„Weil sie zu uns kommen könnte. Darauf kommt keiner. Sie wäre weit weg von der Gefahrenzone und die Polizei hätte genug Zeit, nach den Tätern zu suchen. Oder? Was meinst du, Owen?“
„Allein lassen würde ich sie hier aber auch nicht“, wandte er ein.
„Nein, natürlich nicht. Ich nehme mir frei. Mein Team hat gerade ohnehin keinen Fall.“
„Das würdet ihr tun?“, fragte Matt.
„Natürlich. Ich hatte ihr sowieso angeboten, zu uns zu kommen. Bei uns wäre sie sicher. Allein, weil wir hier in Virginia sind – aber ich wäre immer bei ihr und du weißt, dass ich eine Waffe habe.“
Matt ließ sich Zeit mit seiner Antwort. „Darüber muss ich gleich mit Sadie und Hayley sprechen.“
„Ist okay, tu das. Ich mache jetzt sowieso kein Auge zu ... Meld dich einfach wieder.“
„In Ordnung“, sagte Matt und verabschiedete sich. Nachdem Libby ihr Handy weggelegt hatte, erwiderte sie Owens Blick.
„Das würdest du tun?“, fragte er.
„Sicher. Nick hätte bestimmt nichts dagegen und ich habe immer noch genügend Überstunden, die ich dafür einsetzen könnte. Das wäre jetzt die einfachste Möglichkeit – und die sicherste. Aber du musst auch damit einverstanden sein.“
„Als würde ich was dagegen sagen.“
„Das geht dich auch was an.“
„Sicher, aber wenn da jemand versucht hat, deine Schwester zu entführen – das würde ich nicht einfach abtun. Die Erfahrung sagt uns doch, dass wir das ernst nehmen müssen.“
Der Meinung war Libby auch. „Sie ist erst zwölf. Ich weiß nicht, wer das war und was er beabsichtigt, aber ich kann das nicht zulassen. Das geht nicht.“ Sie schüttelte heftig den Kopf.
„Nein, und wir haben ja die Möglichkeit, zu helfen und sie zu beschützen. Sie soll ruhig kommen.“
„Danke“, sagte Libby und ging zu ihm, um ihn zu küssen. „Ich danke dir so sehr.“
„Was? Warum? Ist doch klar.“
„Bei uns kehrt einfach nie Ruhe ein.“
Nun lachte Owen. „Und wenn schon. Das wusste ich vorher.“
Libby beschloss, sich ins Bett zu legen und in ihrem Buch zu lesen, während sie auf eine Nachricht von ihrer Familie wartete, doch sie konnte sich nicht auf den Text konzentrieren und so surfte sie schließlich ziellos durchs Internet.
Man hatte versucht, Hayley zu entführen? Das war doch verrückt. Warum? Aber der White Front sah es ähnlich. Die hatten sich auch schon an Libby selbst vergreifen wollen, um Sadie zu erpressen. Warum nicht auch Hayley?
Es dauerte bis nach halb zwölf, als ihr Handy wieder klingelte. Diesmal war es Sadie.
„Hey ... es tut mir leid, dass wir euch so aufgemischt haben. Bei euch ist es doch schon mitten in der Nacht“, begann sie.
„Ist doch klar, ich meine – Hayley wäre fast entführt worden!“, entgegnete Libby.
„Ja, aber was kannst du hinten in Virginia jetzt schon ausrichten?“
„Im Augenblick nicht viel, aber hat Matt dir von meinem Vorschlag berichtet?“
„Hat er, und wir haben gerade mit Hayley darüber gesprochen. Sie würde es gern machen. Und es ist dir wirklich nicht zu viel?“
„Ach was, nein“, sagte Libby beschwichtigend. „Du weißt, wie das beim FBI ist. Man hat eigentlich immer genug Überstunden auf dem Konto. Dann mache ich jetzt eben eine Woche Frühlingsferien mit meiner kleinen Schwester und passe auf sie auf – und was in einer Woche ist, sehen wir dann.“
„Wir sind euch wirklich dankbar. Seit Matt mir von deinem Vorschlag berichtet hat, geht es mir besser.“
„Ihr solltet aber auch auf euch aufpassen, das ist euch doch klar, oder?“
„Natürlich, wobei Matt mir erzählt hat, dass er leichtes Spiel mit den Männern hatte. Er hat keine Sekunde gezögert, sie anzugreifen, und das hat sie sofort in die Flucht geschlagen. Vielleicht haben sie jetzt zumindest vor ihm Respekt.“
„Und du denkst, es war die White Front?“
„Wer soll es sonst gewesen sein? Da wollte jemand meine Tochter entführen. Matt sprach von drei Männern, jung, weiß. Hayley sagte, sie hätten keinen Akzent gehabt. Es sähe ihnen ähnlich, die Vorgehensweise passt.“
„Das habe ich mir auch schon gedacht“, stimmte Libby zu. „Trotzdem – es gibt viele, die jetzt noch eine Rechnung mit dir offen haben.“
„Ich weiß. Die Polizei ist dran. Sie werden schon herausfinden, wer es war.“
Daran hatte Libby keinen Zweifel. Gespannt hörte sie zu, wie Matt versuchte, einen Flug für Hayley zu buchen. Mit zwölf war sie alt genug, um das allein zu schaffen, zumal die Flugbegleiter sich um sie kümmern würden.
„Der erste Nonstop-Flug, der noch Restplätze hat, geht Sonntag Morgen um kurz vor neun und landet bei euch nachmittags um kurz vor fünf in Dulles“, sagte Matt schließlich. „Morgen ist alles schon dicht, zumindest bei den Nonstop-Flügen. Aber wenn Hayley allein fliegt, will ich ihr keinen Flug zumuten, bei dem sie umsteigen muss.“
„Ist doch okay“, sagte Libby. „Buch ihr ein Ticket, wir holen sie auch in Dulles. Nur dumm, dass der Flug erst am Sonntag ist. Geht keiner zum Ronald Reagan Airport?“
„Kein Nonstop-Flug“, sagte Matt. Sie einigten sich darauf, dass Matt Hayley den Flug buchte, und Libby schrieb sich alle Daten auf. Matt und Sadie diskutierten auch darüber, sie nach Virginia zu begleiten, aber Sadie hatte einiges für den Start des neuen Semesters vorzubereiten und Matt hatte Aufträge in der Folgewoche, die er nicht absagen konnte oder wollte.
„Gebt mir doch mal Hayley“, bat Libby schließlich und Sadie reichte ihr Handy an ihre Tochter weiter.
„Hi“, sagte Hayley leise. Sie klang etwas mutlos und müde.
„Hey, Kleines ... du machst ja vielleicht Sachen. Wie geht es dir? Alles okay?“, fragte Libby.
„Ja, schon ... es ist ja nichts passiert. Dad war ja da ...“
„Dad ist der Beste, oder?“, sagte Libby und lachte. „Es tut mir leid, dass das passiert ist. Ich freue mich aber darüber, dass du herkommst. Ich nehme mir ganz viel Zeit für dich, das hatte ich dir ja sowieso versprochen. Dann unternehmen wir was und du kannst mir auch davon erzählen, wenn du willst.“
„Ja, okay ... Ich bin froh, wenn ich am Sonntag bei dir bin. Als die mich gepackt und gefesselt haben, hätte ich mir fast vor Angst in die Hose gemacht ...“
„Das glaube ich dir.“
„Aber dann kam Dad. Ich bin so froh, dass er da war ... er hatte ja nicht mal eine Waffe, aber die hatten echt Respekt vor ihm und sind einfach abgehauen.“
Libby lächelte. „Vor Dad kann man auch Respekt haben.“
„Ja, das stimmt. Er hat nicht eine Sekunde gezögert.“
„Natürlich nicht. Du bist seine Tochter. Du weißt ja, was man über Väter und ihre Töchter sagt.“
„Was denn?“, fragte Hayley.
„Du bist seine Prinzessin. Er würde seinen rechten Arm für dich geben, das weißt du.“
Sie konnte hören, dass Hayley schmunzelte. „Du hättest ihn sehen sollen. Ich kann mir vorstellen, wie er als FBI-Agent war. Er hat die Männer ganz allein in die Flucht geschlagen.“
„Ja, das kann er. Er passt immer auf dich auf.“
„Ich weiß. Ich freue mich auf euch, weißt du das?“
„Ich freue mich auch auf dich. Das wird schön. Wir machen uns eine tolle Zeit“, versprach Libby.
Hayley klang nun sehr zuversichtlich, was auch Libby positiv stimmte. Als sie das Gespräch beendeten, hatte Libby das Gefühl, Hayley ein wenig beruhigt zu haben – für sich selbst konnte sie das jedoch nicht feststellen. Wer würde ihre zwölfjährige Schwester entführen?
„Mit Bowman kann das nichts zu tun haben, oder?“, überlegte Owen.
„Mit Bowman? Der Fall ist doch abgeschlossen“, erwiderte Libby.
„Ich überlege bloß. Warum hat jemand es auf deine kleine Schwester abgesehen?“
Genau das fragte Libby sich auch.
Samstag, 18. März
Libby hatte Ewigkeiten gebraucht, bis sie endlich eingeschlafen war. Sie hatte immerzu an Hayley gedacht – daran, wie es ihr ging und wer es wohl war, der es auf sie abgesehen hatte. Was sollte das?
Drei junge, weiße Männer. Matt hatte es allein geschafft, sie in die Flucht zu schlagen. Libby kannte den genauen Ablauf zwar nicht, aber es klang auch so danach, als wären keine Profis am Werk gewesen.
Sie versuchte, sich an die White Front zu erinnern. Sie war damals neunzehn gewesen und gerade im zweiten Jahr an der Uni. Was auch immer diese Terroristen seinerzeit angefangen hatten – es hatte besser funktioniert. Sie hatten koordiniert auf der San Francisco Pride Parade zugeschlagen und wüst um sich geschossen. Damit waren sie ziemlich weit gekommen, ehe die Einsatzkräfte sie gestoppt hatten.
Und auch die Geiselnahme an der Uni hatte gut geklappt. Sie waren zwar impulsiv vorgegangen, aber nicht so stümperhaft wie am Vorabend.
Das passte nicht, das hatte sie im Gefühl. Aber wer würde sonst versuchen, Hayley Whitman zu kidnappen?
Dabei gab es Libby zu denken, dass es offenbar um Hayley persönlich gegangen war und nicht darum, dass sie ein zwölfjähriges Mädchen war. Es gab die Männer, die in mafiösen Strukturen organisiert werden und junge Amerikanerinnen auf offener Straße entführten, um sie in Mädchenhändlerringe einzuschleusen; in einem solchen Fall hatte sie selbst ermittelt. Aber so etwas sah sie hier auch nicht.
Als Oreo maunzend vor dem Bett herumstrich, stand Libby auf und ging in die Küche, um die Katze zu füttern. Die ganze Zeit über war sie weiterhin in Gedanken.
Wer versuchte, Hayley Whitman zu entführen?
In Gedanken spielte sie durch, ob Sheriff Bowman in Frage kam. Der hatte seine Strafe doch längst bekommen. Das konnte jetzt nichts als Nachtreten sein, aber passte das zu ihm?
Die White Front hatte damals versucht, Libby in ihre Gewalt zu bringen, um Sadie zu erpressen. Konnte es das sein? Sie entführten Hayley, um Sadie dazu zu bringen, für Ricky Purcell auszusagen. Sah eigentlich nach ihrer Handschrift aus. Vielleicht gab es bei der White Front inzwischen neue Mitglieder, unerfahren und jung, die man jetzt auf Hayley angesetzt hatte?
Während sie unter der Dusche stand, überlegte Libby fieberhaft. Sadie war jetzt schon seit zehn Jahren keine FBI-Agentin mehr. Bei wem hatte sie sich damals unbeliebt gemacht, der sich nun an ihr rächen wollte?
Libby hatte viele von Sadies Fällen gar nicht miterlebt. Allerdings wäre es nicht das erste Mal gewesen, dass jemand sich an ihr rächen wollte. Als Tyler Evans und Brian Leigh es versucht hatten, war Libby mit ins Kreuzfeuer geraten.
Sie stand noch in der Dusche, als die Tür geöffnet wurde und Owen ins Bad kam. „Guten Morgen“, sagte er und Libby grinste in seine Richtung.
„Guten Morgen.“
„Du bist immer so eine Frühaufsteherin.“
„Tut mir leid. In Gedanken bin ich bei meiner Schwester. Ich denke darüber nach, wer sie entführen wollte und warum.“
„Und? Erkenntnisse?“
Libby stellte die Dusche ab und griff nach ihrem Handtuch. „Leider nicht. Es würde schon auf die White Front passen. Das ist das Wahrscheinlichste, was mir einfällt.“
„Vielleicht geht es ja auch gar nicht um Sadie, sondern um Matt.“ Skeptisch begutachtete Owen sich im Spiegel und griff nach seinem Rasierer.
„Hm“, machte Libby, während sie sich ins Handtuch hüllte. Sie griff nach einem zweiten, das sie um ihren Kopf schlang. „Es gab jemanden, mit dem Matt damals im Gefängnis große Probleme hatte. Ein Drogenboss, dem er Jahre zuvor selbst Handschellen angelegt hat. Der hätte ihn fast umgebracht. Das war sein three strikes – dadurch sitzt er jetzt lebenslänglich.“
„Wo?“, fragte Owen.
„In Chino. Hochsicherheit, vermute ich. Keine Ahnung.“
„Hältst du das denn für wahrscheinlich?“
Libby holte tief Luft und überlegte. „Er hat Matt damals vier Monate lang schikaniert. Du kannst dir vorstellen, was da los war – ein FBI-Agent im Gefängnis. Matt hat nie viel davon erzählt, aber man konnte es ihm manchmal ansehen. Zum Ende hin, als seine Verhandlung schon lief, hat Baker immer wieder dafür gesorgt, dass man ihn zusammengeschlagen hat und solche Dinge. Am Tag seiner Urteilsverkündung kam Matt von der Krankenstation. Er sah richtig übel aus.“
„Puh“, machte Owen. „Ihr habt alle noch nie sehr viel von dieser Zeit erzählt.“
„Nein, das war die Hölle für uns alle. Sadie hatte große finanzielle Probleme – das weiß ich, auch wenn sie nie darüber gesprochen hat. Matts Verdienst fiel weg, obwohl sie immer damit kalkuliert hatten, und noch dazu musste sie immense Anwaltskosten stemmen. Bis rauskam, dass er sich den Mord nur eingebildet hatte, hatten wir befürchtet, dass er fünfzehn Jahre absitzen muss. Er hätte verpasst, wie Hayley aufwächst.“
Owen schluckte. „Meine Güte ...“
„Es war furchtbar. Ich habe die ganze Zeit damit gehadert, dass es meine Mail war, die die Polizisten schließlich gegen ihn verwendet haben, um ihm ein Geständnis abzuringen. Dafür schäme ich mich bis heute.“
„Sie waren dir aber nie böse, oder?“
Libby schüttelte den Kopf. „Nein, und das hat mich auch fertiggemacht. Ich war dumm und naiv und das hat meinem Dad vier Monate Gefängnis und meiner ganzen Familie einen immensen finanziellen Verlust eingebrockt.