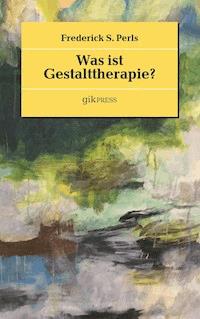
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gestalttherapie an ihren Wurzeln. Einfach und kraftvoll. Immer im Hier und Jetzt. Erlebnis- und erfahrungsbezogen. Denn das, was in der Psychotherapie heilend wirkt, sind neue Erfahrungen und nicht einfach neue Erklärungen. Dieses Buch ist ein wichtiges historisches Dokument. Zum großen Teil erscheinen die hier veröffentlichten Texte von Fritz Perls, dem weltberühmten Mitbegründer der Gestalttherapie, zum ersten Mal in Schriftform: Vorträge, Demonstrationen, ein wirklich außergewöhnliches Interview sowie schließlich seine autobiografischen Stichworte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foto: Ende der 1960er Jahre
Dr. Frederick S. Perls, genannt: Fritz (1893-1971), begründete gemeinsam mit seiner Frau Laura und dem amerikanischen Sozialphilosophen und Schriftsteller Paul Goodman die Gestalttherapie.
Dieses Buch ist ein wichtiges historisches Dokument. Größten Teils erscheinen die hier veröffentlichten Texte von Fritz Perls zum ersten Mal in Schriftform: Vorträge, Demonstrationen, ein außergewöhnliches Interview sowie schließlich seine »autobiografischen Stichworte«.
In der gikPRESS ist bereits folgender Klassiker zur Geschichte der Gestalttherapie erschienen: »Meine Wildnis ist die Seele des Anderen: Der Weg zur Gestalttherapie. Laura Perls im Gespräch mit Daniel Rosenblatt u. a.« (2018). Die Veröffentlichung eines weiteren Buches zu diesem Bereich ist in Vorbereitung: »Erzählte Geschichte der Gestalttherapie: Gespräche mit Gestalttherapeutinnen und Gestalttherapeuten der ersten Stunde«.
therapeutenadressen service
Praxisadressen von Gestalttherapeutinnen und -therapeuten. Infos siehe letzte Buchseite
Inhalt
Schätze vom Vater der Gestalttherapie: Zur Einführung
Erhard Doubrawa
Was ist Gestalttherapie?
Ein außergewöhnliches Interview mit Adelaide Bry,
Ende der 1960er Jahre
Vorträge und Demonstrationen, 1968-1969
»Unsere Aufgabe besteht darin, echte Kommunikation zu ermöglichen« (Band I)
»Die volle Verantwortung für sein Leben übernehmen« (Band II)
»Veränderung findet statt, sobald die Dinge ihren Platz bekommen« (Band III).
»…dass wir uns dem Offensichtlichen, der Oberfläche zuwenden« (Band IV).
Traumarbeiten 1 (Band V)
Traumarbeiten 2 (Band VI)
»Das Paradox der Veränderung« (Band VII)
»Fritz als Puppe zum Mitnehmen« (Band VIII)
Autobiografische Stichworte
Mitte der 1960er Jahre
Frederick S. Perls’ Werkleben
Stefan Blankertz und Erhard Doubrawa.
Und … was ist nun eigentlich Gestalttherapie?
Stefan Blankertz und Erhard Doubrawa.
Anmerkungen.
Literaturempfehlungen
Leseprobe aus:
Laura Perls,
Meine Wildnis ist die Seele des Anderen:
Der Weg zur Gestalttherapie
Zur Künstlerin des Covers
Georgia von Schlieffen
Georgia von Schlieffen, geb. 1968. »Seit meiner Studienzeit intensive Beschäftigung mit der Malerei. Jedoch ging ich erst einmal ganz andere Wege über ein Studium der Vergleichenden Religionswissenschaft und der Internationalen Beziehungen und einer mehrjährigen Tätigkeit im Bereich Projektmanagement und Flüchtlingsarbeit für mehrere Nichtregierungsorganisationen. 2010 nahm ich an Studienwochen bei Markus Lüpertz und Gotthard Graubner an der Reichenhaller Akademie teil. Ab 2011 studierte ich Malerei bei Professor Jerry Zeniuk, Akademie für Farbmalerei, Kunstakademie Bad Reichenhall, und derzeit bei Heribert C. Ottersbach.«
Georgia von Schlieffen illustrierte zwei Lyrik-Bände von Stefan Blankertz, »Ambrosius: Callinische Hymnen« und »Ruan Ji: Zustandsbeschreibungen« sowie den Gedichtband »kleine gebete« von Paul Goodman, der in der gikPRESS erschienen ist.
Bitte besuchen Sie die Seite der Künstlerin auf theartstack.com oder verbinden Sie sich auf linkedin.com mit ihr.
Schätze vom Vater der Gestaltterape: Zur Einführung
Erhard Doubrawa
Zu diesem Buch
Welche Schätze sie vor sich haben, mag den heutigen Leserinnen und Lesern vielleicht nicht unmittelbar bewusst sein. Die Art von Fritz Perls, dem Mitbegründer der Gestalttherapie, ein Interview in eine Therapiesitzung (bzw. eine Demonstration der Gestalttherapie) zu verwandeln, war vor 45 Jahren revolutionär. Vielfach kopiert. Dies ist das Original! Kreativ. Witzig. Völlig unerwartet. Außergewöhnlich. Eben so, wie es der Vater der Gestalttherapie war.
Genauso die »Autobiografischen Stichworte«. Unvorstellbar vor mehr als 30 Jahren. So schreibt doch kein Begründer einer ernst zu nehmenden therapeutischen Schule (wenn er vom etablierten Fachpublikum anerkannt werden will)!
Und er macht es doch. Siebzigjährig. Trägt nun einen Kaftan. Karierte Hemden. Gerne auch Overalls direkt über seinem Pyjama. Einen langen weißen Vollbart. Lächelt wieder. Nach seinem Aufenthalt in Kyoto in Japan und in einem Künstler-Kibbuz in Israel. Nach überwundener Krankheit.
Bei der Überwindung der Krankheit hat ihm Ida Rolf geholfen: Fritz Perls litt lange an sehr starken Angina-pectoris-Schmerzen. Zum ersten Mal denkt er daran, sein Leben zu beenden. Er ist unwirsch und ungehalten. Der Kontakt mit ihm ist keine Freude. Ida Rolf, die ebenfalls im Esalen-Institut in Big Sur/Kalifornien praktiziert, behandelt ihn mit ihrer »Strukturellen Integration«, heute nach der Begründerin Rolfing genannt. Fritz ist nach der Behandlung nicht nur von seinen Herzproblemen befreit. Ruth Cohn, die Begründerin von der »Themenzentrierten Interaktion« und frühe Schülerin von Fritz Perls, nimmt ihn als Verwandelten wahr: »Nun strahlt Fritz Weisheit, Lebensmut, Zärtlichkeit aus«.1 Mit den Worten von Staemmler und Bock: »Aus einem resignierten und verbitterten Zyniker wird ein liebevoller, zärtlicher, weiser alter Mann.«2 Fritz ist durch seinen persönlichen Engpass gegangen. Nun ist er selbst in der Lage, seine Klienten durch deren Engpass zu führen.
Das vorliegende Buch ist ein wichtiges historisches Dokument der Gestalttherapie. Zum großen Teil erscheinen die hier veröffentlichten Vorträge und Demonstrationen aus Esalen zum ersten Mal in Schriftform. Und vor allem auch vollständig.
Aus der Zeit in Esalen ist u.a. schon eine andere Publikation hervorgegangen: »Gestalttherapie in Aktion«.3 Übrigens war das das erste Gestalttherapie-Buch auf dem deutschsprachigen Buchmarkt. John O. Stevens hatte – unter Mithilfe seiner Mutter Barry Stevens – Fritz’ Vorträge und Demonstrationen von 1966 -1968 in Esalen zusammengestellt und in seinem Verlag »Real People Press« herausgegeben. Joe Wysong vom amerikanischen Gestalt Journal beschrieb es in seinem Vorwort zu der amerikanischen Neuauflage von »Gestalttherapie in Aktion« 1992 auf folgende Art:
»Es wurde deutlich, dass Stevens viele herausgeberische Entscheidungen gefällt hat bezüglich dessen, was in das Buch aufgenommen werden sollte und was nicht. Und so ist das Endprodukt entschieden genauso viel Stevens’ Sicht der Gestalttherapie, wie es Fritz Perls’ Sicht ist. Dies gilt insbesondere dafür, welches Material in die Vortragsteile und in die Frage-und-Antwort-Teile des Buches aufgenommen wurden.«4
Ein kleinerer Teil des vorliegenden Buches ist bereits in »Gestalttherapie in Aktion« veröffentlicht worden. Verstreut über den Theorieteil des Buches finden sich Anklänge (manches Mal auch Zitate) aus den dokumentierten Tonbändern. Ich habe darauf verzichtet, diese hervorzuheben. Drei der Demonstrationen sind dort erschienen. Sie sind gekennzeichnet, wurden jedoch neu übersetzt.
Meine Bänder sind ein Teil der Quellen von Stevens’ Arbeit. Ich dokumentiere die mir vorliegenden Bänder so weit wie möglich unbearbeitet. So wird deutlich, wie Fritz demonstrierte und lehrte: Minilektionen und Einzelarbeiten vor der Gruppe. Immer wieder im Wechsel. Mal mit einer längeren Einleitung am Beginn der Workshop-Einheit. Mal beantwortet er Fragen danach.
Stevens hat aus dem hier vorliegenden Tonband-Material nur bestimmte Arbeiten für sein Buchprojekt ausgewählt – die »gelungensten« Arbeiten. Die, bei denen am Ende eine Abrundung erfolgte. Und nicht die Arbeiten, die er abbrach (manchmal nach Sekunden oder Minuten), die nicht am Ende »rund« wurden, oder solche, wo das Tonband mittendrin zu Ende ging.
Was am Ende nicht »rund« wird – das sind in der alltäglichen therapeutischen Praxis wahrscheinlich die meisten. Das ist auch in Ordnung so. Denn das, was in der Gestalttherapie heilend wirkt, ist nicht nur die Abrundung der Arbeit. Oft geschieht die Abrundung erst mehr oder weniger lange Zeit nach der Therapiesitzung.
Heilsam wirken allein schon Prozess und Methode der Gestalttherapie. In den hier dokumentierten Arbeiten sind es vor allem das Gewahrsein für das Hier und Jetzt und die Identifikation mit abgespalteten Trauminhalten. Allein dies wirkt schon fruchtbar. Verändert die Haltung sich und den anderen gegenüber. Ermöglicht neue Erfahrungen mit projizierten, weil unangenehmen Gefühlen, z. B. der eigenen Aggression. In der Tat identifizieren die meisten von uns sich lieber mit dem Opfer als mit dem Täter. Doch damit geben wir häufig auch unsere Macht auf. Fritz jedoch bringt die Teilnehmer wieder mit diesem Teil von sich in Berührung: mit dem wilden Tier in uns, mit dem gewalttätigen, prügelnden Polizisten, etc.
So gibt es also noch einen weiteren Grund, diese Quellentexte zu veröffentlichen: Sie machen uns Therapeuten Mut. Arbeiten müssen am Ende nicht immer rund werden. Sogar bei Fritz war das so.
Schließlich noch diese Anmerkung: Meine vorliegende Veröffentlichung basiert auf acht Tonbändern, die in Esalen Ende der 1960 er Jahre aufgezeichnet wurden. Darüber hinaus lag mir ein englisches Transkript vor, das ich von Joe Wysong erhalten hatte. Bei der redaktionellen Arbeit an diesem Buch machte ich des öfteren eine interessante Feststellung: Das englische Transkript wies z. T. erhebliche Mängel auf. Häufig stimmten Worte nicht mit den Bändern überein. Manchmal wurden ganze Sätze nicht transkribiert – dort fand sich dann die Bemerkung »unverständlich«. Für mich waren diese Sätze häufig gut verständlich – eventuell hängt das damit zusammen, dass Fritz Perls ein recht »deutsches« Englisch sprach. Sollte dies wirklich so sein, wäre es interessant, auch seine anderen Bücher, die auf Transkripten von Vorträgen, Sitzungen etc. beruhen, daraufhin mit evtl. noch vorliegenden Originaltonbändern abzugleichen.5
Zeit und Ort der Entstehung dieses Buches
Mitte der 1960 er Jahre. Esalen – ein kleiner grüner Landstreifen an der fantastischen Pazifik-Steilküste Kaliforniens bei Big Sur, etwa 300 km südlich von San Francisco. Das Zentrum der Human-Potenzial-Bewegung, der therapeutisch-spirituell-politischen Aufbruchbewegung junger Amerikaner in den 1960 er Jahren. Vormals ein alter Kultplatz der Indianer, der »Esalen Indians«, die diesem Platz den Namen gaben. Heiße Quellen. Ein heiliger, ein heilender Ort. Dazu ein O-Ton aus einem zeitgenössischen Artikel von Karin Rese:
»Esalen – […] ein Misthaufen, zwei Beete mit Löwenmäulchen und Kartoffeln; drei Dutzend Holzhäuschen für zahlende Gäste; Wohnwagen und VW-Busse, umlagert von flötespielenden, Säuglinge nährenden und perlenzählenden Hippies; heiße Schwefelquellen, französische Weine, nackte Leiber, nackte Seelen – Wut, Wonne und Tränen, vierundzwanzig Stunden am Tag, von der Unternehmensleitung gefördert, je heftiger, desto besser.
Esalen […] ist eine Art Sanatorium für zivilisationsgeschädigte Seelen. Ziel ist hier allerdings nicht Anpassung, sondern mehr Aufsässigkeit, nicht die Aussöhnung mit dem Feind, sondern die möglichst krasse Konfrontation mit ihm. […]
Seit Michael Murphy dieses Institut vor zehn Jahren gründete und es sich sehr rasch zum Zentrum einer neuen Strömung innerhalb der amerikanischen Psychologie, nämlich dem so genannten Human Potenzial Movement entwickelte, hat Esalen Tausende von Wochenend-, Fünftage- und Dauergästen zu Seelenbad, Bewusstseinserweiterung und Sinnenpflege empfangen, hat ungezählte Ehen geheilt oder gesprengt, Priester zu Sündern gemacht, Studenten zu Handwerkern, Handwerker zu Gurus, Hausmütterchen zu Hippies und Hexen.
Esalen betreibt Bewusstseinserweiterung im Hier und Jetzt. Im Prozess der Erweiterung, sagen seine Gurus, verschwindet die Neurose. […]
Es geht dabei nicht um Wissen, sondern um Erfahrung, und die Erfahrungen werden in Form von Arbeitskreisen [heute würden wir das neudeutsche Wort ›Workshops‹ verwenden, E. D.] gemacht, an denen unter der Führung eines Gruppenleiters jeweils zehn bis dreißig Personen teilnehmen. […]
Das Encounter übersetzt in Aktion, was der Zen-Meister durch die so genannten Koans, d.h. paradoxe Fragen wie: ›Ehe es deine Eltern gab, wer bist du?‹, unternimmt. Das Ziel ist das gleiche: den Schüler oder ›Patienten‹ zum Durchbruch alter Denk- und Verhaltensgewohnheiten zu provozieren. […] Das Durchpusten der verstopften Ventile – die Encounter- oder Gestalttherapiesitzungen mit ihren mindblowing experiences – geht selten ohne Schmerzen ab, aber Esalen geizt nicht mit Belohnungen. Der psychischen Zerreißprobe folgt physische Labsal:
in den zwischen Himmel und Meer in die steilen Felswände geschlagenen Bädern […]bei der Super-Antörn-Massage Esalen-Spezial […]im Swimmingpool […]Erholung, Behagen oder seliges Vergessen – je nachdem – bieten ferner die Tafelfreuden; die vorzüglichen Weine, die Abende, an denen die madonnenhaften Saaltöchter ihr Haar herunterlassen und sich beim dumpfen Geklopfe der Bongotrommeln in kreiselnde, wirbelnde, zuckende, zischende Urwaldhexen verwandeln.Alle Türen stehen offen, alle Lichter sind gelöscht, auf dem Rasen tanzt der Irrsinn, zwei Lagerfeuer, viele Menschen, auch die Einsiedler aus den Bergen sind gekommen, und dazwischen ein paar Heilige oder ein Normaler.«6
Fritz Perls und die Gestalttherapie
Hier also lebte und arbeitete Fritz Perls, der Mitbegründer der Gestalttherapie, mit Unterbrechungen von 1963 bis 1969. Er gab Workshops, leitete Gruppen. Demonstrationen der Gestalttherapie, vor allem der Gestalt-Traumarbeit. Davor und dazwischen Minilektionen: Gestalttherapie an ihren Wurzeln. Einfach und kraftvoll. Immer im Hier und Jetzt. Erlebnis- und erfahrungsbe zogen. Denn das, was in der Therapie heilend wirkt, sind neue Erfahrungen und nicht verbale Erklärungen.
Gestalttherapie wurde von den deutschen Psychoanalytikern Fritz und Lore Perls entwickelt. Zuerst in den 1930 er und 1940 er Jahren im Exil in Südafrika. Dann – ab Ende der 1940 er Jahre – in den USA gemeinsam mit dem amerikanischen Sozialphilosophen und Schriftsteller Paul Goodman, dem späteren Mitbegründer der amerikanischen Schüler- und Studentenbewegung.7
Zum eigentlichen Durchbruch führte Fritz Perls die Gestalttherapie in den 1960er Jahren hier in Esalen, dem kalifornischen Mekka der Human-Potenzial-Bewegung. Reese beschreibt ihn Ende der 1960 er Jahre so: »Ein Meister der psychischen Entschlackung ist Esalens Gestalttherapist Fritz Perls. Mehr Zen-Meister als Psychotherapeut, sitzt er in einem halbkreisförmigen Raum vor der Wand und vermittelt Mini-Satoris. Ein Mini-Satori ist eine ›Aha-Erfahrung‹ oder plötzliche Einsicht. Hat man eine derartige Einsicht, sagt Perls, dann ›ist die Welt plötzlich da – dreidimensional und leuchtend‹.«8
Fritz Perls arbeitet dabei schlicht phänomenologisch. Er interpretiert nicht, zumindest wenig. Er lädt die Teilnehmer ein, sich mit abgespaltenen Persönlichkeitsteilen zu identifizieren – mit dem Ziel, diese wieder zu integrieren. Er arbeitet in kleinen Schritten. Und betont, dass dies keine »ganzen« Therapien seien, sondern nur Demonstrationen. Auch wenn die so gemachten Erfahrungen verändernd auf das ganze Leben einwirken können.
Ich bin überrascht. So, genau so, hat auch seine Frau Lore Perls mit uns Trainees der Gestalttherapie in den 1980er Jahren gearbeitet. Schlicht und in kleinen Schritten. Phänomenologisch. Im Hier und Jetzt.
Fritz Perls’ Demonstrationen hatte ich aus Transkripten und Filmausschnitten ganz anders in Erinnerung. Konfrontativer. Aggressiver. Ruppiger. Dominanter. Dass er so sehr ähnlich wie seine Frau arbeitet, erstaunt zuerst. Dann auch wieder nicht. Sie sind schließlich Mutter und Vater der Gestalttherapie. Und ich nehme hier vielleicht das wahr, was die beiden verbindet.
Wohl verändert der »späte« Fritz Perls in seiner Arbeit den mit Lore Perls und Paul Goodman entwickelten Ansatz: Sie spricht davon, dass jene Menschen »die Psychotherapie brauchen und wollen», die »stecken geblieben sind in ihrer Angst, ihrer Unzufriedenheit, ihren schief gegangenen persönlichen Beziehungen, ihrem Unglücksgefühl«.9
Er geht davon aus, dass Menschen Teile ihrer Persönlichkeit – aufgrund gesellschaftlicher Zwänge – abgespalten haben. Und dass seine Arbeit zur Integration des Abgespaltenen beitragen soll. Darin ist er den anderen in Esalen verbreiteten Therapierichtungen verbunden, »die ausnahmslos auf eine Steigerung der Erlebnisfähigkeit und damit auf eine Wiederherstellung der unter dem Druck der gesellschaftlichen Zwänge zersplitterten Identität abzielen«.10
Hier scheint auch die politische Dimension der Gestalttherapie durch. Noch einmal mit Reeses Worten: »Glaube kann Berge versetzen, und das richtige Bewusstsein genügt, um ein ganzes Pentagon zerfließen zu lassen wie die Uhr von Dali.«11
Und hier schließt sich wieder der Kreis bei den beiden Perls. Auch Lore Perls versteht ihre Arbeit als eine politische. Bei einem Werkstattgespräch im GIK Gestalt-Institut Köln/Bildungswerkstatt 1988 formulierte sie es folgendermaßen:
»Ich denke, wenn man den Menschen dabei unterstützt, authentischer zu werden – in Gesellschaften, die mehr oder weniger autoritär oder autoritätsorientiert sind, ist das immer politische Arbeit, in der Therapie, in der Erziehung, in der Sozialarbeit.«12
Konsequent wird die Gestalttherapie von Theodore Roszak in den 1960 er Jahren zu den »Bausteinen« einer Gegenkultur gezählt. Er skizziert Ansatz und Praxis der Gestalttherapie so:
»Für die Gestaltisten setzt die soziale Neurose erst in dem Augenblick ein, da das nahtlose Gewand des ›Organismus-/ Umgebung-Feldes‹ durch einen psychischen Bruch zerrissen wird. Von der ursprünglichen ökologischen Ganzheit wird infolge eines solchen Bruchs eine Einheit defensiven Bewusstseins abgespalten, das einer fortan als fremd, sperrig und feindlich verstandenen ›äußeren‹ Realität entgegengestellt werden muss.
Das Symptom eines derartigen Vertrauensverlustes in autonome Prozesse ist die Konstruktion eines entfremdeten Selbst, das sich von der ›Außenwelt‹ furchtsam zurückzieht und immer kleiner wird, bis es – einem im eigenen Schädel belagerten Homunkulus gleich – darauf reduziert ist, den Körper zu manipulieren, als sei er eine ungeschlachte Maschine, und in fieberhafter Angst immer neue Abwehr- und Angriffsstrategien zu entwerfen. Statt spontaner Anpassung, dem ›freien Zusammenspiel der Kräfte‹ – wie Goodman diese Anpassung nennt – haben wir an diesem Punkt ein zwanghaftes Misstrauen und den aggressiven Drang, all das zu reglementieren. […]
Am Ende fragen wir uns, wie das Leben überhaupt weiterbestehen konnte, ehe das zivilisierte Gehirn sich zum Superkontrolleur aufschwang. Doch finden wir keine Antwort, da die ursprüngliche ›Weisheit des Körpers‹ uns gründlich abhanden gekommen ist. Wir haben die Verbindung mit der Selbstregulation eines symbiotischen Systems verloren, um einem zwanghaften Kontrollbedürfnis zu verfallen, unter dessen Druck der Organismus gefriert und unsäglich dumm zu werden scheint.
Ein wesentlicher Bestandteil der Gestalttherapie ist demgemäß eine raffinierte Form gesteuerter physischer Aktivität, die darauf abzielt, gefrorene organische Energie zu orten und aufzutauen.«13
Fritz Perls und die Weiterentwicklung der Gestalttherapie
Auch hier erweiterte Fritz Perls die bis dahin entwickelte Gestalttherapie: Er spricht – im Anschluss an Friedlaender – von Schichten der Neurose und davon, wie er sich mit den Klienten durch die Schichten »hindurcharbeitet«. Diese Schichten der Neurose haben übrigens auffällige Parallelen in spirituellen Traditionen – im Zen-Buddhismus und auch in der christlichen Mystik.14
Dies steht (mir ist es wichtig, dies hervorzuheben!) im Gegensatz zum häufig gemachten Vorwurf, Fritz Perls habe mit der Theoriefeindlichkeit seiner »kalifornischen Jahre« die »wahre Gestalttherapie verraten«.
Claudio Naranjo – Schüler und naher Kollege von Fritz Perls – sieht dessen Zeit in Esalen sogar als seine eigentliche Reifezeit an:
»Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Talent und Genie. Genie ist nicht lediglich ein Potenzial, noch besteht es in nützlichen Fertigkeiten, sondern es hat vielmehr mit einem tief greifenden Kontakt der Person mit dem Kern des Wesens zu tun. Die Größe, die all diejenigen, die Fritz Perls kannten, in der zweiten Phase seines Lebens in ihm spürten, war, glaube ich, der Ausdruck einer Reife und nicht etwas, das in der ersten Phase seines Lebens offensichtlich gewesen wäre, so groß sein Talent auch gewesen sein mag. […] Doch es war nicht nur die Blüte von Fritz Perls’ Genie, die der erstaunlichen ›Gestaltexplosion‹ Mitte der 1960 er Jahre zugrundelag. Ein weiterer Faktor dabei war Esalen selbst oder der Beginn des ›Phänomens Kalifornien‹ ganz allgemein. Es gab eine glückliche synergetische Fügung zwischen der Ankunft Perls’ in Kalifornien und den bedeutsamen Inhalten, die er zu bieten hatte, sowie der bemerkenswerten Gemeinschaft dieses Ortes.«15
Schon früh hatte es sich eingebürgert, schlecht über den Vater der Gestalttherapie zu sprechen. Fritz, der »Rastlose« hieß es, »verließ seine Familie, um herumzustreunen«. Das hört sich heute so an, wie immer über Väter gesprochen wurde. Sie waren nie da. Natürlich nicht. Sie waren schließlich weg zur Arbeit. Und wirklich – um Brot für die Familie heranzuschaffen. Der Erfolg zahlte sich auch für letzere aus. Auch Fritz war nun gerade nicht untätig beim »Herumstreunen«. Er gründete Gestalt-Institute. Er lehrte. Er machte Gestalttherapie weltbekannt. Alle, auch Lore Perls und Paul Goodman, haben davon profitiert.
Und Lore? Sie warnt vor »Fehlbegriffen der Gestalttherapie«.16 Entstanden durch Fritz’ Art, der Demonstrations-Workshops vor allem in Esalen. Unverständlich, wo er es doch war, der die Gestalttherapie berühmt gemacht hat.
Aber wie überraschend: Lores Warnung vor »Fehlbegriffen der Gestalttherapie« von 1978 deckt sich in weiten Zügen erstaunlich mit Fritz’ Warnungen davor, z. B. schon 1969 in der Einleitung von »Gestalttherapie in Aktion«.17
Das, was Lore Perls hier für die Gestalttherapie fordert, nämlich gut durchgearbeitete Therapeuten, die mehr sind als Sozialtechniker, hat Fritz dort ebenfalls als Bedingung formuliert. Ebenso verhält es sich bezüglich der Distanzierung von »Wunderheilern« und »plötzlichen Durchbrüchen«. Die waren auch Fritz suspekt.
»Wachstum« ist für ihn »ein Prozess, der Zeit braucht. Gestalttherapie erfordert eine Haltung, die nicht in zwei Monaten erworben wird, sondern durch ein langes, ernstes Training, in dessen Zentrum die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit steht«.18
Übereinstimmung gibt es bei Lore und Fritz Perls auch bei einem weiteren Thema, nämlich der »Weiterentwicklung des Therapeuten«. Wieder ein Anliegen von beiden Perls – Fritz sagte:
»Ich akzeptiere niemanden als kompetenten Gestalttherapeuten, solange er noch ›Techniken‹ benützt. Wenn er seinen eigenen Stil nicht gefunden hat, wenn er sich selbst nicht ins Spiel bringen kann und den Modus (oder die Technik), die die Situation verlangt, nicht der Eingebung des Augenblicks folgend erfindet, ist er kein Gestalttherapeut.«19
Heute überwiegt häufig erst einmal die Kritik an Fritz Perls’ Arbeit: Na ja, gibt man zu. Fritz sei sehr intuitiv und wirklich ein Genie gewesen. Doch seine therapeutische Haltung sei zweifelhaft.
So könne man Gestalttherapie natürlich nicht mehr machen. Sie habe sich weiterentwickelt. Es ist aber doch das mindeste, was man erwarten kann! Dass gute Schüler guter Lehrer das Gelernte weiterentwickeln! Wie der Bauer, der gute Saat pflegt, bis sie auf geht und reiche Frucht trägt. Also, nur zu verständlich, dass Gestalttherapie jetzt an einer anderen Stelle steht. Wie sollte sie anders, wenn sie überhaupt noch »sein« will?
Die Mitbegründerin der Gestalttherapie Lore (Laura) Perlsam 14. 6. 1988 im Gestalt-Institut Köln/GIK Bildungswerkstatt mit Erhard Doubrawa und Daniel Rosenblatt (rechts) (Reproduktion von einem Video-Film, © GIK)
Entnommen aus:
Meine Wildnis ist die Seele des Anderen: Der Weg zur Gestalttherapie. Laura Perls im Gespräch mit Daniel Rosenblatt u. a. Köln&Kassel 2017 (gikPRESS), S. 116. — Siehe auch die Leseprobe auf S. 159ff.
War es in den letzten zwei Jahrzehnten angebracht, Lore Perls’ (ebenso wie Paul Goodmans) Beitrag zur Gestalttherapie20 hervorzuheben, so scheint es nun wichtig, sich wieder Fritz Perls zuzuwenden. Darin stimme ich mit Ludwig Frambach überein:
»Jetzt scheint es mir, angesichts von Abwertungen […], hingegen wieder notwendig, die Bedeutung von Fritz Perls ins Bewusstsein zu heben.«21
Und wenn dieses Buch ein kleiner Beitrag zur Würdigung von Fritz Perls ist, würde ich mich sehr darüber freuen.
Köln/Kassel, im April 2018
Erhard Doubrawa, GestalttherapeutGestalt-Institute Köln und Kassel (GIK)www.gestalt.de · [email protected]
Lore Perls vor einem Porträt ihres Mannes von Otto Dix, 1966. Foto aus den 1970er Jahren. Fotograf unbekannt.
Was ist Gestalttherapie?
Ein außergewöhnliches Interview mit Adelaide Bry
Adelaide Bry: Dr. Perls, was ist Gestalttherapie?
Fritz Perls: All das Diskutieren, Reden und Erklären erscheint mir unwirklich. Ich hasse es, zu intellektualisieren, Sie nicht?
Bry: Manchmal, aber ich möchte Sie interviewen. Ich würde gerne etwas über Gestalttherapie erfahren. Also …
Fritz: Lassen Sie uns etwas anderes versuchen. Sie sind die Patientin. Seien sie echt, keine Intellektualisierungen mehr.
Bry: Nun gut, wenn Sie meinen, versuch ich’s. Ich versuche, die Patientin zu sein. Also, was ich sagen würde ist folgendes: »Dr. Perls, mein Name ist Adelaide, und ich komme zu ihnen als Patientin. Ich bin depressiv und ich habe diese körperliche Angst vorm Fliegen. Meine Hände werden feucht und mein Herz schlägt schneller.« – Was nun?
Fritz: Innerhalb von fünf Minuten werde ich Sie von Ihrer körperlichen Flugangst befreien.
Bry: Oh, wirklich? Sehr gut. Wie wollen Sie das anstellen?
Fritz: Schließen Sie Ihre Augen. Steigen Sie in das Flugzeug. Vergegenwärtigen Sie sich, dass sie nicht in einem richtigen Flugzeug sitzen, es geschieht nur in Ihrer Fantasie. Die Fantasie wird Ihnen helfen zu sehen, was Sie beim Fliegen erleben.
Bry: Mein Herz beginnt, schneller zu schlagen …
Fritz: Lassen Sie Ihre Augen geschlossen …
Bry: Gut.
Fritz: Ihr Herz beginnt, schneller zu schlagen, … erzählen Sie weiter.
Bry: Ich sehe den Rücken des Piloten da vorne, und ich bin mir nicht sicher, ob er der Situation gewachsen ist.
Fritz: Gut. Stehen Sie auf und sagen ihm das.
Bry: Ich tippe ihm auf die Schulter. Er dreht sich um. Ich sage: »Halten Sie die Straße im Auge?« Er stößt mich weg und ich gehe zurück auf meinen Platz.
Fritz: Gehen Sie nicht zurück auf Ihren Platz. Wechseln Sie den Platz. Sie sind jetzt der Pilot. [Dr. Perls bat mich, mich auf einen Stuhl gegenüber von meinem zu setzen. Bei jedem Rollenwechsel wechselte ich auch den Platz.]
Bry: Ich bin der Pilot. Was macht diese Frau hier, sie stört mich. Verlassen Sie das Cockpit und kehren Sie auf Ihren Platz zurück. Ich weiß was ich tue.
Fritz: Ich glaube Ihrer Stimme nicht. Achten Sie auf Ihre Stimme.
Bry [als Pilot]: Entschuldigen Sie bitte, es tut mir leid, es tut mir wirklich schrecklich leid, aber wir wissen, wie man dieses Flugzeug fliegt. Würden Sie bitte zu Ihrem Platz zurückgehen. Alles ist in bester Ordnung und völlig unter Kontrolle.
Fritz: O. K., wie heißen Sie, Adelaide? – Adelaide.
Bry [als Adelaide]: Ich möchte ja zu meinem Platz zurückgehen, aber ich bin so aufgebracht über dieses Flugzeug; ich mag es nicht, vom Boden abzuheben. Ich mag es nicht, in zehntausend Metern Höhe zu sein, das ist unnatürlich.
Fritz: O. K., jetzt sind Sie die Autorin; schreiben Sie das Script.
Bry [als Pilot]: Hören Sie, wir tun unser Bestes, wir sind auch Menschen. Sehen Sie, dieses Flugzeug kostet fünf Millionen Dollar und wurde von Pan American geprüft. Wenn es etwas gibt, das wir mögen, dann ist das Geld. Jedes Mal wenn ein Flugzeug abstürzt, verlieren wir Geld, und wir verlieren Leute. Das ist sehr schlecht für unser Ansehen, und wir tun alles Erdenkliche, um dieses Flugzeug in der Luft zu halten. Wenn wir hin und wieder einen Fehler machen – mein Gott – das kommt eben vor, und in dieser Welt muss man eben manchmal was riskieren. Bis jetzt hatten wir noch keinen einzigen Transatlantikunfall. Ist Ihnen das klar?
Bry [als Adelaide]: Aber ich – wenn mir die Reise nach London zum Verhängnis wird, wenn ich mitten über dem Atlantik abstürze. Aber, naja, ich würde nicht alt werden, mir würden eine Menge schrecklicher Dinge erspart bleiben; vielleicht wäre es gar nicht so schlimm.
Bry [als Pilot]: Hören Sie, gute Frau, das ist keine Art, die Dinge zu sehen, wenn man Urlaub macht. Das ist total töricht.
Fritz: Sagen Sie das nochmal.
Bry [als Pilot]: Sie sind völlig bescheuert, total dumm … töricht, töricht, töricht, töricht, verdammt nochmal. Ich verdiene damit mein Geld; selbst wenn ich im Jahr fünfzig tausend verdiene – ich kann was anderes machen. Jeden Tag – nein, nicht jeden Tag, aber vierzehn Tage lang jeden Monat verdiene ich hier mein Geld und sie sind eine törichte Frau.
Bry [als Adelaide]: Ich weiß bereits, dass ich blöd bin. Das war ein Scherz, ich weiß, dass ich dumm bin. Wissen Sie – ich muss es Ihnen erzählen – ich habe sogar Flugstunden genommen. Ich habe Flugstunden genommen, um etwas gegen die Angst zu unternehmen, in kleinen Piper Cubs. [A.d.Ü.: »Piper Cub« ist eine kleine amerikanische Propellermaschine.]
Fritz: Erzählen Sie das nicht mir …
Bry [als Pilot]: Piper Cubs, oh, Piper Cubs, ja? Piper Cubs, das ist wohl ein Scherz. Sie befinden sich in einer Boeing 707, Piper Cubs. Die beiden haben nichts miteinander zu tun. Ich schlage vor, dass Sie wieder auf Ihren Platz gehen und mich hier arbeiten lassen …
Fritz: Ich schlage etwas anderes vor. Übernehmen Sie das Flugzeug. Setzen Sie sich auf den Pilotensitz.
Bry [als Adelaide]: Oh, großartig. Ich liebe es, die Dinge unter Kontrolle zu haben.
Fritz: Erzählen Sie das nicht mir, sagen Sie ihm das.
Bry [als Adelaide]: Hören Sie zu. Mit nur einer Hand fliege ich diese Maschine noch besser als Sie. Es gibt hier ein paar kleine Details und technische Feinheiten, die Sie kennen, aber ich könnte das in ein paar Monaten lernen. Ich bin intelligent genug dafür; also setzen Sie sich zurück auf meinen Platz und lassen Sie mich das hier machen.
Fritz: Sagen Sie das nochmal: »Lassen Sie mich das hier machen.«
Bry: Lassen Sie mich das hier machen.
Fritz: Nochmal.
Bry: Lassen Sie mich das hier machen.
Fritz: Sagen Sie es mit Ihrem ganzen Körper.
Bry: Lassen Sie mich das hier machen.
Fritz: Jetzt sagen Sie es zu mir: »Fritz, lassen Sie …«
Bry: Fritz, lassen Sie mich das hier machen.
Fritz: Nochmal.
Bry: Lassen Sie mich das hier machen.
Fritz: Haben Sie etwas gelernt?
Bry: Ja, das bin ich – leider.
Fritz: Das war ein kleines Stück Gestalttherapie.
Bry: Faszinierend.
Fritz: Das war ein Beispiel dafür, dass wir nicht analysieren, sondern integrieren. Sie haben das Muster geliefert, einige Ihrer dominierenden Bedürfnisse; und ich helfe Ihnen, sie für sich zurückzugewinnen. Jetzt fühlen Sie sich ein wenig stärker.
Bry: Das stimmt, ja.
Fritz: Das ist Gestalttherapie.
Bry: Ich verstehe. Funktioniert Gestalt immer so? … Ich habe gestern Ihre Demonstration gesehen. Arbeiten Sie immer mit der Technik, die Leute Rollen und Stühle wechseln zu lassen, um einen bestimmten Aspekt zu betonen?
Fritz: Immer dann, wenn ich Polaritäten erkenne, ja; wenn wir es mit zwei Gegensätzen zu tun haben. Sie werden bemerken, dass diese Gegensätze im Streit miteinander liegen. Pilot und Passagier sind Feinde. Sie sind Feinde, weil sie einander nicht zuhören. In unserem Fall – in diesem Dialog – nehmen Sie diesen anderen Teil, der Sie verfolgt, der außerhalb von Ihnen zu sein scheint, wahr und erkennen, dass er zu Ihnen gehört, dass Sie das sind. Dadurch nehmen Sie diese Gefühle zu sich zurück, Sie reassimilieren einen Teil Ihrer dominierenden Bedürfnisse.
Bry: Nun, damit ich das wirklich ganz verstehe: Müssten wir diesen Prozess zwanzig Mal oder zwanzig Jahre lang durchgehen, oder würden wir vielleicht ein Jahr daran arbeiten, damit es ganz zu mir zurückkehren könnte?
Fritz: Nein, nein, nein. Ich muss Ihnen erzählen, was ich gestern schon sagte: Ich habe eine Lösung gefunden. Sie brauchen nicht zwanzig Jahre auf der Couch zu verbringen oder jahrein-jahraus Therapie zu machen. Das Ganze dauert vielleicht drei Monate. Von der Neurose zur Authentizität. Die Lösung liegt in der therapeutischen Gemeinschaft, wo wir zusammenkommen, zusammen arbeiten und zusammen Therapie machen. Der Kernpunkt der Therapie ist, dass wir lernen, uns unseren Gegensätzen zu stellen. Wenn Sie einmal gelernt haben, wie Sie das machen können, fällt es Ihnen beim nächsten Mal vielleicht leichter. Wenn ich Ihnen also ein Beispiel dafür gebe, was bei vielen Menschen der am häufigsten vorkommende Gegensatz ist, können Sie sehen, was sich daraus ergibt. Der am häufigsten vorkommende Gegensatz ist der zwischen Topdog und Underdog. Von hier aus gehen wir die Sache an.
Bry: Gut.
Fritz: Also, der Topdog





























