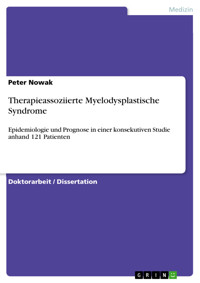Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch gibt überraschende Antworten auf die Fragen: - Gab es Atlantis? - Ist Platon die einzige Quelle? - Was besagt das angebliche Aristoteles-Zitat? - War Atlantis eine Insel oder ein Kontinent? - Wo lag es? - Wann existierte es? - Konnte es wirklich versinken? - Versank es "in einem Tag und einer Nacht"? - Sprechen die wissenschaftlichen Fakten für oder gegen seine Existenz? - Welche technischen Details verstecken sich in Platons Bericht? - Was zeigt die Struktur von Platons Dialog Kritias? - Wie ist der fehlende Schluss des Kritias zu erklären? Und viele mehr. "Was Sie schon immer über Atlantis wissen wollten Behauptungen und Gegenargumente ist meiner Ansicht nach eines der besten Atlantis-Bücher überhaupt!" (Roland M. Horn im Vorwort)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frontcover: Karte aus Athanasius Kircher (1602 – 1680): »Mundus Subterraneus«, von 1664. Ihre Beschriftung lautet wörtlich übersetzt zweideutig:
„Lage der Insel Atlantis, vom Meer verschluckt nach dem Verständnis der Ägypter und Platon’s Beschreibung.“
„… die als einzige die Wahrheit erweist, wie sie wirklich ist, die Zeit“
(Pindar »Olympische Oden« X, 54 f.)
„Denn ungereimte Meinungen vernichtet die Zeit,
aber vernünftige Urteile befestigt sie“
(Cicero »Über das Wesen der Götter« II, 5)
Inhalt:
Vorwort von Roland M. Horn
Einleitung
Behauptungen und Gegenargumente
Behauptung: Platon hat die Atlantis-Dialoge erdichtet!
Gegenargument: Verschiedene Zeugnisse für Atlantis
Gegenargument: Der Gesprächstermin
Die Berechnung des Termins
Platons Ägyptenreise
Unbegründete Vorwürfe
Gegenargument: Der zeitliche Anhaltspunkt
Gegenargument: Das >Aristoteles-Zitat<
Der Ursprung des Zitates
Gegen die Deutung als >Aristoteles-Zitat<
Die richtige Deutung des Zitates
Die inhaltliche Bedeutung
Gegenargument: Die geographische Sicht
Amerika
Die von Atlantis beherrschten Länder
Pflanzen, Tiere, Klima und das Herrschaftssystem
Gegenargument: Die geologische Sicht
Insel oder Kontinent?
Die Erdkrustentypen
Die Inseltypen
Die Lokalisierung von Atlantis
Die Azoren
Der Golfstrom
Der Meeresboden
Was zeigen die Sedimente?
Sandstrände und Vulkanasche
Die Termier-Kontroverse
Termiers Untersuchungsergebnis
Die angebliche Widerlegung
Wie versank Atlantis?
In einem Tag und einer Nacht?
Der Meeresspiegelanstieg
Die unterseeischen Flusstäler
Gegenargument: Die technischen Details
1.technisches Detail: Die zwölf Planeten
2.technisches Detail: Die Himmelskörper
Phaëton – ein Komet?
Das griechische Weltbild zur Zeit Platons
3.technisches Detail: Die statistischen Zeiträume
4.technisches Detail: Das Ende der Eiszeit
5.technisches Detail: Die geographischen Kenntnisse
6.technisches Detail: Insel und Festland
Gegenargument: Die kulturelle Entwicklungsstufe
Gegenargument: Die Familie
Gegenargument: Die Philosophie
Das Wesen des Mythos
Philosophie und Wahrheit
Gegenargument: Das Wesen der Dichter
Theoretische Betrachtung
Praktische Beispiele
Gegenargument: Die Struktur des Berichtes
Der Text der Dialoge
»Timaios«
»Kritias«
Wie ist das abrupte Ende zu erklären?
Was behandelte der Dialog »Hermokrates«?
Meine Deutung der Struktur
Schlussbemerkung
Literatur/Webseiten
(in der Reihenfolge der Verwendung)
Vorwort
„Atlantis“ – Ein Wort, das bei den einen eine intuitive Sehnsucht und bei anderen blanken Hohn hervorruft.
„Atlantis – diesen angeblichen versunkenen Kontinent kann es doch gar nicht gegeben haben“, ruft uns der Mainstream der Wissenschaft zu. „Dies ist aus geophysikalischen Gründen unmöglich“ und „Platon hat die Geschichte einfach erfunden“ wird uns immer wieder eingetrichtert.
Dass beides nicht stimmt, belegt Peter Nowak in »Was Sie schon immer über Atlantis wissen wollten Behauptungen und Gegenargumente)« auf eindrucksvolle Weise. Dabei war es ursprünglich überhaupt nicht seine Intention, die ehemalige Existenz der versunkenen Insel (Platon schreibt keineswegs von einem Kontinent!) nachzuweisen. Vielmehr war es ihm ein Anliegen, sich aufgrund der antiken Quellen ein möglichst zutreffendes Bild zu machen. Und tatsächlich ging dem Schreiben dieses Buches ein umfangreiches Quellenstudium voraus. Peter Nowak sichtete Quelle um Quelle.
In einer nie zuvor da gewesenen Ausführlichkeit kann der Autor beweisen, dass Atlantis nicht von Platon erfunden wurde, und er verweist – nicht Platons Atlantis –, sondern immer wieder von neuem vorgebrachte, festgefahrene Behauptungen ins Reich der Fabel. So beweist Peter Nowak beispielsweise, dass Platons Dialoge »Timaios« und »Kritias« – im Gegensatz zu häufig vertretenen Meinungen – nicht die einzigen Quelle sind, die von der legendären Insel berichten, und genauso kann er belegen, warum die Aussage Aristoteles’ „Er der es (Atlantis) erschuf, zerstörte es“ sich nicht auf Platon bezieht, der den Kritias-Dialog unvollendet liess, sondern auf Poseidon, der bei Platon als Schöpfer von Atlantis genannt wird. So ist es schlicht und einfach nicht wahr, dass Aristoteles ein „Atlantis-Gegner“ war, wie immer wieder kolportiert wird.
„Atlantis-Gegner“ waren eher die Ozeanographen Maurice Ewing und Hans Pettersson, doch auch sie erbrachten ungewollt Beweise für die ehemalige Existenz von Atlantis, waren aber bedacht darauf, ihre Entdeckungen nicht mit dem „bösen A-Wort“ in Verbindung zu bringen.
Ja, geologische Beweise für die ehemalige Existenz von Atlantis gibt es zuhauf, und die Befunde wurden – obwohl vom Mainstream auch damals schon nicht gern gesehen – schon vor dem neuen geologischen Paradigma, das ab Mitte der 1960er Jahre gilt, ansatzweise diskutiert. Doch seit Mitte der 1960er Jahre will man es definitiv wissen: „Atlantis kann nicht existiert haben.“ Damit werden die vorher gemachten Funde, die ohne die ehemalige Existenz einer relativ grossen Landmasse im Atlantik nicht vernünftig zu erklären sind, schlicht und einfach unter den Tisch gekehrt. Warum? Weil nicht sein kann, was nicht sein darf?
Peter Nowak spricht in diesem Zusammenhang von einem „Schweigegebot“, und er sieht die „Vorurteilsfreiheit der Wissenschaft“ in diesem Punkt nicht mehr gewährleistet. Tatsächlich ist der Mainstream der Wissenschaft, insbesondere, wenn es um Atlantis geht, nicht mehr vorurteilsfrei, und so stellt sich die Frage, inwieweit die aktuelle „offizielle“ Ansicht zum Thema „Atlantis“ und der Umgang mit dem „bösen A-Wort“ des Mainstreams der Wissenschaft tatsächlich noch wissenschaftlich ist. Als „wissenschaftlich“ muss aber jeder objektive Leser die vorliegende Studie von Peter Nowak betrachten. Sie ist in allen Belangen vorbildlich, und manch einer, der sich Wissenschaftler schimpft, kann sich hier „eine Scheibe abschneiden“.
Dass Atlantis tatsächlich im Atlantik lag, geht eindeutig aus Platons Dialogen hervor, und so lässt Peter Nowak sich gar nicht erst auf eine unnötige Lokalisierungsdebatte ein, die einen Grossteil der Atlantis-Bücher beherrscht. Viele Autoren versuchen, das Atlantis-Thema mit dem heutigen Paradigma in Verbindung zu bringen, indem sie den Zeitpunkt des Untergangs dieser Insel, der ja von Plato mit etwa 9500 Jahren vor seiner Zeit angegeben wird, auf z.B. 950 vor Plato „herunter zu Rechnen“, um so die von Platon geschilderte Geschichte in eine Zeit und an einen Ort verlegen zu können, der mit dem Standpunkt des Mainstreams der Wissenschaft in Einklang gebracht werden könnte. Dabei verlegen gerade viele akademische Forscher „Atlantis“ mit Vorliebe in ihr eigenes Heimatland. Es gibt kaum ein Fleckchen auf dieser Erde, das noch nicht mit Atlantis in Verbindung gebracht wurde. Doch mit all dem gibt sich Nowak nicht ab. Er konzentriert sich lieber auf die wirklich wichtigen Fragen, die in dieser Ausführlichkeit meines Wissens bislang noch nicht erörtert worden sind. Wichtig ist auch die Frage, ob und auf welche Weise eine verhältnismässig grosse Landmasse im Ozean versinken kann, und Peter Nowak lässt auch hier den Leser nicht im Stich. Er verbindet mehrere Ursachen und nennt als Haupt-Ursache den Einschlag eines Kometen. Mit den von Peter Nowak vorgestellten Szenarien lässt sich der Untergang der Insel Atlantis plausibel erklären.
Nowak beweist weiter, dass unsere Vorfahren nicht so naiv waren, wie ihnen oft unterstellt wird, ja dass das Wissen über die Kugelgestalt der Erde in der Antike und im Mittelalter bereits bestand.
So ergibt sich ein völlig neues Bild über unsere Vergangenheit. In seinem Buch reiht sich Fakt an Fakt, und so ist »Was Sie schon immer über Atlantis wissen wollten Behauptungen und Gegenargumente« eine bahnbrechende Arbeit, die tatsächlich Neues zum Thema Atlantis bringt und aufgrund ihrer Ausführlichkeit und der vielen überzeugenden, nüchtern vorgetragenen, Fakten als ein Buch zu bezeichnen ist, dass jeder, der sich für Atlantis und unsere ferne Vergangenheit interessiert, gelesen haben sollte. Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter und sage: »Was Sie schon immer über Atlantis wissen wollten Behauptungen und Gegenargumente« ist meiner Ansicht nach eines der besten Atlantis-Bücher überhaupt!
Roland M. Horn
I. Einleitung
„Ein zeitloses Geheimnis der vorsintflutlichen Welt, der untergegangene Kontinent von Atlantis, verfolgt unsere Gegenwart immer noch“ (Warren Smith in: [1], Seite 60, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
„… wir hoffen, dass eines Tages ein Geist mit dem unerschütterlichen Vertrauen eines Schliemann, des Entdeckers Trojas, und der Brillanz eines Darwin die verstreuten Teile der Wahrheit zusammensetzen und die Vorgeschichte unseres Planeten schreiben wird“ (Louis Pauwells - Jacques Bergier in: [2], Seite 62, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Der Begriff „Atlantis“ scheint in vielen Menschen eine Urerinnerung anzusprechen. Nur so lässt sich meiner Ansicht nach die unüberschaubare Anzahl von Büchern zu diesem Thema erklären, die jedes andere Thema in den Schatten stellt. Und nun also ein weiteres Buch zu Atlantis. Weshalb? Ist zu diesem Thema nicht längst alles gesagt und erwogen? Wenn dem so wäre, hätte ich auf das Schreiben dieses Buches verzichtet! Nein, trotz der unüberschaubaren Anzahl der Bücher zu Atlantis ist noch nicht alles und nicht einmal das Wichtigste zum Thema gesagt worden. Im Großen und Ganzen lässt sich die Literatur zu Atlantis meiner Ansicht nach in folgende Kategorien einteilen:
1. Die Befürworter von Atlantis, die ihre Deutung zu belegen versuchen.
2. Die Gegner von Atlantis, die ihre Deutung zu belegen versuchen.
3. Diejenigen, die versuchen, sich aufgrund der Quellen ein möglichst zutreffendes Bild zu machen.
4. Diejenigen, die Atlantis nur als Anregung für ihre eigene Phantasie nutzen und damit keinen Anspruch erheben, irgendetwas Sachliches zur Diskussion des Themas beizutragen.
Wie der Titel dieses Buches zeigt, zähle ich mich zu der dritten Kategorie, die innerhalb der sich mit Atlantis beschäftigenden Gruppe der „Atlantologen“ oder „Atlantis-Forscher“ eine absolute Minderheit bildet. In diesem Zusammenhang möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass die jahrelange Arbeit an diesem Buch insbesondere dem Studium der verschiedenen behandelten Teilgebiete geschuldet war. In einigen Bereichen, wie z.B. dem der Geologie, hatte ich bis zur Arbeit an diesem Projekt praktisch keine Kenntnisse und musste sie mir erst mühsam aneignen. Es handelt sich hier also keinesfalls um die Darbietung einer grenzwissenschaftlichen Weltanschauung, sondern um das Ergebnis nicht enden wollender Recherchen.
Andererseits muss ich demnach Leserinnen und Leser enttäuschen, die erwarten, hier etwas über eine vorgeschichtliche Supermacht mit einer der unseren vergleichbaren oder sogar überlegenen Technik zu lesen. Mir geht es nicht darum, der Phantasie freien Raum zu lassen und einen in der Vorzeit spielenden Roman zu verfassen. Mein ursprüngliches Ziel, die Rekonstruktion der Zeitumstände aus den antiken Quellen, habe ich weitestgehend bereits in meinem ersten Buch behandelt ([3]). Hier soll es daher hauptsächlich um die Widerlegung jener Behauptungen gehen, auf die ich im Zuge meiner Untersuchungen stieß. Sie werden im wesentlichen von der Mainstream-Wissenschaft und ihren Anhängern verbreitet, um das Thema zu diskreditieren. Insofern sollte dieses Buch für alle Atlantis-Interessierten eine Quelle kritischer Betrachtung und Überprüfung (auch des eigenen Standpunktes!) sein.
In diesem Zusammenhang möchte ich alle Leserinnen und Leser mit der mir eigenen wissenschaftlichen Ethik bekannt machen, die einen Teil meiner Methodik bildet:
I.) Einstellungsprüfung!
A) Bei sich selbst!
B) Bei dem, dessen Arbeit untersucht / der bekämpft wird / {für den man arbeitet}!
Wissen und / oder Können schafft Verantwortung:
1.) Gegenüber der Natur! [Welche Folgen wird mein Handeln haben?’]
2.) Gegenüber dem Gewissen! [Darf ich?’]
3.) Gegenüber dem Einzelnen und der Gemeinschaft! [Ich kann, also muss ich’:
Was kritisiert werden kann, muss kritisiert werden!’
Ich habe die Fähigkeit, also muss ich handeln!’]
4.) Gegenüber den Nachkommen! [Wissen muss erhalten bleiben!’]
Daraus folgt schon, weshalb ich dieses Buch für notwendig halte: Weil es bisher meines Wissens noch keinen Versuch gegeben hat, die Atlantis betreffenden Behauptungen zu widerlegen, ich mich aber für fähig halte, dies zu tun. Die Mehrheit der Autoren konzentriert sich vielmehr darauf, die Existenz von Atlantis zu beweisen, es an dieser oder jener Stelle des Globus zu lokalisieren oder dies zu widerlegen. Dabei gibt es wohl keine Stelle unseres Planeten, die nicht schon irgendwann von irgendwem mit Atlantis in Verbindung gebracht wurde. Erinnert sei nur an die wissenschaftlichen Versuche, Atlantis in Spanien, auf Kreta, auf Thera/Santorin, in Troja oder Nordafrika nachzuweisen. Sie wurden allesamt mit großem Getöse der Öffentlichkeit präsentiert, um dann einfach ebenso zu versinken, wie Poseidons Insel. Eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema in dem Sinne, dass innerhalb der antiken Literatur nach Bedeutungen und Zusammenhängen geforscht wird, findet dagegen (zumindest in Deutschland) immer noch kaum statt.
Das überrascht umso mehr, als der Text der Atlantis-Dialoge von Platon (428/27 – 348/47 v.Chr.), »Timaios« und »Kritias«, dies eigentlich selbst anregt und geradezu verlangt. Stattdessen scheut sich die wissenschaftliche Atlantis-Kritik aber nicht, unbewiesene Behauptungen aus ihren Kreisen als wissenschaftliche Tatsachen zu behandeln und alle, die in Platons Dialogen mehr als eine Dichtung sehen, zu verunglimpfen. Dieses Buch zielt daher darauf, einige der >wissenschaftlichen< Behauptungen zu Atlantis zu widerlegen. Insofern ist es ein Plädoyer für eine Besinnung auf die Grundanforderungen aller Wissenschaft: Vorurteilsfreiheit und korrekte Methodik, und für eine Korrektur der derzeit angewandten Methoden. Es richtet sich aber nicht vordringlich an ein wissenschaftliches Publikum.
In diesem Zusammenhang bedarf auch meine Auswahl der zum Thema Atlantis zitierten Quellen einer Erläuterung. Diese Auswahl wurde von mir nicht willkürlich getroffen, sondern einfach danach, ob ich von der Existenz dieser Werke Kenntnis erhielt und sie für mich verfügbar waren. Die unüberschaubare Anzahl der Titel zu diesem Thema macht es ohnehin unmöglich, die Literatur dazu auch nur einigermaßen umfassend zu behandeln. Daraus ergibt sich aber für jeden Atlantis-Autor ein Problem: Er kann sich nicht sicher sein, dass seine Erkenntnisse wirklich neu sind und von ihm zuerst entdeckt wurden. Es kann daher sein, dass in diesem Buch Erkenntnisse als von mir stammend dargestellt sind, die bereits vorher von anderen Autoren vertreten wurden, ohne dass diese von mir genannt werden. In solchen möglichen Fällen geschah dies nicht in böser Absicht, sondern weil mir die Arbeiten dieser Autoren nicht bekannt waren. Ich habe mich auch bemüht, Widerholungen dessen, was ich bereits in meinem ersten Buch vorgebracht habe, auf das absolut notwendige Maß zu begrenzen.
Eine Besonderheit dieses Buches betrifft aber die Zitate antiker Texte. Da die meisten, von mir verwendeten Übersetzungen aus dem 19.Jahrhundert stammen, habe ich die zitierten Stellen häufig redigiert, das heißt, dem modernen Sprachgebrauch angepasst. Mein Ziel war es dabei, den Leserinnen und Lesern die sofortige Auseinandersetzung mit dem Inhalt zu ermöglichen, ohne vorherige Beschäftigung mit dem Satzbau. Es sind also im Normalfall keine inhaltlichen Änderungen damit verbunden (Abweichungen werden ausdrücklich genannt), sondern es handelt sich um eine rein äusserliche Behandlung der Formulierungen. Da die verwendeten Quellen angegeben sind, kann dies ohne weiteres überprüft werden. Außerdem wurden in diesem Zusammenhang auch die Namen von mir vereinheitlicht, sodass zum Beispiel durchgehend auch an den Stellen „Platon“ steht, wo in der Quelle der Name in der Form „Plato“ stand. Bei jedem derart bearbeiteten Zitat wurde von mir ausdrücklich angegeben, dass es von mir redigiert wurde. Wo diese Angabe fehlt, wurde das Zitat im Original-Zustand belassen.
Es wurden von mir auch Querverweise in den Text eingefügt, die sowohl vorwärts als auch rückwärts verweisen. Vorwärtsverweise wurden dabei durch „siehe hier Seite …“ und Rückwärtsverweise durch „vergleiche hier Seite …“ gekennzeichnet. Ausserdem habe ich sowohl verschiedene Klammerarten als auch verschiedene Anführungszeichen verwendet. Dies ist sicherlich gewöhnungsbedürftig, wenn man aber eine gewisse Übung darin erlangt hat, vereinfacht es das Verständnis, weil nicht mehr über die spezielle Bedeutung etwa einer Klammer in einem bestimmten Fall nachgedacht werden muss. Es soll also den Leserinnen und Lesern erleichtern, sofort zu erkennen, was damit ausgesagt werden soll. Die verschiedenen Klammerarten und ihre Bedeutungen sind:
Grundsätzlich wurden alle Hinzufügungen von mir in bestehende Zitate in Kursivschrift gesetzt, um sie besser vom Originaltext zu unterscheiden, der ja teilweise auch bereits Einfügungen des Übersetzers enthält. Einfügungen in spitzen Klammern und Kursivschrift stammen also von mir, alle anderen vom jeweils zitierten Autor beziehungsweise dessen Übersetzer.
Außerdem wurden in diesem Buch verschiedene Anführungszeichen von mir verwandt. Diese (der Vollständigkeit halber einschließlich der bekannten Zeichen) und ihre Bedeutungen sind:
Ich würde eine solche Festlegung und sogar eine noch weitergehende Differenzierung in diesem Bereich durchaus für sinnvoll halten, weil Anführungszeichen eine Vielzahl von Bedeutungen haben und stehen können für:
Gedanken
Zitate
Eingefügte Zitate / Begriffe
Sogenannt [also Aussagen, die inhaltlich angezweifelt werden]
Titel (von Büchern usw.)
Begriffe
Alias-Namen / Spitznamen / Künstlernamen
Sprichwörter
Slangausdrücke
Im Grunde genommen finde ich es beschämend, dass der Gebrauch von Anführungszeichen und Klammerarten nicht genormt ist und es jedem überlassen bleibt, welche Zeichen er wie verwenden will. Letztendlich handelt es sich dabei um zusätzliche Informationen, die den Leserinnen und Lesern auf diese Weise vermittelt werden können, etwa wenn Sprichwörter, Slangausdrücke oder auch nur Begriffe durch besondere Anführungszeichen als solche kenntlich gemacht werden. Sie bräuchten dann nicht mehr zu überlegen, ob ein bestimmtes Anführungszeichen die Bedeutung „sogenannt“, „Begriff“ oder „Slangausdruck“ hat, sondern würden dies an der besonderen Form des Anführungszeichens sehen. Vielleicht sollten die Germanisten, noch eher aber wohl die Schriftsteller darüber nachdenken, ob eine solche Weiterentwicklung unserer Sprache nicht sinnvoll wäre, zumal dies alle Bereiche des Schreibens betreffen würde. Ich erlaube mir also, hier einen bescheidenen Anfang in dieser Richtung zu machen um den Leserinnen und Lesern ein Beispiel zu zeigen und ihnen die Beurteilung der Idee zu überlassen.
Ich habe lange überlegt, ob ich nicht den Text der Atlantis-Dialoge von Platon an den Anfang dieses Buches stellen sollte, um es den mit ihnen nicht vertrauten Leserinnen und Lesern zu gestatten, sich erst einmal selbst ein Bild zu machen. Letztlich habe ich mich dann aber dagegen entschieden, weil dies wahrscheinlich dazu führen würde, dass Leserinnen und Leser wie ich, die den Text der Dialoge kennen, diesen Teil dann einfach überschlagen würden. Meine Idee war es aber, auch bei diesen Leserinnen und Lesern das Interesse zu wecken, den Text noch einmal zu lesen. Bevor ich also den Text der Atlantis-Dialoge von Platon selbst wiedergebe, möchte ich die Leserinnen und Leser mit meiner Kritik an einigen Behauptungen der Wissenschaft zu diesen Dialogen bekannt machen. Dies soll es erleichtern, sich bei der Lektüre des Textes ein eigenes Urteil zu bilden oder eine eventuell bestehende Meinung an den vorgebrachten Argumenten zu überprüfen.
Peter Nowak
II. Behauptungen und Gegenargumente
Behauptung: Platon hat die Atlantis-Dialoge erdichtet!
„Viele Menschen haben einen großen Teil ihrer Leben der Untersuchung von etwas gewidmet, was, vom praktischen Standpunkt, nicht mehr als eine Fabel ist“ (Robert Sarmast in: [4], Seite 93, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
„Wir haben … die Pflicht, das Rätsel der <Insel> Atlantis soweit aufzuhellen, dass in jede Richtung hin die Berufenen auf sicherem Boden weiterprüfen können“ (Hanns Fischer in: [5], Seite 182, in spitzen Klammern Einfügung hinzugefügt).
Die Behauptung, Platon habe seine Dialoge erdichtet, ist weit verbreitet, obwohl John Michael Greer zu recht über den Atlantis-Bericht schreibt:
„Nichts in dieser Beschreibung, das verdient besondere Beachtung, ist unmöglich“ ([6], Seite 14, eigene Übersetzung aus dem Englischen),
Der erste, der Platon (428/27 – 348/47 v.Chr.) unterstellte, den Atlantis-Bericht zumindest ausgeschmückt zu haben, war wohl Plutarch (ca. 46 – 120 n.Chr.), der in seinem »Leben Solons« 32 ohne jede Begründung schrieb:
„Wie ein unbestelltes Stück schönen Landes, das ihm gewissermaßen durch Verwandtschaft zugehörte, machte es sich dann Platon zur Aufgabe, den Atlantisstoff auszubauen und zu gestalten …“ ([7], Seite 250).
James Bramwell meint zu Platons Grund für diese Ausschmückung, freilich ebenfalls ohne jeden Beweis:
„Zweifellos dachte Platon, Solons Andenken Tribut zu zollen, als er die Geschichte ausschmückte und erweiterte …“ ([8], Seite 63, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Doch dann fährt er fort:
„Aber generell lässt Platons Achten auf Realismus und dramatische Möglichkeiten eher an eine Verfälschung als an eine völlige dichterische Behandlung denken“ ([8], Seite 63, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Diese trotz der fehlenden Beweise für diese Unterstellung immerhin noch >gemäßigte< Haltung ist aber eher die Ausnahme. Gewöhnlich wird der Atlantis-Bericht dagegen gänzlich als eine Erfindung Platons angesehen, wie Warren Smith ausführt:
„Viele Historiker haben unterstellt, dass der bemerkenswerte alte griechische Philosoph eine phantastische literarische Ente schuf. Sie empfinden Atlantis als eine Fabel, die Platons schöpferischem Verstand entsprang. Sie behaupten, Platon habe sich für eine ideale Gesellschaft interessiert, dass Atlantis ein literarischer Kunstgriff war, um zu beweisen, dass die Menschheit glänzend leben könne“ ([1], Seite 72, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Auch David King schreibt über Platon:
„Platon wusste sicher, wie die Vorstellungskraft gefangen zu nehmen war“ ([9], Seite 108, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Und eine Seite weiter:
„Atlantis hat natürlich niemals existiert. Platon hatte das Ganze aus seinem Kopf gezaubert und ließ es dann, wie um einen peinlichen Mangel an bestätigenden Beweisen zu verschleiern, bequem verschwinden“ ([9], Seite 109, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Auch Paul Jordan nennt Platon einen
„… bekannten Künstler … mit phantasievoller Kreativität beim Geschäft der Mythenbildung“ ([10], Seite 84, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Wenig später spricht er dann von der (bei Lewis Spence, den er zusammen mit Ignatius Donnelly dem „alten, kolonialistischen Zweig in der Atlantologie“ zurechnet, [10], Seite 212 f.), angeblich fehlenden Begeisterung für die
„… künstlerischen und philosophischen Absichten eines Mannes wie Platon“ ([10], Seite 84, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Und noch später führt er, den Thorwald C. Franke eines möglichen Plagiates an Gunnar Rudberg verdächtigt ([17], Seite 111), grundsätzlicher aus:
„Atlantologen verbinden ihre grundsätzliche“ [eigentlich: „ursprüngliche“] „Begriffsstutzigkeit in Bezug auf menschliche Kreativität mit einer absoluten Ablehnung, zu glauben, dass irgend eine Idee mehr als einmal ersonnen worden sein könnte“ ([10], Seite 93, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Die Lächerlichkeit einer solchen Argumentation erschließt sich einem erst durch die Überlegung, dass das Vorhandensein von Kreativität ja noch gar nichts darüber aussagt, ob eine Darstellung tatsächlich erfunden wurde oder auf echten Beobachtungen oder Überlieferungen beruht. Die Leserin und der Leser vergleiche damit seine spätere Schutzbehauptung:
„Natürlich hat die akademische Archäologie in Bezug auf die Vergangenheit nicht immer im Einzelnen oder im Ganzen Recht (sie strebt nicht nach ewiger Wahrheit, nur nach dem Fortschritt des Wissens), und ihre Deutungen ändern sich mit weiteren Funden und weiterem Denken“ ([10], Seite 121, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Im Gegensatz dazu schreibt Barbara Hand Clow völlig zu Recht:
„… ein Akademiker, der diese Geschichte“ [gemeint ist: von Atlantis, P.N.] „ernst nimmt, wird ein ‚unvernünftiger Narr‘ genannt“ ([11], Seite 85, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
John Michael Greer zeigt dagegen, allerdings eigentlich in Bezug auf die Atlantis-Forscher, was von Paul Jordans Meinung zu Platon zu halten ist:
„Zu zeigen, dass etwas möglich ist, ist nicht dasselbe wie zu beweisen, dass es geschah“ ([6], Seite 179, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Die Behauptung, es handele sich bei den Atlantis-Dialogen um ein Produkt von „Platons Kreativität“ ist also unbewiesen, nichts als ein Vorurteil und damit unwissenschaftlich. Karl F. Kohlenberg schreibt jedenfalls sehr richtig:
„An die 40.000 Bücher sind über das Atlantis-Problem geschrieben worden, seit Platon jenen sagenhaften Inselkontinent in seinen Dialogen erwähnte. Noch immer pflegen ‚ernsthafte‘ Wissenschaftler diese Art Literatur mit überlegenem Lächeln als ‚Phantastereien‘ abzutun, ‚weil sich stichhaltige Beweise für die einstige Existenz eines solchen Erdteils nicht beibringen lassen‘. Das erinnert fatal an ähnliche Äußerungen, wie sie Virchow im Falle Koch und die gelehrten Gegner des ungelehrten Schliemann taten“ ([12], Seite 93).
Horst Bohse dürfte jedoch die aktuelle Meinung vieler Menschen dazu wiedergeben, wenn er schreibt:
„Heutzutage kennen wir die Geschichte besser, kennen auch die Geschichte Griechenlands besser, als sie die Zeitzeugen Platons, aber auch die Ägypter zur Zeit Solons, die doch zeitlich wesentlich dichter dran waren, je kannten, und wissen daher, dass uns Platon (durch den Mund <von> Kritias, der wiederum vorgibt, durch den Mund des saïtischen Priesters zu sprechen)“ [gemeint ist natürlich: Kritias gebe vor, die Rede des saïtischen Priesters wiederzugeben, P.N.] „hier ein Märchen erzählt“ ([13] Band 1, Seite 234, in spitzen Klammern Einfügung hinzugefügt).
Bereits davor schrieb er aber:
„Und weil ein historisches Atlantis mit Platons Text unvereinbar ist, muss man sich entweder die Idee von der Historizität“ [das heißt: Geschichtlichkeit, P.N.] der Großinsel Atlantis abschminken, oder den Bereich der Wissenschaft verlassen und grenzwissenschaftlich argumentieren“ ([13] Band 1, Seite 223).
Ich werde mich in diesem Buch zu zeigen bemühen, dass dies schlichtweg Unsinn ist. Bereits Hans Pettersson schrieb aber 1944 (deutsch 1948) zu der Frage, ob der Atlantis-Bericht auf Wahrheit beruhe:
„Von philosophischer Seite ist die Antwort überwiegend gewesen, dass die ganze Atlantis-Erzählung von Platon in didaktischer“ [das heißt: in lehrhafter, P.N.] „Absicht erfunden wurde, um ihm Gelegenheit zu geben, eingehender seine Ideen vom Dialog »Der Staat« über das Gemeinwesen zu entwickeln. … Diese Anschauung, welcher sich die Mehrzahl der Humanisten unserer Zeit anschließen dürfte, bezeichnete Platons Atlantis als eine reine Dichtung, eine Schöpfung seiner eigenen Phantasie ohne Gegenstück in der Wirklichkeit“ ([14], Seite 13, Text von mir redigiert).
Was soll man jedoch von >Philosophen< denken, die es für möglich halten, dass ein Philosoph lügt? Gilt hier das Sprichwort:
„Was ich denk’ und was ich tu,
das trau‘ ich allen andern zu“?
Soweit sich Hans Pettersson tatsächlich auf „Philosophen“ und nicht etwa auf Philologen bezieht, handelt es sich wohl um jene sogenannten >Philosophen<, die an unseren Universitäten ausgebildet werden. Im Grunde ist die Bezeichnung irreführend, denn diese haben mit den antiken Philosophen nur den Namen gemein. Inhaltlich handelt es sich eher um Philosophologen [das heißt: Kenner der Philosophiegeschichte]. Diese Unterscheidung scheint auch Alan F. Alford anzudeuten, wenn er schreibt:
„Echte Philosophie … war keine Philosophie, wie wir sie heute kennen, sondern vielmehr eine viel höhere Art von Kunst, in der ein Mensch Kenntnis von ‚dem, was immer existierte‘ und ‚dem, was ist‘ … suchte“ ([15], Seite 223, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Hans Pettersson schreibt in dem Zusammenhang an einer späteren Stelle von „Zweiflern“ ([14], Seite 21), heute gewöhnlich „Skeptiker“ genannt. Auch dies ist jedoch zumindest irreführend und inhaltlich falsch! Es geht dabei nämlich keineswegs um „Zweifel“, sondern um das Vertreten unbewiesener Behauptungen als wissenschaftlicher Tatsachen, gewissermaßen also das Gegenteil von Zweiflern. Selbst Horst Bohse muss aber zugeben, dass
„… die Altphilologen … davon überzeugt sind, auch wenn sie es natürlich nicht beweisen können, dass es sich >lediglich< um einen platonischen Mythos handelt“ ([13] Band 1, Seite 12, Hervorhebungen hinzugefügt).
Interessant ist aber, dass er dessen ungeachtet eine Seite später schreibt:
„Zunächst geht es um einen kurzen Abriss des Stands der ‚Atlantis-Forschung‘ aus akademischer und das heißt altphilologischer Sicht mit einer kurzen Begründung, weshalb ‚Atlantis‘, und zwar Platons Atlantis, für die Wissenschaft kein Thema ist, da aus ihrer Sicht nichts für ein historisches Atlantis spricht, aber alles für eine Allegorie“ [das heißt: ein Gleichnis, P.N.], „für einen ‚platonischen Mythos‘“ ([13] Band 1, Seite 13, Hervorhebung hinzugefügt).
Mit anderen Worten: Hier werden (neben der falschen Gleichsetzung von Gleichnis und Mythos) die unbewiesenen „Überzeugungen“ von Altphilologen als „Stand der … Forschung“ und als „Wissenschaft“ verkauft. Wenige Seiten später schreibt er:
„In der Frage, ob Platons Atlantisgeschichte als ein dokumentarischer Bericht über ein einstmals real existierendes Staatsgebilde zu verstehen ist oder nur als Allegorie“ [das heißt: als Gleichnis, P.N.], „seine Vorstellung und Ausmalung eines idealen Staats, Platons philosophisches Utopia, ist die Forschergemeinde in zwei unvereinbare Lager gespalten, das der seriösen Wissenschaft, die Atlantis für einen Mythos hält, und das der Laien und Spekulanten, die, weil sie möchten, dass es Atlantis gab, die einstige reale Existenz von Atlantis als Fakt postulieren und nach >Beweisen< suchen“ ([13] Band 1, Seite 18).
Hier soll uns nicht sein ausufernde Satzbau interessieren, sondern seine unbewiesene Unterstellung, die „Laien und Spekulanten“ würden die einstige Existenz von Atlantis behaupten und nur nach Beweisen für diese Behauptung suchen. In der Tat erhebt sich dazu natürlich die Frage, worauf er seine Behauptung denn stützt. Da er dazu keine Angaben macht, scheint es sich doch nur um ein Vorurteil seinerseits zu handeln. Er behauptet dies aber, nachdem er vorher zugeben musste, dass es für die >Ergebnisse< der >seriösen Wissenschaft< „natürlich“ keine Beweise gebe. An einer späteren Stelle versucht er allerdings, diese seine Behauptung bei inhaltlicher Aufrechterhaltung zu relativieren:
„Atlantis Theorien sind daher sui generis“ [hier wohl der Stellung im Text zufolge zu verstehen als: „ihrer Gattung nach“, P.N.] „Pro-Atlantis-Theorien, die die reale Existenz der Insel beweisen wollen – und sei es, was man wohl sämtlichen >Atlantis-Forschern< unterstellen darf, weil sie aus dem Motiv des Wunsches geboren werden, dass es Platons Atlantis gegeben hat“ [richtig wäre dem Zusammenhang nach: haben soll, P.N.] „und daher nach Argumenten und Indizien gesucht wird, die stark genug sind, um die immer wieder aufkeimenden Zweifel an der Existenz <von> Atlantis auszuräumen“ ([13] Band 1, Seite 229, Hervorhebung und in spitzen Klammern Einfügung hinzugefügt).
Hier scheint er sich also nicht mehr sicher zu sein, ob man diese Unterstellung gegenüber allen Atlantis-Forschern aufstellen darf. Was er jedoch offensichtlich will, ist, dass an die Stelle des konkreten Zeugnisses von Kritias in Platons Dialogen die unbewiesenen Vorstellungen der Altphilologen treten sollen. Letztlich versucht er damit, die Beweislast umzukehren: Nicht er erbringt den Beweis, dass der Atlantis-Bericht unglaubwürdig ist, sondern er fordert von den Verteidigern Platons den Beweis für dessen Unschuld! Man könnte dies natürlich einfach seinem eigenen Unvermögen anlasten, wenn es sich nicht um ein allgemeines Vorgehen handeln würde und dabei nicht auch um die böswillige Herabwürdigung der Atlantis-Forscher ginge. Und das soll wissenschaftlich sein! Und dieser Mann will „der Grenzwissenschaft“ den Kampf ansagen!
Doch auch Hans Pettersson steckt den Kreis der Atlantis-Gegner an einer anderen Stelle noch etwas weiter als oben ab, indem er schreibt:
„Auf die Hauptfrage, ob die Atlantissage irgendwelchen Wirklichkeitshintergrund hinter sich habe, haben Philosophen, Sprachforscher, Historiker, kurz gesagt, die Vertreter der humanistischen Wissenschaften, immer überwiegend mit ‚nein’ geantwortet, und das tun sie noch heutigen Tags“ ([14], Seite 20).
Wohlgemerkt: Ohne den geringsten stichhaltigen Beweis. Man ist aber versucht, auf seine Ausführungen mit Sokrates in Platons Dialog »Laches« 184e zu antworten:
„Nach Sachkenntnis, nicht nach Mehrheit, muss entschieden werden, was richtig entschieden werden soll“ ([16], Seite 319, Text von mir redigiert).
Inwieweit man jedoch Leute, die andere mit fadenscheinigen, wenn überhaupt vorhandenen Argumenten des Betrugs bezichtigen, als „Humanisten“ und überhaupt als „Wissenschaftler“ betrachten kann, mag jeder selbst entscheiden. Allerdings hatte Hans Pettersson bereits selbst, ohne nähere Erläuterung, von wem er spricht, festgestellt:
„Die Geschichte von Atlantis ist die Geschichte der menschlichen Wunschträume, der menschlichen Illusionen und der menschlichen Torheiten“ [14], Seite 20).
Und am Ende seines Werkes sagt er dann als Schlusssatz:
„Die Erzählung von der Herrlichkeit und den Reichtümern von Atlantis, von dessen Fürsten und Kriegern, seinem Handel und Eroberungszug, vom Poseidontempel mit dem Dach aus Elfenbein und Gold im Schutze der ringförmigen Kanäle und Mauern, ist ganz bestimmt eine Sage, eine Dichtung des größten Denkers der Antike, Platon“ ([14], Seite 121).
Vergleiche dazu auch wieder die vollmundige Behauptung von Horst Bohse:
„Da Platon aber nun mal die einzige Primärquelle für Atlantis ist, muss man Platon Irrtümer oder gar Täuschungsabsichten bei der Beschreibung von Atlantis vorwerfen, da es Atlantis in dieser Form historisch nicht gegeben hat“ ([13] Band 1, Seite 223).
Dass Platon „die einzige Primärquelle“ zu Atlantis sei, ist zumindest zweifelhaft. Selbst Gunnar Rudberg nennt die Behauptung, „dass es Platon statt Solon war, der die Überlieferung von den Ägyptern entlehnte“, eine „willkürliche Behauptung“ ([17], Seite 29 f.). Allerdings gibt er darauf unkommentiert Svensén’s Ansicht wieder, der ebenso willkürlich behauptete:
„Natürlich missverstanden sowohl Solon als auch Platon vieles in der ägyptischen Schilderung“ ([17], Seite 31, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Während er selbst ebenso ohne jede sachliche Begründung schreibt:
„Platons Umgestaltung der Überlieferung war tatsächlich so gründlich, dass – niemand an seine Existenz“ {die von Atlantis, P.N.} „glauben kann“ ([17], Seite 49, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Zwar stimmt es, dass die antiken Griechen nach »Timaios« 23b (vergleiche 22a) und 24e erst durch Solon bzw. Platons Dialoge von Atlantis erfuhren, aber der Krieg mit Atlantis war ihnen schon vorher als „Krieg der Giganten“ bekannt (siehe Tabelle 1 hier Seite →). Diese Gleichsetzung findet sich bereits in einem antiken Kommentar zu Platons »Politeia« [deutsch: »Der Staat«] 327a ([17], Seite 48, griechischer Text). Gunnar Rudberg kritisiert daran, dass dann „die Legende von Atlantis“ für die Athener nichts Neues gewesen wäre, was (über Solon) „erst von den Ägyptern gelernt werden musste“ ([17], Seite 48). Er übersieht dabei aber, dass der Krieg gegen die Giganten in der Überlieferung der Griechen als ein lokaler Konflikt erscheint, nicht als Weltkrieg.
Ebenso kannten die Griechen aus ihrer Überlieferung auch die Könige Ur-Athens zu dieser Zeit (vergleiche »Kritias« 110b und weitergehend dazu [3], Seite 181 ff.). Immerhin trifft aber auf die oben von Horst Bohse skizzierte Art >wissenschaftlicher Atlantisforschung< seine Darstellung zu:
„… niemand ist sich zu schade, alle jene Parameter, aus denen sich die Koordinaten von Platons Atlantis zusammensetzen, unter den Tisch fallen zu lassen, die nicht passen, und bei der Begründung für die <jeweilige eigene> Hypothese Platons Textvorgabe so weit zu verbiegen, zu verdrehen, zu verhunzen und zu entstellen, bis sie ‚passend gemacht‘ worden ist, zurecht gebogen und gebrochen auf die jeweilige >Theorie< hin“ ([13] Band 1, Seite 233 f., in spitzen Klammern Einfügung hinzugefügt).
Auch John Michael Greer schreibt zwar zu recht:
„Die schiere Anzahl rivalisierender Theorien über Atlantis ist eines der merkwürdigsten Dinge in Bezug auf dieses Phänomen … Was diese spekulativen Ansätze letztlich problematisch macht, ist, dass sie austauschbar sind; keiner davon bildet einen besseren Fall als irgend einer von den anderen“ ([6], Seite 115, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Jedoch spricht sowohl er als auch Horst Bohse diese Behandlung von Platon gerade nicht der >Wissenschaft< zu. Sie sehen einfach davon ab, dass auch sogenannte >seriöse Wissenschaftler< in dem Bestreben, ihre Atlantis-Theorien zu untermauern, den Text Platons willkürlich änderten (und/oder alles verschwiegen, was ihrer Ansicht widerspricht). Den Beweis dafür liefert unter anderen lang und breit Gunnar Rudberg, sowohl in Bezug auf Vorgänger ([17], Seite 22 ff.) als auch selbst ([17], Seite 52 ff.). Stattdessen bezieht es Horst Bohse allein auf die Grenzwissenschaft, wenn er schreibt:
„Getreu der Maxime, wonach Angriff die beste Verteidigung ist, preschen sie“ [gemeint ist: die „sich so nennenden Atlantis-Forscher“, P.N.] „vor und behaupten, Platon müsse sich auch in anderen Punkten geirrt haben“ ([13] Band 1, Seite 233).
Da er aber selbst ein >wissenschaftliches< Beispiel anführt ([13] Band 1, Seite 26!), kann das nur bedeuten, dass er „die Grenzwissenschaft“ mit bewusst falschen Anschuldigungen verunglimpfen will. Im Übrigen nenne ich mich auch „Atlantis-Forscher“, und seine Beschuldigung trifft auf mich nicht zu. Bereits 1939 schrieb aber auch Robert B. Stacy-Judd dazu:
„Wenn wir Solons Geschichte des verlorenen Atlantis wie in Platons Zusammenhang akzeptieren, müssen wir sie als Ganzes akzeptieren. Es ist entweder eine brillante Erfindung oder eine Erzählung von Tatsachen“ ([18], Seite 42, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Auch Nikolai Zhirov bestätigt aber die weitgehende Ablehnung eines Wahrheitsgehaltes des Atlantis-Berichtes mit seiner Angabe:
„Eine genaue Untersuchung von Platons Atlantis-Legende hat viele Forscher rund zu dem Schluss gebracht, dass das gesamte Material künstlich und überlegt zu keinem anderen Zweck erzeugt wurde, als Platons Theorien zu veranschaulichen und zu popularisieren. Diese Idee ist nicht neu. Sie liegt ohne wesentliche Änderungen seit antiken Zeiten vor“ ([19], Seite 61, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Im Anschluss daran zitiert er J.O. Thomson, der bereits 1948 in seiner »History of Ancient Geography« [»Geschichte der antiken Geographie«] über Platons Atlantis-Dialog schrieb:
„Offensichtlich ist das Datum eine Phantasterei und das Ganze ist eine ‚edle Lüge’: Atlantis ist ein böses Utopia, aus der unermesslichen Tiefe hervorgerufen, etwas Gutes zu beweisen und ebenso glaubwürdig wie möglich wieder dorthin überliefert. Da aber natürlich selbst Utopias nicht im Vakuum geschaffen werden, wurde einiges örtliches Kolorit benutzt“ ([19], Seite 61, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Das erinnert an die Aussage eines gewissen Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, der so sehr von seiner Gelehrsamkeit überzeugt war, dass er schon 1920 schrieb:
„Geographische Phantasien hatten ihn“ [das heißt: Platon, P.N.] „öfter beschäftigt; wer die Erde als Kugel kannte und ihre Größe so richtig schätzte, dass er im Mythos des »Phaidon« das Mittelmeer <als> einen Tümpel im Verhältnis zum Ozean bezeichnete, dem fiel eine solche Erfindung“ [gemeint ist: von Atlantis, P.N.] „nicht schwer. Kein Gedanke daran, dass irgendeine Tradition oder auch nur eine ernsthaft gemeinte geologisch-geographische Hypothese zugrunde läge. Das ist längst ausgemacht; aber die Faseleien über die Insel Atlantis verstummen nicht, und die Narren werden nicht aufhören, sie ebenso zu suchen wie die Insel der Kalypso, von der Homer gesagt hat, dass nicht einmal die Götter auf ihr verkehren“ ([20] Band I, Seite 594, ebenso [21], Seite 469, Text von mir redigiert, in spitzen Klammern Einfügung hinzugefügt).
Hans Pettersson schreibt mehr als zwanzig Jahre später zu dieser Ansicht:
„Unseres Jahrhunderts“ [gemeint ist das vorige, 20. Jahrhundert, P.N.] „hervorragendster Klassiker, Wilamowitz-Moellendorff, ist gleichfalls in der Frage nach der Realität von Atlantis skeptisch“ ([14], Seite 21).
Dass dieses Jahrhundert keine besseren Leute hervorgebracht hat, kann man Hans Pettersson nicht vorwerfen, aber diese Haltung als „Skeptizismus“ zu bewerten, lässt doch tief blicken. Ein Skeptiker hat Zweifel, aber er behauptet nicht selbst Unbewiesenes; das ist das Gegenteil eines Skeptikers: ein Ideologe! Auf jeden Fall zeigt die Aussage von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff aber, wie recht Dr. Rudolf Elmayer von Vestenbrugg und Prof. H.S. Bellamy hatten, als sie schrieben:
„Die berufsmäßigen Zweifler haben sich natürlich in schroffster Weise gegen ein einstiges Bestehen von Atlantis ausgesprochen“ ([22], Seite 159).
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff hat in seinem obigen Zitat allerdings nur die Sicht von Franz Susemihl übernommen, der bereits 1857 sehr phantasievoll in einer Endnote schrieb:
„Die Kugelgestalt der Erde veranlasste den Platon aber sodann noch zu der weiteren Hypothese, dass der Ozean nicht den ganzen übrigen Teil derselben bedeckt, sondern dass, wie Europa, Asien und Afrika um das Mittelmeer, ebenso um ihn wieder die eigentliche Hauptmasse des Festlandes herum liegt, indem jene drei Weltteile nur eine große Insel in ihm sind. Eine wirklich historische, wenn auch noch so dunkle Kunde von Amerika scheint dabei nicht zu Grunde zu liegen, sondern das Ganze ist reine Spekulation … und die ‚übrigen Inseln‘ sind westlich von der Atlantis … zu denken und zu dem Zwecke fingiert, um der Hypothese dieses Kontinents einen Schein von historischer Glaubwürdigkeit zu geben; es waltet also in ihnen rein die künstlerische Illusion“ ([23], Endnote 36 auf Seite 726 zu »Timaios« § 24).
Ähnlich erklärt Gunnar Rudberg 1917:
„»Kritias« mit seinen Atlantis-Teilen und die Einleitung zu »Timaios« sind eine Dichtung von Platon. Die Mehrzahl der Fakten spricht unterstützend dafür“ ([17], Seite 44, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Im Gegensatz zu der vollmundigen Behauptung von Gunnar Rudberg versäumten aber beide dabei leider (wie viele andere >Gelehrte< auch), irgendwelche glaubhaften Beweise für ihre Behauptungen anzuführen. Es handelt sich daher ganz offensichtlich nicht mehr um Wissenschaft, sondern um Pseudowissenschaft, um Ideologie! Auch Otto Apelt schreibt jedenfalls 1922 in Bezug auf die Datierung, selbstverständlich ohne den Versuch einer Begründung, dass es sich
„… um mythische Darstellung, also mehr oder weniger um Fiktion der Einbildungskraft handelt“ ([24], Seite 148, Endnote 31 zu Seite 39).
Später verweist er aber immerhin darauf, dass dies Proklos zufolge (»In Timaium« 26c) schon „im Altertum Männer wie Longinus und Origenes glaubten“, dass aber „die Naturgeschichte der Erde“ dafür spräche,
„… dass irgend welche dunkle Überlieferung großer Erdrevolutionen der Darstellung zugrunde liegt“ ([24], Seite 148, Endnote 36 zu Seite 41).
Mit Longinus (der auch bei Gunnar Rudberg als Gegner genannt wird, [17], Seite 35) ist wahrscheinlich Pseudo-Longinus gemeint, ein Autor des 1. Jahrhunderts n.Chr., der „als einer der ersten Griechen aus der Bibel zitierte“ ([25]). Er ist also vermutlich ebenso wie auch Origenes (184 – 254 n.Chr.) ein christlicher Schriftsteller, die allgemein wegen ihrer Gegnerschaft gegen die >Heiden< wenig glaubwürdig sind. Es ist aber auch zweifelhaft, ob sie in diesem Zusammenhang überhaupt richtig verstanden oder wiedergegeben wurden. Gunnar Rudberg bezeichnet nämlich auch Poseidonius (131 – 51 v.Chr.) unberechtigt als Gegner der Atlantis-Geschichte ([17], Seiten 18 und 35; siehe dazu hier Seite →).
In neuerer Zeit vertritt auch Paul Jordan die unbewiesene Behauptung, Platon habe frühere Ereignisse zur Grundlage seiner Dichtung genommen:
„Es ist nur möglich, dass in einer sehr allgemeinen Weise Erinnerungen an eine frühere und größere Katastrophe als jene … im Golf von Korinth und Euböa bis auf Platon gekommen sein könnten, um seine Vorstellung anzuheizen, als er sich an die Arbeit an seiner Atlantis-Geschichte machte“ ([10], Seite 33, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Und bereits vorher schreibt er dort, dass die Angabe des Versinkens der Streitmacht Ur-Athens „in Erdbeben und Überflutung“, nur „Produkte seiner“ [das heißt: Platons, P.N.] „Kunstfertigkeit waren“ ([10], Seite 32). Otto Apelt kommt dagegen, trotz seiner ganz ähnlichen Vorstellung, schließlich zu dem Resümee:
„Ob also in der Atlantissage vielleicht eine dunkle Hindeutung auf eine ehemalige Inselmasse zwischen der alten und neuen Welt liegt, ist eine immerhin diskutable Frage“ ([24], Seite 148, Endnote 36 zu Seite 41).
Hans Pettersson könnte dagegen Kritias möglicherweise sogar (die Übersetzung ist etwas zweideutig) den Gebrauch des Namens „Atlantis“ verweigern wollen:
„Es muss immerhin schon hier vorgehalten werden, dass jenes Atlantis, das allmählich aus den Resultaten von geophysikalischen und biologischen Forschungen heranwuchs“ (!), „in wichtigen Beziehungen so bedeutend von dem abweicht, über welches Kritias seinen drei Zuhörern Timaios, Hermokrates und Sokrates berichtete, dass man die Berechtigung bezweifeln mag, sich auch nur des ehrwürdigen, vom Schimmer der Sage umwobenen Namens Atlantis für seine Konstruktion zu bedienen“ ([14], Seite 21 f.).
Aus seiner Darstellung wird also nicht ganz klar, ob er der Konstruktion von Kritias oder der wissenschaftlichen Konstruktion den Namen abspricht; der letzte Teil des Satzes könnte eher für letzteres sprechen. Interessant ist aber, dass er an dieser Stelle zugibt, dass es wissenschaftliche Fakten gibt, die für die ehemalige Existenz von Atlantis sprechen (siehe aber hier Seite →), wie es ja auch Otto Apelt oben mit seiner „immerhin diskutablen Frage“ anzudeuten scheint!
Als klassisches Beispiel für die Behauptung, Atlantis sei eine Erfindung Platons, und die Art, wie sie häufig vorgebracht wird, kann aber L. Sprague de Camp gelten. Paul Jordan nennt ihn den
„Pionier-Analytiker für Vorstellungen verschwundener Zivilisationen, … (dem alle späteren Schriftsteller so viel verdanken)“ ([10], Seite 40, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Dieser L. Sprague de Camp schrieb 1954 in seinem Buch »Lost Continents The Atlantis Theme in History Science and Literature« [»Verlorene Kontinente Das Atlantis Thema in Geschichte Wissenschaft und Literatur«]:
„Unqualifiziert“ [das heißt: „ohne fachliche Ausbildung“] „zu sagen, dass Platons Atlantis eine versunkene Insel im Atlantik oder Amerika oder sonst irgendetwas in der realen Welt ‚sei‘, zeigt ein verworrenes Denken. Platons Atlantis war, genau genommen, eine Idee in Platons Verstand, nicht mehr und nicht weniger“ ([26], Seite 177, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Und das ohne den geringsten Beweis! Was mag dieser Mann wohl „klares Denken“ nennen? Auch Hermann und Georg Schreiber erklärten aber 1955:
„Platon war Dichter, bevor er sich ganz der Philosophie zuwendete; dies ist aus vielen seiner Werke zu spüren, auch aus dem hier wiedergegebenen. Wer ihn genauer kennt, wer sich die Mühe macht, die Atlantiserzählung im Zusammenhang mit dem Gesamtwerk zu betrachten, wird nicht auf den Gedanken kommen, hier sei eine Sage im richtigen Sinn dieses Wortes niedergeschrieben. … So wie niemand nach der Höhle sucht, in der sich Platons weltberühmtes Höhlengleichnis abspielt, so hat weder er selbst noch sein großer Schüler Aristoteles oder ein anderer Zeitgenosse an die Realität von Atlantis geglaubt. … Die Wundersucht der Neuzeit hat dann immer geglaubt, das Gedankenbild auf Erden suchen zu dürfen. So ist keine der wirklich versunkenen Städte so berühmt geworden wie Stadt und Staat Atlantis, die es nie gegeben hat“ ([27], Seite 44).
Etwas später beschuldigen sie Platon gar, mit dem Atlantis-Bericht „das wohl hartnäckigste Trugbild der Menschheitsgeschichte“ in die Welt gesetzt zu haben ([27], Seite 45). Ich werde mich im Verlauf dieses Buches noch aufzuzeigen bemühen, dass nichts von diesen Behauptungen zutrifft. Als ein besonderes Beispiel sei dazu aber noch der amerikanische Wissenschaftler W. A. Heidel angeführt, dessen Haltung von dem Wissenschaftsjournalisten James W. Mavor folgendermaßen wiedergegeben wird:
„Er behauptet, Platon habe – ebenso wie andere Persönlichkeiten des vierten Jahrhunderts v.Chr. in ihren literarischen Werken – die ägyptischen Priester nicht etwa deshalb in dieser Geschichte auftreten lassen, weil sie im damaligen Griechenland besonders hoch geschätzt worden seien – das Gegenteil war der Fall –, sondern weil er eine Satire beabsichtigte“ ([28], Seite 47).
Auf diese Vorstellung trifft aber auch zu, was Wilhelm Brandenstein gegen die Ansicht vorbrachte, es habe sich um einen Scherz Platons gehandelt:
„Ein Scherz war die Atlantiserzählung aber schon deswegen nicht, weil sie ja die praktische Bedeutung und den realen Charakter der platonischen Staatstheorie erweisen sollte, was doch nur durch ein historisch erweisbares, das heißt, durch ein hieb- und stichfestes Beispiel möglich war“ [29], Seite 42, Hervorhebung im Original).
An vielen dieser Zitate ist also einer der Wesenszüge dieser Art von Kritik zu erkennen: Das Vertreten unbewiesener Behauptungen (im einen Beispiel, Atlantis sei eine Idee oder Erfindung Platons, im anderen, es sei eine Satire oder ein Scherz) als >wissenschaftliche Wahrheiten<. Dieses Vorgehen ist jedoch vollkommen unwissenschaftlich, denn es versucht nicht einmal, die eigene Behauptung zu beweisen, sondern verlangt entgegen der Unschuldsvermutung von den Verteidigern die Widerlegung. Hinzu kommt häufig noch die Verunglimpfung von Menschen, die in Atlantis mehr als eine Erfindung Platons sehen. Ein besonders krasses Beispiel dafür berichtet Frank Joseph 2005:
„Ein Mainstream Archäologe, der für ein kürzliches Special zu Atlantis für den Discovery Channel interviewt wurde, erklärte, die einzigen Menschen, die an solchen Müll glauben, sind Durchgedrehte, Narren und Scharlatane“ (Frank Joseph: »Atlantology: Psychotic or Inspired?« in: [30], Seite 152, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Dagegen stellt sich ein anderer Archäologe, Paul Jordan, hin und beklagt
„… eine ungerechte und selbst hässliche Einstellung gegenüber professionellen Archäologen, die uns“ [das heißt: die Archäologen, P.N.] „im >alternativen< Lager immer noch begleitet“ ([10], Seite 88, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Später beklagt er dann, dass „ihr“ [der Atlantis-Forscher, P.N.] Dilettantismus Verunglimpfung der Profis beinhaltet“ ([10], Seite 121). Und das, wo er selbst spricht von den
„… perversen Arten des Denkens, zu welchen wir sie“ [das heißt: die Atlantis-Forscher, P.N.] „im Stande wissen“ ([10], Seite 115, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Selbst John Michael Greer gibt aber „eine lange und hässliche Geschichte hinter dieser Einstellung“ der „orthodoxen Wissenschaftler“ zu, auch wenn er direkt danach das Gegenteil behauptet ([6], Seite 106). Ebenso, dass die „Geringschätzung, die viele Atlantis-Forscher für konventionelle Wissenschaft haben“, nur die Reaktion auf solche Verunglimpfungen ist (am angegebenen Ort). So kann es jedenfalls nicht verwundern, dass Pierre Vidal-Naquet das Verständnis von Atlantis als Realität „eine ständig wiederkehrende Krankheit“ nennt ([31], Seite 13). Auch Paul Jordan spricht von einem „Atlantis Syndrom“ ([10], Seite 47 und öfter), das heißt, einem einheitlichen Krankheitsbild ([32]). Und Pierre Vidal-Naquet redet später von „Hirngespinsten“ ([31], Seite 18). Andererseits führt derselbe Mann aber seine Leserinnen und Leser mit einer Textfälschung hinters Licht, indem er in zwei direkt aufeinander folgenden Zitaten einmal griechisch „Logos“ und einmal griechisch „Mythos“ mit „Sage“ übersetzt ([31], Seite 20).
Ein anderes Beispiel für diese Art der Auseinandersetzung mit der Atlantis-Forschung gibt wieder der oben erwähnte Paul Jordan zum Besten:
„(… beides, Religion und Atlantologie spielen menschliche Leistungen herunter. Das Atlantis-Syndrom verdankt religiösen Traditionen des Denkens sehr viel)“ ([10], Seite 87, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Und später führt er aus, Atlantologie sei
„… tatsächlich eine Art Religion in Zivilkleidung, die sich als Geschichte und selbst als Wissenschaft aufbläht“ ([10], Seite 213, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Man meint, im verkehrten Film zu sein! Die begründete (!) Überzeugung, Atlantis sei einst Realität gewesen, als „Krankheit“ (bei Paul Jordan: ein „Syndrom“, also ein einheitliches Krankheitsbild) zu bezeichnen, ist schon ebenso unverschämt wie die Bezeichnung der Atlantis-Forscher als „Narren“ durch Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff! Doch Paul Jordan vergleicht dann nicht etwa die Wissenschaft mit der Religion, die
1. einen der Religion entsprechenden Wahrheitsanspruch vertritt,
2. mit der Inbrunst der Inquisition gegen abweichende Meinungen vorgeht und sie wie Häretiker aus ihren Reihen ausschließt (siehe das Zitat von Professor Högbom hier Seite → und vergleiche allgemein [33]).
Vielmehr wendet er diesen Vergleich auf Forscher an, die danach trachten, die Vorgeschichte der Menschheit zu verstehen. Eine der wohltuenden wissenschaftlichen Ausnahmen ist dagegen Pierre Termier, der 1912 sagte:
„Es erscheint durchaus möglich, dass die Poeten ein weiteres Mal Recht behielten. Nach einer langen Zeit herablassender Indifferenz“ [das heißt: Gleichgültigkeit, P.N.] „kehrt die Wissenschaft seit wenigen Jahren zu Atlantis zurück. Noch gibt es keine Bestätigung, aber es wird zunehmend deutlich, dass sich eine weite Region, entweder kontinental oder in Form großer Inseln, westlich der Säulen des Herakles oder der Straße von Gibraltar absenkte, und dass diese Absenkung in naher Vergangenheit geschah“ (zitiert nach: [34], Seite 159).
Und Richard Hennig schrieb schon 1925:
„Zunächst muss die weitverbreitete und beliebte Hypothese, dass Platon uns eine reine Fabel geliefert hat, aus allgemeinen kulturpsychologischen Erwägungen heraus abgelehnt werden. Es wäre ohne Beispiel in der Weltliteratur, dass die Beschreibung eines reinen Fabellandes an wohlbekannte geographische Namen anknüpft. … Aus diesem Grund kann als erste und oberste These aufgestellt werden: es muss als ausgeschlossen gelten, dass der Atlantisbericht Platons einfach aus der Luft gegriffen ist, dass ihm nicht positive Tatsachen zugrunde liegen“ ([35], Seite 14 f., Text von mir redigiert, Hervorhebung im Original).
Ebenso schreibt auch H.S. Bellamy 1948 sehr schön dazu:
„Ich plädiere hiermit dafür, dass Platons Mythos, der Urquell all unserer Kenntnis über Atlantis, im Wesentlichen als ein Tatsachenbericht akzeptiert werde“ ([36], Seite 49, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Und der russische Forscher Viatscheslav Koudriavtsev schrieb in seinem Essay »Atlantis: A New Hypothesis« [»Atlantis: Eine Neue Hypothese«]:
„Meiner Meinung nach ist das gewichtigste Argument für die Annahme, dass Atlantis nicht von Platon erfunden wurde, dass die Zeit, als es, wie von Platon angegeben, verschwand und die von ihm beschriebenen Umstände seines Verschwindens mit den Daten über die Zeit und das Ende der letzten Eiszeit und eine wesentliche Änderung des Weltmeeresspiegels, die es begleiteten, übereinstimmen, die ohne Zweifel für Platon nicht zugänglich waren“ (zitiert nach: [37], Seite 115, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Richard Firestone, Allen West und Simon Warwick Smith schreiben ebenso:
„Die Legende von Atlantis passt sehr gut zu den bekannten Fakten des Ereignisses“ [gemeint ist das Ende der Eiszeit, P.N.]: „Erdbeben, Tsunami-Wellen und steigende Meeresspiegel, die eine große Inselkultur und alle Bewohner vernichteten“ ([38], Seite 328, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Trotz ihrer besseren Argumente waren die Gegner der Behauptung, Platon habe die Geschichte erfunden, in der Wissenschaft jedoch immer in der Minderheit. Im Folgenden will ich mich bemühen, zu zeigen, dass sie dennoch Recht hatten.
1. Gegenargument: Verschiedene Zeugnisse für Atlantis
„Zahlreiche namhafte Gelehrte, sowohl vor Platons Zeit als auch danach, stimmen über den historischen Aufstieg und Fall der atlantidischen Zivilisation überein. Bei meiner Forschung habe ich Beschreibungen der <atlantidischen> Gesellschaft von siebenundachtzig antiken Autoren über einen Zeitraum von tausenden Jahren gefunden“ (Richard Wingate in: [39], Seite 53, eigene Übersetzung aus dem Englischen, in spitzen Klammern Einfügung hinzugefügt).
Bezüglich der angeblichen Erfindung von Atlantis durch Platon ist zunächst darauf hinzuweisen, dass bereits Proklos (412 – 485 n.Chr.) nebenbei bemerkt, dass
„… der Atlantische Ozean seinen Namen von Atlantis bekam“
([31], Seite 52 f.).
Proklos bezieht sich dabei auf die Angabe in »Kritias« 114a:
„Auch legte er“ [gemeint ist: Poseidon, P.N.] „allen“ [gemeint ist: seinen Söhnen, P.N.] „Namen bei, und zwar dem ältesten und König den, von welchem auch die ganze Insel und das Meer, welches ja das atlantische heißt, ihre Namen empfingen. Dieser erste damals herrschende König wurde nämlich ‚Atlas‘ genannt“ ([40], Seite 453, Text von mir redigiert).
Charles Berlitz schreibt daher durchaus zu recht:
„Selbst wenn es für die einstige Existenz von Atlantis keinen anderen Beweis gäbe als den Namen, wäre das allein schon ein beinahe überzeugendes Argument dafür, dass hinter der Legende etwas Wahres steckt“ ([41], Seite 122 f.).
Nun erklärt jedoch Franz Susemihl 1857 in einer Endnote zu dem Namen des Atlantischen Ozeans:
„Dieser Name kommt von Atlas, dem Wächter der Säulen, auf welchem das Himmelsgewölbe ruht, oder dem Träger dieses Himmelsgewölbes selbst nach der griechischen Mythologie, den man sich als im fernen Westen wohnend dachte, und danach hat Platon auch den Namen der fabelhaften Insel erst geschaffen“ ([23], Endnote 36 auf Seite 726 zu »Timaios« § 24).
Er leitet ihn also von dem Titanen Atlas ab, obwohl es schon ziemlich seltsam ist, den „Wächter der Säulen“ oder diese Säulen selbst, - die Pole der in den Himmel verlängerten Erdachse - ,als „im Westen wohnend“ anzunehmen. Seine unbegründete Behauptung steht aber im Gegensatz zu der von Proklos bestätigten Aussage bei Platon, der Atlantik habe seine Benennung erst nach dem ersten Poseidon-Sohn erhalten.
Gegen eine Erfindung des Atlantis-Berichtes könnte auch die Atlantiskarte Athanasius Kirchers sprechen. Noch Paul Jordan schreibt 2001 über ihre (von ihm ungenau wiedergegebene) Beschriftung, sie mache
„…ganz klar, dass er einfach eine Karte auf der Grundlage dessen zeichnete, was bei Platon darüber gesagt wird, wo Atlantis lag“ ([10], Seite 201, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Colin Wilson schreibt dagegen 2007 (leider ohne genaue Stellenangabe):
„Im ersten Buch seines enzyklopädischen Werkes »Mundus Subterraneus«, herausgegeben 1665, behauptet Kircher, dass die Karte, die er bei seiner Forschung entdeckte, den Ägyptern durch die römischen Eroberer gestohlen wurde. Das Original der Karte wurde noch nicht entdeckt, aber es scheint, insbesondere in einem wissenschaftlichen Werk, unwahrscheinlich, dass ein jesuitischer Gelehrter sich dies ausgedacht haben würde“ ([42], Seite 126, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Frank Joseph bestätigt diese Aussage 2008 und fügt (auch ohne genaue Stellenangabe) hinzu, dass die Karte im 1.Jahrhundert nach Rom kam und in der Vatikan-Bibliothek lagert ([43], Seite 33). Möglicherweise schlummert in den vatikanischen Archiven also ein Indiz für die einstige Existenz von Atlantis und erweist sich Edna Kentons Aussage von 1928 noch als richtig:
„Es kann sehr gut sein, dass in einem halben Jahrhundert diese alte ‚erfundene Karte‘ von Kircher noch interessanter als heute sein wird“ ([44], Seite 76, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Die Behauptung, Platon habe die Geschichte erfunden, ist jedoch allein schon deshalb unsinnig, weil Atlantis bei Völkern bekannt war, die Platon gar nicht kannten. Daher schreibt Robert von Ranke-Graves 1960 zu recht:
„Die ägyptische Legende von Atlantis – auch in den Volkssagen entlang der atlantischen Küste von Gibraltar bis zu den Hebriden und bei den Yorubas in Westafrika geläufig – kann nicht als reines Phantasiegebilde abgetan werden“ ([45], Band I, Seite 129).
Dazu passt auch die Aussage bei Harold T. Wilkins von 1952:
„… ein russischer Flüchtling, der in Algier lebt …, Herr Felipoff, weist richtig darauf hin, dass nicht nur in den Dialogen Platons, abgeleitet von dem, was die antiken Priester von Saïs und Heliopolis Solon erzählten, sondern <auch> in Mexiko und Südamerika antike Legenden über das Verschlingen von Atlantis und Rutas-Mu durch den Ozean existieren, über unzählige Generationen weitergegeben. Sie erzählen über einen gewaltigen kosmischen Kataklysmus, der Vulkanismus und eine große Flut von halb-globalen Ausmaßen hervorbrachte“ ([46], Seite 62, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
In Nordamerika gibt es in Bezug auf den Verbleib des Michigan-Kupfers ([47]) Überlieferungen, die sich auf Atlantis zu beziehen scheinen ([48], Seite 2 f.; [49], Seiten 23, 27, 30, 46, vergleiche dort Seite 16). Diese scheinen durch die Felszeichnung der „Cueva del Castillo“ (einer Höhle in Spanien) bestätigt zu werden
Abbildung 1: Felszeichnung der Cueva del Castillo (entnommen: [50] Seite 10 Figure 3). Es handelt sich um eine Umzeichnung von Dr. Christine Pellech der tatsächlichen Darstellung Sie deutet diese Darstellung allerdings auf die Meeresströmungen, statt auf die Küstenlinien. Dargestellt sind aber unstrittig Seehandelswege. Die Schöpfer der Darstellung (sie ist von mindestens zwei Personen gefertigt worden) sind offenbar ein Kapitän und (aufgrund der teilweise fehlerhaften Darstellung) sein Sohn. Links in der Mitte der Höhe (siehe den Pfeil) ist nach meiner Deutung Atlantis dargestellt, rechts davon ober- und unterhalb die Straße von Gibraltar.
Vergleiche dazu die Darstellung von Otto Muck (entnommen: [51], Seite 131, vergleiche auch dort Seite 41 und 136) auf der Grundlage der „erloteten Tiefenlinien“ (die Lage der Königsstadt kann allerdings nicht stimmen, da sie nach »Kritias« 113c „etwa in der Mitte der ganzen Insel 60 Stadien vom Meer entfernt“ (mehr als 11 km) gelegen haben soll. Außerdem hätte sie dann zum Gebiet von Gadeiros bzw. Eumelos gehört, gehörte aber nach »Kritias« 114a zu dem von Atlas).
In der Cueva del Castillo ist Atlantis zwar seitenverkehrt dargestellt (das ist einer der Fehler der Darstellung dort), aber die Form stimmt bemerkenswert mit der Darstellung von Otto Muck überein.
Zu der mündlichen Überlieferung schreibt aber Richard Wingate zu recht:
„Die weite Verbreitung der Atlantis-Geschichte zeugt ebenso von dem weitreichenden Einfluss des verlorenen Kontinentes“ ([39], Seite 48, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Phillip Smith schreibt gleichfalls in seinem Artikel über Atlantis in dem von William Smith herausgegebenen »Dictionary of Greek and Roman Geography« [»Lexikon der griechischen und römischen Geographie«]:
„Die Legende wurde in anderen Formen gefunden, die nicht vollständig von Platon kopiert zu sein scheinen“ (zitiert nach: [52], Seite 43, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Daher erklärt auch Warren Smith richtig:
„Wenn Platon nur einen vereinzelten Bericht über den verschwundenen Kontinent geschrieben hätte, könnten wir seine Werke verdächtigen. Aber Fragmente der Atlantischen Überlieferung haben in einer großen Vielfalt von Schriften durch die Jahrhunderte überdauert“ ([1], Seite 72, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Frank Joseph nennt beispielsweise drei antike Autoren, die in ihren Schriften Atlantis erwähnten:
„Statius Sebosus war ein griechischer Geograph und Zeitgenosse von Platon, der von dem römischen Wissenschaftler Plinius dem Älteren wegen seiner detaillierten Beschreibung von Atlantis erwähnt wurde. …
Dionysius von Milet, wegen seiner ledernen Armprothese auch als ‚Skythobrachion‘ bekannt, schrieb um 550 v.Chr. eine »Reise nach Atlantis«, nicht nur Platon, sondern auch Solon vorangehend. …
Ein anderer griechischer Historiker, Dionysius von Mytilene (430 – 367 v.Chr.) berichtet auf der Grundlage vorklassischer Quellen, dass
‚… von ihrem tiefwurzelnden Grund die phlegyische Insel, die der strenge Poseidon erschütterte und mit ihren gottlosen Einwohnern unter die Wellen warf‘.
In der feurigen (phlegyischen) Insel ist die vulkanische Insel Atlantis angedeutet, die vom Meeresgott zerstört wurde“ (Frank Joseph: »Atlantology: Psychotic or inspired?« in: [30], Seite 153, eigene Übersetzung aus dem Englischen).
Eberhard Zangger bestätigt, dass es bereits vor Platon Aussagen über Atlantis gab:
„Der Name Atlantis ist sogar aus der Zeit vor Platon belegt. So veröffentlichte beispielsweise Hellanikos von Lesbos, ein Gelehrter aus dem fünften Jahrhundert v. Chr., der sich mit Mythologie, Chronologie, lokaler Geschichte und Ethnologie beschäftigte, ein Werk mit dem Titel »Atlantis«. Es ist zwar verlorengegangen, findet aber noch vielfach Erwähnung (Jacoby 1923, 109f, 139; Fragmente 5, 134, 135; Jacoby 1954, 2).“ ([53], Seite 312, Endnote 59).
Auf Hellanikos von Lesbos nimmt auch Alan F. Alford Bezug. Obwohl er den Namen zu „Hellikanus von Lesbos“ verschreibt ([15], Seite 421, Endnote 24), gibt er in diesem Zusammenhang an, dass es in dessen Werk um „die sieben Pleiaden Nymphen“ als „Atlantiden“ ging, was „wörtlich die Töchter von Atlas“ bedeutet. Auch Rainer Krämer sagt über diesen Hellanikos von Lesbos:
„Von letzterem stammt übrigens ein Werk mit dem Titel »Atlantis«, das sich aber nicht mit versunkenen Kontinenten, sondern mit den Nachfahren des Titanen Atlas beschäftigt“ ([54], Seite 24).
Rainer Krämer und Alan F. Alford gehen also, wie andere Autoren, davon aus, dass kein Zusammenhang zwischen dem Titanen Atlas und dem Zwillingssohn von Poseidon besteht. Wie aber der Titel des verloren gegangenen Buches von Dionysius von Milet, »Reise nach Atlantis«, zeigt, könnte möglicherweise auch bei dem Werk des Hellanikos von Lesbos „Atlantis“ als ORT aufgefasst sein! Walter Schilling zitiert nämlich ein Fragment dieses Hellanikos von Lesbos, das Pherekydes in seinem Kommentar zum Argonauten-Epos des Apollonius von Rhodos mitteilt, in dem es heißt: