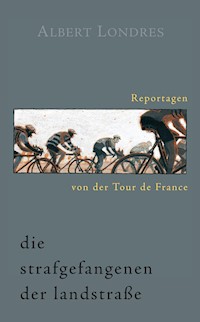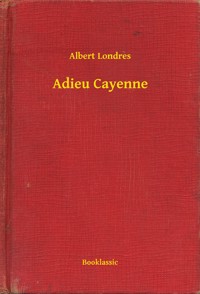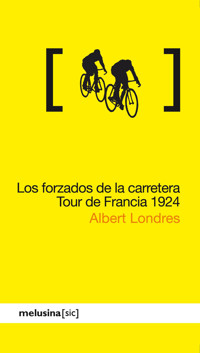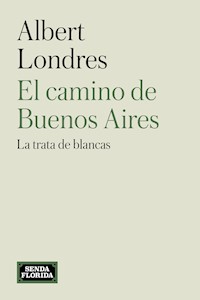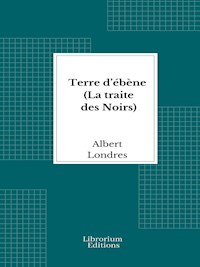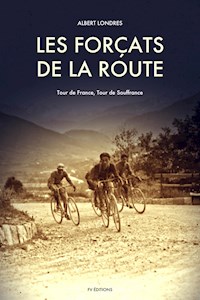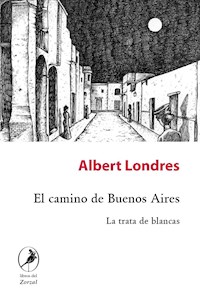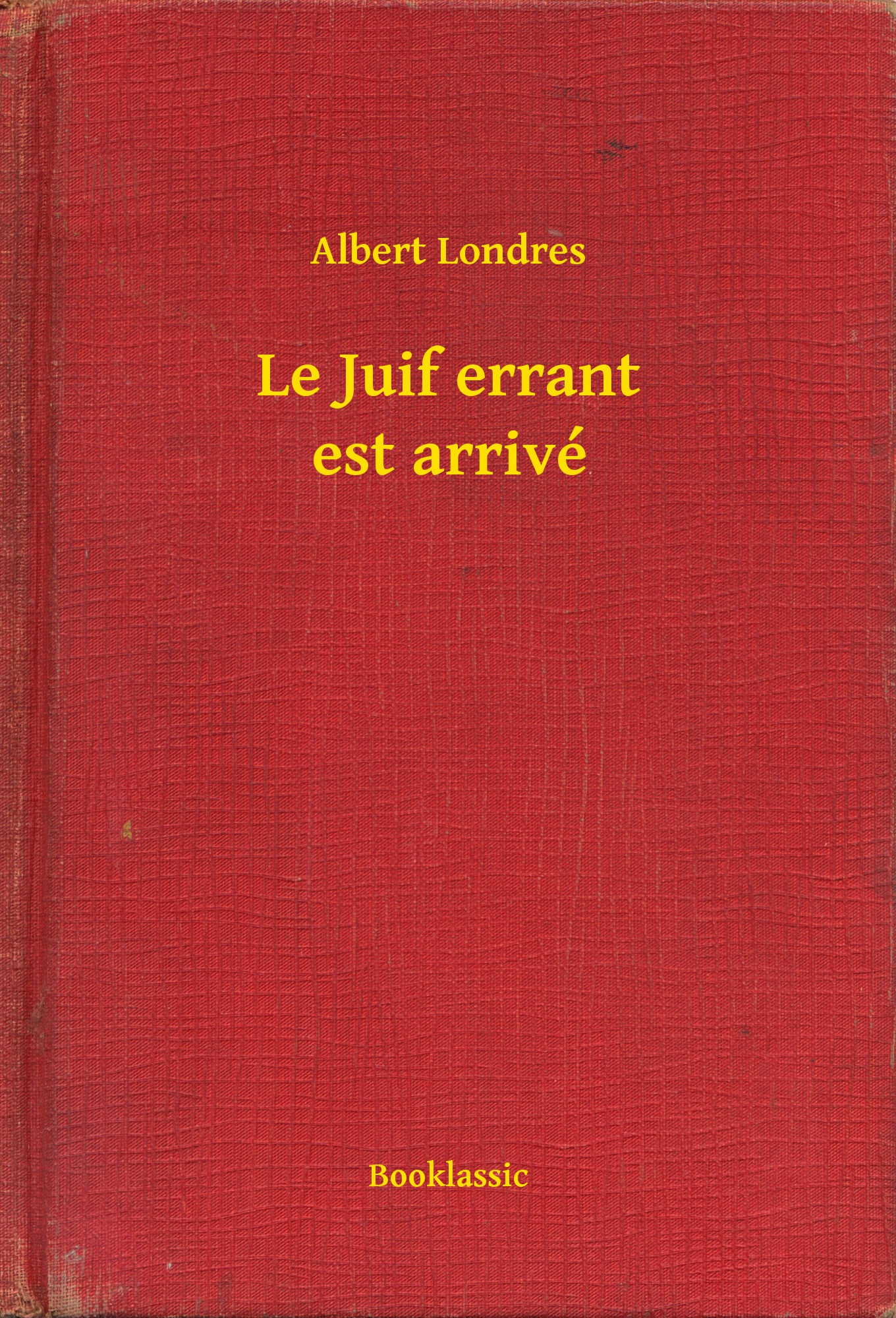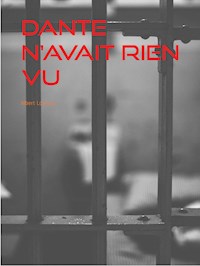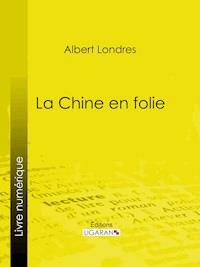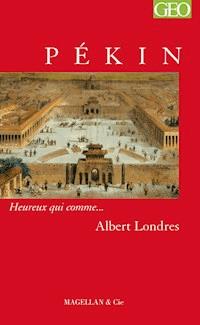16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: diaphanes Broschur
- Sprache: Deutsch
September 1914: Die Deutschen stehen vor Reims. Sie beschießen das Symbol der Grande Nation: die Krönungskathedrale der französischen Könige. Der gewaltige Bau steht im Todeskampf, ausgeweidet, vom Feuer zerfressen: nur noch eine Wunde in der verwüsteten Stadt. Sein kurzer Augenzeugenbericht über die Bombardierung von Reims machte Albert Londres, damals dreißigjährig, von einem Tag auf den anderen bekannt – und sein Stil als Reporter wurde zum Nonplusultra. Schlaglichtartig kommen seine Berichte daher, knapp, heftig, auch hundert Jahre danach noch von drastischer Nähe.
Der Band versammelt die Kriegsberichte, die Albert Londres 1914 für »Le Matin« von der Front kabelte – bevor er kündigte und ab 1915 für »Le Petit Journal« aus Südosteuropa berichtete. Seine beispiellose (und nur 18 Jahre dauernde) Karriere als rastloser Reporter, der als ebenso unbequemer wie unbestechlicher Beobachter seiner Zeit die ganze Welt bereiste, hatte begonnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Albert Londres
Was sind neun TageSchlacht?
Frontdepeschen 1914
Aus dem Französischen von
Inhalt
Bilder vom Krieg — Eine Nacht im Lager — Soldat mit sechzehn Jahren — Die Wut der Barbaren — Bei Anbruch der Schlacht — Sie bombardieren Reims… — Der Todeskampf der Basilika — Die Senegalesen in der Schlacht — Ein Coup — Auch Arras! — Die befestigte Stadt — Bei den Helden — Im Kampfgeschehen — Bei unseren Freunden — In Nieuwpoort — Vor Diksmuide — Eine menschliche Stimme unter den Kanonen — Sechs Schiffe, vom Strand aus gesehen — Die Fröhlichkeit unserer Soldaten — Auf den Ruinen von Ypern — Die Flandernschlacht — Eine Königin geht vorbei — Das Joch der Angst über zwei Städten — Das Heldenepos vor Ort — Der Krieg über Arras —Editorische Notiz
Bilder vom Krieg
Das Land war noch warm.
Hinter einem Heuschober markierten die Kadaver des Feindes die äußerste Grenze des deutschen Vormarschs. Niedergemacht in den verschiedensten Stellungen, vermählten sie sich auf unheimliche Weise mit dem Erdboden. Beim Gedanken an die Eltern, die niemals die Stelle kennen würden, wo sich das Schicksal ihrer Söhne erfüllt hatte, konnten wir unser Mitgefühl nicht verweigern.
Das Geschütz sprach zum Raum. Wir folgten seiner Stimme. Es sprach kurz und trocken, als gäbe es Befehle. Wir näherten uns ihm und gerieten dabei in die französischen Linien. Dort gestattete man uns dann, dem beizuwohnen, was das Oberkommando in seinem Kommuniqué vom siebenten September, dreiundzwanzig Uhr, wie folgt zusammenfasste: »In Paris haben sich die Einheiten der Abwehr in der Nähe der Ourcq erfolgreich Gefechte geliefert.«
Um dorthin zu kommen, hatten wir einen Teil der Ile-de-France durchquert. »Le pays national«, so nannte man sie im Mittelalter. Nun hatte sie dieses Privileg zurückerobert: Die Ile-de-France war die pulsierende Seele der Nation. Sie war der Krieg mit all seinem Schmutz und all seinem Jammer.
Den Jammer bekamen wir während der zwei Stunden unterwegs zu spüren. Keine Bewohner mehr, keine Alten mehr auf der Schwelle, keine schmutzigen Kinder mehr, die die Augen gegen den Straßenstaub zukneifen, den die Wagen aufwirbeln.
Aber einen Menschen finden wir hier noch. Wir stehen an der Marne. Es ist der Fährmann. Was kann er noch transportieren, wenn alles verlassen ist?
»Von Zeit zu Zeit fahre ich ganz allein«, sagt er. »Die Brücken sind ja zerstört, alle sind evakuiert.«
Um ihm eine Freude zu machen, ließen wir uns hinübersetzen.
»Dieses Dorf war zweitausend Jahre alt, meine Herren. Hören Sie jetzt.«
Wir hörten nur den Schlag seines Ruders.
Verlassen wir die Marne. Fahren wir weiter. Die Toröffnungen sind immer noch leer, und noch immer sind keine Kinder da.
Langsam jetzt. Ein Konvoi. Hundert »ganz frische« deutsche Gefangene werden abgeführt. Im Bourbonnais hatten wir schon welche gesehen, aber im Waggon, will sagen im Käfig. Diese hier sind aufregender: Sie kommen vom Kampfgeschehen. Ihre Augen sind noch nicht zur Ruhe gekommen, von einem Wirbel gepackt. Noch haben sie ihre Entwaffnung nicht wirklich begriffen. Sie haben den Lärm des Krieges im Ohr und an der Schulter spüren sie den Druck des Gewehrs. Sie marschieren, ohne zur Wirklichkeit erwacht zu sein. Trostloser Rausch!
Die Geschütze sind deutlich zu hören. Nicht bloß wie ein Geräusch, das einen zum Nebenmann sagen lässt: »Hör mal!« Wir nehmen sie jetzt wahr, ohne hinzuhören. Das Herz zieht sich einem zusammen wie der Mund vom Geschmack einer Zitrone. Wir nähern uns der Linie. In der Ferne scheinen die Felder schwach zu dampfen.
Ein Posten bedeutet uns, man habe eine Ulanenpatrouille entdeckt. Sie bewegt sich längs eines Waldrands. Es gibt viele kleine Wäldchen hier. Das Risiko ist groß. Wir folgen weiter der Straße. Sie führt uns zu den französischen Linien. Statt des Jammers jetzt Pulverdampf.
Die französischen Linien! Wir erreichen sie zum ersten Mal. Seit vierzig Tagen spricht man vom Heldentum, endlich begegnen wir ihm von Angesicht zu Angesicht. Ehrfurcht lässt uns innehalten. Wie fromme alte Frauen beim Empfang der Hostie empfinden wir das Bedürfnis, uns erst einmal zu sammeln, während das göttliche Gefühl in uns aufsteigt.
Dann sagt uns ein Dragoner:
»Sehen Sie den Kirchturm da? Da war es, vorgestern. Sie haben das Dorf eingenommen. Sie hatten über den Fluss gesetzt, diese Banditen. Der französische Oberst inspizierte sein Regiment. Zu den Soldaten sagte er: Kinder, das Schicksal des Vaterlandes hängt an der Spitze eurer Bajonette. Kommt mit jetzt. Das Signalhorn tönte: Vorwärts! Sie gingen ran. Die Deutschen sind wieder zurück übers Wasser. Bis dahin haben wir sie zurückdrängt. Ein bisschen höher, bitte. Sehen Sie den anderen Kirchturm da hinten? Sie sehen ihn nicht? Ja, da unten. Da waren sie gestern. Das ging heiß her gestern. Ab vier Uhr morgens. Abends waren sie raus aus diesem zweiten Dorf da. Heute – aber was suchen Sie denn da drüben? Etwa das Geschütz? Du liebe Güte! Interessiert das noch wen? Sie haben nichts gesehen, sagen Sie? Hören Sie mir mal zu. Jetzt gerade sind sie vier Kilometer von hier weg. Heute Morgen waren’s noch zwei. So schnell geht das nicht. Die klammern sich fest wie die Wanzen, Stück für Stück muss man sie herauspulen. Immerhin, in drei Tagen mussten sie acht Kilometer zurückweichen. Und wie das zuging!«
Es kam der Befehl zum Aufsitzen.
Das Regiment entfernte sich. Nach einiger Zeit erschienen auf der leeren Straße die Wagen und Karren der Ambulanzen. Die man aufgelesen hatte, wurden zu den Verbandplätzen gebracht. Viele hatten offene Wunden. Bei anderen sickerte Blut durch den Stoff. Einige versorgte man an Ort und Stelle. Es waren Afrikaner. Zwei von ihnen starben. Man legte sie auf jene Erde, für die sie gekämpft hatten. Ihrer gedenkend, gedachten wir ihrer Heimat.
Das Geschützfeuer hörte nicht auf. Schon neigte sich der Tag. Nur noch als Schatten sah man die Reiter übers Feld huschen. Das Geschütz verdoppelte sein Feuer, um die letzte Helligkeit auszunutzen. Aufrecht standen wir da, an eben dem Platz, den das Regiment gerade verlassen hatte. Aufrecht, mit dem Blick verfolgend, was man kaum sah, aber stets hörte – in immer rascherer Folge den hoheitlichen Ruf des zornigen Vaterlands.
Le Matin, 10. September 1914
Eine Nacht im Lager
Wir hatten das Regiment ziehen lassen. Diesmal war die Nacht hereingebrochen. Das Geschütz, das in der Dämmerung Schlag auf Schlag gefeuert hatte, flaute ab. Schatten bedeckte die Felder. Es wurde still.
Noch lange rauschte es uns in den Ohren wie von einer Muschel. Die Wetterhähne auf den Kirchtürmen, die den Adler hatten fliehen sehen, sahen einander nicht mehr. Überall Schweigen, das auf der Seele lastete.
Auf einmal Fahrzeuggeratter. Es kommt aus Richtung Paris. Es sind örtliche Taxis, die die Verwundeten holen kommen. Sie wirbeln mächtig Staub auf; wir denken nicht daran, auszuweichen. Die Normalität interessiert uns nicht mehr. Die Sanftheit des Friedens hat ihre Lockung für uns verloren. Die Früchte dieses Tages sind herber, die Kehle passt sich an.
Die Taxis überholen uns. Wir folgen ihnen. Sie halten in Sichtweite von N…, wo sich am Tag die Kämpfe abgespielt hatten.
Nicht alle Verwundeten sind zu den Verbandplätzen gebracht worden. Der Großteil von ihnen liegt noch auf dem Feld verstreut. Kein Mondlicht. Wir wagen nicht, weiterzugehen: Man könnte auf einen leidenden Körper treten! In zwanzig Metern Abstand bleiben wir im Dunkeln stehen.
Mit den Augen folgen wir den Laternen, die das Feld durchsuchen. Deutlich sehen wir, wie die Sanitäter sich bücken, einen Soldaten aufheben, auf die Bahre legen und mitnehmen. So bückten sich einst auch die Bauern über diese Erde, aber für andere Ernten. Die gestrigen Ernten nährten das Vaterland. Die von heute Abend retten es.
»Wo hat’s dich erwischt?«, fragt ein Verwundeter seinen Nachbarn.
»Am Arm.«
»An welchem?«
»Am rechten.«
»Verdammt!«
»Ist mir wurscht, bin Linkshänder.«
Ein anderer überschüttet seinen Sanitäter mit Vorwürfen:
»Du hast meinen Helm fallen lassen, als du mich aufgelesen hast. Geh ihn suchen!«
Der Sanitäter hat keine Lust, umzukehren.
»Geh, hol meine Trophäe«, wiederholt er, »oder ich steige nicht in deinen Schlitten!«
Man findet einen anderen Helm für ihn.
»Das ist aber doch blöd, wenn man nicht mehr hat, was man gewonnen hat!«, sagt er.
Die Laternen streichen weiter über das Feld. Man sieht nur den roten Punkt am Ende des Arms. Aber nicht alle werden aufgelesen. Manche werden die Ile-de-France nicht mehr verlassen. Sie werden bleiben, stets gegenwärtig. Die unterirdische Garde.
Die Taxis kehren in Richtung Paris zurück. Zu Fuß gehen wir weiter bis zu dem Posten, an dem wir nicht vorbeikommen. Wir erkennen die Hügellandschaft der schlafenden Armee. Nirgends ein Feuer. Für einen Augenblick das anschwellende Knattern eines Motorrads. Der Melder fährt vorbei, den Kopf gesenkt haltend. Seinen Lichtstrahl nimmt er schnell mit sich. Was für ein Abend!
Der ganze Tag war ein Schaustück der Geschichte. Noch in Jahrhunderten werden die Kinder lernen, was sich hier abgespielt hat. Nur noch Stahlgetöse, Blitzschläge, Fleisch gegen Fleisch. Menschliche Linien, die aufeinanderprallten, sich ineinander verbissen, sich niedermachten. Ein und dieselbe Aufwallung, die die schönste Jugend des schönsten Vaterlands beseelte und vorwärtsdrängte. Man lebte, starb, stand wieder auf. Jetzt aber herrscht Schweigen, jetzt ist Totenwache. Davon wird keiner erzählen, das werden die Kinder nicht lernen. Es steht am Seitenrand. Rühren wir uns nicht, damit wir sie nicht knicken, diese Seite.
Die Stunden vergehen, wir verspüren gleichbleibende innere Erregung.
Mitten in der Nacht nähern sich schwere Fahrzeuge. Wir hören sie von weitem. Sie fahren langsam: Hungrig erwarteter Nachschub trifft ein.
Es sind Autobusse, wir kennen sie. Wie oft sind wir auf den Boulevards im Fahren aufgesprungen, haben in ihnen geplaudert, geraucht, manchmal gelächelt. Wie anders ist jetzt das Antlitz der Dinge!
Wir können uns nicht enthalten, zu horchen. Diese momentane Stille scheint uns nicht normal. Jeden Augenblick glauben wir, eine Klage zu hören, eine Stimme, die ruft. Falsch. Keiner gibt ein Zeichen. Keiner ruft. Es ist unser erregter Geist, der die Ebene sprechen lässt.
Unser erregter Geist ist es auch, der uns an jene deutschen Leichen denken lässt, die wir tags gesehen hatten. Und an alle anderen, die unsere Truppen hingemäht haben, an die Art, wie die Generale des Kaisers sich ihrer nutzlos gewordenen Soldaten entledigen.
Sie lassen ihre Leichen zu Haufen schichten. Wird die Pyramide höher, so wirft man sie mit aller Kraft, damit der Schwung sie höher trägt. Ist die Pyramide fertig, steigt jemand hinauf, stolpert bisweilen in einen Zwischenraum, und gießt von unten bis oben eimerweise Petroleum an. Dann wird sie angezündet. Die Kleidungsstücke brennen, das Fleisch bläht sich, das menschliche Gebirge schrumpft. Möge der Wind diese Ausdünstungen erbarmungslos über den Rhein tragen!
Dieser Rauch ist es, den wir im Geist aufsteigen sahen.
Vertreiben wir diese Gespenster, die sich allzu aufdringlich an uns heranmachen. Es ist nicht der Moment, sich den Geist verwirren zu lassen. Hören wir nicht auf die Nacht. Es wäre eine schlechte Vorbereitung auf das kommende Wort der Morgenfrühe.
Le Matin, 12. September 1914
Soldat mit sechzehn Jahren
Sie haben Vater und Mutter getötet – er rächt sie
Das Infanterieregiment, das sich etwa Mitte August von Longuyon nach Spincourt begab, war von zwei berittenen Jägern begleitet, die den Auftrag hatten, seinen Marsch abzusichern. Als sie sich einem kleinen Wäldchen näherten, dessen letzte Büsche am Wegesrand verdorrten, bemerkten die beiden Reiter eine verdächtige Gruppe, in der sie deutsche Uniformen ausmachen zu können glaubten.
Nach kurzem Galopp kamen sie, den Karabiner in der Faust, in Schussweite, feuerten zweimal und luden. Wie Elstern, die man bei der Mahlzeit stört, flatterte ein halbes Dutzend Ulanen auf; die Unseren, die ihre Pferde bis zu der Stelle getrieben hatten, wo sich der Feind irgendeinem mysteriösen Geschäft gewidmet zu haben schien, entdeckten dort, an einen Baum gefesselt und geknebelt, einen jungen Mann von kaum sechzehn Jahren, fast ein Kind noch.
Man band ihn los, man befragte ihn. Die Deutschen hatten seinen Vater und seine Mutter getötet, und als der tapfere Junge sich wütend und verzweifelt auf die Mörder der Seinen stürzen wollte, sie beschimpfte, sie mit ohnmächtigen Händen zu schlagen versuchte, hatte man ihn, wie einst bei den Rothäuten, an den Marterpfahl gebunden und wollte ihn erschießen, als die Unseren zu seiner Befreiung herbeigeeilt waren.
Die beiden Reiter, die nicht wussten, was tun, um ihn in dieser von Kämpfen verwüsteten Gegend in Sicherheit zu bringen, nahmen ihn ganz einfach mit zu dem Regiment, das sie begleiteten, und zunächst zur sechsten Kompanie des Bataillons, dem sie zugeteilt waren.
Als der Hauptmann von der Angelegenheit unterrichtet war, nahm er den Waisenjungen, der ihnen da vom Himmel gefallen war, unverzüglich im Namen seiner Männer in Obhut. Er bekam seinen Platz beim Essenfassen und Kampieren. Man gab ihm eine Militärdecke; man kürzte für ihn die Rockschöße eines Soldatenmantels; man trieb eine Hose, Gamaschen und eine Mütze auf. Bald war er imstande, der Truppe zu folgen und in seinem Gehabe in allen Einzelheiten mit ihr eins zu werden. Und weil er trotz seiner Jugend tapfer, kräftig und geschickt ist, vertraut man ihm schließlich zusammen mit der ganzen Ausrüstung eines Gefallenen auch ein Gewehr an.
Von Osten kommend näherte sich das Regiment Paris, um sich dann erneut zu entfernen und an den Kämpfen teilzunehmen, die eben die Ufer der Marne mit Ruhm bedeckten und mit Blut tränkten. Der Fahne treu, die ihn in Obhut genommen hatte, folgte der Waisenjunge aus Lothringen den Tapferen, die ihn aufgelesen hatten, auf allen ihren Wegen. Gewiss ist seine Gestalt noch etwas unter der Normgröße; gewiss sind sein junges bartloses Gesicht und seine erstaunten, großen blauen Augen, wenn man sie im Vorbeigehen wahrnimmt, überraschend, und noch ist er eher ein großes Truppenkind als ein Soldat. Aber seine großen Waffenbrüder zu verlassen, davon will er nichts wissen; er folgt ihnen, und manchmal geht er ihnen voran.
Hat sich der Offizier, der ihn derart in Dienst genommen hat, im Sinne der Vorschrift schuldig gemacht? Wird man ihm vorwerfen, dieses Kind nach seiner Rettung behalten zu haben? Ist es wirklich verboten, Helden jeden Alters zu rekrutieren? Immerhin ist es möglich, dass die öffentliche Meinung anders urteilt und dem Anführer dieser Truppe von Landsern die Absolution erteilt, der der Meinung war, dass beim Vaterland, jener Mutter, in den Tagen der Gefahr für all diejenigen seiner Söhne Platz ist, die Mut haben.
Le Matin, 14. September 1914
Die Wut der Barbaren
Sie achten weder die Schönheit noch den Tod
Als sie über Meaux, das sie einnehmen wollten, die Belagerung verhängt und die Stadt zu bombardieren begonnen hatten, installierten die Deutschen ihren Generalstab ein paar hundert Meter von dem Dorf Congis entfernt im Schloss von Gué. Vornehme Bauten, hinter dem Laub hundertjähriger Bäume verborgen, die auf ihrer Höhe die bezauberndste aller Landschaften beherrschen.
Mit sehr sicherem Geschmack waren die riesigen Zimmer mit alten Möbeln ausgestattet worden. Tapisserien von unschätzbarem Wert schmückten sie, und noch die geringsten Einzelheiten der Dekoration waren mit großer Sorgfalt vom gegenwärtigen Besitzer gestaltet worden, einem Architekten von klugem Talent.
Von alledem sind nur noch Trümmer übrig. Aufgebrochen die Kommoden von Boulle, besudelt die Tapisserien der Savonnerie, zerbrochen die Empire-Fauteuils mit den feinen Samtbezügen, aufgeschlitzt die Leinwände berühmter Meister.
Die Horde der Barbaren hat diese Orte verwüstet und nicht einmal die Wäsche der Hausherrin respektiert, wobei sie sich ihrer zu ekelhaftestem Behufe bediente.
Als die englisch-französischen Armeen die Deutschen gezwungen hatten, die Belagerung aufzuheben und einen Rückzug einzuleiten, der sehr bald zur Flucht wurde, als es möglich war, ins Schloss von Gué vorzudringen, das – und in welcher Hast! – von seinen zeitweiligen Okkupanten verlassen worden war, bot sich den Eintretenden ein niederdrückendes Bild.
Auf dem Mosaik-Parkettfußboden des großen, in einen Lazarett-Schlafsaal verwandelten Salons lagen kreuz und quer verwundete Deutsche, stöhnend auf den Leichen ihrer Kameraden, die man, nachdem man sie auf einem Spieltisch im Vestibül operiert hatte, sterbend dorthin geworfen hatte.
Das Stöhnen der Verwundeten, das Ächzen der Sterbenden hatte den Generalstab, der im benachbarten Esszimmer gespeist hatte, nicht gestört. Zweiunddreißig Stühle zeigten die Zahl der Gäste an, deren Tafel mit den kostbarsten, in den Gewächshäusern des Schlosses gepflückten Blumen geschmückt war. Überall standen Flaschen edler Weine, feiner Liköre und Champagner. Die Flucht der Gäste musste äußerst überstürzt erfolgt sein, denn die Speisen auf den Tellern zeigten, dass die Mahlzeit unterbrochen worden war.
In diesem Schloss, das unermessliche Schätze barg und teilweise zum Lazarett umgewandelt worden war, waren sämtliche Toten einfache Soldaten. Bedeckt von aus dem Garten entwendeten Blumen, fand man im Garten auch zwei Offiziersgräber. Vor ihrem Verschwinden hatten die Kameraden Sorge getragen, Inschriften anzubringen, die die Franzosen ermahnten, die Grabstätten zu respektieren, bis zu dem Tag, da die Angehörigen der Verstorbenen die Leichen an sich nehmen würden.
Um zu demonstrieren, welche Verachtung sie für das Mobiliar ihres unfreiwilligen Gastgebers hegten, hatten die deutschen Offiziere den Billardtisch auf das zentrale Rasenstück bringen lassen und mit Pistolen darauf geschossen. Daneben hatten sie eine wunderbare Boulle-Kommode aufgebrochen, die voll war mit Schriftstücken, welche sie auf der Freitreppe verstreut hatten, inmitten anderer Überreste jeder Art, Waffen und Kleidungsstücken, die von toten, im Park begrabenen Soldaten stammten. Die Tapisserien hatten den Stiefeln der Soldateska als Fußabtreter gedient. Sie hatten gehaust wie die Landsknechte!