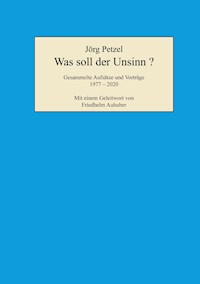
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Diese Sammlung von Vorträgen und Aufsätzen aus den Jahren 1977-2020 beschäftigt sich mit E.T.A. Hoffmann und seinen künstlerischen Zeitgenossen sowie mit bildenden Künstlern, die Hoffmanns Werke illustriert haben. Es folgen Beiträge über Friedrich Schillers Beziehung zur Französischen Revolution und über das weite Feld Theodor Fontanes. Eine literaturkritische Auseinandersetzung mit prägenden Autoren aus der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, Arno Schmidt, Günter Grass und Franz Fühmann, runden diesen Sammelband ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zum Geleit
I. E.T.A. Hoffmann
Hoffmann und Langbein
Hoffmann und die Allgemeine Musikalische Zeitung
Meister Floh – ein zensiertes Märchen
Kreisleriana (Nachwort)
E.T.A. Hoffmanns theatralische Sendung. Seine Beziehungen zu den Schauspielern Iffland, Holbein, Leo und Devrient
Antijüdische Affekte oder vermeintlicher Antijudaismus in E.T.A. Hoffmanns späten Almanach-Erzählungen
Bruder Medardus und der Pferdefuß oder E.T.A. Hoffmann und Wilhelm Dorow
II. Bildkünstler auf E.T.A. Hoffmanns Spuren
Illustrierte und bibliophile E.T.A. Hoffmann-Ausgaben
Der Zauber einer überregen Phantasie. Steffen Faust und seine Illustrationen zu E. T. A. Hoffmann
Klein Zaches – die magnetisierte Marionette
Doppelnaturen und Weltbürger. Die multimedialen Abenteuer der Gebrüder Häfner
„Sich träumend über die Misere zu erheben.“ Die Phantasiestücke und Märchen des Caspar Walter Rauh
Caspar Walter Rauh und sein Briefwechsel
III. Hoffmanneske Romantiker
Ein Geisterabend im Hause Hitzig
Caroline de la Motte Fouqué – eine preußische Romantikerin
Ritter und Bürger oder einige Gedanken zur Dürer-Rezeption von Fouqué und E.T.A. Hoffmann
Wilhelm Müller und E.T.A. Hoffmann
Jenseits der Weinschwaden und Legenden – Ludwig Devrient und E. T. A. Hoffmann als Kunstverwandte
Willibald Alexis und seine Beziehung zu E.T.A. Hoffmann
IV. Arno Schmidt
„Ich habe erlesene [G]esellschaft: [H]offmann…“ Arno Schmidt liest E.T.A. Hoffmann
Zwischen Sucht und SehnSucht. Arno Schmidt & Bibliomanie
V. Franz Fühmann
Hephaistos - Künstlergott und olympische Randfigur
Im bibliomanischen Labyrinth. Die Arbeitsbibliothek von Franz Fühmann
„Die Wanderungen sind Miststücke von Büchern“ oder Franz Fühmann auf den Spuren Theodor Fontanes
VI. Theodor Fontane
Und Gundermann vor Zorne sprühte. Über eine Nebenfigur in Theodor Fontanes Roman „Der Stechlin“
To beginn with the Beginning. Fontane und „Ein weites Feld“ von Günter Grass
Mickiewicz und Fontane
VII. Friedrich Schiller
Friedrich Schiller und die Französische Revolution
Vita
Quellenverzeichnis
Zum Geleit
Jörg Petzel muss man eigentlich hören. Er ist ein erstklassiger Referent und glänzender Rezitator. Doch jetzt entschließt er sich, unter dem sympathisch selbstironischen Titel seine weit verstreut und ebenso weit gespannt liegenden Themen, Vorträge und Aufsätze, entstanden in gut vier Jahrzehnten, zu veröffentlichen. Die Inhalte reichen vom Ende des 18. Jahrhunderts mit Friedrich Schiller, über das frühe und späte 19. Jahrhundert, also die Zeit der Romantik, mit E.T.A. Hoffmann, Caroline und Friedrich de la Motte Fouqué und Willibald Alexis, zu so markanten Theatermännern jener Zeit wie August Wilhelm Iffland, Franz von Holbein, Carl Leo und Ludwig Devrint, aber auch zum Sammler, Diplomat und Archäologen Wilhelm Dorow und den großen Romancier Theodor Fontane, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, mit den Schriftstellern Arno Schmidt, Franz Fühmann, Günter Grass und den Zeichnern und Grafikern Caspar Walter Rauh und Steffen Faust. Gleichwohl gehört bis heute seine besondere Aufmerksamkeit dem Universalkünstler E.T.A. Hoffmann und der deutschen Romantik.
Wenn Jörg Petzel über Bücher spricht und schreibt, lernt man ihn geradezu persönlich kennen in seiner schier unbegrenzten Liebe zu ihnen in Gestaltung und Inhalt. Deshalb ist meine Empfehlung einer Einstiegslektüre sein Vortrag vor dem Leipziger Bibliophilen Abend, gehalten am 7. Mai 2002: „Illustrierte und bibliophile E.T.A. Hoffmann-Ausgaben“, mit einem Längsschnitt bis in unsere Tage; setzt man die Lektüre fort mit seinen Aufsätzen über die Bibliomanen Arno Schmidt und Franz Fühmann, hat man schon fast den ganzen Petzel vor sich. Wie er sich auf Spurensuche ins „Bibliomanische Labyrinth“ Franz Fühmanns begibt und sich darin orientiert, ohne je den berühmten roten Faden zu verlieren, seine Funde ans Tageslicht bringt und sie Hörer und Leser präsentiert, ist schlicht bewundernswert. Mit Arno Schmidt begegnen sich darüber hinaus zwei Seelen- und Geistesverwandte in der uneingeschränkten Hingabe zum guten Buch und einer lustvoll praktizierten, mit Fakten gesicherten Arbeitsmethode und beider Verständnis von Literatur.
Meine Einschränkung will besagen, dass damit gewiss nicht der ganze Petzel erfasst ist. Dazu kommen sein detektivischer Spürsinn und seine Fähigkeit, zunächst verdeckte Verbindungslinien zu ziehen, besonders anschaulich vorgeführt an „Ritter und Bürger oder einige Gedanken zur Dürer-Rezeption von Fouqué und E.T.A. Hoffmann“. Petzels Findigkeit, peripher erscheinende Notizen ins Zentrum seiner Darstellungen zu rücken, ist enorm, sein Wissen biografischer Zusammenhänge erstaunlich. Die Basis dafür sind sein Reichtum an Büchern und seine große Belesenheit, die es ihm erlauben, den verborgensten textlichen Hinweisen und Querverbindungen nachzugehen. Er muss weder in Staats- noch in Universitätsbibliotheken stöbern oder in kommunalen Bucheinrichtungen suchen; ihm stehen seine privaten, prall gefüllten Regale zur Verfügung; sein Bestand umfasst gut und gerne zehn- bis zwölftausend Exemplare. Mit seinem bildhaften Vermögen und differenzierten Gedächtnis für Entlegenes orientiert er sich darin rasch während der Abfassung seiner Arbeiten, und sie erlauben ihm nahezu jeden zielsicheren Zugriff für gründliche Recherchen.
Die Ergebnisse solch entsagungsvoller Arbeit finden sich nicht nur in Aufsätzen und Vorträgen, sondern außerordentlich ertragreich in der vorzüglichen Kommentierung der Briefe E.T.A. Hoffmanns und des Märchens „Meister Floh“ im Rahmen der Gesamtausgabe des Deutschen Klassiker Verlags, als ich über einen längeren Zeitraum mit ihm zusammenarbeitete und seine mikroskopische Akribie, anhaltende Zuverlässigkeit und absolute Termintreue schätzen lernte.
Nimmt Jörg Petzel Nebenfiguren in den Blick, wie Gundermann aus Fontanes Roman „Der Stechlin“, erstaunt das weit ausgeworfene Netz, mit dem biografische und literarische Bezüge eingefangen werden. Unscheinbaren, zunächst nebensächlich wirkenden Spuren dieses Namens folgt er, die nicht nur in die Biologie und Botanik führen, sondern weit nach Frankreich hinein bis hin zu Émile Zola. Diese Findigkeit ist keineswegs biografischer Selbstzweck, sondern Petzels glänzend geführter Nachweis, mit welchem Ernst und welch literarischer Genauigkeit Fontane gerade auch seine Nebenfiguren auszustatten pflegte.
Gerne arbeitet er, der besseren Anschaulichkeit wegen, mit Zitaten aus Quellen und literarischen Werken, besonders in Vorträgen. Das weckt zunächst des Hörers und Lesers Interesse und hält deren Aufmerksamkeit durchgehend wach, auch weil seine Arbeitsmethode stets luzide bleibt, und sein Gedankengang immer klar ist. Man lese nur, wie er die Radierer und Zeichner Caspar Walter Rauh anhand des Briefwechsels mit Verlegern oder Steffen Faust in Szene setzt und sie für den Leser sichtbar und begreiflich macht. Er zieht Lebenslinien nach und bebildert sie mit Zitaten der Künstler. Gleiches gilt, wenn er auf Steffen Fausts Radierungen zu Hoffmanns Märchen „Klein Zaches genannt Zinnober“ und ihre verdeckten Anspielungen zu sprechen kommt.
Oder nehmen wir die Arbeit über Ludwig Devrient und E.T.A. Hoffmann als Kunstverwandte. Seine Darstellung aus dem Leben eines der berühmtesten Schauspieler jener Zeit, ist ein Muster an gründlicher Recherche und lebendiger Darstellung. Die Hälfte davon gilt der Lebensbeschreibung Devrients; erst dann geraten E.T.A. Hoffmann und die Freundschaft beider ins Zentrum. Ebenso weit ausholend, in Längsschnitten erzählt, lesen sich die Arbeiten „Wilhelm Müller und E.T.A. Hoffmann“ und jene über E.T.A. Hoffmann und die „Allgemeine Musikalische Zeitung“. So erhält der Leser nicht nur Einblick in eine produktiv kritische Seelen- und Geistesverwandtschaft (Devrient), er kommt auch in den Genuss von Petzels detektivischem Spürsinn während der Herstellung biografischer Zusammenhänge in glasklarer Diktion auf solider Faktenbasis. Das kann im Idealfall zu glücklich geglückten Momenten führen, in denen sogar literarische Atmosphären geschaffen werden: „Ein Geisterabend im Hause Hitzig“ ist so ein Moment, wenn anhand persönlicher und verwandtschaftlicher Verbindungen über Generationen hinweg Künstler sich zu geselligen Treffen einfinden und über Poesie und Leben diskutieren. All das wird konkret, lebendig und sehr präzise demonstriert.
Dieser unerschütterliche Konkretismus hat zur Folge, dass Petzel einem etwas unheilschwangeren Thema der neueren Forschung zu Hoffmann, dessen angeblichen Antisemitismus, der sich in seinem literarischen Werk verbergen soll, nüchtern, aber sehr entschieden begegnet: „Antijüdische Affekte oder vermeintlicher Antijudaismus in E.T.A. Hoffmanns späten Almanach-Erzählungen“ heißt Petzels Antwort. Sein Nachweis: Selbst bei genauester Lektüre ließen sich keine Spuren dafür finden; wenn überhaupt, tauchen sie auf als die sattsam bekannten christlichen Topoi vermeintlich jüdischer physiognomischer Charakteristika.
Ein Paradestück positiver Findigkeit und literarischer Spurensuche ist sein Aufsatz über den Roman „Ein weites Feld“ von Günter Grass und dem – ja, man kann schon sagen – Gesamtwerk Theodor Fontanes. Es ist ein Vergnügen zu beobachten, wie er die Zwiebel Schale für Schale häutet und die literarische Folie Fontanes freilegt, auf der Günter Grass seinen Roman konzipierte. Dass er, so ganz nebenbei, die zum Teil vernichtende Kritik beim Erscheinen von „Ein weites Feld“ subtil, energisch und sachkundig zugleich widerlegt, sei nur am Rande vermerkt.
Neben den genannten Vorzügen geben seine Arbeiten noch etwas zu erkennen. Wer die Titel im Inhaltsverzeichnis aufmerksam liest, dem fällt auf, dass Petzel die in historischer Zeit namhaften, heute jedoch nicht mehr geläufigen, selbst in der Fachwissenschaft kaum mehr berücksichtigten Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur zutage fördert und sie auf seine spezifische Art illuminiert: Ludwig Devrient, August Friedrich Ernst Langbein, Friedrich und Caroline de la Motte Fouqué oder Johann Wilhelm Ludwig Müller, ja vielleicht sogar Arno Schmidt gehören dazu; mit Sicherheit auch Franz von Holbein, Willibald Alexis, Carl Leo oder Wilhelm Dorow. Er stattet sie aus mit ihrem entsprechenden Lokalkolorit und macht sie so nicht nur wieder lebendig für die Gegenwart, sondern gibt jenen nahezu Vergessenen einen Namen, eine Stimme, eine Kontur und ein Gesicht.
Für solche, heute keineswegs mehr selbstverständlichen, verdienstvollen Aufgaben scheint Jörg Petzel prädestiniert zu sein. Als waschechter Berliner kennt er sich in der historischen Kulturszene dieser Stadt aus wie kein zweiter. Ein Gang mit ihm an Orte, zentrale Plätze, oder Spaziergänge durch Parks hin zu einst berühmten Cafés und Wohnungen, in denen im 19. Jahrhundert Künstler und Gelehrte zu Hause waren, gelebt und gearbeitet haben, ist ein Ereignis.
Lässt sich nun an Jörg Petzels Schaffen auch eine Entwicklung ablesen? Ja und Nein. Nein, weil er seinem Stil und seiner Arbeitsweise treu bleibt. Ja, weil er seine Methode des sorgfältigen Spurenlegens und findigen Fährtenlesens im Bereich schöngeistiger Literatur und Biografie fortgesetzt verfeinert. Seine Arbeiten lesen sich daher zwar nicht so sehr gelehrt im streng germanistischen Sinn, bleiben aber stets klug in der Argumentation, lebhaft in der Darstellung und konzentriert auf das Ergebnis, lassen darüber hinaus auch immer genügend Raum für eigenes Nachdenken. Basis bleibt seine stabil verankerte Fähigkeit einer mustergültigen, äußerst subtilen Faktenverknüpfung, geschmeidig verwoben, selbst mit entlegenen Stellen. Im Ergebnis sind es feine Miniaturen biografisch-literarischer Zusammenhänge, in denen bisher eher Randständiges in die Mitte gerückt und das scheinbar Konturlose mit kräftigen Strichen nachgezogen wird.
Last but not least, und gerne sei es noch einmal gesagt: Wer jenseits einer stets lohnenden Lektüre die Gelegenheit fände, Jörg Petzel zu hören, sollte sie wahrnehmen. Der ironische Klang im Titel, der sein Buch intoniert, und es damit selbstbewusst auf den Weg bringt, ist ein Versprechen.
Friedhelm Auhuber
I.
E.T.A. Hoffmann
HOFFMANN UND LANGBEIN
Die Anregung zu diesem Beitrag gab Arno Schmidt1. In „Zettels Traum“ (Zettel 1082) verweist er die „Hoffmann-Spezialisten“ auf August Friedrich Ernst Langbeins Roman „Der Bräutigam ohne Braut“ (1810). Dieses Werk, meint Schmidt, weise deutliche Parallelen zu „Klein Zaches“ auf. Hoffmanns Werk erschien bekanntlich 1819. Schmidts provokante Frage lautet, leicht abgeändert: „Wer hat da wohl von wem ...?“
Hoffmann selbst hat sich im Vorwort zur „Prinzessin Brambilla“ ironisch über die Quellenforschung zu „Klein Zaches“ mokiert2, und C. G. v. Maassen schreibt in der Einleitung zu „Klein Zaches“:
Auch literarischen Reminiszenzen glaubt man hie und da zu begegnen, und diese nachzuweisen, bildet einen besonderen Reiz für den Forscher, nur darf sich dieser nicht dazu hinreißen lassen, derartigen Entdeckungen, die oft recht zweifelhafter Natur sind, einen übertrieben großen Wert beimessen zu wollen; da allein, wo sogenannte Anlehnungen oder auch Zitate einwandfrei oder wenigstens mit größter Wahrscheinlichkeit auf ihre Quelle zurückgeführt werden können, gewinnen die Resultate einige Bedeutung, insofern als sie einen Einblick in die Geisteswerkstatt des Dichters geben, nicht aber, um an den Dichtungen, wenn auch noch so leisen, unangebrachten pedantischen Tadel oder lächerliche Kritik zu üben.3
Trotz dieser Mahnung Maassens bin ich der Meinung: Hoffmanns Arbeitsmethoden sind vom größten Interesse, und durch Aufdeckung erkennbarer Quellen, die Hoffmann in seinen Werken verarbeitete, werden seine Entlehnungsmethoden deutlicher bzw. durchsichtiger. Hoffmanns künstlerische Leistung wird dadurch in keiner Weise gemindert.
Folgender Hinweis, freundlich und bereitwilligst erteilt von Friedrich Schnapp, stützt die These, wonach Hoffmann Langbeins Roman gekannt hat: Langbeins „Bräutigam ohne Braut“ ist im Katalog des Kunz‘schen Lese-Instituts (Bamberg, den 1. Januar 1813) unter Nr. 2939 verzeichnet in der nicht weniger als 1633 Bände umfassenden Abteilung „Romane und damit nah verwandte Schriften“. Kunz hat den „Bräutigam ohne Braut“ wohl gleich nach Erscheinen angeschafft, und das Buch dürfte Hoffmann zwischen 1810 und 1813 zu Gesicht gekommen sein. Bekanntlich hat Hoffmann sich wiederholt Bücher aus der Kunz‘schen Bibliothek entliehen, auch schon vor der Eröffnung des Lese-Instituts, z. T. nur aus Unterhaltungsbedürfnis. Selbst wenn Hoffmann Langbeins Roman nur flüchtig gelesen hat, können ihm Stellen daraus im Gedächtnis haftengeblieben sein. Maassen weist in seiner Einleitung darauf hin, daß die Titelfigur des „Klein Zaches“ auf eine persönliche Begegnung Hoffmanns zurückzuführen sei: Er soll den Sohn der Dichterin v. Heydebreck, der verkrüppelt war, im Tiergarten reiten gesehen haben. Dies konnte Friedrich Schnapp jedoch durch den Hinweis auf eine Bemerkung des Kammergerichtsrats Carl Adolph Wilke zu einer Federzeichnung Hoffmanns widerlegen4, in der der Student Friederici als Vorbild namhaft gemacht wird.
August Friedrich Ernst Langbein wurde am 6. 9. 1757 in Radeburg bei Dresden als Sohn eines Amtmannes geboren. Zunächst besuchte er die Fürstenschule in Meißen. 1777-1780 studierte er Jura in Leipzig. Seine Mitarbeit an Bürgers Musenalmanach brachte ihm hohes Ansehen, so daß sogar Schiller seine Arbeiten gern druckte. 1781 war er Vizeaktuar in Großenhain, 1785 ging er als Advokat nach Dresden. Dort arbeitete er 1786-1800 als Kanzlist beim Geh. Archiv. 1800 übersiedelte er nach Berlin, wo er seit 1820 das Amt eines Zensors im Fach der schönen Wissenschaften ausübte. Dabei ging er in seinem Eifer so weit, daß er sogar einige seiner eigenen Schriften nicht verschonte und aus den Katalogen strich.
Er besaß keine dichterische Originalität. Wohl kann man ihm ein bescheidenes komisches Talent und ein Geschick, leichtfüßige Verse zu schmieden, zugestehen. Wegen seiner mangelnden Erfindungsgabe wertete er meist alte literarische Quellen aus, besonders italienische Novellen und französische Fabliaux. Seine zweibändigen „Schwänke“ (1792), die oft den Ehebruch zum Thema haben, erfüllten ein offensichtliches literarisches Bedürfnis. Ihrer knappen Formulierung wegen zählen sie zu seinen wertvolleren Arbeiten, während seine zahlreichen Gedichtsammlungen weder von der Kritik noch von den Buchkäufern sonderlich gewürdigt wurden. Nur seine humoristischen Verse, die noch 1872 in einer Neuausgabe erscheinen konnten, erregten das Interesse der Leser wie auch seine Kriminalgeschichten, die er aus reiner Sensationslust schrieb und die er in den dritten Band seiner „Feierabende“ (1793-98) aufnahm. Seine komischen Romane und Erzählungen wie „Thomas Kellerwurm“ (1806) oder „Magister Zimpels Brautfahrt“ (1820), denen ein Zug ins Frivole anhaftet und die sich durch eine anspruchslose, aber gefällige Darstellung auszeichnen, waren eine ungemein beliebte Lektüre. Noch 1845 konnten Langbeins „Prosaische Schriften“ in 16 Bänden erscheinen. Sie sind durch eine arge Verspießerung des Lebens gekennzeichnet. Immerhin verstand Langbein es ausgezeichnet, seine künstlerischen Mängel geschickt zu verbergen. Seine Leser, die sich bei ihm angenehm unterhalten fühlten, sahen gern über alle formalen Schwächen ihres Lieblingsautors hinweg, der sich auch politisch so anzupassen verstand, daß ihm der preußische König eine Pension von 300 Talern gewährte. Langbein gelangte über die niedrige Sphäre der Komik freilich nie hinaus, doch verfügte er über genügend Mutterwitz, um einige Effekte durch seine Situationskomik zu erzielen. Komische Charaktere konnte er nicht überzeugend entwickeln. Selbst bei der Umformung literarischer Vorlagen zeigte sich sein Mangel an Esprit. Selten erreichte er das geistige Format seiner Vorbilder. Das deutsche Lesepublikum gab sich jedoch auch mit dem zweiten Aufguß zufrieden und bekannte sich auch noch nach Langbeins Tod (2. 2. 1835 Berlin) zu ihm. Bei dem Mangel an humoristischen Autoren in Deutschland konnte das kaum verwundern.5
Hans von Müller schreibt über Langbein: „Dieser gute alte Herr lebte seit 1800 als Schriftsteller in Berlin. Gubitz (der ihn in den „Erlebnissen I“ 187/94 hübsch schildert) lernte ihn bei Kra1owsky kennen; vielleicht kannte auch Hoffmann ihn von dort her.6
Die Lektüre von „Bräutigam ohne Braut“ ist durchaus amüsant; das Buch enthält ironische, oft sogar satirische Zeitkritik-Elemente, doch sind die trivialen Züge nicht zu übersehen. In unserem Zusammenhang interessiert nicht die Haupthandlung des Romans, sondern die Rahmenerzählung „Leben, Thaten und Widerwärtigkeiten eines kleinen Gerngroß (13. Kapitel, S. 202209, auch S. 212). Bei diesem Gerngroß handelt es sich um den Zwerg Zachäus Trill (!).7
Hier nun der Textvergleich:
LANGBEIN:
(11. Kapitel, Seite. 195)
Junker Ortlieb (der, beiläufig gesagt, allein Hahn im Korbe blieb und keine jüngern Geschwister hatte) ging eines Tages, als er ungefähr achtzehn Jahre alt war, mit seinem Vater und seinem Hofmeister spazieren. Das geschah in der Nähe des Schlosses sehr oft, doch dießmal wagte sich das vorsichtige Kleeblatt fast bis an die Landstraße, die eine halbe Stunde weit entfernt war und eben jetzt von einem seltsamen Fuhrwerke befahren wurde. Es war ein kleiner, mit zwei Eseln bespannter Wagen, auf welchem ein hoher, buntgemalter Kasten stand, der zweien Affen, die oben auf der Decke saßen, zum Belvedere diente. Ein Wagenlenker in ausländischer Tracht ging nebenher, und knallte mit seiner Peitsche den säumigen Grauen immer vor den Ohren herum. Ortlieb, ein schärferer Seher als seine Begleiter, entdeckte die ungewöhnliche Erscheinung zuerst, schrie vor Verwunderung laut auf, und lief so schnell, als er kaum in seinem ganzen Leben gelaufen war, drauf zu. »Lieber Sohn! bester Junker! sachte sachte,« riefen Vater und Mentor zugleich, aber er ließ sich, von Neugier fortgerissen, nicht halten.
»Himmel! es kann ihm ein Unglück begegnen! « sagte Herr von Runenstein, und begann mit dem Hofmeister einen Wettlauf, um den tollkühnen Springinsfeld vor Unfällen zu bewahren. Aber bevor sie ihn erreichten, stand er schon am Wagen und erhob ein Zetergeschrei, weil ihm einer der Affen den Hut vom Kopfe riß und der andere die Haare zerzaus‘te. Vater Runenstein, der diese Feindseligkeiten in einer Entfernung von hundert Schritten sah, schrie noch gräßlicher als Ortlieb, und stürzte über Stock und Stein ihm zur Hülfe. Doch schon vor seiner Ankunft vermittelte des Eselstreibers Peitsche den Frieden. Atemlos schloß Arbogast den geliebten Sohn in die Arme und fragte ängstlich, ob er verwundet sey. Ortlieb antwortete mit einem tröstlichen Nein; dennoch setzte Jener den Fremdling hitzig zur Rede: wie er sich unterfangen könne, mit so gefährlichen Tieren die Landstraße unsicher zu machen. »O, niks gefährlik, Excellenz!« erwiederte der Affenwärter mit entblößtem Haupte. »Sie spaße nur, di kleine Sapaju‘s.« »Der Henker hol‘ ihren Spaß!« zürnte die neugeschaffene Excellenz. »Und was steckt denn in diesem Käfich? Wahrscheinlich ein grimmiges Raubtier, das sich über kurz oder lang in Freiheit setzen und Menschen zerreißen wird.« Und indem er das sagte, entstand ein Teufelslärm im Kasten, und erschütterte ihn so gewaltig, daß er vom Wagen zu stürzen drohte. Arbogast und seine Gefährten ergriffen mit Entsetzen die Flucht. Ihnen folgte ein Gelächter aus dem Kasten und der Eselstreiber, der sie in seinem gebrochenen Deutsch flehentlich bat, sich nicht zu fürchten: denn der Rumorgeist sey kein wildes Thier, sondern ein zahmer Mensch, der wegen seiner außerordentlichen Kleinheit für Geld gezeigt werde. Ihnen aber - setzte der höfliche Mann hinzu - stehe dieß angenehme Schauspiel, das schon viele Fürsten ergötzt habe, unentgeldlich zu Diensten, und er bitte höchlich, diese Entschädigung für den ausgestandenen Schrecken in Gnaden anzunehmen. »O ja, lieber Papa!« rief Ortlieb. »Lassen Sie mich das kleine Männchen sehen! »Wir wollen‘s sehen«, sagte der Vater mit leichterm Herzen: aber nicht hier auf der Heerstraße.«
HOFFMANN:
(7. Kapitel, Seite 72)
Neulich ist der Minister in vollem Staat, mit Degen, Stern und Ordensband im zoologischen Kabinett, und hat sich nach seiner gewöhnlichen Weise, den Stock untergestemmt, auf den Fußspitzen schwebend, an den Glasschrank hingestellt: wo die seltensten amerikanischen Affen stehen. Fremde, die das Kabinett besehen, treten heran, und einer, den kleinen Wurzelmann erblickend, ruft laut aus: »Ei! – was für ein allerliebster Affe! – Welch ein niedliches Tier! – Die Zierde des ganzen Kabinetts! – Ei wie heißt das hübsche Äfflein? woher des Landes?« Das spricht der Aufseher des Kabinetts sehr ernsthaft, indem er Zinnobers Schulter berührt: »Ja ein sehr schönes Exemplar, ein vortrefflicher Brasilianer, Mycetes Belzebub– Simia Belzebub Linnei–niger, barbatus, podiis candaque apice brunneis–Brüllaffe –«
»Herr« – prustet nun der Kleine den Aufseher an, »Herr, ich glaube Sie sind wahnsinnig oder neunmal des Teufels, ich bin kein Belzebub – caudaque – kein Brüllaffe, ich bin Zinnober, der Minister der Zinnober, Ritter des grüngefleckten Tigers mit zwanzig Knöpfen!« – Nicht weit davon stehe ich, und breche – hätt es das Leben gekostet auf der Stelle, ich konnte mich nicht zurückhalten – aus in ein wieherndes Gelächter.
»Sind Sie auch da, Herr Referendarius?« schnarcht er mich an, in dem rote Glut aus seinen Hexenaugen funkelt. Gott weiß, wie es kam, daß die Fremden ihn immerfort für den schönsten seltensten Affen hielten, den sie jemals gesehen, und ihn durchaus mit Lampertsnüssen füttern wollten, die sie aus der Tasche gezogen.
Zinnober geriet nun so ganz außer sich, daß er vergebens nach Atem schnappte und die Beinchen ihm den Dienst versagten.
Der herbeigerufene Kammerdiener mußte ihn auf den Arm nehmen und hinab tragen in die Kutsche.8
LANGBEIN:
(13. Kapitel, Seite 202/203)
Vater und Mutter freuten sich, daß ich (Zachäus) ihnen nicht über die Köpfe wuchs: ich hingegen war mit dem kurzen Maßstabe, womit mich die Natur gemessen hatte, von Jugend auf unzufrieden, und sann Tag und Nacht, wie ich, den bekannten Bibelspruch gleichsam zum Trotz, meiner Länge eine Elle zusetzen könne. Dabei spielt‘ ich immer auf die lächerlichste Weise den Gerngroß! -
Auf der Universität . . . gewann meine Thorheit ein freieres Feld zu merkwürdigen Thaten. Ich machte ein ungeheuern Aufwand, hielt Reit- und Wagenpferde, hatte eine fürstliche Garderobe von gestickten und gallonierten Kleidern, gefiel mir aber am besten in bunten, kecken, soldatischen Trachten, die mit meiner Figur auf die seltsamste Weise im Widerspruch standen und mich dem öffentlichen Gelächter aussetzten.
HOFFMANN:
(2. Kapitel, Seite 26)
Da gewahrte Fabian, wie aus der Ferne ein Pferd ohne Reiter in eine Staubwolke gehüllt herantrabte - »Hei hei!« - rief er, sich in seiner Rede unterbrechend, »hei hei, da ist eine verfluchte Schindmähre durchgegangen und hat ihren Reiter abgesetzt - die müssen wir fangen und nachher den Reiter suchen im Walde.« Damit stellte er sich mitten in den Weg. Näher und näher kam das Pferd, da war es, als wenn von beiden Seiten ein paar Reitstiefel in der Luft auf und nieder baumelten und auf dem Sattel etwas schwarzes sich rege und bewege. Dicht vor Fabian erschallte ein langes gellendes Prrr-Prr - und dem selben Augenblick flogen ihm auch ein paar Reitstiefel um den Kopf und ein kleines seltsames schwarzes Ding kugelte hin, ihm zwischen die Beine. Mauerstill stand das große Pferd und beschnüffelte mit lang vorgestrecktem Halse sein winziges Herrlein, das sich im Sande wälzte und endlich mühsam auf die Beine richtete ... Als nun Fabian dies seltsame kleine Ungetüm vor sich stehen sah, brach er in ein lautes Gelächter aus.9
LANGBEIN:
(14. Kapitel, Seite 212)
»Aber noch eine Frage!« fuhr Herr von Runenstein fort. »Ist ER, der in alle Sattel gerecht zu seyn vorgibt, auch im Pferdesattel zu Hause? Das heißt: Kann Er reiten? « Diese Kunst war dem Zwerg nicht fremd, aber verhaßt, weil sich in frühern Zeiten manches Roß das Vergnügen gemacht hatte, den fast schnepellosen Reiter abzuwerfen, und er überhaupt bei jedem Ritt allerlei Unbequemlichkeiten empfand.
HOFFMANN:
(3. Kapitel, Seite 36)
Dann wandte er sich zum Kleinen und sprach: »Ich hoffe nicht, bester Herr Zinnober, daß Ihr gestriger Fall vom Pferde etwa schlimme Folgen gehabt haben wird?« Zinnober hob sich aber, indem er einen kleinen Stock, den er in der Hand trug, hinten unterstemmte, auf den Fußspitzen in die Höhe, so daß er dem Balthasar beinahe bis an den Gürtel reichte, warf den Kopf in den Nacken, schaute mit wild funkelnden Augen herauf und sprach in seltsam schnarrenden Baßton: »Ich weiß nicht was Sie wollen, wovon Sie sprechen, mein Herr! - Vom Pferde gefallen? - ich vom Pferde gefallen? - Sie wissen wahrscheinlich nicht, daß ich der beste Reiter bin, den es geben kann, daß ich niemals vom Pferde falle, daß ich als Freiwilliger unter den Kürassieren den Feldzug mitgemacht und Offizieren und Gemeinen Unterricht gab im Reiten auf der Manege! - hm hm - vom Pferde fallen - ich vom Pferde fallen!«
Es sind zu viele Parallelen, um an einen Zufall glauben zu können. Bei Langbein taucht, wenn auch nur kurz, ebenfalls eine Professorentochter (siehe Candida) auf. Auch ein Examen muß Zachäus Trill über sich ergehen lassen; wie Klein Zaches seine Prüfung besteht, dürfte wohl bekannt sein. Hoffmann hat diese Einzelheiten so gekonnt in sein Werk integriert, daß ein Plagiatsvorwurf sich von selbst erübrigt. Man kann aber anhand der hier gegenübergestellten Zitate sehen, welche Einzelheiten Hoffmann entlehnte und welche er als überflüssig betrachtete.
Anmerkungen
1 Ich möchte zwei Herren danken, ohne die die vorliegende Arbeit nicht zustandegekommen wäre: Herrn Werner Maschmeier, der mir freundlicherweise die seltene Langbein Ausgabe (vgl. Anm. 7) zum Vergleichen überließ und mich außerdem tatkräftig unterstützte, und Herrn Dr. Friedrich Schnapp, der mir mit wichtigen Hinweisen freundlich half.
2 Vgl. E. T. A. Hoffmann: „Späte Werke“. München 1965, S. 211.
3 E. T. A. Hoffmanns „Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe“. Hrsg. von Carl Georg von Maassen. Vierter Band. München und Leipzig 1910, S. XCI.
4 Vgl. Friedrich Schnapp: „E. T.A. Hoffmann in Aufzeichnungen seiner Freunde und Bekannten.“ München 1974, S. 439. - Eine Abbildung des Studenten Friederici ebenda, neben S. 480; weitere Belege dafür, daß man hinter „Klein Zaches“ eine wirklich lebende Person vermutete: ebenda, S. 470, 486 und 616.
5 Gustav Sichelschmidt: „Liebe, Mord und Abenteuer. Eine Geschichte der deutschen Unterhaltungsliteratur“. Berlin 1969, S. 314 f. Den negativen Werturteilen Sichelschmidts kann ich mich im Falle des „Bräutigams ohne Braut“ nicht anschließen.
6 „E. T. A. Hoffmann im persönlichen und brieflichen Verkehr. Sein Briefwechsel und die Erinnerungen seiner Bekannten“. Ges. und erl. von Hans von Müller. Zweiter Band: Der Briefwechsel. Berlin 1912, S. 386. 1819 versuchte Langbein, Hoffmann einen Brief zu übergeben, traf diesen aber nicht an. Vgl. Friedrich Schnapp: „E. T.A. Hoffmann in Aufzeichnungen seiner Freunde und Bekannten.“ München 1974, S. 487.
7 August Friedrich Ernst Langbein: „Sämtliche Schriften“. Zweite, verbesserte Auflage. Stuttgart 1841, Bd. 8. Dieser Band enthält die „Herbstrosen“ und „Der Bräutigam ohne-Braut“ (S. 158-336) sowie 12 Umrißzeichnungen, von denen die achte die für uns interessante Figur des Zwerges Zachäus Trill zeigt. Die Erstausgabe des Romans (Berlin: Schüppel 1810) war leider nicht erreichbar. Hoffmann wird nach der in Anm. 2 angeführten Ausgabe zitiert ..
8 Hoffmann hat hier nur die Verwechslungsszene in sein Werk integriert.
9 Auch hier übernimmt Hoffmann nur einige Elemente, nicht etwa den Inhalt; wir finden die Universität, den Gerngroß, der Reit- und Wagenpferde hält und eine fürstliche Garderobe besitzt. Dazu wird er verlacht.
E.T.A. Hoffmann und die Allgemeine Musikalische Zeitung
Eine Gastvorlesung an der Freien Universität Berlin 2005
Die Zusammenarbeit E.T.A. Hoffmanns mit der AMZ in Leipzig hat eine Vorgeschichte, die in Warschau spielt und nicht unerwähnt bleiben soll.
1805 arbeitete E.T.A. Hoffmann als Regierungsrat im südpreußischen Warschau, das nach der letzten polnischen Teilung bis zum Einmarsch Napoleons 1806 Preußen einverleibt war. Im Vergleich zu seinem Exil in Płock, Hoffmann war 1803 dorthin strafversetzt worden, da er seine Vorgesetzten in bissigen Karikaturen verewigt hatte, verlebte er in Warschau glückliche Jahre, in denen er vor allem als Komponist seinen Durchbruch schaffte. Hier entstanden u.a. seine Es-Dur Sinfonie, einige Klaviersonaten und das Singspiel nach einem Text Clemens Brentanos „Die lustigen Musikanten“, dessen Partitur erstmals Hoffmanns Vornamen Ernst Theodor Amadeus enthält. In Warschau gehörte Hoffmann zu den Mitbegründern der Musikalischen Gesellschaft, als deren zweiter Vorsteher und Zensor er agierte, auch trat er, neben seinen juristischen Tätigkeiten, als Pianist, Sänger und Dirigent öffentlich auf, laut seinem ersten Biographen dirigierte er auch eine Sinfonie Beethovens. Seine 1805 geborene Tochter wird nach der Schutzheiligen der Musik auf den Namen Cäcilia getauft. In Warschau befreundet er sich mit seinem literarisch versierteren Kollegen Itzig, der später unter dem Taufnamen Julius Eduard Hitzig sein erster Biograph werden sollte.
Am 16. Oktober 1805 wird der Regierungsrat Hoffmann in einem Bericht von Friedrich Rochlitz über die Musikalische Gesellschaft in Warschau erstmals in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung namentlich erwähnt.
Im Jahr 1798 wurde die AMZ durch den Musikverleger Gottfried Christoph Härtel (1763-1827) und den Redakteur und Schriftsteller Friedrich Rochlitz (1769-1842) gegründet, sie erschien bis 1848 im Verlag Breitkopf & Härtel, der sich bleibenden Ruhm mit neuen kritischen Gesamtausgaben von Palestrina, Schütz, Mozart, Schubert und Mendelssohn verschaffte. Bereits 1799 hatte E.T.A. Hoffmann vergeblich versucht, bei Breitkopf & Härtel seine Liedkomposition „fürs Klavier und Chitarra“ verlegen zu lassen, doch der Verlag lehnte ab und schickte ihm sein Manuskript zurück. Friedrich Rochlitz, der Mitbegründer der AMZ, leitete deren Redaktion bis 1818 und feierte nebenbei auch Erfolge als Schriftsteller und Lustspieldichter. Rochlitz korrespondierte mit allen wichtigen Autoren seiner Zeit, wie Goethe, Schiller, Wieland und Tieck. 1804 publizierte Rochlitz in der AMZ eine kleine Skizze unter dem Titel „Besuch im Irrenhaus“, die auch Hoffmann las, aber dazu später.
E.T.A. Hoffmanns idyllische Jahre in Warschau endeten 1806 mit der Besetzung Warschaus durch die napoleonischen Truppen. Da Hoffmann, wie der Großteil der preußischen Beamten den Amtseid auf Napoleon verweigerte, verlor er seine Stellung und vermehrte das arbeitslose Beamtenarsenal in der preußischen Hauptstadt Berlin. Hoffmann geriet in eine existenzbedrohende Krise, oft mußte er hungern, weil er von seinen verkauften Zeichnungen und Kompositionen nicht leben konnte. Nur die sporadische Hilfe seines Königsberger Jugendfreundes Hippel konnte seine Not ein wenig lindern. Auch der Warschauer Freund Hitzig versuchte durch seine Beziehungen Hoffmann zu helfen, in dem er, neben Rochlitz, im Oktober 1807 auch dem Leipziger Musikverleger Ambrosius Kühnel (1770-1813) und dessen Bureau de musique Hoffmanns Kompositionen empfahl. Hoffmann bot darauf Kühnel nicht nur seine Kompositionen an, sondern erwog auch den Antritt einer Korrektorenstelle in dessen Verlag.
Auf Kühnels Rat schrieb Hoffmann einen nicht erhaltenen Empfehlungsbrief an Rochlitz und mit einem, ebenfalls nicht erhaltenen, weiteren Brief schickte Hoffmann Rochlitz auch eine nicht mehr zu identifizierende Komposition als Talentprobe. Zum Jahresende 1807 erhielt Hoffmann endlich eine positive Antwort von Rochlitz, die sich nicht erhalten hat, in der Rochlitz Hoffmanns Kompositionen rühmte und ihm das Versprechen übermittelte, eine sachkundige und unparteiische Rezension seiner Werke in der AMZ zu publizieren. Trotzdem es Hoffman nicht gelingt, seine Komposition beim Verleger Kühnel unterzubringen und sich auch der Stellenantritt als schlechtbezahlter Korrektor unter Kühnel verschleppte, so glückte es Hoffmann doch, einen festen Kontakt zu Friedrich Rochlitz und die AMZ zu knüpfen, die als Multiplikatoren den Komponisten und Autor E.T.A. Hoffmann in der musikalischen Welt zukünftig präsenter machen sollten. Obwohl das Jahr 1808 für Hoffmann eine positive Wende bringen wird – er wird ab September die Stelle eines Musikdirektors am Bamberger Theater übernehmen – kann er die stellungslose Übergangszeit in Berlin kaum bewältigen. An seinem Freund Hippel schreibt er am 7. Mai 1808:
Ich mag Dir meine Not nicht schildern, sie hat den höchsten Punkt erreicht. Seit fünf Tagen habe ich nichts gegessen als Brod – so war es noch nie! [...] Es ist schrecklich den Hafen im Gesichte zu scheitern. Heute aß ich im Thiergarten auf die gewöhnliche Weise – Mich sprach ein Bettler an – einer den andern! Mit Talenten mancherley Art zu darben ist vernichtend!
Der reine Geldmangel hinderte Hoffmann bis in den August 1808 sofort nach Bamberg zu reisen. Zwei Tage nach diesem Brief an Hippel veröffentlichte Friedrich Rochlitz folgende Nachricht in der AMZ Nr. 37 vom 9. Juni 1808:
Hr. Musikd[irektor] Hoffmann, der vor einigen Jahren in Warschau angestellt, und seit der veränderten Ordnung der Dinge daselbst in Berlin sich aufhaltend, ist vom Hrn. Reichsgrafen Soden als Musikdirektor zum Bamberger Theater berufen worden. Man kann diese Bühne zur Acquisition eines so gründlichen Komponisten, so erfahrnen Singmeisters, und überhaupt so talentvollen, gebildeten und achtungswürdigen Mannes, Glück wünschen. In kurzem werden wir von ihm drey grosse charakteristische Klaviersonaten (Zürich bey Nägeli,) erscheinen, und von einer Oper, die Hr. Reichsgr. Soden gedichtet und Hr. H. in Musik gesetzt hat, ist wol auch schon im voraus anzunehmen, sie werde eine wahre Bereicherung der Bühne seyn.
Einen Tag nach diesem AMZ-Artikel schickte Hoffmann Rochlitz mit einem Begleitbrief vom 10. Mai 1808 seine Troi Canzonettes und ein kleines Lied:
Es ist eine lange Zeit verflossen, seit ich von Ew. WohlGebohren die freundliche Zusicherung sich meines Bekanntwerdens in der Künstlerwelt gütigst anzunehmen, erhielt; ich habe in dieser Periode mit den drückensten Verhältnissen gekämpft und [bin] beynahe erlegen, bis sich denn nun endlich ein Unterkommen für mich als Künstler fand. [...] Auch mit meinen Compositionen glückt es mir endlich hervorzutreten; Hr. Naegeli in Zürich nimmt Sonaten von mir [...] und eben jetzt ist auch eine Kleinigkeit von mir bey Werckmeister erschienen. Es sind drey Canzonetten mit italiänischem und teutschen Text welche ich Ew. WohlGebohren zu überreichen die Ehre habe. [...] Sollten Ew. WohlGebohren an diesen Canzonetten einigen Gefallen finden und sie vielleicht der Bekanntwerdung durch die Musikalische Zeitung werth achten, so würde mein innigster Wunsch befriedigt.
Die beiliegende Liedkomposition ist vom taktisch agierenden E.T.A. Hoffmann als Köder für den Schriftsteller Rochlitz ausgelegt, denn er beabsichtigt, ein von Rochitz gedichtetes Singspiel zu vertonen um damit auch die Beziehung zu diesem zu intensivieren. Friedrich Rochlitz reagierte mit einer von ihm verfassten Anzeige auf Hoffmanns Brief in der AMZ Nr. 39 vom 23. Juni 1808:
Je mehr sich der Geschmack jetzt vom Trillern luftiger Opernarien und Bravaden zum Vortrage einfacher, mehrstimmiger Gesänge wendet, je mehr werden wir auch zum Edlern, wirklich Schönen, im Singen selbst zurückkommen. Männer, die daher, wie Hr. H. Musikd. in Bamberg, ausserdem, dass sie gute Komponisten überhaupt sind, auch die Singkunst gründlich verstehen, erwerben sich durch Werkchen, wie das angezeigte, womit sie diesen Geschmack nähren und leiten, den Dank aller Verständigen. Es beweiset unverkennbar, dass der Verf. der eben genannten Vorzüge sich in nicht gewöhnlichem Grade zu erfreuen hat. Alle drey Stücke, vorzüglich aber das zweyte und dritte, haben leichte, fliessende, angenehme Melodieen, die aber darum nicht verbraucht, flach, und nichts sagend sind; diese Melodieen sind mit Sorgfalt verschlungen, ohne dadurch schwer, gesucht oder unnatürlich zu werden; und das dritte Stück hat in seinem naiven, etwas komischen Tone noch einen besondern Reiz. Das Accompagnement ist weder leer, noch überladen; es unterstützt, gerade wie es in dieser Gattung am besten ist, zugleich die Sänger und den Effekt des Ganzen; und die deutsche Unterlegung, neben dem italienischen Texte, ist artig und gut angepasst. Was will man mehr von solchen kleinen Blumen am Wege?
Im August 1808 zog Hoffmann mit seiner Frau nach Bamberg, wo er fast fünf Jahre verleben sollte, um dort die Musikdirektorenstelle anzutreten. Am 12. Januar 1809 schrieb er Rochlitz einen umfangreichen Brief, dem das Manuskript seiner Erzählung „Ritter Gluck“ beilag. Hoffmann berichtete Rochlitz über den Fortgang seiner Künstlerlaufbahn als Musikdirektor in Bamberg, die schon beendet schien, bevor sie richtig begonnen hatte. Die Theaterleitung war vom Grafen Soden, der Hoffmann engagiert hatte, auf den Theaterunternehmer Heinrich Cuno übertragen worden. Der von Hoffmann abgesetzte erste Kapellmeister intrigierte erfolgreich gegen den neuen Musikdirektor Hoffmann aus Berlin, der das Orchester vom Klavier aus und nicht mit der Geige in der Hand dirigierte, was für die fränkischen Provinzler ungewohnt war. Hoffmann legte nach zwei mißglückten Aufführungen von Bertons Oper „Aline, Königin von Golkonda“ die Orchesterleitung nieder.
MusikDirektor bin ich zwar geblieben, besorge indessen nur die GelegenheitsCompositionen [...]. Für meine jetzige TheaterArbeit erhalte ich 30 rth Gage, welches zu meinem Unterhalt nicht hinreichen würde, wenn ich mir nicht Neben-Einkünfte durch den Unterricht im Singen, den ich in einigen der hiesigen ersten Häuser ertheile und den man sehr schäzt, verschaffe. [...] In meiner jetzigen Lage habe ich Muße genug mich ganz dem zu überlassen, wohin mich meine ganze Neigung zieht; ich meine das Studium der Composition.
Nach dieser längeren autobiographischen Einleitung kommt Hoffmann zum eigentlichen Zweck seines Briefes, mit dem Manuskript des „Ritter Gluck“ weitere Nebeneinkünfte aufzutreiben und den dazu nötigen Kontakt zu Friedrich Rochlitz und zur AMZ zu konsolidieren:
Ich wage es einen kleinen Aufsatz, dem eine wirkliche Begebenheit in Berlin zugrunde liegt, mit der Anfrage beyzulegen, ob er wohl in die Musik[alische] Zeitung aufgenommen werden könte? – Aehnliche Sachen habe ich ehmals in oben erwähnter Zeitung wirklich gefunden zB. die höchst interessanten Nachrichten von einem Wahnsinnigen, der auf eine wunderbare Art auf dem Clavier zu fantasiren pflegte. – Vielleicht könte ich mit der Redaktion der Mus[ikalischen] Zeitung in nähere Verbindung treten und zuweilen Aufsätze und auch Rezensionen kleinerer Werke einliefern.
Dieser Brief Hoffmanns an Rochlitz ist ein taktisches Bravourstück, denn Hoffmanns, wie ein Köder hingeworfener, Hinweis auf den AMZ-Artikel über einen Wahnsinnigen stammte aus der Feder von Friedrich Rochlitz und erschien in den AMZ-Nr. 39-42 des Jahres 1804 unter dem Titel „Der Besuch im Irrenhause“ mit Verfasserangabe und 1807 publizierte Rochlitz diese Studie sogar als Buchfassung in seinen „Kleinen Romanen und Erzählungen“. Der Erzähler belauscht im Irrenhaus zu W. durch eine halb offene Tür einen Geisteskranken, den er Karl nennt. Dieser
schlug einige einzelne leise Töne, und dann Akkorde an [.] Er griff nun mit beyden Händen voll und ließ die Akkorde schneller auf einander folgen [.] Endlich kam einige Verbindung in sein Spiel; es wurde zugleich immer heftiger, und er bewies auch eine ungemeine Fertigkeit [.] Dies alles gab nun eine höchst seltsame Musik [.] Von eigentlich kunstmäßiger Ausführung kann dabey keine Rede seyn; [doch] wurde sein Spiel sehr bestimmt und äußerst eindringlich [.] Unverkennbar [...] äußerste sich auch sein Stolz. Dieser unterstützte seine Verachtung aller Musik Anderer und aller gangbaren musikalischen Formen.
Der Irrenhaus-Insasse Karl entwickelt sogar eine eigene Akkord-Theorie. Rochlitz erzählt nun zunächst Karls Geschichte und bemerkt zum Schluß: „Er hat seine herrschenden Ideen und Lieblingsvorstellungen öfters mündlich und auch schriftlich erklärt“, u.a. in einem Brief an König Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Einzelne Züge und Symptome belegen, daß sich E.T.A. Hoffmann mit dem „Ritter Gluck“ durchaus an Rochlitz Studie orientiert hat, doch Hoffmann entkleidete, seiner Anschauung entsprechend, das allegorisch-mystische System Karls des spezifisch christlichen Charakters; und um die Figur des Kranken individueller und damit zugleich interessanter und anschaulicher zu gestalten, gab er ihm die fixe Idee, mit einem großen Künstler der Vergangenheit identisch zu sein.
Friedrich Rochlitz schluckte Hoffmanns taktischen Köder, was er 1822 nach Hoffmanns Tod in seinem AMZ-Nekrolog zu verschleiern suchte, in dem er fälschlich behauptete, er selbst, Rochlitz, habe Hoffmann zur Abfassung einer Erzählung aufgefordert und ihm damit den entscheiden Weg vom Musikschriftsteller zum Dichter geebnet.
Am 25. Januar 1809 notierte Hoffmann in seinem Tagebuch:
Einen sehr angenehmen Brief von Rochlitz aus Leipz[ig]. Er nimt den Ritter Gluck zum Einrücken, und mich zum Mitarbeiter an der Mus:Zeit: an.
Obwohl Rochlitz Brief vom 19. Januar nicht erhalten ist, läßt sich sein Inhalt aus Hoffmanns Antwort vom 29. Januar 1809 erschließen:
Die Bedingungen unter welchen Sie mich zum MitArbeiter an der Musik[alischen] Zeitung zulassen wollen, sind, wie ich sie mir dachte, ganz der Sache angemessen und mir sehr angenehm.- Sinfonien, Ouverturen, Quartette, Quintette, nächstdem ClavierSonaten, dergleichen Quart[ette] und Trios, von KirchenMusik indessen höchstens nur Messen von kleinerm Umfange kan ich hier oft und recht gut hören und allso auch gründlich darüber urtheilen, indem es sich von selbst versteht, daß es meine Pflicht ist, habe ich die Partitur nicht zur Hand, mir zweifelhafte Stellen selbst in Part[itur] zu setzen. Was Aufsätze anderer Art betrifft, so werde ich mir dann und wann eine kleine Anfrage über einen kleinen von mir gewählten Gegenstand erlauben, übrigens aber gewiß nie irgend einen kleinen Unmuth hegen, wenn die Redaktion etwas von mir nicht in die Zeitung aufnehmen sollte. Ich bemerke indessen, daß etwa einzelne anstößige Sätze die Aufnahme des Ganzen nicht verhindern sollen, denn diese bitte ich ohne weiteres wegzustreichen: überhaupt werde ich es mit Dank erkennen wenn Sie, VerEhrungswürdger Herr HofRath! Sich meiner Aufsätze annehmen, und was zu breit gerathen, abkürzen wollen, wie Sie es schon jetzt mit dem Ritter Gluck thun werden, denn mein Manuskript kann dadurch nur gewinnen. Von jeder schriftstellerischen Eitelkeit bin ich weit entfernt und auch geneigt, von jedem Künstler das beste zu glauben so bald nicht das Gegentheil deutlich constirt; zu dem gerügten Ausfall gegen W[eber] konte mich daher auch nur der tiefe Ärger aufregen, den ich in B[erlin] empfand wenn ich die hohen Meisterwerke Mozarts erst auf dem Theater mißhandeln‘ sah und denn darüber so gemein aburtheilen hörte, als wären es Exercitia eines Anfängers.
Hoffmanns konziliante Äußerungen über nicht autorisierte Kürzungen und Eingriffe in seinen Texten, die ja wie ein Freibrief für Rochlitz wirken, hätte er später sicherlich gerne zurückgenommen. Am 13. März 1809 notierte Hoffmann in seinem Tagebuch: „ Den Ritter Gluk gedruckt gelesen! - Es ist sonderbar, daß sich die Sachen gedruckt anders ausnehmen als geschrieben.“ Hoffmanns erste bedeutende Erzählung war in der AMZ Nr. 20 vom 15. Februar 1809 gedruckt erschienen und noch am gleichen Tag schrieb er an die Redaktion der AMZ :
Mit dem was an dem Ritter Gluck geschehen ist, bin ich sehr wohl zufrieden, nur habe ich den alten Italiäner mit dem gekrümmten Finger so wie die Berliner Egoisten nicht ganz gern vermißt, wiewohl ich mich gern bescheide, daß die Züge des Gemähldes etwas zu grell aufgefaßt seyn mochten. Dagegen haben mich der zugesezte geschlossene Handelsstaat und die bösen Groschen recht sehr erfreut.
Der von Hoffmann erwähnte Ausfall gegenüber dem Kapellmeister der Königlichen Schauspiele zu Berlin, Bernhard Anselm Weber, wurde von Rochlitz vermutlich deswegen gestrichen, weil bereits 1807 in der AMZ Webers Dirigat und Tempi des Mozartschen „Don Giovanni“ kritisiert wurden, worüber sich Weber wahrscheinlich bei Rochlitz beschwert hatte.
Der Redakteur Friedrich Rochlitz hat also Hoffmanns Manuskript des „Ritter Gluck“ nicht nur leicht gekürzt, sondern eigenmächtig ergänzt, was Hoffmann keineswegs gleichgültig hinnahm. Seinem Freund Hitzig schrieb er am 25. Mai 1809:
Sie können meinen Debut [...] Ritter Gluck lesen; ein Aufsatz, der Ihnen in mancher Hinsicht merkwürdig seyn wird, dem Sie es aber auch anmerken werden daß R[ochlitz] hin und wieder nach seiner Art gefeilt hat, welches ich geschehen lassen mußte, unerachtet es mir nicht lieb war.
Seltsamerweise hat Hoffmann 1813 bei seiner Neuabschrift des Erstdrucks vom „Ritter Gluck“ für die Buchfassung im ersten Band der „Fantasiestücke in Callots Manier“ Rochlitz Eigenmächtigkeiten nicht wieder rückgängig gemacht, was aber ohne die ihm nicht vorliegende Manuskript-Fassung, die nicht mehr erhalten ist, auch schwer fiel.
Obwohl die Textunterschiede des „Ritter Gluck“ zwischen dem Erstdruck und der ersten Buchfassung eher marginal erscheinen, ist doch der Kontext nicht unwichtig, denn Hoffmanns Erzählung, die er stets als „Aufsatz“ bezeichnete, erschien innerhalb der AMZ in der Abteilung „Miscellen“, im Umkreis von Musikberichten, Rezensionen und theoretischen Artikeln über Musik. Erzählungen, auch musikalischer Natur, waren in der AMZ unüblich. Eher noch erschienen dort Anekdoten über Musiker und musikalische Themen.
Nur wenige Wochen nach Erscheinen von Hoffmanns „Ritter Gluck“ erschien in der AMZ Nr. 25 vom 22. März 1809 der Aufsatz „Glucks letzte Plane und Arbeiten“ von Friedrich Rochlitz, der nun E.T.A. Hoffmann keinesfalls die Deutungshoheit in der AMZ zum Thema Gluck überlassen wollte.
In der älteren Hoffmann-Forschung, vor allem der aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, war man bei der Verfasserfrage von anonym erschienenen Rezensionen in der AMZ schnell bei der Hand, diese E.T.A. Hoffmann zuzuschreiben. Laut Friedrich Schnapp hat E.T.A. Hoffmann für die AMZ insgesamt 41 Beiträge, einschließlich der musikalischen Novellen, geschrieben.
Anfang März 1809 bekam Hoffmann von der Redaktion der AMZ ein Musikalienpaket zugeschickt, das Kompositionen von Dotzauer, Hänsel, Stumpf, Tuch und Friedrich Witt enthielt, die Hoffmann in der AMZ rezensieren sollte. Hoffmann wählte für seine Premiere als AMZ-Musik-Kritiker die Sinfonien Nr. 5 und 6 von Friedrich Witt (1770-1836), deren gestochene Stimmen er laut Tagebuch am 2. März 1809 erhalten hatte. Eine davon ließ Hoffmann im Konzert der Bamberger Harmonie-Gesellschaft am 13. März aufführen. Am 19. April notierte er in seinem Tagebuch: „Die beiden Symph. von Witt rezensiert – opus 1. Dieser Art – ging leichter als ich gedacht hatte“.
Die Rezension schickte Hoffmann zusammen mit den übrigen Musikalien am 20. April 1809 laut seinem Tagebuch an die AMZ, „sowie einer kurzen Beurtheilung der Stumpfschen Entr’Actes“, die aber die AMZ nicht abdruckte, was zur Folge hatte, daß Hoffmanns Text verloren ging. Die Tuchsche Harmonie bewertet er als „sehr unbedeutend“ und auch die restlichen Kompositionen hielt Hoffmann nicht der Besprechung wert.
Wer war aber nun dieser Friedrich Witt? Er hatte zwischen 1804-1815 neun Sinfonien veröffentlicht und sein Oratorium „Der leidende Heiland“ (1802) brachte ihm die Berufung als Kapellmeister des Fürstbischofs von Würzburg ein. Danach vergessen, tauchte sein Name erst 1957 wieder auf, als es durch einen Hinweis des Musikwissenschaftlers Robbins Landon gelang, die 1912 bei Breitkopf & Härtel unter Beethovens Namen publizierte sog. Jenaer Symphonie als ein Werk Friedrich Witts zu identifizieren. Hoffmanns Debut als Musik-Kritiker mit den Rezensionen der Witt’schen Sinfonien Nr. 5 und 6 erfolgte in der AMZ Nr. 33 am 17. Mai 1809 und beginnt wie folgt:
Daß die Instrumentalmusik jetzt zu einer Höhe gestiegen ist, von der man vor nicht gar zu langer Zeit wohl noch keinen Begriff hatte: daß ferner die Sinfonie insonderheit durch den Schwung, den Haydn und Mozart ihr gaben, das höchste in der Instrumentalmusik – gleichsam die Oper der Instrumente geworden ist: alles dieses weiß jeder Freund der Tonkunst. [...] Auch Herr Witt hat sich Haydn zum Muster und Vorbild genommen, und daß er würdig, die Bahn des Meisters betritt, beweiset seine Sinfonie No.5 aufs neue.
Nach einer genauen Analyse resümiert der Rezensent Hoffmann, mit diesen Kompositionen
hat sich Herr Witt als einen gründlichen, verständigen Komponisten gezeigt, und das sichtbare Bemühen, dem Ganzen nicht sowohl viel Tiefe, sondern nur den möglichst hohen Grad von Gefälligkeit zu geben, zeigt, daß sie für ein großes Publikum geschrieben ist, welches sie dann auch gewiß finden wird, indem sie, nur irgend gut ausgeführt, sehr effektvoll und daher jedem Orchester mit Recht zu empfehlen ist.
Aber diese Musikrezensionen waren nicht sehr einträglich und so verfuhr Hoffmann mehrgleisig, das erfolgreiche Debüt mit dem „Ritter Gluck“ stärkte ihm den Rücken, und so schlug er dem AMZ-Verleger Härtel in einem Brief vom 26. Februar 1809 folgende Zusammenarbeit vor:
Es fehlt hier in Bamberg gänzlich an einem MusikLager und meine Scolaren (ich gebe Unterricht im Gesange und Clavier) sind in beständger Verlegenheit neue Sachen zu erhalten: ich bin daher gesonnen selbst einige Sachen, die hier gerade gesucht werden – in Commission zu nehmen und frage Sie, ob Sie wohl geneigt werden mir einige Sachen aus Ihrem Verlage in Commission zu geben? [...] Ew.WohlGeb. wird bekannt seyn daß ich selbst komponire, und zwar sind es Canzonetten [...] ClavierSachen und OrchesterSimphonien die ich im Vorrath habe; Ew.WohlGeb. werden indessen, da mein Nahme noch wenig bekannt ist, wohl nicht geneigt seyn etwas von mir in Verlag zu nehmen, eine Anfrage deshalb werden Sie mir aber erlauben, indem ich ohne Eigendünkel wohl bemerken kann, daß meine Sachen das Glück haben zu gefallen.
Hoffmann verfällt hier vor lauter Höflichkeitsfloskeln in den selben Fehler, den er schon Rochlitz gegenüber machte, daher fällt es Härtel leicht, den Verlag von Hoffmanns Kompositionen abzulehnen. Immerhin nimmt er Hoffmanns Mitarbeit als Kommissionär von Musikalien an und möchte darüber hinaus, daß Hoffmann auch im Namen Breitkopf & Härtels Pianoforte in Kommission verkauft. Für die Musikalien bietet ihm Härtel 25% Rabatt an, was Hoffmann zu wenig ist, der auf den gewöhnlichen Buchhändler-Rabatt von 331/3Prozent pocht, „da sonst nach Abzug des Portos mein Profit kaum die Mühe lohnt“. Auf Härtels Angebot mit dem Pianoforte geht Hoffmann ein, denn er plant ein solches im Hause der Consulin Mark aufzustellen, deren Tochter Julia er Musikunterricht erteilt und zu der er später eine mehr als nur pädagogische Leidenschaft entwickeln sollte.
Am 5. Juni 1809 erstattete Hoffmann dem Verleger Härtel einen Zwischenbericht:
Nicht länger kann ich anstehen Ew.WohlGeb. anzuzeigen, daß bis jezt der von mir intendirte Verkauf der Musikal[ien] sehr schlecht gegangen ist indem von der ersten Sendung nur den Sargino, 2 Cahiers von Clementi so wie 2 Cah[iers] Dussecksche Sonaten, von der lezten Sendung aber nur 3 Arien von Mozart verkauft habe.
Insgesamt kann man resümieren, daß Hoffmann mit seiner Nebenarbeit als Kommissionär für Breitkopf & Härtel mehr Aufwand als pekuniären Ertrag hatte. Aber am 23. Juni 1809 notierte Hoffmann in seinem Tagebuch:
Einen äußerst angenehmen Brief von der Redaction der musik[alischen] Zeit[ung] bekommen – Sie fragen an ob ich die Beethovensch[en] Sinfonien rezens[ieren] wollte?
Der Verleger Härtel hatte im September 1808 direkt mit Beethoven verhandelt und Breitkopf & Härtel die Verlagsrechte für dessen 5. und 6. Sinfonie gesichert, auf diese beiden Beethoven-Sinfonien bezog sich die Anfrage der AMZ bei Hoffmann, der das Rezensions-Angebot natürlich erfreut annahm, indem er am 1. Juli 1809 der AMZ mitteilte, daß er sich darüber sehr geschmeichelt und über das Zutrauen der AMZ geehrt fühle. Hoffmann rezensierte aber nur die 5. Sinfonie, da inzwischen bereits der Erfurter Musikdirektor M.G. Fischer die Besprechung von Beethovens 6. Sinfonie, der Pastorale, übernommen hatte. Hoffmann erhielt als Arbeitsgrundlage eine Abschrift der Partitur, die gestochenen Stimmen und eine Bearbeitung für Klavier zu vier Händen von Friedrich Schneider, denn eine gestochene Partitur der 5. Sinfonie erschien erst nach Hoffmanns Tod 1826.
Hoffmann mußte seinen Rezensionsauftrag zunächst aufschieben, denn von Juni bis September 1809 komponierte er das dreiaktige vom Grafen von Soden gedichtete Melodram „Dirna“, das kürzlich erstmals auf CD erschienen ist. Daneben komponierte Hoffmann ein Klaviertrio, das sog. Grand Trio, das er vergeblich bei Nägeli in Zürich zum Verlag anbietet. Erst am 6. Mai 1810 schickt Hoffman seine fertige Rezension der 5. Sinfonie Beethovens an die Redaktion nach Leipzig, die sie in der AMZ Nr. 40 vom 4. Juli und der Nr. 41 vom 11. Juli 1810 abdruckte. Das Echo auf Hoffmanns Besprechung war außergewöhnlich groß. Rochlitz übertrug Hoffmann danach weitere Werke Beethovens zum Rezensieren, denn der hatte mit seiner Rezension das Verständnis Beethovenscher Werke auch beim breiteren kunstinteressierten Publikum gefördert und nicht nur für geschulte Musiker geschrieben. Doch Hoffmanns Beethoven-Rezension hatte später auch großen Einfluß auf das Beethovenbild Robert Schumanns und Richard Wagners.
Am 30. Mai 1810 bestellte Hoffmann bei Härtel Beethovens Trio op. 70 No. 2, das im August 1809 bei Breitkopf & Härtel erschienen war, zur Rezension, ohne zu ahnen, daß ihm sein Engagement am Bamberger Theater unter der neuen Leitung seines alten Freundes Holbein kaum Zeit dafür lassen würde. Erst am 10. September 1812 begann Hoffmann mit der Rezensionsarbeit. Zuvor hatte er in seinem Tagebuch vom 3. Juli 1812 über einen großen Teeabend im gräflichen Rothenhanschen Haus in Bamberg berichtet, wo Hoffmanns Ideen über das Wesen der Musik in Beethovens Trio wenig Anklang fand. Vermutlich wurde das Trio auch an diesem Abend mit Hoffmann am Flügel gespielt, was ihm mehr als willkommen sein mußte, denn aus den zu besprechenden Stimmen konnte Hoffmann kaum ein Gesamteindruck der Komposition gewinnen, denn die Klavierstimme enthielt damals nicht zugleich die Partitur des Ganzen. Am 16. September schloß er 1812 die Rezension des ersten Trios ab, die des zweiten Trios beendete Hoffmann erst am 2. Februar 1813.
Teile aus beiden seiner Beethoven-Rezensionen verwendete er für sein viertes Kreislerianum unter dem Titel „Beethovens Instrumentaslmusik“, das zuerst in der Zeitung für die elegante Welt ab dem 9. Dezember 1813 in drei Fortsetzungen erschien, deren Redakteur August Mahlmann in einer Fußnote zum Erstdruck bemerkte:
Wir theilen diesen Aufsatz als Probe eines Werkes mit, welches nächstens unter dem Titel: Fantasiestücke in Callots Manier, Blätter aus dem Tagebuch eines reisenden Enthusiasten, mit einer Vorrede von Jean Paul Friedrich Richter, bei Kunz in Bamberg, erscheinen wird. Wir sind überzeugt, daß der geistreiche Verfasser allen, die eine nicht blos zeitverkürzende, sondern wahrhaft unterhaltende Lektüre lieben, mit der Herausgabe dieses Werkes ein sehr erfreuliches Geschenk machen wird.
Etliche Jahre später, im Frühjahr 1820 bekam Hoffmann die für ihn wohl wichtigste Resonanz seiner Beethoven-Rezensionen, einen freundlichen Brief des Komponisten vom 23. März 1820, den Beethoven, passenderweise durch einen Weinvertreter, Hoffmann übermittelte:
Euer wohlgebohrn! Ich ergreife die Gelegenheit durch Hr: Neberich, mich einem So geistreichen Manne, wie sie sind, zu nähern – auch über meine wenigkeit haben sie geschrieben [...] Hr: Starke zeigte mir in Seinem Stammbuche einige Zeilen Von ihnen über mich, sie nehmen also, wie ich glauben muß, einigen Antheil an mir; Erlauben Sie mir zu sagen, daß dieses, von einem mit So ausgezeichneten Eigenschaften begabten Manne ihres gleichen, mir sehr wohl thut. Ich wünsche ihnen alles Schöne u. Gute und bin. Euer wohlgebohrn Mit Hochachtung ergebenster Beethoven.
Hoffmanns Freund und Biograph Hitzig meinte dazu: „Man muß seine Verehrung dieses Meisters gekannt haben, um beurtheilen zu können, wie dieser Gruß aus der Ferne auf ihn wirkte“.
Aber kehren wir zurück in das Jahr 1810, E.T.A. Hoffmann bewirbt sich um die frei gewordene Stelle als Musikdirektor bei der Secondaschen Opertruppe in Leipzig, um endlich seiner Bamberger Schulden-Malaise zu entkommen – und so wendet er sich in einem Brief vom 8. März 1810 an Rochlitz mit Bitte um dessen Empfehlung, da er Rochlitz Ansehen für seine Bewerbung nutzen möchte:
Die Auflösung des hiesigen Theaters hat mich darauf reduzirt meinen Unterhalt bloß durch Informat[ion] in der Musik, die noch dazu sehr schlecht bezahlt wird, zu erwerben und sie könne denken, wie dies mühsame Geschäft, das ich, um leben zu können, den ganzen Tag über treiben muß, mich für jede höhere Arbeit abstumpft.- Ein fixirter Posten bey einem, wie ich hoffen darf, soliden Theater würde mich dagegen in den WirkungsKreis, der meine Kunst gedeyhen läßt, versetzen.
Zwar war die angeblich vakante Stelle bei Seconda schon mit Friedrich Schneider besetzt, dessen Klaviersonate zu vier Händen Hoffmann 1814 in der AMZ rezensieren sollte. Doch im Februar 1813 bekam Hoffmann von Seconda, dank der Empfehlung von Rochlitz und auch von Härtel, ein akzeptables Stellenangebot als Musikdirektor, das ihm den entgültigen Abschied von Bamberg ermöglichte. Die schlecht bezahlte Arbeit als Musiklehrer, Rezensent und Kommissionär für den Verleger Härtel trieb Hoffmann immer weiter in Schulden, über die er bald den Überblick verlor, so daß ihm Härtel im Juli 1812 ein Überblicks-Verzeichnis der sich noch in Hoffmanns Händen befindlichen unbezahlten Musikalien schickte und Hoffmann den Vorschlag machte, seine Schulden durch weitere Rezensionen für die AMZ abzuarbeiten, was Hoffmann selbst als angenehme Lösung empfand.
Am 14. September 1812 fragte Härtel bei Hoffmann an, ob er mit dem Violinspiel vertraut sei und falls dieses der Fall sei, ob Hoffmann für den Verlag Breitkopf & Härtel die Violinschule von Baillot, Rode und Kreutzer zu übersetzen bereit sei. Hoffmann antwortete Härtel am 16. September 1812:
Ew. WohlGebohren erwiedere ich auf das geehrte Schreiben vom 8t d. M., daß ich allerdings auch mit der Violine vertraut bin, da ich sie sonst in jüngern Jahren mit ziemlicher Virtuosität gespielt habe [...] In dieser Hinsicht bin ich sehr geneigt Ihren Wunsch Rücksichts der Uebersetzung der Violinschule aus dem Französischen zu erfüllen, indem ich voraussetzen kan, daß Sie mich nach Ihrer mir bekannten liberalen DenkungsArt für Mühe und ZeitAufwand gehörig entschädigen werden. [...] Ich erwarte das französische Original der ViolinSchule, so wie Ihre fernern gütigen Bedingungn Rücksichts des Honorars und werde dann mit Eifer und Liebe arbeiten.
Am 2. Januar 1813 schickte ihm Härtel per Anweisung 65 Reichstaler Honorar für die von Hoffmann übersetzte Violinschule, womit sich dieser zufrieden gab. Erst im Juli 1814 erschien die neu übersetzte und erweiterte Violinschule mit einem Umfang von 65 Seiten bei Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Neben seinen zahlreichen Musikrezensionen aber entstanden in Bamberg einige literarische Texte E.T.A. Hoffmanns, die das Fundament für die ersten beiden Bände seiner vierbändigen Erzählsammlung, die „Fantasiestücke in Callots Manier“ bildeten und die Hoffmann größtenteils als Erstdruck in der AMZ veröffentlichte.
Über den ersten Text, in dem die Figur des Kapellmeisters Johannes Kreisler eingeführt wird, gibt es keine Dokumente zur Entstehungsgeschichte, er erschien unter dem Titel „Johannes Kreisler’s des Kapellmeisters musikalische Leiden“ in der AMZ Nr. 52 vom 26. September 1810. Doch hat sich ausnahmsweise eine andere Manuskriptfassung Hoffmanns erhalten, die Einblick gibt, in welchem Umfang Rochlitz auch in diesen Text Hoffmanns vor dem Abdruck eingegriffen hat. Wie schon beim „Ritter Gluck“ und auch später beim „Don Juan“ versagte sich Hoffmann einen Protest gegenüber Rochlitz, er wollte eine seiner wenigen sicheren Einnahmequellen nicht gefährden. Gegenüber seinem ersten Verleger Carl Friedrich Kunz in Bamberg dagegen brauchte er eine derartige Rücksichtnahme nicht walten zu lassen und warnte ihn:
Bester Mann!- Nur keine Aenderungen in meinem Manuskript – es ist nicht Eitelkeit, aber jeder hat doch was eignes, und was so aus der Seele, aus dem Innersten hervorgegangen, dem schadet oft selbst scheinbare Politur – Haben Sie die Leiden nach meinem Manuskr[ipt] oder nach der Mus[ikalischen] Z[eitung] abdrucken lassen – Ich finde „verlungerter Abend, pikantes Stumpfnäschen – dumm, wie ich fürchte alles dieses ist nicht in meinem Manuskr[ipt].
Doch finden sich alle drei angemahnten Stellen auch im Druck der „Fantasiestücke“ von 1814, woraus man schließen kann, daß Kunz Hoffmanns Mahnung ignorierte und dem von Rochlitz redigierten AMZ-Abdruck folgte. Während es im AMZ-Erstdruck und in der ersten Buchfassung heißt: „Ein hundsvöttischer, verlungerter Abend!“ lautet diese Stelle in Hoffmanns Manuskriptfassung: „Ein verfluchter verwünschter Abend“. Noch fragwürdiger scheint aber die folgende von Rochlitz hinzugefügte Textpassage:
Fräulein Marie faßt es schon beim achten Mal, und wenn sie öfters einen Viertelston tiefer steht, als das Piano, so hat das bey so einem pikanten Stumpfnäschen nicht eben viel zu bedeuten.
Die gleiche Passage nun in Hoffmanns Manuskriptfassung:
Fräulein Marie faßt eine solche Melodie schon beym achten Mahl, und wenn sie einen ViertelsTon tiefer singt als das Pianoforte steht, so liegt es bloß daran, daß ihr Organ anders gestimmt ist als das Pianoforte wofür niemand kann.
Letztere Textpassage lautet aber in der von Hoffmann selbst redigierten zweiten Auflage der Fantasiestücke von 1819:
Fräulein Marie faßt es schon beim achten Mal, und wenn sie öfters einen Viertelston tiefer steht als das Piano, so ist das bei solch niedlichem Gesichtlein und den ganz leidlichen Rosenlippen am Ende wohl zu ertragen.
Diese eklatanten Beispiele für die Texteingriffe von Friedrich Rochlitz in die Manuskripte E.T.A. Hoffmanns sind auch ein Beispiel für die Ohnmacht des noch nicht arrivierten Schriftstellers gegenüber dem seine Macht ausübenden Redakteur.
Im Juni 1812 schloß Hoffmann ein weiteres Kreislerianum, „Des Capellmeisters Johannes Kreilser Gedanken über der hohen Werth der Musik“ ab und schickte das Manuskript am 1. Juli 1812 zusammen mit zwei Rezensionen über Beethovens Coriolan-Ouvertüre und Pustkuchens Choralbuch an die AMZ mit folgender Bemerkung:
Dem scherzhaften Aufsatz [...] wird E[ine] Verehrte Red[aktion] die Aufnahme in die M.Z. wohl nicht versagen, da er gegen die gemeine Art wie die Kunst und vorzüglich die Musik beurtheilt und getrieben wird gerichtet und meines Bedünkens die Ironie die beste Waffe dagegen ist.
Rochlitz scheint Hoffmanns Text so gut gefallen zu haben, daß er diesen noch im selben Monat in der AMZ Nr. 31 vom 29. Juli 1812 in der AMZ abdruckte, wobei die beiden Rezensionen erst Monate später erschienen. Rochlitz veränderte jedoch Hoffmanns Titel in „Des Kapellmeisters, Johannes Kreislers, Dissertatiuncula über den hohen Wert der Musik“, was soviel wie kurze gelehrte Bemerkungen oder Erörterungen bedeutet. Für den Abdruck in der Bucherstausgabe veränderte wiederum Hoffmann den Titel seines Textes in „Gedanken über den hohen Werth der Musik“. Mozarts Oper „Don Giovanni“ blieb lebenslang E.T.A. Hoffmanns Lieblings-Oper. Schon in einem seiner frühen Briefe an seinem Jugendfreund Hippel schrieb Hoffmann am 4. März 1795:
Noch 6 Wochen wolte ich den Don Juan studiren, und Dir ihn denn auf einem englischen Fortepiano vorspielen – wahrhaftig Freund, Du säßest still und ruhig von vorne bis zu Ende, und würdest ihn noch viele Zeit in Deinem noch dazu unmusikalischen Gehirn behalten.
Die Inspiration zu seinem Fantasiestück „Don Juan“ erhielt Hoffmann vermutlich durch die Inszenierung des „Don Giovanni“ seines Freundes Holbein, der auch die Titelpartie übernahm, die zwischen 15. Oktober 1810 und 30. Oktober 1811 in Bamberg aufgeführt wurde. Denn am 16. Dezember 1810 erbat er sich beim AMZ-Verleger Härtel den Klavierauszug des „Don Giovanni“ zum Studium. Sein erster Verleger Carl Friedrich Kunz, seines Zeichens auch Weinhändler, schrieb dazu in seinen nicht immer zuverlässigen Erinnerungen:
Ich war mit ihm darüber einig, daß Holbein, was das Spiel betreffe, der beste Don Juan sei, den wir noch gesehen, und selbst Beschort [in Berlin] überträfe. [...] Hoffmann läugnete nicht, daß ihm bei Bearbeitung seines Aufsatzes: „Don Juan“, in den Phantasiestücken, Holbeins Bild ebenso vorgeschwebt, wie seine Julia bei der Zeichnung der Donna Anna. Seine Verehrung dieser Oper überstieg oft alle Grenzen besonnener Beurtheilung und selbst manchmal den Culminationspunkt jeder Phantasie.
Am 22. September 1812 vermerkte Hoffmann in seinem Bamberger Tagebuch: „Abends bey Kunz – poetische Stimmung / dan mein[en] Aufsatz von Don Juan Stellenweise vorgelesen und gefunden daß er gut ist“ Nach zwei Tagen weiterer Arbeit daran vollendete Hoffmann sein Fantasiestück, bot dieses aber erst nach Jahreswechsel am 2. Februar 1813 der AMZ zum Abdruck an:
Noch füge ich einen kleinen Aufsatz: Don Juan pp bey, von dem ich in der That nicht weiß ob E[ine] H[och] V[erhrte] Red[aktion] ihn der Aufnahme in die Zeitung würdig finden wird oder nicht? – Mir scheint, als wenn über die Darstellung des Don Juan manches Neue gesagt worden und als wenn der „reisende Enthusiast“ die Ueberspannung und die darin herrschende Geisterseherey entschuldigen könnte, weshalb ich denn wohl die Aufnahme wünschte.





























