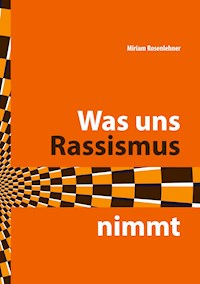
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir alle lernen Rassismus, ohne uns bewusst dafür entschieden zu haben. Aber wie funktioniert das? Dieses Buch bietet einen Blick hinter die Stirn unserer Gesellschaft. Neue Forschungsergebnisse, verständlich und spannend aufbereitet, lassen tiefe Einblicke in das Phänomen Rassismus zu. Sie geben den Blick frei auf ein Gesellschaftsmuster, das uns alle mehr beeinflusst, als wir bisher dachten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil I Defining Racism - wie eine Idee die Menschheit in den Kriegszustand versetzte
1 Wie wir Rassismus lernen
1.1 Rassistisches Wissen als Modelllernen
1.2 Natürlich Rassist - Populäre Erklärungen für Rassismus und warum sie falsch sind
1.2.1 Genetisch und entwicklungsgeschichtlich begründeter Rassismus
1.2.2 Territorial begründeter Rassismus
1.2.3 Neurowissenschaftlich begründeter Rassismus
2 Wie der Rassismus in die Welt kam
2.1 Vor der Aufklärung - Gesellschaftlicher Ausschluss schafft Knappheit
2.1.1 Die aufgeklärte Krone der Schöpfung
2.1.2 Cui bono - wem nutzt es?
2.2 Die Rolle der Wissenschaft
2.3 Die Verbreitung von rassistischem Gedankengut
2.3.1 Dreifünftelmensch
2.3.2 Untermensch
2.4 Normalität - Warum es bleibt, wie es ist, weil es so ist
3 Choreografie eines Systems
3.1 Die Idee der Ungleichwertigkeit und ihre Folgen
3.2 Gesellschaftlicher Ausschluss spaltet
3.3 Die Weiße Schallschutzmauer
3.4 Impact oder Intent? Warum Weiße nichts über Rassismus wissen
Teil II Into The Deep - Wie Rassismus funktioniert
4 Wie Menschen mit unerwünschtem Wissen umgehen
4.1 Kognitive Dissonanz und Rassismus
4.1.1 Unheilvolles Trio: Dissonanz, Gaslighting und Stockholm Syndrom
4.1.2 Rassismus als Gaslightingerfahrung
4.2 Ansehen und angesehen werden
4.3 Was rassistische Dissonanz für NichtWeiße bedeutet
4.3.1 Wie soll man über Rassismus sprechen? Über Opfererzählungen
4.3.2 Wie soll man über Rassismus sprechen? Verschwiegene Wut und die Dosierung von Spott
4.4 Tiefe Abwehr - Whitecentering und Schuld
5 Empathie und Ungleichheit: Wie Rassismus sozial unfähig macht
5.1 Der soziale Mensch: Die Anderen wohnen in deinem Kopf
5.2 Selektive Psychopathen
5.2.1 Mind the Gap - Vorsicht Lücke
5.2.2 Feuer frei - wie weit die Mitfühlstörung reicht
5.3 Folgen Weißer Empathiestörung: Angst, Orientierungslosigkeit, Fehlentscheidungen
5.4 Weiße Medizin und nichtWeißer Schmerz
5.4.1 Woran wir Weiße Empathiearmut erkennen
5.4.2 Bösartige Mechanismen: Wie Menschen ihr Empathiesystem abschalten
5.4.3 Anstrengender Nahkontakt: Weiße Abwehr gegen Schwarze Anwesenheit
Teil III Shaping Your Mind - Was Rassismus für Weiße Mehrheitsgesellschaften bedeutet
6 Licht auf die Mechanismen der Macht
6.1 Macht, Berechtigung und Knappheit - Wie uns Rassismus ärmer macht
6.2 Soziales Kapital und soziale Kreditwürdigkeit
6.3 Rassismus und Recht
6.3.1 Rassismus und Grundrechte
6.3.2 Tatmotiv Rassismus
6.3.3 Wirkung von sozialer Kreditwürdigkeit auf die Rechtsstellung von Rassismusbetroffenen
6.4 Deutungshoheit als Herrschaft
7 Aufklärung 2.0 - Den Übergang in eine postrassistische Gesellschaft gestalten
7.1 Fallen oder Gestalten - Über den Untergang der Weißen Denkschule
7.2 Kosten und Chancen im toten Winkel entdecken
7.2.1 Wie die Aufklärung 2.0 ein entwicklungsfreundliches Klima schafft
7.2.2 Wie wir durch neue Dialoge unsere Demokratien schützen
7.2.3 Wie wir eine modernere und wettbewerbsfähigere Gesellschaft bauen
7.2.4 Wie wir Lücken in unserem Rechtssystem schließen können
7.2.5 Wie wir lernen, uns mutiger und kooperativer in der Welt zu bewegen
7.2.6 Wie neue Denkweisen die Weltwirtschaft ankurbeln werden
7.2.7 Wie ein neues Verständnis vom „Wir“ uns zu erfolgreicheren Menschen macht
Quellen
Prolog
Racism shaped us.
Rassismus beeinflusst unser aller Leben, egal welche Hautfarbe wir haben oder welcher Herkunft wir sind. Dieses Buch geht den Einflüssen nach und beschreibt wesentliche Mechanismen von Rassismus.
Unsere Gesellschaft, an die wir und unsere Kinder gebunden sind, geht in eine Zukunft, in der wir alle mehr als jemals zuvor voneinander abhängen. Alles, was passiert, wirkt auf alles andere ein. Auf diese Zukunft sind wir schlecht vorbereitet, solange wir die Einflüsse von Rassismus nicht wahrnehmen, nicht verstehen und nicht ändern.
Vor allem NichtWeiße denken bereits seit Jahrhunderten über Rassismus nach. Sie bekämpfen ungerechte Verhältnisse durch ihre Analysen und streiten darum, ihre Perspektiven in Politik, Kunst, Musik, Philosophie oder den Wissenschaften sicht- und hörbar zu machen. In Deutschland ist diese Arbeit lange wenig beachtet worden. Zeugnisse davon sind zum Teil verschollen, Arbeiten und Analysen nicht verstanden, nicht unterstützt oder nicht veröffentlicht worden. Trotzdem gibt es Vorreiter, auf die man sich beziehen kann und ohne die dieses Buch nicht entstanden wäre. Bildlich gesprochen wird deshalb jede neue Arbeit von Zwergen getan, die auf den Schultern von Giganten stehen. Die, die vor uns über Rassismus nachgedacht haben, haben die Grundlage geschaffen, auf der neue Gedanken entstehen konnten. Dem, was bereits getan wurde, kann man immer nur eine Kleinigkeit hinzufügen.
Bevor wir uns also auf die Reise machen, Rassismus und seinen Einfluss auf uns alle besser zu verstehen, darf ich dazu einladen, einer Stimme zuzuhören, die das Thema in Deutschland wie kaum eine andere in den vergangenen 36 Jahren öffentlich gemacht hat. Ich habe mit Tahir Della, heute Pressesprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und jahrzehntelang im Vorstand der Organisation, über seine Sicht auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Gesprächs über Rassismus gesprochen.
M.R.: Tahir Della, danke, dass du das Projekt „Was uns Rassismus nimmt“ mit diesem Gespräch unterstützt. Du arbeitest seit 36 Jahren daran, Menschen für das Thema Rassismus zu sensibilisieren und die Rechte NichtWeißer in den Blick zu nehmen. Wie bist du dazu gekommen, und warum bist du immer noch dabei?
Della: Der Anlass war, als 1984/85 das Buch „Farbe bekennen“ herauskam. Darin haben Schwarze Frauen aus Deutschland zum ersten Mal Lebenswelten von Schwarzen Frauen in Deutschland abgebildet. Und ich bin immer noch dabei, weil, kurz gesagt, der Job noch nicht erledigt ist. Inzwischen erreichen wir schon viel und ich sehe positiv in die Zukunft. Wir werden noch mehr erreichen. Das zeigt mir, dass es sich lohnt, weiterzumachen.
M.R.: Du wurdest zu dem Thema von allen großen Medienformaten in Deutschland interviewt: Für den Stern hast du den Begriff „Schwarzfahrer“ eingeordnet, dem Deutschlandfunk hast du die Linien aus der Kolonialzeit zum heutigen Rassismus erklärt, ich habe Interviews mit der Süddeutschen, der deutschen Welle, dem WDR, der ARD gefunden. Der Africancourier nennt dich den Sprecher der Schwarzen Gesellschaft in Deutschland. Als die UN Racial Profiling in Deutschland untersuchte, wurdest du dazu von der DPA befragt. Wenn es um Rassismus geht, wirst du angerufen.Wie viele Interviews hast du in den vergangenen 36 Jahren gegeben?
Della: Ich stelle fest, ich habe keine Ahnung. Wenn ich hochrechne, würde ich sagen, so vier- bis fünfhundert Interviews. Die Medienaufmerksamkeit für die Themen Rassismus und Kolonialgeschichte nimmt ja erst in den letzten 10 bis 15 Jahren zu. 2020 nach dem Mord an George Floyd haben uns die Medien das Büro in Berlin förmlich eingerannt und allein in diesem Jahr waren es wohl über 100 Interviews.
M.R.: Rassismus gibt es in allen Weißen Mehrheitsgesellschaften. Erkennst du einen Unterschied zwischen verschiedenen Gesellschaften? Ich will verstehen, ist der Rassismus deiner Meinung nach in Großbritannien, USA und Deutschland derselbe oder gibt es wesentliche Unterschiede?
Della: Weiße Mehrheitsgesellschaften, also Gesellschaften, die von Weißen Menschen dominiert werden, sind global gesehen in der Position, in der sie jetzt sind, aufgrund von Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Rassismus ist Teil dieser Machtverhältnisse. Das Selbstverständnis von Weißen Gesellschaften ist stark davon geprägt, dass sie immer noch in Konzepten wie Rasse denken. Immer noch werden bestimmte gesellschaftliche Gruppen innerhalb und außerhalb dieser Weißen Mehrheitsgesellschaften schlechter behandelt, diskriminiert und ausgegrenzt. Wir sehen ja, gerade vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, dass wir anscheinend leichter Menschen aus der Ukraine hier in Deutschland aufnehmen können, als Menschen aus Afghanistan, Syrien oder Irak. Das macht schon deutlich, dass wir mit rassistischen Konzepten arbeiten.
Die Gesellschaften, die du genannt hast, unterscheiden sich natürlich maßgeblich voneinander. Trotzdem sind die rassistischen Vorbehalte, das Eingeschriebene an rassistischem Gedankengut, sehr ähnlich: Die Bilder sind ähnlich, die sich diese Weißen Gesellschaften von Schwarzen Menschen machen, die Auslegungen sind ähnlich und auch die Ergebnisse dieser Praxis sind oft identisch. Im schlimmsten Fall sterben Menschen durch Rassismus.
M.R.: Wenn du die Dauer deiner Arbeit zum Thema überblickst, welche wesentlichen Änderungen gab es im gesellschaftlichen Gespräch über Rassismus in deiner bisherigen aktiven Zeit? Gibt es so etwas wie Wendepunkte oder eine stetige Entwicklung?
Della: Ich würde sagen Letzteres. Ich denke, wir haben immer noch ein sehr verengtes Verständnis von Rassismus, zum Beispiel, dass Rassismus nur stattfindet, wenn Menschen eine Intention haben, also ganz bewusst rassistisch handeln wollen. Wir wollen Rassismus auch immer noch ausschließlich in der politisch rechten Ecke verorten. Bei der Frage „wann sprechen wir von Rassismus?“ haben wir deshalb immer noch einen Weg zu gehen. Es ist ein Prozess, der andauert, und er führt immer noch dazu, dass Rassismus sozusagen missverständlich eingeordnet wird.
May Ayim hat mit dem Buch „Farbe bekennen“ in den 1980er Jahren an ihrer Universität eine Arbeit zum Thema Rassismus und Kolonialgeschichte in Deutschland vorgelegt. Eigentlich war sie als Abschlussarbeit für ihr Studium gedacht. Ihr Professor sagte ihr damals: Rassismus in Deutschland ist kein Thema. Es gibt keinen Rassismus in Deutschland, und wenn, dann höchstens vereinzelt. Ihre Arbeit wurde nicht als Abschlussarbeit angenommen. Ich denke, das würde heute kein Doktorvater mehr sagen. Das wird auch nicht mehr so gesehen. Es ist also erkennbar, dass sich etwas verändert.
Die Entwicklung ist mittlerweile sichtbarer. Die Reaktionen auf die Mordanschläge in Hanau haben das gezeigt. Zum ersten Mal wurde in den Medien von „rassistischen Anschlägen“ gesprochen. Zu der Zeit, als wir angefangen haben, hat man von „fremdenfeindlichen Angriffen“ gesprochen. Ich denke, das zeigt, dass wir als Gesellschaft jetzt schon weiter sind, Rassismus zu erkennen. Und ihn nicht nur dann zu erkennen, wenn sich Leute selbst dazu bekennen. Es wird klarer, dass Rassismus aus der Perspektive derjenigen beschrieben werden muss, die Rassismus erfahren.
Jetzt wird auch danach gefragt, wie negativ Betroffene Angriffe und Ausgrenzung einordnen, oder Bilder in den Medien oder der Schule. Aber ich denke, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, wir sind noch dabei, klarer zu definieren und Erkenntnis zu gewinnen. Ich denke, erst wenn wir Rassismus umfänglich beschrieben haben, sind wir in der Lage, ihn wirkungsvoll zu bekämpfen.
M.R.: Tahir, in meinem Buch stelle ich die These auf, dass wir Rassismus in den Köpfen der Menschen in zwei Generationen überwinden können. Für wie steil hältst du diese These? Denkst du, dass es möglich ist?
Della: (lacht) Das ist eine sehr optimistische These. Ich denke, wir müssen uns vor Augen halten, dass wir es mit einem Machtsystem zu tun haben, das in den letzten 500 Jahren entwickelt worden ist. Sehr viele Menschen profitieren immer noch davon. Ich kann mich da selbst nicht einmal ausnehmen. Das Verhältnis des globalen Südens und Nordens ist immer noch geprägt von diesen Machtverhältnissen und die Menschen im globalen Norden profitieren davon. In der Hinsicht glaube ich nicht, dass das in zwei Generationen abzubauen sein wird. Was aber stimmt, dass in einer relativ kurzen Zeit im Verhältnis zu diesen 500 Jahren doch schon eine Menge passiert ist. Die Wirksamkeiten werden mehr erkannt, es wird gesehen, wie die Verhältnisse die Gesellschaften durchdrungen haben. Es gibt ein wachsendes Potenzial an Menschen, ich spreche da konkret von Weißen Menschen, die sagen, wir wollen diese rassistischen Verhältnisse verändern. Das haben wir nach dem Mord an George Floyd gesehen, wo ja zum ersten Mal in Deutschland großangelegte Kundgebungen stattgefunden haben.
Man könnte sich jetzt zwar gleichzeitig fragen, wieso gehen die Leute eigentlich nicht wegen Oury Jalloh auf die Straße oder nach der Mordserie des NSU. Wir tun uns schon noch leicht, Rassismus in den USA zu verorten und ernst zu nehmen, aber nicht hier. Trotzdem gibt es ein wachsendes Potenzial an Menschen, die das jetzt nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch als Anlass, sich zu engagieren.
Das heißt für mich schon, dass es sich zumindest anbahnt, dass sich diese Verhältnisse auflösen lassen. Ob das in zwei Generationen passiert, davon müssen wir uns überraschen lassen. Ich vermute allerdings, dass es länger dauern wird.
M.R.: Die Rassismusforschung konzentriert sich in den letzten Jahren viel auf die Vorteile, die Privilegien, die Weiße Menschen aus Rassismus ziehen. In meinem Buch habe ich stattdessen die Nachteile untersucht, die die Gesamtgesellschaft durch Rassismus hat. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass sie enorm sind. Es ist also im Interesse der Weißen Bevölkerung, ihre Vorurteile abzubauen. Siehst du auch Vorteile für die Mehrheitsgesellschaft, wenn Sie rassistische Denkmuster überwindet?
Della: Ich bin der Auffassung, dass Änderungen im Interesse aller sind. Wenn wir eine demokratisch verfasste Gesellschaft frei von Diskriminierung und auf der Basis von Menschenrechten wollen, dann ist es im Interesse aller, das zu verwirklichen. Dann müssen wir das Werkzeug entwickeln, Ausgrenzung und Benachteiligung zu erkennen. Wer selbst nicht Ziel von Ausgrenzung werden will, ist in der Verantwortung, dafür einzutreten. Davon haben wir alle etwas. Für mich als Schwarzer Mann, der sich gegen Rassismus engagiert, ist es auch in meinem Interesse, Diskriminierung gegenüber Frauen, gegenüber Sinti und Roma, gegenüber Jüdinnen und Juden und gegenüber Menschen mit Behinderung nicht zu dulden und genauso zu adressieren wie antiSchwarzen Rassismus. Es gibt viele Gruppen in der Gesellschaft, die aufgrund verschiedener Zuschreibungen benachteiligt sind. Wir müssen das Phänomen insgesamt ernstnehmen und nicht nur von „Betroffenen“ reden, denn betroffen sind wir letztlich alle. Nämlich von einer Gesellschaft, die, mal ganz geschärft ausgedrückt, auf unmenschlichen Konzepten beruht.
M.R.: Wie sieht für dich eine Gesellschaft nach der Überwindung des Rassismus aus? Was wäre für dich das Signal, dich zurückzulehnen und zu sagen: Wir sind fertig. Meine Arbeit wird nicht mehr gebraucht.
Della: (lacht) Ich glaube, dass die Gesellschaft an dieser Stelle nicht komplett frei wäre von Rassismus. Aber ich glaube, dass sie so aussehen könnte, dass diese Gesellschaft sofort und umfassend reagiert, wenn es zu rassistischen oder anderen Diskriminierungsformen kommt. Sie müsste dann alle Strukturen und Institutionen im Blick haben, alle Wirksamkeiten in diesen Strukturen, anstatt zu versuchen, Veränderungen zu vermeiden. Bisher wird zu oft zuerst erklärt, warum ein rassistischer Vorfall „nicht schlimm“ oder ein Einzelfall war. In einer Gesellschaft nach dem Rassismus würde dagegen sofort gehandelt. Ich glaube, so müsste eine Gesellschaft aussehen. Ausgrenzungsmechanismen wird es wahrscheinlich immer geben, weil wir Menschen aufgrund von Vorurteilen einordnen, ihnen Eigenschaften zuschreiben, die dann zu Diskriminierung führen. Ich denke, dass wir diese Prozesse im Moment einfach noch nicht umfassend genug beantworten. Sie finden statt und erst dann, wenn es mehrfach und mit Nachdruck adressiert wird, fangen wir an, darüber nachzudenken. Ich denke, es würde helfen, wenn sich möglichst alle in der Verantwortung fühlen, sich dem entgegenzustellen, anstatt zu erklären, warum das jetzt eigentlich nicht ganz so schlimm ist für die direkt Betroffenen.
M.R.: Tahir Della, danke für dieses Gespräch.
Disclaimer:
Einige Schreibweisen im Buch versuchen zu berücksichtigen, dass hier bei der Benennung von Hautfarbe über die damit verbundene sozialen Erfahrung geschrieben wird, nicht über Farbe an sich. Um das zu zeigen, sind die Adjektive „Schwarz“ und „Weiß“ großgeschrieben. Ich verwende häufig den Begriff „nichtWeiß“, weil ich ihn für passender halte, um die Gruppe der Zielpersonen von Rassismus zu beschreiben. Für manche Lesende werden sich die Benennungen nicht richtig anfühlen.
Über Gleichstellung in einer Welt zu sprechen, die sie nicht vollständig verwirklicht, ist immer unordentlich. Gesellschaftliche Verhältnisse sind tief in unsere Sprache eingegraben. Über diese Verhältnisse zu sprechen, bringt einen in die Lage, diskriminierende Denkmuster mit einer Sprache beschreiben und kritisieren zu müssen, die selbst durch diese Muster geschaffen wurde.
Teil I
Defining Racism
Wie eine Idee
die Menschheit in den
Kriegszustand versetzt
1 Wie wir Rassismus lernen
Die meisten Menschen wollen es nicht, aber trotzdem geben sie „rassistisches Wissen“ an ihre Kinder weiter. Die vergangenen Jahrhunderte haben ihre Spuren in unseren Köpfen hinterlassen.
Aber wie geht das? Wir sind gewohnt, uns nicht für Rassisten zu halten. Wir erziehen unsere Kinder in gutem Glauben. Wir sagen ihnen sogar, dass Rassismus verachtenswert ist.
Unser guter Wille reicht leider nicht. Denn Rassismus ist nicht das, was die Mehrheit glaubt. Die meisten Menschen denken, Rassismus sei aktiver, bewusster Hass. Aber gewalttätige Angriffe, Springerstiefel und kahlgeschorene Jugendliche, die den Hitlergruß zeigen, sind nur die sichtbare Spitze eines Eisbergs. Offene Gewalt ist plakativer Teil des Phänomens, was wir aber übersehen ist so viel größer und durchzieht unsere Gesellschaftsstrukturen und unsere tägliche Wahrnehmung wie eine Tiefenströmung den Ozean: Unter der Oberfläche, dem bloßen Auge verborgen, aber gnadenlos wirkungsvoll.
Die Ablehnung rassistischer Gewalt bedeutet nicht, dass wir keinen Rassismus ausüben. Wir haben unbedarft ein hässliches Erbe angenommen. Es steht wie eine noch nicht ausgepackte Kiste aus dem Nachlass unserer Vorfahren im Keller unserer Wahrnehmung. Es ist da, es gehört uns, aber wir wissen nicht genau, was drin ist.
Die Forschung geht davon aus, dass es keine bewusste Entscheidung ist, Rassist zu sein. Vielmehr ist Rassismus ein Verhalten, das wir sehr früh lernen. Es fällt uns schwer, das zu erkennen, trotzdem ist vermutlich jeder Mensch bereits damit in Berührung gekommen. Es ist normal, darüber besonders als Weiße Person nichts oder wenig zu wissen. Das Problem ist der Lernweg, auf dem wir Rassismus lernen. Wer versteht, wie wir lernen, versteht auch, warum wir darüber so wenig wissen.
Lernen bedeutet im landläufigen Verständnis, sich Kenntnisse bewusst und mit Arbeit anzueignen: Wir lernen zuerst die Regeln und dann wenden wir sie an. Das ist so, wenn wir Vokabeln üben und sie anschließend nach den Regeln der Grammatik in einen sinnvollen Satz sortieren. Das ist auch so, wenn wir uns die Regeln der Addition aneignen und diese Fähigkeit anschließend beim Bezahlen verwenden. Wenn Lernen nur so funktionierte, wäre es in der Tat eine unverfrorene Behauptung, dass wir alle rassistisches Wissen gelernt haben und es anwenden, ohne dies bewusst wahrzunehmen.
Aber gerade bei den ersten Dingen, die ein Mensch erfährt, funktioniert Lernen anders. Wenn wir lernen, uns in unserer sozialen Umgebung zu bewegen, erfahren wir, wie man sich in Gesellschaft verhält. Wir lernen, wie man soziale Situationen einordnet, welche Hierarchie besteht, wann man sie akzeptieren muss und wann nicht, welche Machtsituationen eine Rolle spielen, was man tut und was man nicht tut, Konventionen über Kleidung, Verhalten und vieles mehr. Wir lernen, dass das Sozialgefüge, in dem wir uns bewegen, uns sanktioniert, wenn wir uns nicht so verhalten, wie es sich gehört. Wir lernen, dennoch unseren Teil zu bekommen und dabei die Regeln einzuhalten.
Beim sozialen Lernen benutzen wir einen anderen Lernweg als bei Vokabeln. An diese Lernsituationen erinnern wir uns später nicht mehr, aber wir verwenden das Gelernte ganz selbstverständlich. Wer erinnert sich daran, wie er lernte, dass und welchen Einfluss sein Lächeln auf die Menschen hat? Wer weiß noch, wann er verstanden hat, dass er besser Papa nach den Süßigkeiten fragen sollte, statt Mama, weil Papa das eher erlaubt?
In sozialen Situationen lernen wir nicht zuerst die Regel und dann, wie man sie anwendet. Es ist umgekehrt. Besonders als Kind leitet man die Regeln der Welt aus Erlebnissen ab. Die Bedeutung des Erlebten erkennen wir daran, wie die Menschen um uns darauf reagieren. Wie Menschen sozial lernen, haben Psychologen in den 1960er-Jahren untersucht. Sie nannten es „Lernen am Modell“.
An der Universität Stanford führten Bandura und Walters damals Versuche mit der „Bobo Doll“ durch1, die bis heute berühmt sind. Der Versuch ist sehr aufschlussreich, wenn wir uns anschließend damit befassen, wie und was wir in unserer Kindheit über Rassismus lernen. Die beiden Psychologen zeigten Kindern zwischen drei und sechs Jahren einen Film, in dem „Rocky“, ein Erwachsener, die Puppe „Bobo“ beschimpfte und schlug.
Die Kinder, die an dem Versuch teilnahmen, waren in drei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe sah denselben Film, aber jeweils mit einem anderen Ende. Die erste Gruppe sah, dass Rocky für sein brutales Verhalten bestraft wurde, während die zweite Gruppe am Ende erlebte, dass Rocky für sein Verhalten gelobt wurde. Der Film der dritten Gruppe endete ohne sichtbare Konsequenzen für Rocky. Sein Verhalten wurde von seiner Umwelt also nicht bewertet.
Was die Versuche berühmt machte, war die Reaktion der Kinder auf den Film. Sie durften im Anschluss daran in ein Spielzimmer, in dem die Plastikpuppe Bobo und weitere Spielzeuge auf die Kinder warteten.
Die meisten Kinder, die gesehen hatten, wie Rocky für seine Grausamkeiten belohnt worden war, ahmten sein Verhalten nach. Sie verwendeten dieselben Beschimpfungen und benutzten dieselben Werkzeuge, die sie im Film bei Rocky gesehen hatten. Aber sie veränderten ihr Verhalten auch. Die Kinder interpretierten, was sie gesehen hatten: Zum Beispiel nahmen sie eine Spielzeugpistole, um damit auf Bobo zu zielen und abzudrücken. Im Film war die Pistole nicht vorgekommen. In den Gesichtern der Kleinen war kein Mitgefühl zu lesen ist, dagegen öfter Freude. Auch die Kinder, die weder Lob noch Strafe gesehen hatten, traten, schlugen und beschimpften die Puppe.
Nur durch das Ansehen des Films hatten die Kleinen gelernt, dass man Bobo brutal behandelte. Es hatte dabei keinen Unterschied gemacht, ob sie Belohnung gesehen hatten oder keine Reaktion ihrer Umwelt auf das Verhalten.
Kinder, die gesehen hatten, wie Rocky bestraft wurde, imitierten das aggressive Verhalten dagegen wesentlich seltener. Sie hatten durch das Sehen der Strafe verstanden, dass die Erwachsenen die brutale Behandlung von Bobo für falsch hielten.
In einer anderen Versuchsvariante wurde den kleinen Teilnehmern eine Belohnung dafür angeboten, wenn sie möglichst viele Einzelheiten des Films nachspielen konnten. Nun ahmten alle Kinder die Gewalt nach. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Kinder im Film Belohnung oder Strafe gesehen hatten. Die Psychologen bewiesen so, dass alle Kinder das Verhalten gelernt hatten, ganz gleich, ob sie es für sozial erwünscht (Belohnung) oder sozial unerwünscht (Strafe) hielten.
Aber warum verhielten sich Kinder, die die Strafe gesehen hatten, weniger aggressiv? Die Psychologie erklärt, dass das gelernte Verhalten zwar gelernt wurde, durch das Sehen der Strafe aber gehemmt wird. Der Nachwuchs lernte, sich nicht so zu verhalten wie Rocky. Trotzdem, gelernt ist gelernt: Bobo kann man brutal behandeln. Allerdings macht man das nicht.
In einer weiteren Versuchsvariante sahen die Kleinen Rocky mit der Puppe Bobo spielen, ohne dabei Gewalt anzuwenden. Als sie später im Zimmer auf den echten Bobo trafen, spielten sie mit ihm und verhielten sich dabei nicht aggressiv. Zum Spielen wählten sie auch keine Pistolen oder Hämmer aus. Sie hatten gesehen, dass man mit Bobo spielen kann, und das taten sie anschließend auch.
Das Ergebnis der Versuche war für viele erschreckend, sagte es doch, dass man Kindern sehr einfach aggressives Verhalten beibringen kann. Selbst als in der Versuchsgruppe mit dem Belohnungsszenario die Puppe Bobo durch einen echten Menschen ersetzt wurde, handelten die Kinder immer noch genauso. Sie schlugen, traten, beschimpften und bedrohten den menschlichen Clown genau, wie sie es im Film gesehen hatten.
Die berühmten Versuche zeigen, dass Menschen soziale Lerner sind. Wir lernen, was wir erleben und wir bewerten das Erlebte genauso wie unsere Umgebung. War es richtig, Bobo so zu behandeln? An Lob und Strafe konnten die Kinder erkennen, wie die Erwachsenen das Verhalten bewerteten. In den Versuchen fragten sich die Kinder nicht, ob es richtig war, Bobo zu schlagen. Sie bewerteten ihre Handlungen nicht selbst. Sie machten nach, was ihnen gezeigt worden war und wendeten den moralischen Kompass an, der ihnen vorgelebt wurde.
Dazu passt auch, dass die Kinder, die Strafe für das aggressive Verhalten gesehen hatten, die also davon ausgehen mussten, dass das gelernte Verhalten unerwünscht war, Bobo besonders aggressiv behandelten, nachdem sie dazu aufgefordert und ihnen eine Belohnung dafür versprochen worden war. Diese Kinder, die zuerst Strafe für das gelernte Verhalten gesehen hatten und anschließend dafür belohnt wurden, zeigten die größere Gewaltbereitschaft.
Das Ergebnis ist besonders interessant, weil man daraus schließen könnte, dass gelerntes Verhalten wiederholt werden will. Strafe scheint das Gelernte teilweise zu unterdrücken. Der Drang zum Ausleben wächst dabei aber eher, als dass er schrumpft.
Wie wir aus Erlebtem Erlerntes anschließend anwenden, hängt davon ab, welche Bewertung oder Einordnung wir von der Gesellschaft um uns herum erfahren. Wenn wir sehen, dass das Gelernte bestraft wird, verstehen wir, dass es das Verhalten gibt und dass dieses Verhalten sozial unerwünscht ist. Erleben wir eine Belohnung, lernen wir, dass das Verhalten sozial erwünscht ist. Sehen wir kein aggressives Verhalten, lernen wir das Verhalten erst gar nicht für die Situation.
Wenn wir sozial lernen, lernen wir also nicht bewusst. Wir leiten stattdessen Regeln aus dem gelernten Verhalten ab. Die Regel für die Behandlung der Puppe Bobo lautet, je nachdem, welches Ende der Film hatte:
Bobo brutal zu behandeln ist richtig (sozial akzeptiert).
Verletze Bobo. Das Werkzeug muss die Anforderungen erfüllen, um Verletzung und Erniedrigung hervorrufen zu können.
Im Versuch, in dem die Kinder nur eine friedliche Spielszene sahen, lautete die Regel:
Mit Bobo kann man spielen.
Du befindest dich in einem sozialen Kontext, in dem gespielt wird.
Die Frage nach Gewalt im Spiel kam gar nicht erst auf
2
.
Die Versuche zeigen, wie groß der Spielraum ist, den wir beim sozialen Lernen haben. Die Kinder im Experiment lernten die Regel, dass man gegen Bobo Gewalt einsetzt. Sie verstanden sofort, dass es dabei egal war, welches Mittel man dazu benutzte. Denn die Kleinen verwendeten nicht immer dieselben Waffen wie Rocky. Rocky schlug Bobo mit einem Knüppel. Er beschimpfte Bobo. Aber die Kinder, die sein Verhalten nachahmten, benutzten ein Werkzeug, das im Film gar nicht vorkam. Sie setzten die Spielzeugpistole ein und sie verwendeten andere Schimpfworte. Sie ahmten nicht einfach nach. Sie interpretierten, was sie gesehen hatten. Das zeigt, dass sie eine Regel gelernt hatten, die sie dann anwendeten. Die Regel lautete: Sei brutal zu Bobo.
Was wir sozial lernen, hängt davon ab, wie wir interpretieren, was wir erlebt haben. Es hängt davon ab, welche Regel wir davon ableiten. Niemand fragte die kleinen Probanden, wie die Regel lautete, die sie im Bobo-Film lernten. Vermutlich wäre es ihnen schwergefallen, die gelernte Regel in Worte zu fassen. Es verwundert deshalb nicht, dass wir so häufig Verhaltensweisen lernen, deren Regeln wir nicht sofort in Worte fassen können.
Beim sozialen Lernen spielt auch eine Rolle, von wem wir lernen. Im Bobo Doll Experiment ist das nicht auf den ersten Blick zu sehen. Wer soziale Sachverhalte lernt, lernt in der Regel von denjenigen, die er als Autorität anerkennt3. Das Lernen über Autorität ist selbst ein sozialer Lernprozess. Wir lernen, wer die Macht hat und wir lernen, dass das in unserer Gesellschaft eine große Rolle spielt. Wir wissen durch diese Lernprozesse, wem man zuhört und wem nicht, wessen Handlungen man nachahmt und wer sich nicht so gut als Modell eignet. Es liegt im Interesse des Lernenden, zu wissen, wer die Macht besitzt, sein „Richtig“ oder „Falsch“ durchzusetzen. Autorität und Macht spielen also besonders in sozialen Lernsituationen eine wichtige Rolle.
1.1 Rassistisches Wissen als Modelllernen
Wir lernen Rassismus genauso wie die Kinder im Bobo-Versuch.
Der Begriff "Rassistisches Wissen"4 bedeutet, dass wir die Regeln des Rassismus kennen und anwenden, wenn auch, ohne die Regel aufsagen zu können. Die Rassismusforschung behauptet, dass wir alle rassistisches Wissen gelernt haben. Auch wenn wir sagen, wir hätten Rassismus nicht gelernt, auch wenn wir rassistische Regeln nicht auswendig hersagen können, als seien es Englischvokabeln, trotzdem kennen wir sie und wir wenden sie an.
„Heimliche“ Regeln über Vorurteile lernen wir ab dem Alter von drei Jahren5. Wir können uns deshalb nicht mehr an die einzelnen Situationen erinnern, in denen wir unser rassistisches Wissen erworben haben. Stattdessen haben wir Rassismus nachhaltiger gelernt, als das bei anderen Lernprozessen möglich ist. Wir haben die allgemeinen Regeln aus dem, was wir gesehen haben, abgeleitet. Was immer uns ein anderer Mensch an Regeln vorgibt, diese Regeln kann man infrage stellen. Aber Regeln, die ein Mensch selbst erkannt hat, die er anschließend ohne Zuhilfenahme der Sprache gespeichert hat, diese Regeln sind naturgemäß schwerer zu hinterfragen. Sie können noch nicht einmal spontan in Worte gefasst werden. Deshalb ist es möglich, dass die meisten Menschen rassistisches Wissen besitzen und anwenden, ohne dass sie darüber nachdenken, dass sie noch nicht einmal erkennen können, was sie tun.
Wir geben unser rassistisches Wissen an unsere Kinder weiter und wenden Rassismus an, ohne das zu erkennen.
Wie genau sieht es aus, wenn wir Regeln aus einer Erfahrung ableiten? Hier kann man einen Selbstversuch aus einem anderen Lernbereich machen:
Wie geht die Zahlenreihe weiter: 2,4,8,16....
Regel erkannt? Und was war zuerst da: Die nächste Zahl, die kommen würde, oder die abstrakte Regel, die hinter dem Lernprozess steckt? Haben Sie spontan eine abstrakte Regel formuliert, die Sie ohne nachzudenken wiederholen könnten?
Aber welche Regel lernt das Kind, das so aufwächst:
Ich sehe fern, alle die etwas zu sagen haben, sind Weiß.
Ich steige in die Straßenbahn. Weiße Deutsche und Nichtdeutsche sitzen meist getrennt. Der Sitz neben dem Schwarzen ist frei.
Im Supermarkt sagt ein Kind: „Mama, der Mann ist schwarz.“ Die Mama sagt erschrocken: „psst“ und zieht das Kind weg.
Der Freundeskreis meiner Eltern ist Weiß und deutsch. Schwarze und Menschen mit anderer Sprache sehe ich in der Regel nur im Fernsehen.
Ich sehe, dass nichtWeiße Menschen unter sich bleiben.
Ich darf Tatort mitschauen. Die deutschen Kommissare helfen einem Schwarzen Flüchtling, der arm dran ist. Er hat kaum eine Sprechrolle, er ist ständig verängstigt, seine Motive sind unklar. Er zeigt keine Charakterzüge, während die letzte Weiße Nebenrolle nebenbei mit Charakter ausgestattet wird.
Es gibt Viertel in der Stadt, da darf ich nicht hin, die Erwachsenen sagen, das sei zu gefährlich. Wenn man mit Erwachsenen hingeht, stellt man fest, die meisten Leute sind nichtdeutsch.
Die Mieten in nichtdeutschen Vierteln sind billiger. Deutsche wollen dort trotzdem nicht wohnen.
Die Schulen in mehrheitlich nichtdeutschen Vierteln haben einen schlechten Ruf.
Meine Lehrer sind Weiße Deutsche. Der Chef von meinem Papa ist Weiß, deutsch und fährt Mercedes. In der Küche seiner Restaurants arbeiten die Nationen der Welt.
Im Kaufhaus sitzt vor der Klotür eine dunkelhäutige Frau. Die Leute sagen „Du“ zu ihr.
Das Kind, das so aufwächst, wird eine unerwartete Menge an rassistischem Wissen anhäufen. Dabei wird es lernen, wie andere mit diesem Wissen umgehen. Das Kind wird versuchen, herauszufinden, wie diese Art von Begebenheiten zu dem passen, was es über Rassismus als gesprochenes, behauptetes Wissen lernt.
In der Schule malen wir ein Bild, auf dem steht: Wir sind alle Freunde. Der Kreis aus Händen, die einander halten, ist in allen Hautfarben angemalt.
Mama sagt, ich solle das Schwarze Nachbarskind nicht schlagen. Ich muss es zu meiner Geburtstagsfeier einladen.
Die Interpretation, die abgeleitete Regel dazu ist: Die Leute machen das Eine und sie sagen das Andere.
Das Kind lernt, rassistisch zu handeln und das selbst nicht wahrzunehmen. Es lernt auch, welche Sprachregelungen zum Thema Rassismus gehören. Die Sprachregelungen, also was man über Rassismus sagt und mehr noch, was man nicht sagt, widersprechen dem gelernten Verhalten. Die Lernsituation ähnelt der Bobo-Versuchsvariante, bei der auf die Gewalt an Bobo Strafe folgt.
Wir können nicht sicher sein, wie die unausgesprochene Regel genau lautet, die dieses Kind lernt, weil sie aus den Erlebnissen abgeleitet wird. Jedes Kind wird eine ähnliche Regeln abspeichern. Da diese Regeln aber nicht formuliert werden, werden sie nicht in Worten abgespeichert. Sie bleiben unbewusst, aber wirksam.
Von der Regel zur Grundannahme des Rassismus
Was genau lernt ein Kind in Deutschland, wenn es die gesellschaftliche Wirklichkeit beobachtet?
Ich sehe fern, alle die etwas zu sagen haben, sind Weiß.
Die Regel lautet: Weiße sind die Bestimmer. Was NichtWeiße sagen, spielt keine Rolle.
Die Mieten in nichtdeutschen Vierteln sind billiger. Deutsche wollen dort trotzdem nicht wohnen.
Es gibt Viertel in der Stadt, da darf ich nicht hin, die Erwachsenen sagen, das sei zu gefährlich. Wenn man mit Erwachsenen hingeht, stellt man fest, die meisten Leute sind nichtdeutsch.
Die Regel lautet: NichtWeiße und Nichtdeutsche sind gefährlich. Als Weißer erfahre ich einen sozialen Abstieg, wenn ich zu NichtWeißen ziehe. Das bedeutet, dass NichtWeiße weniger wert sind als Weiße.
Meine Lehrer sind Weiße Deutsche. Der Chef von meinem Papa ist Weiß, deutsch und fährt Mercedes. In der Küche seiner Restaurants arbeiten die Nationen der Welt.
Im Kaufhaus sitzt vor der Klotür eine dunkelhäutige Frau. Die Leute sagen „Du“ zu ihr.
Die Regel lautet: Weiße haben ein Recht auf die Ressourcen. Nicht-Weiße sind Diener. Man hat vor ihnen nicht denselben Respekt wie vor Weißen.
Aber wie erklären wir uns diese Regeln? Warum gibt es sie? Menschen sind denkende Wesen, sie suchen nach Begründungen.
Im Bobo Doll Experiment lernen die Kinder, dass man Bobo brutal behandelt. Sie leiten Regeln ab wie: Man schlägt Bobo. Man verletzt Bobo. Man beschimpft Bobo. Bei dieser Art Lernen, dem sozialen Lernen, bekommen wir keine Erklärung, warum man die Dinge so macht. Wir lernen nicht die Antwort auf die Frage: Warum ist das so? Niemand erklärt den Kindern: Wir machen das, weil Bobo böse ist.
Soziales Lernen ist Nachahmung, die wir verallgemeinern. Aber eine Begründung bleibt dabei aus. Wir geben sie uns selbst.
Diese Begründung, die die Antwort auf die Frage „warum“ gibt, ist eine Grundannahme. In den Naturwissenschaften werden Grundannahmen „Axiome“ genannt. Es sind Annahmen, die wir nicht weiter hinterfragen. Wir gehen davon aus, dass sie wahr sind, ohne dafür einen Beweis anzufordern. Grundannahmen sind Antworten auf die letzten Fragen, die wir uns zu einem Thema stellen. Sie erscheinen uns so sonnenklar und einleuchtend, dass wir danach keine Fragen mehr haben.
In der Mathematik ist ein Axiom ein Satz, der nicht in der Theorie bewiesen werden muss, sondern beweislos vorausgesetzt wird. Auf ihm baut das Theoriegebäude auf. Es verbindet zwei Ideen miteinander, deren Verbindung nicht bewiesen wird.
Aus all den kleinen rassistischen Einzelbegebenheiten leiten wir auch eine Grundannahme ab, warum der soziale Umgang mit nichtWeißen Menschen so aussieht.
Wenn wir die Frage „warum sind Weiße und nichtWeiße Menschen unterschiedlich zu behandeln?“ beantworten sollten, wenn wir also aus den einzelnen Regeln eine Grundannahme ableiten sollen, lautet die in etwa so:
„NichtWeiße sind weniger Menschen als wir.“
Wir beweisen uns diese Annahme, indem wir die Behandlung NichtWeißer als Beweis heranziehen: NichtWeiße werden mit „du“ angesprochen, das heißt, man verweigert ihnen den Respekt. Man verweigert den Respekt, weil sie nicht genauso viel wert sind wie wir. Wäre das nicht so, würden wir sie ja nicht so behandeln. Das Axiom, die Grundannahme ist ein Zirkelschluss, eine fehlerhafte logische Einheit, die behauptet, sich selbst zu beweisen.
1 McLeod, 2014
2 ebd.
3 Rakoczy, 2009
4 Terkessidis, 1998
5 Podbregar, 2016
Story: Ein Prinz lernt um
Im Karneval 2005 zeigte die Presse den englischen Prinzen Harry, der eine Naziuniform als Verkleidung gewählt hatte. Es handelte sich um eine Uniform von Rommels Afrikakorps. Viele waren schockiert. Die Militärakademie, für die sich der Prinz beworben hatte, ließ verlautbaren, dass sie den Aufnahmeantrag des Prinzen nun ablehnen werde. Der Spiegel, der über den „Fauxpas“ berichtet hatte, disqualifizierte sich allerdings anschließend selbst, als er die Verkleidung für seine Leser einordnete. Er nannte sie in einem Atemzug mit diesen weiteren Verfehlungen des Prinzen: Harry habe außerdem in jungen Jahren Cannabis geraucht, als Minderjähriger Alkohol getrunken, sich mit Fotografen geprügelt und bei Schulprüfungen geschummelt. Auch das Magazin hat die Dimension des Vorfalls nicht erkannt, als es Rassismus mit vorzeitigem Alkoholgenuss und Spicken verglich6.
Für viele hört sich dieser Vergleich etwa so an: Jemand verhöhnt die Opfer des Holocaust und schreibt sogar bei Prüfungen ab.
2018 heiratete Harry die Schauspielerin Meghan Markle. Markle ist die Tochter einer afroamerikanischen Mutter und eine Bürgerliche. Die Berichterstattung über die Hochzeit strotzte vor rassistischen Bildern und Einordnungen. Ein ZDF-Korrespondent kommentierte: „Ist die Queen da so großzügig und sagt: ‚Die beiden werden ja niemals König und Königin, da können wir uns auch mal so ein exotisches Paar leisten‘, ich sag‘ es mal so salopp“. Für solche und ähnliche Kommentare wollte das ZDF sich anschließend nicht entschuldigen7. Der Gerechtigkeit halber muss man allerdings sagen, dass nicht nur das ZDF sich ohne Unterlass auf Klischees und rassistisches Wissen bezog. Die Hautfarbe Meghan Markles war ständiges Gesprächsthema auf allen Kanälen. Die Einsicht, dass es sich dabei um Rassismus handelt, leider nicht.
2019 kritisierte das royale Paar zum ersten Mal öffentlich die britische Boulevardpresse, die bei ihrer Berichterstattung über Meghan „veraltete und koloniale Untertöne“ anschlage8.
Im selben Jahr wurde Archie geboren, der Sohn der beiden Royals. Die Familie verließ das Königshaus und übersiedelte in die USA. Inmitten der Black Lives Matter Proteste 2020 meldete sich der Prinz zu Wort. In einem Interview mit dem Aktivisten Patrick Hutchinson äußerte er, erst das Zusammenleben mit Meghan habe ihm die Augen dafür geöffnet, wie gegenwärtig Rassismus sei. Er sagte: „Von meinem Verständnis her, mit der Kindheit und der Ausbildung, die ich hatte, hatte ich keine Ahnung, was unbewusste rassistische Vorurteile sind.“9 Die Stuttgarter Nachrichten berichteten unter der Überschrift „Privilegierte Herkunft. Prinz Harry war nicht auf Rassismus vorbereitet“10, dass Harry seine Denkweise überdacht habe. In dem Interview, auf das sich die Zeitung bezieht, fügte Harry Forderungen hinzu, dass ein Umlernen nötig sei und für alle gut sein werde.
Einordnung
Wenn die Berichterstattung über die royale Hochzeit in jedem dritten Satz die Hautfarbe der Braut erwähnt, kann man davon ausgehen, dass die Braut nicht Weiß ist. Wenn Berichterstatter die Hautfarbe von Meghan als „exotisch“ ansehen und äußern, dass es ein Wunder sei, dass die Queen die Verbindung erlaube, zeigt das, dass im allgemeinen Verständnis eine Barriere zwischen nicht-Weißen Menschen und dem Königshaus steht. Diese Barriere bezieht sich auf die Position der Macht, die Schwarzen im allgemeinen Verständnis verwehrt bleiben sollte. Der Gedanke erscheint dem Reporter so selbstverständlich, dass er ihn nicht infrage stellt. Es zeigt, wie selbstverständlich, wie normal, rassistisches Wissen ist.
Dass Reporter aller Couleur verweigern, ihre tendenziöse Haltung abzulegen oder auch nur in Betracht zu ziehen, dass sie tendenziös ist, zeigt, wie stark und unhinterfragbar normalisierter Rassismus ist. Wenn in der Folgezeit die Boulevardpresse kein anderes Thema findet als die Hautfarbe der Herzogin, zeigt das, wie weitverbreitet normalisierter Rassismus ist. Weil die Boulevardpresse auf Verkaufszahlen ausgerichtet ist, zeigt es ebenfalls, dass man sich als Weißer Journalist darauf verlassen kann, dass die Mehrheit der Leser demselben Rassismus anhängt wie man selbst. Das ist rassistisches Wissen.
Wenn ein Royal, der in der Tradition einer Kolonialmacht erzogen wurde, umlernen kann, können das alle. Wenn einer, dem es nie an Bildung gemangelt haben kann, der die Welt bereist hat, nichts über Rassismus weiß, bis er eine NichtWeiße heiratet, stellt das dar, wie tendenziös auch die durchdachtesten Bildungspläne sind.
6 Spiegel.de, 13.01.2005
7 Schindler, 2018
8 Rotifer, 2019
9 British GQ, 26.10.2020
10 Schmock, 2020
1.2 Natürlich Rassist - Populäre Erklärungen für Rassismus und warum sie falsch sind
Heute lernen wir Rassismus durch Modelllernen. Die Idee allerdings ist älter. Die Erfindung von Rassismus ist mit wissenschaftlicher Theoriebildung verbunden. Drei dieser Theorien sollen näher betrachtet werden, um zu verstehen, was sie verbindet.
Die Wissenschaft spielte eine große Rolle dabei, Rassismus mit Autorität auszustatten. Anfangs sollte Wissenschaft Rassismus rechtfertigen, spätere Theorien sollten das Phänomen wenigstens erklären. Alle Theorien sind bis heute weit verbreitet. Was sie gemeinsam haben ist, dass sie Rassismus als natürlich und damit als in der Grundausstattung des Menschseins enthalten verstehen. Das ist falsch und zudem gefährlich.
Gefährlich ist, dass die Theorien, ohne das direkt in Worte zu fassen, bedeuten, Rassismus sei normal, Rassismus sei Teil des Menschseins. Wenn das der Fall wäre, müssten wir gegen unsere Natur handeln, um keine Rassisten zu sein. Die Menschheit würde sich selbst den Krieg erklären, eine Kriegserklärung, die nie wieder zurückgenommen werden könnte und ein Krieg, der nie enden würde.
Die zusammenwachsende Welt wäre ein zunehmend gefährlicher Ort. Und was die Künstlerin Ceija Stojka sagte, wäre für immer wahr: „Auschwitz schläft nur“.
1.2.1 Genetisch und entwicklungsgeschichtlich begründeter Rassismus
Zu Kolonialzeiten und im Dritten Reich war die Idee des genetischen Rassismus verbreitet. Man versuchte, wissenschaftliche Beweise zu finden, dass es zwischen Weißen und NichtWeißen eine weitere, möglichst eindeutige Unterscheidung geben müsse als nur die Farbe der Haut. Hautfarbe und Herkunft wurde ein Indiz für „Rasse“. Dazu wurden Körper vermessen, Nasenformen kategorisiert, Haarfarben und Augenfarben sortiert. Anschließend wurden die willkürlich geschaffenen Kategorien mit ebenso willkürlich gewählten Eigenschaften, wie zum Beispiel Intelligenz oder Neigung zu Kriminalität verknüpft.
Bis heute wird sich bei der „Rassenfrage“ auf den Wissenschaftler Charles Darwin bezogen und sein Wirken wird dabei missverstanden. Die entwicklungsgeschichtliche („evolutionäre“) Erklärung, mit der die Rassentheorie untermauert werden soll, behauptet, dass Menschen sich entsprechend ihrer Umgebung so getrennt entwickelt hätten, dass sie unterschiedliche Rassen ausgebildet hätten. Dabei hätten sie in jeder „Rasse“ Merkmale entwickelt, die dann besonders häufig bei Angehörigen dieser „Rasse“ vorkämen. So kam es zu dem „Missverständnis“: Früher ging man davon aus, dass die äußeren Erscheinungsbilder von Lebewesen darauf schließen ließen, dass diese sich genetisch ähnlich seien. Das heißt, man nahm an, dass ähnlich aussehende Lebewesen sich auch genetisch ähneln. Im Umkehrschluss nahm man an, dass Menschen, die sich nach äußerlichen Merkmalen unähnlicher sind, genetisch voneinander unterscheiden. Diese Annahme hat sich allerdings sogar für das Tierreich als falsch erwiesen. Wie viele Ähnlichkeiten es in den Genen gibt, kann man nicht daran sehen, wie Lebewesen von außen aussehen.
Biologen haben bewiesen, dass es keine unterschiedlichen Menschenrassen gibt. Menschen ähneln einander in der genetischen Ausstattung über alle Ländergrenzen und Kontinente hinweg. Äußerlich sichtbare Unterscheidungsmerkmale wie die Hautfarbe hängen von genetischen Festlegungen ab, die sich in einem langwierigen evolutionären Prozess als vorteilhaft erwiesen haben.
Wissenschaftler der Universität Pennsylvania stellten 2017 fest, dass sich die Hautfarbe der Menschheit den Umweltbedingungen anpasst11. Dunkle Haut bietet einen Schutz gegen Sonneneinstrahlung, während helle, melaninarme Haut in den sonnenarmen Gebieten der Erde dafür sorgt, dass der Körper trotz wenig Sonne genügend Vitamin D bilden kann. Vitamin D ist lebensnotwendig, kommt in der Nahrung kaum vor und wird vom Körper nur gebildet, wenn die Haut der Sonne ausgesetzt wird.
Jüngste Untersuchungen zur Hautpigmentierung zeigen, dass die Hautfarben der Menschheit auf Genen beruhen, die immer noch Veränderungen unterworfen sind. Ein interessantes Ergebnis der Forschungen war die Erkenntnis, dass Europäer menschheitsgeschichtlich betrachtet erst vor kurzem helle Haut ausgebildet haben. Vor 7000 Jahren waren europäische Jäger und Sammler noch dunkelhäutig.12 Die Anpassung der Hautfarbe ergab sich, so die Forscher, vermutlich erst durch die Sesshaftwerdung. Als die Menschen begannen, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, änderten sie ihre Ess- und Lebensgewohnheiten. Weil diese frühen Landwirte durch ihre neue Lebensweise weniger Vitamin D erhielten, war hellere Haut ein genetischer Vorteil, der sich durchsetzte.
Rassistische Theorien beziehen sich häufig auf die Hautfarbe, weil das Merkmal so einfach zu erkennen ist. Dahinter steckt der Wunsch, Menschen auf simple Weise einteilen zu können. Mit der Haut an sich hat das wenig zu tun. Trotzdem ist die Hautfarbe eines der bekanntesten Kriterien, dem immer wieder nachgesagt wurde, es bezeichne die „Rassegrenze“. Dabei spielt die Farbe an sich für rassistische Theorien keine eigene Rolle. Wichtig sind Rassetheoretikern soziale Merkmale, die sie mit dem Merkmal der Hautfarbe verbinden. Für die Farbe an sich, und die Mechanismen, wie sie entsteht, interessiert man sich erst seit kurzem.
Im Zentrum der Theorien stand die Idee, das Äußere eines Menschen ließe auf sein Inneres, seinen Charakter, schließen. Aus heutiger Sicht fällt die unzulässige Verbindung zwischen zwei völlig voneinander unabhängigen Merkmalen ins Auge. Es ist etwa so logisch, wie beweisen zu wollen, dass die Schokolade von gelben Smarties giftig ist, weil sie außen gelb sind.
Die Behauptung der „Rasse“ beim Menschen führte zu Verbindungen, die bis heute als rassistisches Wissen weiterleben, auch wenn sie wissenschaftlich längst widerlegt sind. Obwohl logisch unglaubwürdig und wissenschaftlich widerlegt, ist dieses rassistische Wissen auch heute noch weitverbreitet. So denken immer noch viele Menschen, dass menschliches Verhalten wie „Neigung zu Kriminalität“ oder Intelligenz mit dem, was sie als „Rasse“ begreifen, in Zusammenhang steht.
In den USA der Trumpzeit äußerte etwa der ehemalige Trumpberater Stephen Bannon 2016, dass Schwarze von Natur aus aggressiv und gewalttätig seien. Ein ehemaliger Journalist der New York Times schrieb 2014 ein Buch, in dem er behauptete, menschliche Gehirne hätten sich je nach „Rasse“ unterschiedlich entwickelt, Juden seien von Natur aus klug und hätten sich genetisch an den Kapitalismus angepasst13. Das Buch veranlasste 139 führende Bevölkerungsgenetiker und Evolutionstheoretiker, einen Widerspruch gegen die rassistischen Thesen über „Rasse“, Evolution und Genetik zu verfassen und diesen in der New York Times zu veröffentlichen.
2019 verfasste die Deutsche Zoologische Gesellschaft gemeinsam mit dem Institut für Zoologie und Evolutionsforschung die „Jenaer Erklärung“.14 Darin heißt es: „Das Konzept von Rasse ist das Ergebnis von Rassismus und nicht dessen Voraussetzung.“ Die Wissenschaftler erklären, dass es Menschenrassen im biologischen Sinn nicht gibt. Anders als bei Tieren finden wir große biologische Unterschiede zwischen Menschen nicht dort, wo wir nach Augenschein die „Rassegrenze“ ziehen, sondern bereits im eigenen kleinen Dorf.
Auf Spektrum.de erklärt der Direktor des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte, Johannes Krause, was der Unterschied zwischen Rassen bei Tieren und der genetischen Ausstattung des Menschen ist: „Rassen haben wir bei Haustieren. Menschen haben über mehrere hundert Jahre immer eng verwandte Tiere, bis hin zu Geschwistern, miteinander verpaart und so jeweils Populationen gezüchtet, die untereinander nahe verwandt sind. Zwischen zwei Schäferhunden finde ich deshalb kaum genetische Unterschiede, aber zwischen Schäferhund und Dackel viele. So etwas gibt es beim Menschen nicht15.“
Genetisch gesehen ist die landläufige Einteilung in Afrikaner, Europäer und Asiaten falsch, so Krause, denn Ostafrikaner sind mit Europäern näher verwandt als mit Westafrikanern.16 „Genetisch gesehen sind Europäer Ostafrikaner“, sagt der Wissenschaftler. Besonders in Afrika sind zwischen den einzelnen Menschen die größten genetischen Unterschiede weltweit zu finden, während der Rest der Welt genetisch einen geringeren Variantenreichtum aufweist. Warum man bei Menschen nicht von Rassen sprechen kann, erklärt Krause dem (Weißen) Interviewer so:
„Wenn ich Ihre und meine DNA vergleiche, dann finde ich ungefähr 4,1 oder 4,2 Millionen Unterschiede. Vergleiche ich Ihre Erbsubstanz mit einem Menschen, der aus Peking stammt, dann machen wir etwa 4,3 Millionen voneinander verschiedene Stellen aus. Das heißt, 90 Prozent der Unterschiede finden sich schon in der Population selbst – in jedem Dorf, wenn zwei Leute nicht miteinander verwandt sind. Dabei ist es nicht etwa so, dass jeder Chinese oder Afrikaner einen fixierten Unterschied hat, der ihn von allen Europäern unterscheidet. Unter den drei Milliarden Positionen des menschlichen Genoms gibt es tatsächlich keine Stelle, an der etwa alle Europäer ein A haben und alle Asiaten oder Afrikaner ein C. Es gibt nicht nur kein Gen, das jeweils Asiaten, Afrikaner und Europäer unterscheidet, es gibt nicht mal eine einzige unterschiedliche Stelle im Genom. Es gibt die gleichen Varianten überall, nur in manchen Regionen eben seltener als in anderen. Als Menschheit eint uns also viel mehr, als uns trennt.“
Dennoch, die Idee des genetischen Rassismus ist nicht totzukriegen. Aktuelle Rassetheoretiker haben ihre Theorie allerdings an die wissenschaftlichen Tatsachen angepasst. Sie behaupten nicht mehr, dass „Rasse“ auf genetischen Merkmalen beruht.
Rassismus passt sich in der Geschichte häufiger an neue Erkenntnisse an, bleibt beim „Wie“ und „Warum“ aber gleich. In diesem Fall wurde der Begriff „Rasse“ von einigen durch Begriffe wie „Ethnizität“ ersetzt. Nachdem der Rassebegriff die Wissenschaft zwei Jahrhunderte beschäftigt hat, erst in dem Versuch, ihn zu beweisen, dann damit, ihn zu widerlegen, wurde er von Rassisten einfach kurzerhand ersetzt. Nun sagt man Ethnizität und meint: „Die“ sind trotzdem alle gleich. Die grundsätzliche und wissenschaftlich unhaltbare Verbindung von Merkmalen bleibt dabei bestehen.
1.2.2 Territorial begründeter Rassismus
Modernere Denker, die wissen, dass die Idee der „Rasse“ falsch ist, meinen dennoch, Rassismus sei eine natürliche menschliche Regung. Sie begründen, Menschen würden sich naturgemäß von anderen abgrenzen und andere abwerten. Sie erklären Rassismus mit territorialem Verhalten und vergleichen uns Menschen mit Tieren, die ihr Gebiet verteidigen.
Die Idee des territorialen Verhaltens beim Menschen hat eine versteckte Grundannahme, die sie nicht benennt. Sie geht davon aus, dass unser Verhalten, uns sozial an eine Gruppe zu binden und ein Territorium zu besetzen, davon abhängt, dass die Gruppe „rassisch homogen“ ist.
Selbst wenn wir in erster Linie territoriale Wesen wären, ist nicht gesagt, wer zu unserer und wer zu einer Fremdgruppe gehört. Das aber ist die Wurzel von Rassismus: Die Definition, wer zu uns gehört und wer nicht. „Wir und die“ ist eine willkürlich gezogene Grenze zwischen uns und den anderen, sie ist nicht gottgegeben, sie ist nicht „natürlich“ und sie ist deshalb nicht unveränderbar. Sie ist eine Entscheidung. Die territoriale Idee als Ursprung für Rassismus scheidet aus, sie fußt selbst auf rassistischen Grundannahmen, die nicht bewiesen, ja, nicht einmal wahrscheinlich sind.
Im Gegenteil ist es eine Eigenschaft des Menschen, dass er im Laufe seiner Entwicklung immer unterwegs war. Der Mensch hat den ganzen Planeten eingenommen, weil er von Natur aus ein Wanderer ist.
Die Wanderungsbewegung des Menschen ist eine so zentrale menschliche Eigenschaft wie seine Sozialität.
Der Erfolg dieser einen Menschheit beruht auf der Suche nach einem besseren Leben, der Neugier, dem Aufbruch und der Anpassungsfähigkeit an neue Umgebungen.
Schon die ersten Menschen wanderten und vergesellschafteten sich neu. Vermutlich aus Afrika kommend, besiedelten sie die ganze Welt. Trafen sie auf andere Menschen, wie das vor etwa 45 000 Jahren bei der Begegnung des Homo Sapiens und des in Europa ansässigen Neandertalers der Fall war, waren ihre vorrangigen Ziele nicht kriegerisch. Bei ihren Wanderungen gingen Menschen stattdessen Beziehungen zu anderen Menschen ein. Deshalb besteht das durchschnittliche Genom des heutigen Europäers noch bis zu 4% aus Neandertalergenen. Die beiden Menschenarten lebten etwa 60 000 Jahre nebeneinander. An vielen untersuchten Fundstellen wurde eine Vermischung zwischen Neandertaler und modernem Menschen festgestellt, so zum Beispiel in der Levante, in Osteuropa und in Sibirien.17
Auch die oft gehörte Behauptung, der kriegerische Homo Sapiens habe den Neandertaler ausgerottet, scheint nicht zu stimmen. Ältere Ideen gingen (mal wieder) davon aus, dass Homo Sapiens dem Neandertaler überlegen war und nahmen an, dass die europäischen Ureinwohner deshalb ausstarben. Neuere Forschungen aus den Niederlanden zeigen aber, dass das vermutlich nicht der Grund für das Verschwinden des Neandertalers war.18
Neandertaler lebten weitverstreut in ganz Europa verteilt. Sie waren kulturell hochentwickelt, gebrauchten Werkzeuge, benutzten Feuer und verwendeten Pflanzen zu Medizinzwecken. Man vermutet, dass sie ausstarben, weil sie einfach zu wenige waren. Ein Selektionsnachteil war eventuell ihre monogame Lebensweise. Anders als der Homo Sapiens verbreitete sich der Neandertaler deshalb nicht so stark. Der Genpool des Neandertalers war durch seine Abgeschlossenheit eher eingeschränkt. Probleme, die mit Inzucht einhergehen, mögen ebenfalls eine Rolle beim Verschwinden des Neandertalers gespielt haben. Die Überlegenheit des Homo Sapiens war es dagegen nicht, denn zur Zeit des Aussterbens des Neandertalers lebten diesen Forschungen zufolge nur etwa 1500 Exemplare des Homo Sapiens im Gebiet des Neandertalers.
Für Menschen war und ist es sinnvoll, sich mit anderen Menschen zusammenzutun. Nicht nur aus sozialen Gründen und um die Widrigkeiten neuer Umgebungen zu meistern, sondern auch, um den Genpool zu erweitern. Die Vorstellung von genetischer „Reinheit“, die vielen rassistischen Theorien zugrunde liegt, ist dagegen widernatürlich. Genetische Vielfalt ist ein Überlebensvorteil. Wenn wir die Theorien genetischer „Reinheit“ lange genug anwendeten, würde Inzucht den Fortbestand unserer Gesellschaften gefährden.





























