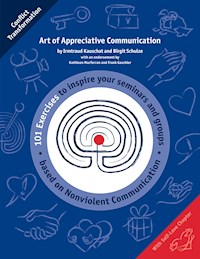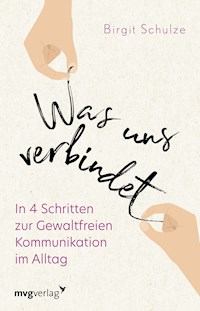
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mvg Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ob in der Familie, im Freundeskreis oder im Büro: Wenn Menschen zusammenkommen und kommunizieren, entstehen oft Missverständnisse und Konflikte. Kommunikation betrifft aber auch einen selbst: Wer sehr streng mit sich spricht, entwickelt kein Selbstvertrauen und neigt zu einem schlechten Selbstwertgefühl. Birgit Schulze ist Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation und erklärt anhand zahlreicher Übungen und Aufgaben, wie es gelingt, Gewaltfreie Kommunikation mit sich und anderen in den Alltag zu integrieren. Sie lädt ein, in einem praktischen 4-Schritte-Programm die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu erkunden und besser wahrzunehmen, um so in eine wertschätzende Verbindung zu sich selbst und zum Gegenüber zu treten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Birgit Schulze
Was uns verbindet
Birgit Schulze
Was uns verbindet
In 4 Schritten zur Gewaltfreien Kommunikation im Alltag
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe
1. Auflage 2021
© 2021 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Petra Holzmann
Umschlaggestaltung: Manuela Amode
Umschlagabbildung: Shutterstock.com/mexrix, klerik78
Satz: Sania Haschemi für Pageturner Production GmbH
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-7474-0336-5
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96121-701-4
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96121-702-1
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter www.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1. Einführung in den Prozess der Gewaltfreien Kommunikation (GFK)
Die vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation
Die drei Wege der Gewaltfreien Kommunikation
2. Einführung in den Praxisteil
Was uns verbindet: Beobachtung
Was uns verbindet: Gefühle
Was uns verbindet: Bedürfnisse
Was uns verbindet: Bitten
3. Nutze die vier Schritte der GFK für dich
Was mich mit mir verbindet: Selbst-Einfühlung
Meine innere Stimme und ich
Meine Trigger und ich
Was uns verbindet, auch wenn wir uns ärgern
Vertiefende Übungen und Selbst-Fürsorge
4. Kommunikativen Herausforderungen mit Empathie und Mitgefühl begegnen
Was uns verbindet: Die Absicht der Verbindung
Was uns verbindet: Empathisches Zuhören
Was uns trennt: Kommunikationssperren
Was uns verbindet: Der empathische Dialog – bestehend aus Selbst-Einfühlung, Einfühlung und Selbst-Ausdruck
Was uns verbindet: Mein Feind und ich
Was uns verbindet: Gewaltfrei unterbrechen im Alltag
Was uns verbindet: Empathie in Konflikten
Was uns verbindet – wenn wir Nein sagen
Was uns verbindet – wenn ich Nein sage
Was uns verbindet: Nein hören – Widerstand gewaltfrei annehmen
Was uns verbindet: Die vier Schritte in Alltagssprache verwandeln
Was uns verbindet: Wertschätzung und Feedback geben
Was uns verbindet: Wenn Empathie, Selbst-Empathie und Selbst-Ausdruck nicht weiterhelfen
5. Nutze die vier Schritte für deine persönliche Entwicklung
Was uns verbindet: Dankbarkeit
Was uns verbindet: Embodiment
Was uns verbindet: Selbst-Wertschätzung
Was uns verbindet: Abschied nehmen
Was uns verbindet: Entwickle, entdecke und gestalte dein Leben
Dankbarkeit und Wertschätzung
Anhang
Gefühls- und Bedürfnislisten
Die Grundannahmen zu den Bedürfnissen in der Gewaltfreien Kommunikation
Verwendete und weiterführende Literatur
Endnoten
Über die Autorin
Ansprache im Buch
Viele meiner Klientinnen, Leserinnen und Hörerinnen sind Frauen. Daher wirst du in diesem Buch mehr Beispiele aus dem Leben von Frauen finden. Der besseren Lesbarkeit wegen verwende ich in diesem Buch abwechselnd und unregelmäßig die weibliche, männliche und neutrale Form. Gemeint sind immer alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter, Religion, Hautfarbe, Kultur oder anderen Unterscheidungsmerkmalen.
Hinweis
Meine Absicht ist es, mit diesem Buch die Methode der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg vorzustellen und dir Anwendungsbeispiele und Übungen für die Umsetzung im Alltag zu geben. Die Beschäftigung mit den vier Schritten kann dazu führen, dass du mit schmerzhaften Auslösern deiner persönlichen Geschichte in Kontakt kommst. Gleichzeitig ist es mir wichtig zu betonen, dass ich keine Therapeutin bin und keinen therapeutischen Anspruch an die GFK habe. Wenn du erkennst, dass du mit Themen in Kontakt kommst, die Schmerz in dir auslösen, dann rate ich dir, professionelle Unterstützung aufzusuchen.
Vorwort
Was verbindet dich mit deinen Mitmenschen? Gemeinsame Erlebnisse, Lachen, Liebe, Freundschaft oder das Betrauern von gemeinsamen Verlusten? In schwierigen Situationen zusammenzuhalten, verbindet ebenso wie das gemeinsame Erleben glücklicher und schöner Momente. Aber was verbindet uns, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Wenn Vorwürfe und Schuldzuweisungen durch den Raum schwirren, wenn Konflikte schon seit langer Zeit unausgesprochen im Raum schwelen? Dann ist da alles – aber keine Verbindung. Wir sehen nur noch das, was uns am anderen stört, was der andere hätte besser oder richtiger machen können. Wir verteilen und hören Vorwürfe und Anschuldigungen. Oftmals bleibt ein schaler Geschmack zurück, selbst dann, wenn wir uns entschuldigt oder ausgesprochen zu haben glauben. Wir erinnern uns wieder und wieder an die Fehler, die wir selbst gemacht haben, oder an die, die die andere Person gemacht hat, und schmieren sie uns jedes Mal erneut aufs Brot. Verzeihen und vergeben gelingt meist nicht.
Also, was verbindet uns dann wirklich? Es ist die Verbindung mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen und denen unserer Mitmenschen, kurz: Mitgefühl oder Empathie. Das macht uns menschlich. Mitgefühl ist eine angeborene Fähigkeit, die wir in entspannten Lebenslagen automatisch abrufen können. Aber auch in herausfordernden Momenten sind wir dazu in der Lage, vorausgesetzt, wir erinnern uns daran und wollen uns mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen verbinden. Wenn Verletzungen zu groß, zu tief oder zu lang anhaltend sind, ist diese Bereitschaft vergessen. Aber wir verlieren sie nie.
Es gibt unterschiedliche Wege und Methoden, Mitgefühl und Empathiefähigkeit zu trainieren, zu stärken und auch in den herausfordernden Momenten des Lebens abzurufen. Eine davon ist die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg.
Einleitung
WAS IST GEWALTFREIE KOMMUNIKATION?
Marshall B. Rosenberg, Begründer der Gewaltfreien Kommunikation (GFK), entwickelte einen Prozess, der es ermöglicht, in konflikthaften Situationen Lösungen zu finden, die die Bedürfnisse aller im Blick haben. Dieser Prozess basiert auf den vier Schritten Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Allerdings ist die Gewaltfreie Kommunikation mehr als nur ein Kommunikationsprozess.
GFK ist Bewusstsein: Die GFK bietet dir an, ein Leben mit Mitgefühl, Zusammenarbeit, Verbindung, Mut und Authentizität zu führen.
GFK ist Sprache: Mit der GFK verstehst du besser, wie Worte zu einer Verbindung oder einer Trennung beitragen.
GFK ist Kommunikation: Die GFK bietet Wege und Möglichkeiten, mit denen du in Konflikten klarer um das bitten kannst, was du wirklich brauchst. Dank der vier Schritte verstehst du leichter, was andere Menschen brauchen. Auch, wenn du damit nicht einverstanden bist.
GFK ist Gestaltung beziehungsweise Social Change1: Die GFK bietet dir die Möglichkeit, deine Welt nach deinen Werten zu gestalten – indem du Macht mit anderen gemeinsam teilst (Power with), anstelle sie über andere auszuüben (Power over).
WARUM GEWALTFREIE KOMMUNIKATION?
Die Gewaltfreie Kommunikation wurde in den 1970er-/1980er-Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt. Sie basiert auf der klientenzentrierten Gesprächsführung nach Carl Rogers. Marshall B. Rosenberg, Begründer der GFK, war Schüler von Rogers. Der Begriff Gewaltfreie Kommunikation ist angelehnt an das indische Sanskritwort Ahimsa, das »Gewaltlosigkeit« bedeutet und von Gandhi geprägt wurde. Ahimsa schließt neben physischer Gewalt auch die geistige aus. Geistige Gewalt zeigt sich in unserer Alltagssprache beispielsweise durch Beleidigungen, Ausdruck von Hass oder verletzende Formulierungen.2
Den Ansatz des respektvollen und verbundenen Miteinanders findet man in allen Weltreligionen. Mit den vier Schritten der Gewaltfreien Kommunikation gibt es eine übersichtliche, praktische und anwendbare Methode, um diese Werte in Sprache einzubinden und im Alltag umzusetzen. Wir brauchen deshalb neue Bücher, Menschen und Ideen, um Altbewährtes, Lebensdienliches und Friedenförderndes in die heutige Zeit zu übertragen und eine Sprache zu verwenden, die die Menschen heute verstehen.
Du hast dieses Buch vermutlich deshalb ausgewählt, weil es dir wichtig ist, auch in herausfordernden Momenten auf respektvolle Weise mit deinen Mitmenschen zu sprechen. Oder vielleicht deshalb, weil du von der Gewaltfreien Kommunikation gehört hast und neugierig bist, was es damit auf sich hat? Dann hoffe ich, dass du deine Neugier mit diesem Buch stillen kannst. Ich lade dich hier an dieser Stelle ein, dich auf deinen persönlichen Lernweg zu begeben – auf der Basis der Gewaltfreien Kommunikation.
Was das Lernen für uns alle leichter macht, sind Übungen, um sich in einem geschützten Rahmen auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu machen. Die in diesem Buch angebotenen Inhalte, Übungen, Materialien und persönlichen Geschichten aus meinem Leben und aus dem meiner Seminarteilnehmerinnen und Medianten dienen zur Inspiration, die GFK auszuprobieren und in sein Leben zu integrieren. Dieses Angebot erfüllt mir die Bedürfnisse nach Sinnhaftigkeit, Wertschätzung und Eingebunden-Sein und ist mein Beitrag zur Umsetzung von Marshall Rosenbergs Vision des Social Change.
Social Change bedeutet, die Welt auf friedliche Weise aktiv mitzugestalten. Konzepte wie das der GFK tragen dazu bei. Durch eine individuelle und persönliche Entwicklung kann Wandel in der Gesellschaft gelingen. Mit den vier Schritten werde ich befähigt, zu dem Menschen zu werden, den ich in der Welt sehen will, wodurch die Welt zu der Welt wird, in der ich leben will.
Die Frage lautet für mich persönlich: Wie gelingt es mir, zu diesem Menschen zu werden, obwohl mir weiterhin Konflikte, Widerstände, Neins oder Ablehnung begegnen? Ich lebe (noch) nicht in einer heilen Welt. Mir geht es nicht darum, in meiner eigenen heilen Welt zu leben und mit verklärtem Blick durch meine rosarote Brille auf die Welt zu schauen. Nein, mir ist es wichtig, die Vielfalt, die mich umgibt, zu würdigen, anzunehmen und als Fülle und Reichtum unseres Lebens genießen zu können. Die GFK mit ihren vier Schritten und drei Wegen ist für mich das wirkungsvollste Werkzeug, das ich in meinem alltäglichen Kommunikations- und Lebensrucksack mit mir führe.
In Konflikten bietet sich damit die Möglichkeit, Lösungen zu finden, die die Bedürfnisse aller in den Blick nehmen. Darum geht es für mich: gemeinsam Lösungen zu finden, die zur Erfüllung unserer Bedürfnisse beitragen. Das gelingt manchmal besser und manchmal schlechter.
Die GFK ist nicht nur eine Methode, die ich anwenden kann. Sie ist eher eine Haltung oder persönliche Einstellung, die im Laufe der Zeit wächst. Mich unterstützen die vier Schritte dabei auf empathische Weise, um mit mir und meinen Mitmenschen verbunden zu bleiben, wenn Bedürfnisse sich nicht oder schwer erfüllen. Diese Verbundenheit führt zum Social Change im Kleinen wie im Großen. Ich kann die GFK für mich allein praktizieren, ohne dass ich andere aktiv einbinde. Ich kann sie im direkten Kontakt mit meinen Mitmenschen anwenden und mich in empathischen Prozessen mit mir und allen anderen verbinden.
Solche empathischen Prozesse brauchen erfahrungsgemäß Übung. Du findest in diesem Buch eine Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation, sodass du die Methode und den Prozess kennenlernen und verstehen kannst. Du lernst die vier Schritte und drei Wege der GFK kennen. Durch die praktischen Übungen bist du eingeladen, dich direkt auszuprobieren und deine persönliche GFK-Haltung zu entwickeln oder zu vertiefen. Die unterschiedlichen Geschichten sollen dir dabei als Beispiel und als Inspiration für deine Übungspraxis dienen.
Im kostenlosen Downloadbereich zum Buch findest du vielfältiges weiterführendes Übungsmaterial, Beispiele und Begleitmeditationen.
Gefühls- und Bedürfnisbegriffe sind zentrale Elemente der GFK. Im Alltag drücken wir Gefühle oftmals über sogenannte Pseudogefühle, wie zum Beispiel »Ich fühle mich missverstanden, hintergegangen, nicht gesehen ...« aus. Diese Formulierungen beinhalten einen direkten Vorwurf. Denn wir teilen damit mit, dass unser Gesprächspartner etwas falsch gemacht hat oder anders, als wir es uns wünschen. Im Buch sind die Pseudogefühle deshalb kursiv geschrieben, um sie deutlicher von den echten Gefühlsbegriffen zu unterscheiden.
Ich freue mich und bin dankbar, dich auf deinem Weg zur Entwicklung deiner persönlichen GFK-Haltung begleiten zu dürfen. Die Bedürfnisse Beitragen, Gesehen-Werden, Wertschätzung und Sinnhaftigkeit sind dadurch erfüllt. Es ist schön zu wissen, dass wir beide gemeinsam ein Stück dieses Weges gehen. Danke, dass du hier bist.
Darmstadt, im Juli 2021
1
Einführung in den Prozess der Gewaltfreien Kommunikation (GFK)
Wir Menschen sind soziale und kommunikative Wesen. Wir tauschen uns aus, mit Worten und auch ohne Worte. Es gelingt uns zu kommunizieren, auch wenn wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Wenn wir aktiv kommunizieren, verwenden wir Worte. Wir unterstützen unsere Aussagen, den Inhalt, das, was wir sagen wollen, ebenfalls durch Gesten, Mimik oder Körperhaltung. Wir verwenden Wörter, die wir bevorzugen, um Sachverhalte zu beschreiben, zu bewerten oder zu erklären. Je nach Situation, Tagesverfassung und Beziehungserfahrungen können Worte oder auch dass wir etwas nicht sagen oder dass wir es so sagen, wie wir es sagen, Auslöser für Konflikte sein. Darüber hinaus gibt es verschiedene Sprachmuster, die wir einsetzen. All dies geschieht bewusst und gleichzeitig unbewusst. Aus Sicht der GFK geschieht nichts davon aus böser Absicht, sondern aus der Motivation heraus, unsere Bedürfnisse zu erfüllen.
Im Alltag gibt es ausreichend Potenzial für angespannte Situationen und Konflikte. Dafür gibt es unterschiedliche Auslöser: Mal ist es ein Wort, das uns auf die Palme bringt, mal werden wir falsch verstanden, mal will uns der andere nicht richtig verstehen, mal hört uns keiner zu oder wir wissen, wie es besser geht, wir fühlen uns unter Druck gesetzt, sollen gegen unsere Werte handeln ... Sicherlich kannst du diese Liste fortsetzen und weitere Auslöser benennen, die zu Konflikten führen. Eine Grundannahme der GFK besagt:
Es sind die Auslöser, die die Gefühle in uns erzeugen, wie zum Beispiel Wut, Ärger, Trauer, Schmerz. Die Ursache unserer Gefühle liegt jedoch nicht in den Auslösern, sondern in dem zugrunde liegenden unerfüllten Bedürfnis. Natürlich kann ein Auslöser auch dafür sorgen, dass es dir gut geht. Dass du fröhlich, beschwingt, leicht oder zufrieden bist. Dann liegt auch ein Bedürfnis zugrunde. Ein erfülltes.
Die folgende Grundannahme der Gewaltfreien Kommunikation hilft zu verstehen, auf welcher Ebene Konflikte entstehen:
Konflikte entstehen auf der Strategieebene. Also auf der Ebene, wie sich die Bedürfnisse erfüllen.
Eines meiner Lieblingsbeispiele zur Erklärung des Unterschieds zwischen Bedürfnis und Strategie ist das Folgende:
Mein Sohn kommt nach der Schule nach Hause. Er schleudert seine Tasche in die Ecke seines Zimmers, schaltet den PC an und beginnt, ein Computerspiel zu spielen, bei dem er sich permanent aufregt und herumbrüllt. Parallel dazu hört er Musik in einer Lautstärke, die mich stört. Ruhe, Ausspannen, Abschalten, Entspannung sind die Bedürfnisse, die er sich durch die Strategie des Computerspiels und der lauten Musik erfüllt. Um diese Uhrzeit aber brauche ich Ruhe und Entspannung. Ich bevorzuge ruhige Musik, liege auf dem Sofa oder mache mir einen Kaffee und ruhe mich aus. Worüber streiten wir? Nicht über Ruhe, sondern über die Lautstärke der Musik und sein Herumbrüllen beim Spielen. Wir nutzen gegensätzliche Strategien zur Erfüllung unserer Bedürfnisse nach Ruhe und Entspannung. Ich erfülle mir mein Bedürfnis nach Ruhe durch Auf-dem-Sofa-Liegen und Stille. Mein Sohn erfüllt es sich durch das Spielen am PC mit lauter Musik.
Du kannst dir sicher vorstellen, dass wir uns häufig darüber gestritten haben und es auch hin und wieder noch tun.
Um Konflikte zu lösen, ist es hilfreich, die Bedürfnisse aller in den Blick zu nehmen. Dadurch fällt es leichter, neue Strategien zu entwickeln, die die Bedürfnisse erfüllen. Die Gewaltfreie Kommunikation ist ein bedürfnisorientierter Kommunikationsprozess. Wenn du tiefer in die Gewaltfreie Kommunikation einsteigen willst, mache dich als Erstes mit den vier Schritten, die Marshall Rosenberg entwickelt hat, vertraut.
DIE VIER SCHRITTE DER GEWALTFREIEN KOMMUNIKATION
Hier stelle ich dir die vier Schritte der GFK vor. Auch findest du Übungen, durch die du sie aktiv in deine Alltagskommunikation aufnehmen kannst. Dadurch entwickelst du deinen persönlichen Gefühls- und Bedürfniswortschatz, wirst vertrauter mit der Formulierung deiner Beobachtung, deines Gefühls, deines unerfüllten Bedürfnisses und deiner Bitte, und bist schneller in der Lage, in angespannten Momenten deines Lebens mit dir und gleichzeitig mit deinen Mitmenschen verbunden zu bleiben.
1. SCHRITT »BEOBACHTUNG«
Im Alltag vermischt sich die Gefühlswelt häufig mit Gedanken oder Bewertungen. Wir glauben dann zu wissen, was richtig oder falsch ist, sind aber nicht verbunden mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen. Das Richtig- und Falschdenken fördern die Entstehung von Konflikten. Wichtig ist es deshalb, die Gedanken von den Gefühlen zu trennen. Das ist der Schritt der Beobachtung. Durch die Beobachtung erkennst du, ob du Bewertungen über dich oder andere hast oder was du in dieser Situation denkst.
Der Schritt der Beobachtung erleichtert es dir, dich aktiv mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen zu verbinden. Indem du dich darauf fokussierst, was du siehst, hörst, schmeckst, wahrnimmst, bleibst du im gegenwärtigen Moment. Stell dir vor, du beobachtest eine Situation wie durch ein Kameraobjektiv und beschreibst das, was du wirklich sehen kannst. Nicht das, was dir außerdem durch den Kopf geht. Du kannst dich ebenfalls an Zahlen, Daten und Fakten zur Situation orientieren. Der Schritt der Beobachtung hilft dir zu erkennen, ob du moralische Bewertungen im Sinne von richtig/falsch, gut/schlecht, böse/lieb in der aktuellen Situation anwendest. In unserer Alltagskommunikation sind wir es gewohnt, aus diesem richtig/falsch-Denken zu handeln, und verwenden eine entsprechende Sprache. Bleibst du in diesen Kategorien verhaftet, verhindert das die Verbindung zu dir selbst und zu deinen Mitmenschen.
Das Beispiel mit meinem Sohn zeigt es deutlich. In meiner Vorstellung ist es unmöglich, sich bei lauter Musik und mit Computerspielen zu entspannen. Er dagegen findet es langweilig und blöd, auf dem Sofa zu liegen und leise Musik zu hören. Wir finden also beide, dass der andere es besser oder vielleicht sogar richtiger machen könnte und der eine den anderen mit seiner Strategie einschränken will.
ÜBUNG ZUM ERSTEN SCHRITT: BEOBACHTE DEINE GEDANKEN!
Verbinde dich jetzt mit deinen Gedanken, Urteilen, Bewertungen oder Beobachtungen zu der von mir geschilderten Situation. Wenn du Kinder hast, kennst du das vielleicht. Möglicherweise hast du ähnliche Erfahrungen gemacht.
Schritt 1: Werde dir jetzt deiner Gedanken bewusst.
Was hast du in dem Moment gedacht, als du das Beispiel von mir und meinem Sohn von Seite 17 gelesen hast? Welche Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen?
Notiere dir deine Gedanken.
Findest du in deinen Notizen Bewertungen, Analysen, Interpretationen oder Urteile? Gibt es Sätze wie zum Beispiel »Dann soll er die Musik leiser machen!«, »So schlimm kann das ja nicht sein!«, »Das ist doch Kinderkram!«, »Was ist denn das für ein Beispiel?«, »Was hat das mit Gewaltfreier Kommunikation zu tun?«
Falls du ähnliche Gedanken notiert hast, sei unbesorgt. Das ist normal und menschlich. Es geht in der GFK nicht darum, diese Gedanken nicht zu haben, sondern sie als Zeichen zu nutzen, um seinen Gedankenmustern auf die Spur zu kommen. Durch die Verwandlung von moralischen Bewertungen, Interpretationen, Urteilen oder Diagnosen in wertfreie Beobachtungen erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Person keinen Vorwurf hört. Letztlich geschieht genau das in unserer Alltagskommunikation. Wenn ich zu meinem Sohn ins Zimmer gehe und sage: »Immer kommst du nach der Schule heim, wirfst deine Tasche in die Ecke, und das Erste, was du machst, ist, den Computer anzuschalten und die Musik aufzudrehen«, hört er vermutlich Vorwürfe und macht sich seine eigenen bewertenden Gedanken über mich. Die Reaktion darauf kannst du dir vorstellen. Auf Dauer führt das bei mir dazu, dass ich schon gereizt bin, bevor er nach Hause kommt, weil ich in Gedanken bei dem bin, was er aus meiner Sicht wieder falsch macht. Von seiner Gereiztheit möchte ich hier gar nicht sprechen.
Eine moralisch wertfreie Beobachtung zu formulieren, reicht allein nicht aus, um Konflikte zu lösen oder Wege zu einem friedlichen Miteinander zu gestalten. Die wertfreie Beobachtung dient als Einstieg, um dich mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen zu verbinden und diese zum Ausdruck zu bringen.
2. SCHRITT »GEFÜHLE«
Gefühle sind der nächste Schritt in diesem Konzept. Sie dienen dir als Wegweiser zu deinen Bedürfnissen. Mal spürst du diese Gefühle intensiver – beispielsweise Wut oder Ärger. Auch Gefühle wie Freude oder Verliebtsein kannst du sehr intensiv wahrnehmen. Mal sind deine Gefühle leise und kaum wahrnehmbar. Du merkst vielleicht gar nicht, wie es dir gerade geht. Dadurch fällt es dir schwerer zu erkennen, was du in diesem Moment eigentlich brauchst und welches Bedürfnis unerfüllt ist.
Mit den vier Schritten der Gewaltfreien Kommunikation wirst du immer wieder daran erinnert, dich mit deinem Gefühl zu verbinden, um deine Bedürfnisse zu erkennen und zu benennen. In der GFK gehen wir davon aus, dass es weder positive noch negative Gefühle gibt. Wir kennen nur den Zustand erfüllter oder unerfüllter Bedürfnisse. Rosenberg sagte, es gebe lediglich zwei Gefühlszustände, in denen wir uns befinden: Entweder sind wir im Zustand des Feierns oder im Zustand des Trauerns/Bedauerns.3 Wir feiern, wenn sich unsere Bedürfnisse erfüllen. In diesen Momenten fühlen wir uns zum Beispiel angeregt, begeistert, dankbar, erfolgreich, fröhlich, gut gelaunt, lebendig, sicher, verbunden oder zugehörig. Wir trauern/bedauern, wenn sich unsere Bedürfnisse nicht erfüllen. Dann fühlen wir uns zum Beispiel ärgerlich, bedrückt, frustriert, geladen, hilflos, irritiert, mutlos, ohnmächtig, sprachlos, verwirrt oder zornig.
ÜBUNG ZUM ZWEITEN SCHRITT: GEFÜHL ERKUNDEN
Versetze dich noch einmal in die Beispielsituation mit meinem Sohn, um dir deinen Gefühlszustand ins Bewusstsein zu rufen. Erinnere dich an deine Gedanken zu der von mir geschilderten Situation.
Wie fühlst du dich jetzt? Gibt es einen Gefühlsbegriff, der dir durch den Kopf geht? Kannst du in deinem Körper ein Gefühl wahrnehmen? Eine Spannung, einen Druck oder eine andere Wahrnehmung? Wo in deinem Körper nimmst du das wahr?
Notiere dir deine Erkenntnis.
Vielleicht fällt es dir schwer, vielleicht fällt es dir leicht, dein Gefühl zu finden. Wir alle haben einen unterschiedlichen Zugang zu unserer Gefühlswelt. Wie schon beschrieben, gibt es Gefühle, die wir stärker oder schwächer wahrnehmen. Sei geduldig mit dir, wenn es dir noch schwerfällt oder für dich ungewohnt ist, dich auf deine Gefühle zu konzentrieren. Wenn dir jetzt spontan kein Wort für deinen Gefühlszustand eingefallen ist, so wird es dich trösten, dass du mit der Zeit deinen Gefühlswortschatz aufbaust. Du kannst dir auch eine Gefühlsliste erstellen und regelmäßig durchlesen. Das hilft dir, dich dauerhaft mit der Fülle deiner Gefühle auseinanderzusetzen. Im Anhang findest du eine Gefühlsliste zur Inspiration. Dein Gefühl ist dein Wegweiser zu deinen Bedürfnissen. Deshalb schauen wir uns jetzt den Schritt »Bedürfnisse« ausführlich an.
3. SCHRITT »BEDÜRFNIS«
Konflikte spielen sich auf der Ebene der Strategien ab. Wenn es uns gelingt, die Bedürfnisse aller in den Blick zu nehmen, wird es leichter, Lösungen oder Strategien zu finden, die die Bedürfnisse aller erfüllen.
Besser gelingt die Lösungsfindung, wenn ich in meiner Ruhe, in meiner Kraft bin und mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen gut verbunden bin. Schlechter gelingt es, wenn ich außer mir bin, ausschließlich meinen Gedanken oder Bewertungen zuhöre und meinen Emotionen, wie Wut und Ärger, freien Lauf lasse. Dann bin ich nicht mit mir und dem, was ich brauche, verbunden, sondern mit meinen Gedanken und Bewertungen, Urteilen, Interpretationen, zum Beispiel über meinen Sohn. Das führt dazu, dass Türen knallen, wir uns gegenseitig Vorwürfe an den Kopf werfen und die Stimmung vergiftet ist. Er spielt weiter und ich tigere schmollend durch die Wohnung.
Mein Sohn ist aber nicht die Ursache für meinen Ärger oder meine Wut, sondern mein unerfülltes Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung. Ausgelöst wird unser Konflikt durch das Aufeinanderprallen gegensätzlicher Strategien: die laute Musik oder das laute Computerspielen auf der einen Seite und in Stille auf dem Sofa zu liegen auf der anderen Seite. Wir trennen deshalb in der GFK den Auslöser von der Ursache.
Für mich ist die Erkenntnis der Bedürfnisse in diesem Prozess der wesentliche, alles verändernde Schritt. Bedürfnisse zu erkennen, ist wichtig, um den eigenen Bedürfnissen nach und nach auf die Spur zu kommen. Im Beispiel mit meinem Sohn haben wir beide das Bedürfnis nach Ruhe und Erholung.
Mit der GFK werden wir uns unserer Bedürfnisse und den von uns angewendeten Strategien bewusster. Sind meine Strategien lebensdienlich? Oder nutze ich Strategien, die eher Trennung und Spannungen hervorrufen? Dabei geht es bei diesem dritten Schritt noch nicht darum, gleich eine neue Strategie aus dem Hut zu zaubern, sondern sich mit dem Bedürfnis zu verbinden.
ÜBUNG ZUM DRITTEN SCHRITT: BEDÜRFNIS ERKUNDEN
Gehe in Gedanken zurück zum Beispiel. Du hast bereits die Schritte Beobachtung und Gefühl durchlaufen. Jetzt erkundest du dein Bedürfnis.
Welches Bedürfnis ist bei dir in dieser Situation erfüllt? Welches ist nicht erfüllt? Nutze hierzu gerne die Bedürfnisliste, die du im Anhang findest.
Notiere dein Bedürfnis:
Wenn du ein Bedürfnis gefunden hast, spüre nach, wie es sich anfühlt. Tritt Entspannung ein? Oder das Gegenteil? Frage dich: »Was brauche ich in diesem Moment? Von mir? Von dem anderen? Von einer anderen Person?«
Anfangs kann es ungewohnt sein, das Bedürfnis zu vermuten. Das liegt vielleicht daran, dass du es nicht gewohnt bist oder noch keine Begriffe dafür kennst. Möglicherweise bist du erneut bei deinen Gedanken und Bewertungen. Das ist natürlich und menschlich.
Die Gewaltfreie Kommunikation ist keine Methode, die du Schritt für Schritt durchgehst und sofort abrufen kannst. Sie ist ein Prozess. Prozesshaftes Vorgehen bedeutet ein Vor und Zurück, ein Hin und Her. Manchmal bedeutet es auch, einige Runden zu drehen. Es braucht Zeit und Nachsicht mit dir selbst, wenn du dich auf diesen Weg begibst. Um neue Strategien zu entwickeln, ist der vierte Schritt notwendig. Daher erläutere ich dir hier den nächsten Schritt zur Gewaltfreien Kommunikation im Alltag.
4. SCHRITT »BITTE«
Die Bitte ist der Schritt, der dich ins Handeln bringt und über den du die Verbindung zu deinen Mitmenschen herstellen kannst. Dann, wenn du dazu bereit bist. Mit einer Bitte im Sinne der Gewaltfreien Kommunikation bittest du andere Menschen darum, zur Erfüllung deiner Bedürfnisse beizutragen, du bittest nicht um das Ausführen einer konkreten Strategie. Du überlässt ihnen die Entscheidung darüber, deiner Bitte nachzukommen – also zur Erfüllung deiner Bedürfnisse beizutragen.
Idealerweise hast du dich vor der Formulierung deiner Bitte mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen verbunden. Du teilst in der Bitte deine Beobachtung, dein Gefühl und dein unerfülltes beziehungsweise durch die Bitte erfülltes Bedürfnis mit. Diese Formulierung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass deine Bitte als Bitte und nicht als Forderung gehört wird.
Ob es sich um eine Bitte im Sinne der GFK handelt, erkennst du daran, wie entspannt du mit einem Nein umgehst, das dir die andere Person vielleicht erwidert. Sofern du das Nein ruhig und gelassen nimmst und andere Strategien zur Erfüllung deiner Bedürfnisse bereit bist zu nutzen, hast du eine Bitte geäußert. Reagierst du dagegen ärgerlich, genervt oder wütend, hattest du vermutlich eine Forderung im Kopf. Übrigens: Es geht nicht darum, keine Forderungen mehr zu stellen. Vielmehr geht es darum, ähnlich wie bei der Trennung von Bewertungen und Beobachtung zu erkennen, aus welchem Bewusstsein heraus wir handeln. Dieser Schritt bietet enormes Potenzial für die Verbindung mit deinen Mitmenschen und dir selbst. Und damit ist es ein wichtiger Schritt für den gewaltfreien Umgang in deinen verschiedenen Lebensbereichen.
Die Gewaltfreie Kommunikation unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Formen von Bitten.
DIE HANDLUNGSBITTE
Dies ist die alltäglichere Form einer Bitte. Mit einer Handlungsbitte bittest du eine andere Person um eine konkrete Handlung; du bittest darum, etwas zu tun oder zu unterlassen, was zur Erfüllung deiner Bedürfnisse beiträgt. Du drückst dich auf Basis der vier Schritte aus, indem du deine Beobachtung, dein Gefühl und dein Bedürfnis benennst, das sich durch die Handlung erfüllt. Eine Bitte ist darüber hinaus positiv, machbar, konkret formuliert und im Hier und Jetzt erfüllbar.
In meinem Beispiel könnte eine Handlungsbitte folgendermaßen lauten:
Schritt: Beobachtung: »Wenn ich höre, dass die Musik so laut ist, dass ich sie in meinem Arbeitszimmer mitsingen kann …«
Schritt: Gefühl: »… bin ich genervt.«
Schritt: Bedürfnis: »Ich brauche Ruhe.«
Schritt: Handlungsbitte: »Bist du bereit, die Musik leiser zu drehen?«
Vielleicht antwortet er mit einem Ja, vielleicht mit einem Nein. Entscheidend ist nicht, wie er reagiert, sondern wie ich mit seiner Antwort umgehe. Daran erkenne ich, ob ich in einer bittenden oder fordernden Haltung war.
DIE VERBINDUNGSBITTE
Bei dieser Form der Bitte bietest du Verbindung an, stellst sie her oder versuchst, sie zu halten. Die Verbindungsbitte ist nützlich, wenn die Situation angespannt ist und du sicherstellen willst, dass du so gehört wirst, wie es dir wichtig ist. Oder du willst sicherstellen, dass kein Missverständnis vorliegt. Dies gelingt zum Beispiel durch Fragen wie:
Wie geht es dir mit dem, was ich gesagt/getan/unterlassen habe?
Was brauchst du von mir?
Was hast du von mir gehört?
Willst du wissen, was ich von dir gehört habe?
Willst du wissen, wie es mir mit dem geht, was du gesagt/getan/unterlassen hast?
In meinem Beispiel könnte eine Verbindungsbitte so lauten:
Schritt: Beobachtung: »Wenn ich höre, dass die Musik so laut ist, dass ich sie in meinem Arbeitszimmer mitsingen kann …«
Schritt: Gefühl: »… bin ich genervt.«
Schritt: Bedürfnis: »Ich brauche Ruhe.«
Schritt: Verbindungsbitte: »Kannst du mir sagen, was du von mir gehört hast?«
Die Reaktion kann auch hier anders als erwartet ausfallen. Wie bei der Handlungsbitte liegt der gewaltfreie Umgang damit darin, wie du auf die Antwort deines Gesprächspartners reagierst. Im Falle einer unerwarteten Rückmeldung kannst du eine weitere Verbindungsbitte anschließen.
Nach einer Bitte, die du auf Basis der vier Schritte formuliert hast, hört der Prozess der GFK nicht auf, sondern er eröffnet dir die Chance, dich in der eigenen Verletzlichkeit zu zeigen und dem anderen die Möglichkeit zu geben, sich genauso verletzlich zu zeigen. Im Vertrauen darauf, dass es andere, noch unbekannte Wege zur Erfüllung deiner Bedürfnisse gibt.
Gewaltfreiheit bedeutet, im Austausch mit unseren Mitmenschen zu bleiben, auch wenn wir nicht mit deren Meinung oder Sichtweise einverstanden sind. Herauszufinden, welches unserer Bedürfnisse unerfüllt ist, ermöglicht es, Wege zu finden, wie wir es uns auf lebensdienliche Weise erfüllen können. Das geht nicht immer ohne Konflikte. Die GFK hat nicht das Anliegen, Konflikte zu vermeiden. Ihr Anliegen ist, dass wir aus einer offenen, verbindenden, vertrauensvollen Haltung heraus mit uns selbst und gleichzeitig mit unseren Mitmenschen in Verbindung kommen und bleiben. Auch dann, wenn es kracht.
DIE DREI WEGE DER GEWALTFREIEN KOMMUNIKATION
Die GFK ist eine kurze und übersichtliche Methode. Es gibt die vier Schritte, durch die du dich mit dem verbinden kannst, was sich dir in diesem Moment zeigt. Und mit der du um die Erfüllung deiner Bedürfnisse bitten kannst.
Der Prozess der Gewaltfreien Kommunikation ist allerdings kein geradliniger Prozess. Die Chance für mehr Verbindung, Bedürfniserfüllung und Empathie im Lebensalltag liegt darin, die vier Schritte zu gehen – im Stillen, im Lauten, in Diskussionen, in Alltagsgesprächen – und bereit zu sein, erneut einzusteigen. Die Absicht, aus der heraus wir handeln, ist die Absicht der Verbindung. Dass es Momente gibt, in denen Verbindung nicht möglich ist, schließt die GFK dabei nicht aus.
Du hast jetzt einen ersten Eindruck davon, was es mit den vier Schritten der Gewaltfreien Kommunikation (Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte) auf sich hat. Mir ist es wichtig, das Konzept der GFK verständlich und anwendbar zu machen.
Ein häufiges Missverständnis zu Beginn der Beschäftigung mit der GFK ist zu glauben, es reiche aus, seine Beobachtung, Gefühle, die unerfüllten Bedürfnisse und eine Bitte zu äußern, damit die anderen genau das machen, worum sie gebeten wurden. Das ging auch mir anfangs so. Neben den vier Schritten kennen wir noch drei Wege in der Gewaltfreien Kommunikation:
Selbst-Einfühlung