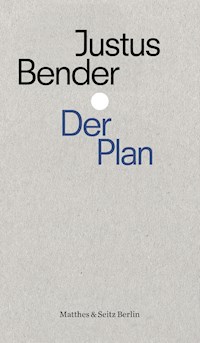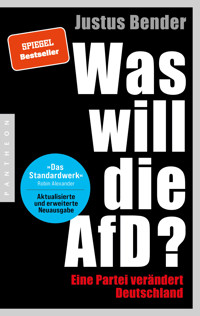
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie sähe Deutschland aus, wenn die AfD an der Macht wäre?
Aktueller denn je: Ein erschreckend weitsichtiges Buch über die zunehmende Radikalisierung der AfD und die Bedrohung für unsere Demokratie
»Hammer! 2017 schreibt Justus Bender, dass 2021 Olaf Scholz Kanzler ist – nicht genau dieses Bündnis, aber fast ganz genau. Und mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich das lese, weil das ist plötzlich alles denkbar.« Markus Lanz im Jahr 2025
Der unaufhaltsam scheinende Aufstieg der AfD verändert nicht nur die politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland – er droht das Land zu spalten, während die traditionellen Parteien immer verzweifelter nach einer Antwort suchen, um den Siegeszug zu stoppen. Es gibt kaum einen Journalisten, der die AfD und ihr Umfeld so gut kennt wie Justus Bender. Seit ihren Anfängen im Jahr 2013 begleitet er den Aufstieg der Partei mit investigativen Recherchen und berichtet über ihre innerparteilichen Querelen und radikalen Tendenzen. Er führte Hunderte Interviews mit ranghohen Funktionären der AfD, er kennt alle relevanten Akteure aus zahllosen persönlichen Begegnungen.
In diesem, erstmals 2017 erschienen, Buch, das von seiner Aktualität nichts eingebüßt hat, zeichnet Justus Bender ein Porträt der AfD aus nächster Nähe: Er beschreibt das Spitzenpersonal und damit zugleich die wichtigsten Repräsentanten der verschiedenen Flügel und Strömungen – ihre Positionen, ihre Machtkämpfe. Vor allem aber untersucht er, mit welchen Mitteln diese Partei unser Land und unsere Demokratie verändert. Was will die AfD eigentlich? Und wie sähe Deutschland aus, wenn sie an der Macht wäre?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Justus Bender
Was will die AfD?
Eine Partei verändert Deutschland
Erweiterte und aktualisierte Neuausgabe
Pantheon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © dieser Ausgabe 2025 Pantheon Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-20716-8V003
www.pantheon-verlag.de
Inhalt
Vorwort zur Neuausgabe
Der Rhododendron-Effekt
Wie es ist, jahrelang mit AfD-Mitgliedern zu sprechen und was sie mich gelehrt haben
Platonische Triebe
Warum die AfD die Demokratie gefährdet – obwohl ihre Mitglieder glauben, eine Tyrannei zu bekämpfen
Das Recht des Lauteren
Wie in der AfD immer die Radikalen gewinnen – und warum das keine Verschwörung einzelner Funktionäre ist
Schmetterlinge im Bauch
Wie die Vordenker der AfD den Populismus verteidigen – und welches Deutschland sie dabei im Sinn haben
Der große Graben
Warum es in der Partei keine Flügelkämpfe mehr gibt – und worum es bei den ständigen Querelen wirklich geht
Konterrevolution
Was die AfD wirklich will – und wie Deutschland aussähe, wenn sie an der Macht wäre
Kopfgedanken gegen Bauchgefühle
Weshalb so viele Strategien gegen die AfD wirkungslos bleiben – und was wir an ihnen ändern müssen
Vorwort zur Neuausgabe
Als dieses Buch geschrieben wurde, war die Welt noch eine andere. Angela Merkel war Bundeskanzlerin und Barack Obama amerikanischer Präsident. Die Briten hatten gerade für den Brexit gestimmt. Das Bundesverfassungsgericht verhandelte über ein NPD-Verbot. Die Deutschen betrauerten die Opfer des islamistischen Anschlags vom Breitscheidplatz.
Dass dieses Buch heute, im Jahr 2025, noch immer gelesen wird und nicht auf den Ramschtischen landete, dass es ein »Standardwerk« geworden ist, wie manche sagen, hat zwei Ursachen. Die erste Ursache heißt Gerald Knaus. Der bekannte Migrationsforscher wollte ein Buch über Europa schreiben und dazu recherchieren, wie die Europakritiker von der AfD sich in ihren Anfangsjahren verhielten. Also nahm er dieses in die Jahre gekommene Buch zur Hand, pustete den Staub vom Einband und begann zu lesen.
Das war Anfang 2025, als in Österreich zwei Parteien namens FPÖ und ÖVP über eine Regierungskoalition verhandelten. Eine Zeit also, in der die Möglichkeit bestand, dass der österreichische Rechtspopulist Herbert Kickl Bundeskanzler würde. Auch in Deutschland stand im Februar 2025 eine Bundestagswahl bevor, und es war unklar, ob die AfD so stark werden würde, dass sie eine Regierungsbeteiligung erzwingen könnte. Genau diese Möglichkeit hatte ich acht Jahre zuvor in meinem Buch beschrieben. Ich hatte spekuliert, dass nach Angela Merkel ein Mann namens Olaf Scholz Bundeskanzler werden würde. Und dass dieser eine unbeliebte Koalition führen würde, die unter dem Eindruck von Terroranschlägen abgewählt wird. Und dass die AfD 2025 einen großen Wahlerfolg feiern würde. So kam es.
Knaus las also ein acht Jahre altes Buch und entdeckte eine gespenstisch genaue Beschreibung seiner Gegenwart. Das musste er jemandem erzählen. Zufällig lud ihn Markus Lanz in seine Fernsehsendung ein, und das Gespräch kam auf den Rechtspopulismus. Also sagte Knaus: »Wenn dieser Trend so weitergeht, dann sage ich voraus, dann könnte eintreten, was ein Korrespondent der F.A.Z. in einem Buch 2017 vorausgesagt hat. Das ist unglaublich. Der hat ein Buch über die AfD geschrieben und hat gesagt – 2017! –, im Jahr 2021 wird Olaf Scholz eine Regierung bilden. Das war damals noch nicht jedem klar. Die Regierung wird bis 2025 regieren und wird am Ende unbeliebt sein. Und dann gibt es einen Terroranschlag. Und unter dem Eindruck von Terror und Angst wird die AfD 28 Prozent gewinnen. Und dann werden alle demokratischen Parteien sagen: ›Wir machen jetzt aber eine Koalition gegen die AfD.‹ Und nach einem Jahr wird das scheitern, weil die Parteien sich nicht einigen. Und dann wird in der CDU jemand aufstehen und sagen: ›Machen wir die Koalition mit der AfD.‹ Und 2026 gibt es den AfD-Kanzler.«
Dieser Teil der Sendung verbreitete sich auf Tiktok und Instagram. Hunderttausende Menschen sahen ihn. Es war eine Aufregung wie auf dem Jahrmarkt, wenn die Wahrsagerin, die Menschen aus der Hand liest, richtig liegt mit ihrer Prognose. Schließlich lebt die Aufregung über die AfD davon, dass niemand weiß, wie die Geschichte ausgehen wird. Ob man im Rückblick sagen wird, es sei alles nur eine übertriebene Sorge gewesen. Oder ob Deutschland ein autoritär regiertes Land wird. Eine wahrgewordene Spekulation schuf deshalb Aufmerksamkeit. Vielleicht wusste dieser Journalist von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung etwas, das andere nicht wissen?
Ich kann erklären, warum ich richtig lag. Meine Spekulation war ein Gedankenspiel zu der Frage, wie die AfD an die Macht kommen könnte, ohne fünfzig Prozent der Stimmen zu erreichen. Es ging also nicht darum, vorherzusagen, dass Olaf Scholz einmal Bundeskanzler werden würde oder Jens Spahn in der CDU zu denen gehören würde, die eine Normalisierung der AfD nahelegen. Das war nur Kolorit, um das Gedankenspiel lebendiger zu machen. Die Leser sollten vor allem verstehen, dass eine stärker werdende AfD schon mit 28 Prozent den Bundeskanzler stellen könnte. Warum? Weil in einem solchen Fall nur noch instabile Bündnisse gegen sie möglich sind. Koalitionen von nervösen Parteien, die unter Existenzangst leiden.
Wie sich instabile Bündnisse verhalten, hat die Ampelkoalition gezeigt. SPD, Grüne und FDP hatten ein gestörtes Verhältnis. Sie waren in einem Zwiespalt, einerseits durften sie nicht streiten, andererseits mussten sie unterscheidbar bleiben, durften ihre Prinzipien also nicht preisgeben. Wenn sie das eine taten, half das der AfD, also versuchten sie das andere. Das half der AfD auch. Wenn sie sich vertrugen, sprachen die AfD-Politiker von »Kartellparteien« oder »Blockparteien«, egal was man wähle, man bekomme immer das Gleiche, nur die AfD stehe für den Neuanfang. Wenn sie sich stritten, sprachen AfD-Politiker von chaotischen Zuständen und verlachten die Ampel für ihre Unfähigkeit. Wie es die Ampel machte, machte sie es falsch. Eine stärker werdende AfD erzeugt automatisch diese Situation. Auch die seit 2025 regierende schwarz-rote Koalition leidet unter diesem Effekt. Ab einer gewissen Größe entsteht ein Sog, der die AfD immer weiter nach oben trägt.
Als ich das 2016 schrieb, bevor das Buch im Jahr darauf erschien, waren das gewagte Gedanken. Damals wurde diskutiert, ob mein Manuskript so düster sein musste. Die AfD stand bei 13 Prozent. Meinungsforscher sagten, die Partei sei »ausmobilisiert«, habe also schon fast alle Wähler gewonnen, die sie theoretisch gewinnen kann. So gesehen war das, was in meinem Buch stand, eine Provokation; ein möglicher Ausgang der Geschichte, über dessen Wahrscheinlichkeit man streiten konnte. Schließlich kommen die Dinge meistens nicht so schlimm, wie die üblichen Warner meinen.
Hier schon. Unsere Gegenwart ist das, was ich im Jahr 2016 für möglich hielt, wenn vieles schiefgeht, das realistischerweise schiefgehen kann. Der politische Albtraum von damals, eine AfD kurz vor der Regierungsmacht, ist also unsere Realität. Das vergessen wir manchmal.
Wir vergessen auch, wie knapp die Bundestagswahl 2025 ausgegangen ist. Dem »Bündnis Sahra Wagenknecht« fehlten rund 9500 Stimmen für den Einzug in den Bundestag. Hätte es diese bekommen, wären die Mehrheitsverhältnisse anders gewesen. Eine Zweierkoalition unter Friedrich Merz wäre unmöglich geworden. Die Union hätte eine Afghanistan-Koalition mit SPD und Grünen versuchen können, eine ähnliche Konstellation wie die Ampel. In meinem Gedankenspiel waren es genau diese Koalitionsverhandlungen, die an einem Mitgliedervotum der SPD gescheitert wären, ein Mitgliedervotum, das die SPD im Jahr 2025 tatsächlich ankündigte und abhielt.
Mit 9500 Stimmen für das »Bündnis Sahra Wagenknecht« wäre es also möglich geworden, dass Unionspolitiker im Jahr 2026 eine Koalition mit der AfD erwägen, wie ich es überlegt hatte. 9500 Stimmen sind nur 0,019 Prozent der bei der Bundestagswahl abgegebenen Stimmen. Unsere Mehrheitsverhältnisse sind auf Sand gebaut.
Das Gedankenspiel wurde nicht durch Zufall Realität. Die Geschichte seit 2016 war keine Serie von Zufällen. Sie folgte einem unbarmherzigen Mechanismus, den jeder Populismus bedient: Egal, was die übrigen Parteien versuchten, die AfD würde Wege finden, daraus Kapital zu schlagen. Wer im Jahr 2016 annahm, dass diese Entwicklung genau so weitergehen würde, konnte vom Jahr 2025 nicht überrascht sein.
Das Szenario war also nicht aus der Luft gegriffen, sondern mit dem Lineal gezogen: Es war das, was passieren musste, wenn sich nichts an der Ausgangslage ändert. Wenn die AfD also weiter Spitzenreiter darin bleibt, neue Anhänger im Internet zu mobilisieren. Wenn die politische Lage weiter von Krisen geprägt wird: Eurokrise, Flüchtlingskrise, Pandemie, Ukraine-Krieg. Wenn es also gute Gründe gibt, Angst zu haben, und Menschen sich aus dieser Angst heraus eine befreiende, radikale Politik herbeisehnen. Wenn vom gegenwärtigen Rechtsruck im Zeitgeist weiter vor allem die AfD profitiert und nicht die Konservativen in der Union, weil die AfD für Neurechte nahbarer wirkt. Wenn all das so bleiben würde, konnte man davon ausgehen, dass die Zukunft in etwa so aussehen würde, wie wir sie heute kennen.
Kurz nach der Sendung mit Gerald Knaus besorgte sich Markus Lanz mein Buch und fing an zu lesen. In einem Podcast mit Richard David Precht erzählte er davon, wie ihn die Lektüre mitnahm, ihm gehe es »kalt den Rücken« herunter. Fortan diskutierten die beiden manchmal über meine Thesen, etwa schon eine Woche später. Da ging es um die Frage, warum Rechtspopulisten so erfolgreich sind und alte Eliten an Autorität verlieren. Lanz sagte, mein Buch habe ihn »letzte Nacht wirklich wach gehalten«. Besonders das Kapitel »Platonische Triebe« hatte es ihm angetan, in dem beschrieben wird, wie das ganze 20. Jahrhundert unweigerlich auf den Populismus zusteuerte, den wir heute erleben.
Die von Gerald Knaus wiederentdeckte Prophezeiung ist also nicht der einzige Grund, warum sich das Buch neu anfühlt. Viele Kapitel, auch das über Platon, enthalten Erkenntnisse über die AfD, die 2016 genauso gültig waren wie heute. Die Entwicklung der Partei hat nicht an ihnen zweifeln lassen, sondern sie untermauert. Das Buch wurde von den Ereignissen bestätigt, es ist also gut gealtert.
Wir erzählen uns die Geschichte der AfD oft als eine Aneinanderreihung großer Veränderungen. Am Anfang, sagen wir, war die AfD eine Partei von bürgerlichen Eurokritikern. Dann, sagen wir, wurde sie immer radikaler, Eurokritiker verließen die Partei, Rechtsextreme kamen hinzu, erreichten Mehrheiten. Heute sind nicht nur die Führungspersönlichkeiten andere, sondern auch die Mitglieder. Die AfD hat seit ihrer Gründung Tausende Mitglieder verloren, die ersetzt wurden von radikaleren, wilderen Charakteren. Warum sollte da jemand ein Buch über die Anfangsjahre der Partei lesen? Die einzige Konstante zwischen damals und heute wären demnach das Parteilogo, vielleicht das Mobiliar der Bundesgeschäftsstelle und ein paar wenige Politiker: Alexander Gauland, Beatrix von Storch, Björn Höcke. Was 2016 über die Partei gesagt wurde, hätte, so gesehen, keine Bedeutung mehr für die Gegenwart.
Wer so denkt, hat ein falsches Verständnis davon, was die AfD ausmacht. Ihr Erfolg erwuchs nie daraus, an einem bestimmten ideologischen Ort zu sein, eine feste Position zu vertreten, ein bestimmtes Personal zu haben, das für etwas steht. Ihr Erfolgsgeheimnis lautet, das genaue Gegenteil davon zu tun: nicht genau zu sagen, wofür man steht. Es der Fantasie des Publikums zu überlassen, was jenseits des Parteiprogramms die Absicht sein könnte. Die Leute von der AfD wollen immer das eine und das andere und beides zugleich. Sie wollen nur die Migrationspolitik strikter machen und sie wollen die Grenzen gleich mit Schusswaffen sichern und sie wollen alle Ausreisepflichtigen abschieben und sie wollen sogar Deutsche mit Migrationshintergrund deportieren.
Das Parteiprogramm ist immer nur eine Möglichkeit, die Absichten der AfD-Anhänger zu deuten, ihre Vertreter, ihre Mitglieder, ihr Vorfeld rufen Dutzende andere Möglichkeiten in den Raum und überlassen es dem Publikum, sich eine Deutung herauszusuchen. Für AfD-Funktionäre in Talkshows bedeutet »Remigration« einfach nur die Abschiebung von Ausreisepflichtigen. Für das politische Vorfeld der Partei bedeutet »Remigration« eine gewaltsame ethnische Säuberung Westeuropas.
Diese Vieldeutigkeit hat die AfD schon immer kultiviert, auch in den Anfangsjahren. Da argumentierten Professoren, die Bundesrepublik dürfe nicht für die Staatsverschuldung südeuropäischer Länder in Haftung genommen werden, weil dies einen Staatsbankrott riskiere. Und die Tumben in der Partei riefen, man dürfe nicht zuschauen, wie faule, verlogene Griechen das gute deutsche Geld verprassten. Beides wurde zur gleichen Zeit gesagt, ein Argument war akademisch, das andere nationalchauvinistisch. Für jeden war etwas dabei, im Hörsaal und am Kneipentresen. In der Kneipe konnten sie auf den Hörsaal verweisen und sagen, es ginge nicht um Ressentiments, sondern um höchst komplexe europarechtliche und volkswirtschaftliche Zusammenhänge. Im Hörsaal konnten sie sich freuen, wie viel Zuspruch ihre Wirtschaftstheorien auf einmal in der breiten Bevölkerung hatten, sogar bei denen am Tresen. Und wenn dort etwas Rassistisches gesagt wurde, konnten sie ganz verwundert sein und von einem Missverständnis sprechen: Das Rassistische stand ja nicht im Parteiprogramm. Es ist bis heute eine gut funktionierende Arbeitsteilung: Die einen liefern den Antrieb, die anderen das Alibi.
Alle bisherigen Parteivorsitzenden der AfD beherrschten dieses Spiel, ihre Partei in dieser Schwebe zu halten; in einem Zustand also, in dem ein bisschen unklar war, wofür sie wirklich stand. Wer die AfD kritisieren wollte, musste mühsam belegen, dass es ihr um mehr ging als die Buchstaben ihres Parteiprogramms. Und wenn dann eine Sammlung fertig war voll belastender Äußerungen, konnten die Vertreter lachend abwinken: Wieder so ein Versuch verlogener Journalisten, korrupter Beamter oder linksgrüner Wissenschaftler, ihre gutbürgerliche Partei in Misskredit zu bringen. Also musste darüber diskutiert werden, dass die Journalisten nicht verlogen, die Beamten nicht korrupt und die Wissenschaftler nicht ideologisch verblendet waren. Und schienen die Vorwürfe schließlich erdrückend, musste die AfD selbst prüfen, oder ein Parteiausschlussverfahren abwarten, oder einen Parteitag. Das verschaffte ihr wieder Zeit, den Schwebezustand zu behalten. Der garantierte den Extremisten ein Alibi und den Gemäßigten eine Partei, die mehr Prozente holt als Parteien wie die »Allianz für Fortschritt und Aufbruch«, später »Liberal-Konservative Reformer« genannt, oder »Die Blauen« oder »Die Werte-Union«. So erfolglos wie diese Parteien wäre auch die AfD, wenn sie nicht konservative Salonradikale mit gesichtstätowierten Hooligans mischen würde.
Die AfD hat sich in all den Jahren vielleicht in ihren Inhalten verändert und in ihrem Personal, nicht aber in ihrem Geschäftsmodell und ihrer inneren Dynamik. Man darf nicht denken, frühere Vorsitzende wie Bernd Lucke, Frauke Petry und Jörg Meuthen seien aus Sicht der Partei gescheitert. Sie haben vielleicht ihre Karrieren verloren. Sie standen für einen Kurs der Mäßigung und ließen das Publikum über Monate und Jahre zuschauen, wie sie die Rechtsextremen in ihrer Partei erst verleugneten, dann mit ihnen rangen und schließlich verloren und die Partei unter Protest und mit allerlei Schmährufen verließen. Das waren aber keine schlechten Jahre für die AfD. Es war genau die Dauerschleife, in der sie floriert. Das ist ihr Lieblingsort, ihre eigentliche Identität. Sie ist nichts Starres, Festgelegtes. Die AfD flimmert. Sie oszilliert. Sie pendelt.
Jedes Mal, wenn einer der Vorsitzenden verloren hatte, wurde behauptet, nun sei alles entschieden. Es gebe keine Gemäßigten mehr in der Partei. Das hatte auch jeweils seine Berechtigung, im Vergleich zu vorher war die Partei meistens radikaler. Und doch gelang es jeder einzelnen AfD-Generation wieder, die immergleiche Seifenoper von der ambivalenten Uneindeutigkeit aufzuführen.
So etwas hält das Publikum in Atem. Eine Talkshow, in der Friedrich Merz erzählt, was er schon immer gesagt hat, kann langweilen. Eine Sendung aber, in der Alice Weidel befragt wird und die Möglichkeit besteht, dass sie entweder etwas Extremistisches sagt, das ein Verbot ihrer Partei ermöglichen würde, oder aber etwas Gemäßigtes, das die Radikalen in ihrer Partei gegen sie aufbrächte, ist ein Krimi. Da schaut jeder hin, nicht nur für Anhänger von Weidel, sondern gerade auch für ihre Gegner.
Und für die Radikalen ist das ganze Tohuwabohu eine Chance. Extremisten brauchen keine Klarheit, in der gesagt wird, dass Extremismus gut ist. Das würde viele Menschen sehr erschrecken und die Unmenschlichkeit ihrer Position offenbaren. Sie sind nicht darauf angewiesen, dass jemand sagt, ihre Aussagen seien wahr, es reicht, wenn Unklarheit darüber herrscht, was wahr ist und was falsch. Sie brauchen eine Situation, in der Dinge nebulös sind, moralische Gesetze aufgeweicht und ein kleines bisschen Chaos herrscht in den Köpfen der Zuhörer. Der Rechtsextremismus ist nicht umsonst eine irrationalistische Haltung.
Was damals geschah, geschieht heute genauso. Der AfD-Abgeordnete Maximilian Krah hat traurige Berühmtheit erlangt, weil er 2024 Spitzenkandidat im Europawahlkampf war und anfing, Mitglieder der Waffen-SS zu verteidigen. Krah wurde von der Öffentlichkeit und seiner Partei dafür bestraft, von den Extremisten bejubelt. Das war eine kümmerliche Position, in der Krah nun war. Er hatte als AfD-Politiker seine Wirkungsmacht verloren. Er war eindeutig geworden. Er trug keine Spannung mehr in sich. Er war nicht Krah, der bürgerliche Jurist, der mit radikalen Ideen liebäugelte und einen auflösbaren Widerspruch verkörperte. Er war einfach nur Krah, der Rechtsextremist. Ein politisch Unberührbarer.
Krah ließ das einige Monate über sich ergehen, dann erfand er sich neu. Er begann, den Begriff der »Remigration« zu kritisieren. Er sagte, die AfD dürfe nicht länger Bürger mit Migrationshintergrund abwerten, weil das Angriffsfläche biete. Er argumentierte strategisch, die AfD solle sich mäßigen, um mehr zu erreichen, und warnte, im Extremismus könne sie alles verlieren, nämlich durch ein Verbot. Journalisten fragten, ob da etwas kippe in der AfD. Rechtsextremisten waren irritiert über Krah. Ihr mutiger Wortführer war auf einmal ein Bedenkenträger geworden. Sie stellten ihn zur Rede, und Krah wich dem nicht aus. Er diskutierte im Internet, er stritt mit einem rechtsextremen Publizisten. Er verteidigte sein Argument, stellte aber auch Gemeinsamkeiten heraus. Er machte das Angebot, sich an ihm abzuarbeiten.
Und auf einmal war es wieder da, das Flimmern. Krah war einer, der mit Extremisten rang, wie Lucke, wie Petry, wie Meuthen. Man konnte es knistern hören. Und beim Publikum konnte der Eindruck entstehen, dass alles wieder unklar war. Ob die AfD nun radikal war oder nicht, das musste sich erst zeigen, je nachdem, wie die Sache mit Krah und den Extremisten ausgeht. Wieder war Zeit gewonnen, in der Bürger, wenn sie über die Regierung empört waren, eine Partei wählten, in der Verfassungsfeinde in hohen Positionen mitarbeiteten. Das Geschäft lief. So wie es immer schon war. Die Zukunft bietet der AfD nur neue Gelegenheiten, ihr Wesen auszudrücken.
Als dieses Buch erschien, war es wichtig, die AfD zu verstehen. Heute ist es noch wichtiger. Die deutsche Demokratie befindet sich in einer historischen Krise. Wahrscheinlich wird man in vielen Jahren sagen, dass unsere Gegenwart eine Zeit war, in der Menschen darüber nachdenken mussten, was ihre Prinzipien waren und ob sie für diese einstehen wollten. Es werden Jahre, auf die man im Rückblick mit großer Genauigkeit schauen wird. Spätere Generationen werden Erklärungen verlangen und Fragen stellen. Eine dieser Fragen könnte sein, warum im Jahr 2025, zwölf Jahre nach Gründung der AfD, noch immer falsche Mythen über die Partei kursierten; es ihr noch immer leicht gemacht wurde, politisch zu punkten, obwohl Beobachter längst Argumente geliefert hatten, ihre Rhetorik zu durchschauen.
Die Brandmauer zum Beispiel. Das Wort ist fast so alt wie die AfD, der damalige CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer benutzte es im August 2014, um vor einem Regierungsbündnis zwischen CDU und AfD in Sachsen zu warnen. Die CSU sei gegen jede Zusammenarbeit, da gebe es eine »Brandmauer«, sagte Scheuer in der »Berliner Runde« des ZDF.
Brandmauer ist eigentlich das falsche Wort, denn was zwischen zwei Häusern verhindert, dass ein Feuer von einem auf das andere Haus übergreift, heißt Brandwand. Die Metapher unterstellt, es gebe etwas Flammendes, das von der AfD-Seite überzugreifen drohe und von einer Brandwand daran gehindert werden müsse, in diesem Fall die Bereitschaft zur Zusammenarbeit.
Genau die ist aber fraglich. Sie wird von der AfD immer behauptet, weil das die Union in die Bredouille bringt. Wer von einer Brandmauer redet, überträgt der Union eine große Verantwortung. Sie muss ihre Brandwand so hoch mauern, wie sie nur kann, muss Schäden reparieren, muss Löcher abdichten und sich bei jeder Gelegenheit fragen lassen, ob sie diese Arbeit auch in Zukunft fortsetzen werde. Für die AfD ist das bequem. Sie kann hinter der Mauer stehen und eine Zusammenarbeit anbieten. Je mehr die Union mauert, umso geringer ist ihr Risiko, jemals kooperieren zu müssen.
Aber selbst das Reden darüber ist manchen in der AfD schon zu viel. Am Abend der Bundestagswahl 2025 sagte die AfD-Vorsitzende Alice Weidel in Richtung der Union: »Unsere Hand ist ausgestreckt, den Willen des Volkes umzusetzen, man muss sie nur ergreifen.« Und der niedersächsische AfD-Vorsitzende Klaus Wichmann erklärte: »Wir stehen zur Verfügung, wenn die CDU uns braucht für das Durchsetzen der richtigen Politik.« Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die Union – wieder einmal – keinen Gebrauch machen würde von dem Angebot. Trotzdem sah sich der thüringische AfD-Vorsitzende Björn Höcke gezwungen, in aller Öffentlichkeit zu widersprechen: »Gespräche immer, temporäre eingegrenzte Kooperationen meinetwegen auch, aber im Augenblick keine Koalition. Das wäre mein Credo, wenn es denn in die Parteigremien ginge«, sagte er und stellte unerfüllbare Bedingungen. Die Union müsse sich um 180 Grad wandeln, sagte Höcke. Erst dann, als gebrochene Partei, kommt sie als Bündnispartner infrage.
Höcke hat gute Gründe, eine Koalition mit der Union abzulehnen. Wenn die AfD Juniorpartner der Union wäre, müsste sie Kompromissen zustimmen und sich an diese halten. Dafür müsste sie sich mäßigen und radikale Denker einhegen, Leute wie Höcke also. Das letzte Parteiausschlussverfahren gegen ihn hatte aus meiner Sicht genau diese tiefere Ursache. Die Parteiführung wollte sich durch Mäßigung annehmbar machen für die Wähler und regierungsfähig als Juniorpartner der CDU in Ostdeutschland. Das ging nur ohne Höcke, also musste er weg.
Würde Friedrich Merz eines Tages auf Alice Weidel zugehen und ihre Hand ergreifen, als Zeichen einer politischen Zusammenarbeit, hätte das für die Union verheerende Auswirkungen. Wahrscheinlich würden CDU und CSU daran zerbrechen. Abertausende Mitglieder würden austreten, möglicherweise ginge eine ganze Politikergeneration verloren. Etwas anderes würde aber auch passieren: Die AfD hätte von dieser Sekunde an einen großen Flügelstreit in ihren Reihen. Radikale würde mit allen Mitteln versuchen, eine Koalition zu verhindern, und jeden Bundesvorstand bekämpfen, der diesen Plan verfolgt.
Die gesamte Brandmauer-Debatte beruht also auf einem Missverständnis. Die AfD ist nicht Feuer und Flamme für eine Koalition mit der Union. Sie tut nur so. Und solange das Publikum ihr glaubt, funktioniert die Strategie. Als Alice Weidel einmal auf diesen Widerstand in ihrer Partei hingewiesen wurde, leugnete sie schnell jede Koalitionsbereitschaft. Sie sagte, mit dieser CDU werde sie ohnehin nicht koalieren und mit diesem Friedrich Merz auch nicht. Da wirkte die Brandmauer auf einmal wie ein sehr überflüssiges Bauwerk.
Wenn viele Menschen die AfD verstehen, sind sie also nicht nur informiert, sie werden auch immun gegen Lügen der Partei. Gerade die frühen AfD-Politiker waren gute Lehrmeister in diesen Fragen, denn sie waren weniger professionell als die heutige Generation. Sie gaben Dinge offen zu. Sie erzählten aus Gremiensitzungen. Sie wussten selbst nicht, warum ihre Partei erfolgreich ist, deshalb sahen sie auch keine Gefahr darin, offen über ihre Strategie zu sprechen.
Vieles, was in der Gegenwart geschieht, lässt sich aus der Parteigeschichte heraus verstehen. In Zukunft werden es wieder andere Phänomene sein, die erst dann verständlich werden, wenn wir die strategischen Wurzeln der Partei kennen. Welche das sein werden, wissen wir nicht. Sie müssen noch entdeckt werden.
In der Neuausgabe dieses Buches wurden nur der Anfang und das Ende verändert, ein neues Vorwort also und ein Schlusskapitel darüber, welche Strategien gegenüber Rechtspopulisten funktionieren. In dieser entscheidenden Frage sind seit 2016, als ich die Erstauflage schrieb, viele Erkenntnisse hinzugekommen.
Der Rest des Buches wurde nicht angetastet. Der Leser darf also nicht stolpern, wenn das Buch aus einer anderen Zeit zu ihm spricht. Auch das viel zitierte Gedankenspiel zum Jahr 2025 wurde nicht verändert. So kann jeder nachlesen, wo ich falsch lag und wo nicht. Und auch in Zukunft beurteilen, ob meine Argumente halten. Das Gedankenspiel endete nämlich nicht mit einem AfD-Kanzler, sondern beschrieb, welche zerstörerische Dynamik die Union in einer solchen Koalition erwarten würde. Falls es jemals dazu käme, müsste sich das Buch aufs Neue beweisen.
Die AfD ist für Journalisten ein besonderer Gegenstand. Von keiner anderen Partei werden sie so persönlich angegriffen. Im ersten Kapitel »Der Rhododendron-Effekt« reflektiere ich deshalb meine Rolle, bevor ich aus dieser Rolle heraus die Partei betrachte. Im Kapitel »Platonische Triebe« erkläre ich die ideologischen Wurzeln der Partei, nicht als eine Gegenbewegung zum Liberalismus des 20. Jahrhunderts, sondern als seine Fortsetzung in ihrer extremsten Form. Dass der Hyperliberalismus in einer Diktatur enden kann, wusste schon Platon. Das ist heute so aktuell wie vor mehr als 2000 Jahren. Das Kapitel »Das Recht des Lauteren« erläutert, warum die AfD strukturell nicht in der Lage ist, sich zu mäßigen – und warum die Radikalen bisher immer gewinnen konnten.
Die Regeln, denen die Partei gehorcht, haben sich nicht verändert, nur die Beispiele sind andere. Im Kapitel »Schmetterlinge im Bauch« beschreibe ich, wie das intellektuelle Vorfeld der Partei versucht, die Ressentiments ihrer Anhänger zu rationalisieren – damals wie heute. Das Kapitel »Der große Graben« handelt von AfD-Politikern, die nur deshalb gegen Radikale kämpfen, weil sie alte Rechnungen begleichen wollen und ein demokratisches Gewissen nur heucheln. Dieses Phänomen ist in der AfD bis heute nicht ausgestorben. Im Kapitel »Konterrevolution« wird aus der Sicht des Jahres 2016 beschrieben, wie die AfD im Jahr 2026 an die Macht kommen könnte und wie sie Deutschland verändern würde. Darauf folgte das aktualisierte Schlusskapitel mit möglichen Gegenstrategien.
Diese Neuauflage ist der Begeisterung von Gerald Knaus und Markus Lanz zu verdanken. Auch die Erstauflage hatte euphorische Leser gehabt, das waren jene gewesen, die an grundsätzlichen Fragen interessiert waren und den philosophischen Ansatz des Buches schätzten. Andere Leser, wie zum Beispiel Alexander Gauland, waren von diesem Buch nie überzeugt. Gauland fand es »zu essayistisch«, wie er mir höflich sagte. Von AfD-Anhängern wurde das Buch verrissen und verspottet, sie nannten es »substanzlos«, einen »rotgrünen Propagandaversuch«, ein »Hetzwerk« voller »Fake News«. Das Buch ist für die Partei offenbar nicht bequem. Ihr Widerstand ist ein mindestens so großer Ansporn, es wieder zu veröffentlichen, wie das freundliche Lob der interessierten Leser. Insofern danke ich beiden Gruppen für ihre Anteilnahme.
Der Rhododendron-Effekt
Wie es ist, jahrelang mit AfD-Mitgliedern zu sprechen und was sie mich gelehrt haben
Manchmal, wenn ich AfD-Mitgliedern meinen Namen sage, verändert sich ihre Körperhaltung. Einmal stand ich im Getümmel eines Parteitages und sagte einem AfD-Mitglied, ich sei Journalist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er fragte: »Aber Sie sind nicht Justus Bender, oder?« Ich zuckte mit den Schultern. »Doch«, sagte ich. Da zog er seine zur Begrüßung ausgestreckte Hand wieder zurück und murmelte etwas über einen Artikel von mir. Einmal sagte ich einem Funktionär, dass ein anderer Amtsträger nicht mit mir reden wolle, weil er mich offensichtlich nicht leiden könne. Der Funktionär sagte nur: »Das kann ich verstehen.« Es gibt Parteivertreter, die aus Prinzip jedes Gespräch mit mir ablehnen. Sie gehen nicht ans Telefon, wenn sie meine Nummer auf ihrem Display sehen. Sie laufen an mir vorbei, wenn ich ihnen begegne, sie blockieren mich auf Twitter. Wenn sie doch das Wort an mich richten, dann meist um eine subtile Beleidigung auszusprechen. Ein früheres Landesvorstandsmitglied schrieb einmal, ich hätte ein »ausdrucksloses Milchgesicht«, weil ihm ein Artikel nicht gefallen hatte. Das fand ich als Beobachtung nicht unoriginell. Einmal schrieb ich, eine Parteivorsitzende habe gegen einen Parteibeschluss verstoßen. Die Parteivorsitzende antwortete, ich sei offenbar nicht in der Lage, den Parteibeschluss richtig zu deuten – nämlich so, dass kein Verstoß von ihr vorliege. Und dann sagte sie: »Sie tun mir leid, Herr Bender.« Wohl nach dem Motto: weil ich so erbärmlich sei. Für den Umgang zwischen Politikern und Journalisten ist das ein ungewöhnlicher Tonfall. Ich bedankte mich und sagte, dass ich auf ihr Mitleid gehofft hatte. In Wirklichkeit fiel mir auf, dass einem in der AfD von allen Spielarten der Ablehnung besonders oft die der Häme begegnet.
In sozialen Netzwerken nennen mich AfD-Mitglieder einen »Hetzer«, einen Vertreter der »Holznasenpresse«, einen »Ideologen« – oder schlicht »doof«, »verlogen«, »retardiert« und »skurril«, »peinlich«. Ein Leser schrieb mir einmal eine E-Mail, in der Betreffzeile stand »Bender und die AfD«. Der komplette Inhalt lautete: »Was für eine bescheuerte Schreibe. Sind bei Euch denn wirklich nur noch Vollidioten beschäftigt. Kleine, verschissene, ideologisch linksverklemmte Wichser? Traurig, was aus den meisten deutschen Zeitungen geworden ist. Aber die Schrumpfung der Auflage wird automatisch dafür sorgen, dass solche Kerle arbeitslos werden.« Der Leserbrief kam nach einem Leitartikel, in dem ich gewarnt hatte, dass ein Populismus leicht in einen Autoritarismus kippen kann. Nichts an diesem Leitartikel war »links« oder »rechts«, ich war einfach nur am Erhalt unserer repräsentativen pluralistischen Demokratie interessiert. Diesen Leser aber schien der Autoritarismus-Vorwurf so zu empören, dass er mir autoritär die Arbeitslosigkeit wünschte, weil ich eine Meinung geäußert hatte, die nicht seine war. Das sprach dann für sich.
Es gibt Tausende Leserkommentare unter meinen Artikeln, in denen ich beschimpft werde. Nicht mein Artikel, sondern ich. Manche duzen mich, einfach so. Einmal verweigerte mir ein Landesvorsitzender die Akkreditierung für einen Fraktionskongress, obwohl die Presse im Allgemeinen zugelassen war. Er schrieb mir eine E-Mail: »Fange (sic!) Sie an, diferenziert (sic!) zu berichten, anstatt Gülle auszukippen.« Einige Male wurde im Bundesvorstand der AfD wegen meiner Zeitungsartikel gestritten. Die einen Funktionäre wollten von den anderen wissen, wer Interna weitergegeben hatte. Warum in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus vertraulichen E-Mails oder Telefonkonferenzen zitiert wurde. Natürlich sagte niemand etwas. Einmal schrieb ein Landesvorsitzender einen ganzen Artikel in einer Parteizeitschrift über die These, ich sei so was wie ein manipulativer Hetzer. Ein anderes Mal reagierte ein Parteivorsitzender auf einen Artikel mit Anwaltsbriefen und einer Unterlassungsaufforderung. Oft schon gab es Beschwerden über mich aus der AfD. Meistens ging es in diesen Beschwerden um meine Arbeitshypothese, es handele sich bei der AfD um eine rechtspopulistische Partei mit radikalen Strömungen. Mehr nicht. Im Rückblick war das keine gewagte These. Für AfD-Politiker aber galt schon das damals als eine unerhörte Verdrehung der »Tatsachen«. Wäre ich nicht Politikredakteur einer bürgerlichen Tageszeitung, sondern ein linksradikaler Blogger der Antifaschistischen Aktion, ich wüsste eigentlich nicht, wie manche AfD-Mitglieder ihre Rhetorik mir gegenüber noch steigern könnten.
Natürlich ist es nicht immer so. Manchmal lache ich auch mit AfD-Funktionären. Gründe gibt es genug. Es gibt einen, der kann den dröhnenden Singsang des thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke gut nachmachen, wenn dieser in Erfurt auf Kundgebungen irgendetwas in sein Mikrofon brüllt, das selbst AfD-Mitglieder schaudern lässt. Es gibt Funktionäre, die sind mir als Menschen sympathisch. Was manche sagen, wenn alle Mikrofone ausgeschaltet sind, ist bisweilen sehr kritisch. Sie beschimpfen andere Funktionäre als Rechtsradikale oder wagen die Prophezeiung, dass die Partei schon in naher Zukunft an sich selbst scheitern wird. Sie sprechen auch über Banales, über Eitelkeiten in der Partei, über Karrieristen und Opportunisten, über Affären zwischen Mitgliedern, über die kleinen Geschichten, die überall entstehen, wenn Menschen aufeinandertreffen. Mit ihnen lässt sich wunderbar quatschen. Wenn ich auf Parteitage gehe, winken mir manche Landesvorsitzende schon von Weitem zu und begrüßen mich freundlich. Wir sprechen dann ohne gegenseitige Vorwürfe, wie zwei Beobachter, die sich für die gleiche Sache interessieren. So ist es ja auch.
Manche AfD-Funktionäre wissen nicht viel mehr über die Partei als das, was ein Zeitungsleser von außen erfährt. Weder können sie ihre Partei nach Belieben steuern, noch wissen sie mit Sicherheit, in welche Richtung sie sich entwickeln wird. Manchmal stelle ich mir die Parteiführung der AfD deshalb wie Hollywood-Schauspieler aus den fünfziger Jahren vor, die in Autos über den Sunset Boulevard fahren. In Wirklichkeit fahren sie aber gar nicht über den Sunset Boulevard. Das sind nur Straßenszenen, die auf eine Leinwand hinter der Heckscheibe projiziert werden. Und das Lenkrad, das sie mal nach links, mal nach rechts drehen, ist in Wirklichkeit nur eine Attrappe. Sie sind Darsteller, die es ihrem Publikum recht machen wollen, Menschen also, die man sich gut als Autofahrer vorstellen kann. Wo das Auto aber hinfährt, das bestimmen andere, im Fall der AfD sind das die Parteimitglieder, zumindest jenes Zehntel, das auf die Parteitage geht. Entsprechend harmlos sind manche dieser Statisten. Solange niemand »Action« ruft, kann ich mich mit ihnen in großer Entspanntheit unterhalten. Von interessiertem Beobachter zu interessiertem Beobachter sozusagen. Das können nette Unterhaltungen sein.
Wenn mich jemand fragt, wie die AfD so ist, weiß ich manchmal nicht, was ich erzählen soll. Die bösen oder die netten Anekdoten. Am besten erzähle ich immer die ganze Geschichte.