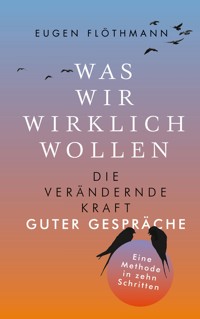
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gespräche mit Kunden, Partnern oder Freunden, alles Leben ist letztlich Kommuni-kation. Doch nur allzu oft stehen Missverständnisse oder andere Hindernisse uns dabei im Weg... Dieses Buch präsentiert eine neue Methode für gelingende Kommunikation: die Me-thode der Guten Gespräche. Diese geht davon aus, dass jede Gesprächssituation zwischen Menschen von bestimmten seelischen Grundbedürfnissen geprägt ist. Al-lerdings gibt es immer ein Grundbedürfnis, das dominiert. Zu verstehen, was wir wirklich wollen und dieses wahre gemeinsame Bedürfnis aller Beteiligten zu benennen, das ist die Voraussetzung für einen kooperativer Aus-tausch, nur so werden gute Lösungen für Probleme erst möglich. Der Autor erklärt anschaulich und lebendig die einzelnen Prozessschritte der Metho-de der Guten Gespräche. In mitunter humorvollen Fallbeispielen und Dialogen illus-triert er ihre praktische Umsetzung in Alltag und Beruf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Einleitung
Was sind Gute Gespräche? |
1 | DIE AUSGANGSLAGE: SCHWIERIGE GESPRÄCHE
Über Rollen, Etiketten und Schubladen
Unser Denken in Schubladen
Gewinner und Verlierer
Die Lust am Lamentieren
2 |DER LÖSUNGSANSATZ: GUTE GESPRÄCHE
Was ist unsere Sehnsucht?
Situationen neu gestalten
Die Versöhnung von Xanthippe und Sokrates
Der Ansatz
Wie entsteht Ordnung?
Werte und Bedürfnisse
Das »Was« und das »Wie« – und die entsprechenden Bedürfnisse
Miteinander Werte schaffen
Selbsterschaffene Werte und universelle Gesetzmäßigkeiten
Viele Köche verderben den Brei – aber wie sorgen wir dafür, dass der Brei gut wird?
Die Sehnsucht aktiviert schöpferische Kräfte
Eine Analogie aus der Physik: die Supraleitung
3 |DIE METHODE UND IHRE PRAXIS
Das Gesprächsmodell
Beispiel: Der Einkaufszettel
Die führenden Fragen zur Strukturierung guter Gespräche
Der Gesprächsprozess
Beispiel: Die Urlaubsplanung
Wie können wir unsere seelischen Bedürfnisse freilegen und umsetzen
Beispiel: Schach mit Paul
Gute Gespräche in Aktion
Beispiel: Der Gartenteich
Grundhaltungen in der Moderation
Beispiel: Der Arztbesuch
Voraussetzungen und Fallstricke
Beispiel: Parkplatznot
Der Methodenkoffer
1. Das Thema festlegen
2. Die Situation erfassen
3. Die wahren Bedürfnisse ermitteln
4. Ideen finden
5. Einen Entschluss fassen
6. Die Lösung entwickeln
7. Die Lösung vermitteln
8. Ziele formulieren
9. Der Weg zum Ziel
1 0. Am Ziel
Nachwort
Literatur
Quellen
EINLEITUNG
Du kehrst den Mist hierhin, du kehrst den Mist dorthin. Es bleibt Mist. Du grübelst. Dabei könntest du Perle an Perle reihen zur Freude des Himmels.Chassidische Lehre 1
ÜBER GESPRÄCHE TRETEN WIR mit unseren Mitmenschen in Verbindung. Wir führen Gespräche über die Dinge des Alltags, die großen wie die kleinen, die privaten wie die beruflichen, wir sprechen mit Mitgliedern der Familie, mit Freunden und Kollegen, mit Kunden, mit Vertretern von Behörden und Mitarbeitern von Geschäften.
Meist haben wir dabei den Wunsch, dass diese Gespräche gut verlaufen, das heißt, dass sie gelingen mögen und zu etwas Positivem führen. Diesen Wunsch haben wohl sehr viele Menschen gemeinsam.
Doch gute Gespräche zu führen, ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Häufig sind diese geprägt von negativen Gefühlen, die unbewusst mitschwingen und den gesamten Austausch belasten können. So kommen wir oft gar nicht richtig auf den Punkt, reden um den heißen Brei herum oder wir verlieren uns in Ansichten und Meinungen über dieses und jenes, tauschen vehement und durchaus erhitzt Argumente aus, verrennen uns und verausgaben uns an Widerständen. Nur allzu oft lassen sich die Gesprächsteilnehmer nur von der Frage leiten: Wie kann ich meine Ansicht, meine Position am besten durchsetzen? In solchen Fällen wird aus dem Gespräch ein Gegeneinander, in dem es nur noch Gewinner und Verlierer gibt. Am Ende solcher Auseinandersetzungen sind wir dann nur noch erschöpft und mit unserem Ansinnen keinen einzigen Schritt weiter. Und die Aussicht auf ein gelingendes Gespräch rückt in weite Ferne.
DAS KONZEPT, DAS HIER VORGESTELLT WIRD, setzt genau an dieser Stelle an. Die Methode Gute Gespräche führen hat das Ziel, in einem freudigen Miteinander konstruktive Lösungen für alltägliche, aber auch für berufliche Fragen zu finden. Doch wie können wir das erreichen?
Der hier behandelte Ansatz geht davon aus, dass unser menschliches Handeln, unser Fühlen und Denken maßgeblich von Bedürfnissen geprägt wird. Wir unterscheiden zwei Arten von Bedürfnissen: zum einen betrifft es die Frage, »Was« wir wollen – zum Beispiel etwas zu essen, ein Auto oder Gesundheit – und zum anderen geht es um die Frage, »Wie« wir etwas machen, also mit welchen Persönlichkeitseigenschaften wir das »Was« zu einer Lösung bringen können. Diese »Wie«-Bedürfnisse werden auch als seelische Bedürfnisse bezeichnet.
Bei den Guten Gesprächen werden neun seelische Grundbedürfnisse unterschieden:
1. Der Wunsch nach Orientierung
2. Der Wunsch nach dem Wesentlichen
3. Der Wunsch nach Transzendenz
4. Der Wunsch nach Eigenständigkeit
5. Der Wunsch nach Klarheit
6. Der Wunsch nach Verbundenheit
7. Der Wunsch nach Neuausrichtung
8. Der Wunsch nach Aktivität
9. Der Wunsch nach Ordnung
Jede Gesprächssituation wird von diesen seelischen Grundbedürfnissen bestimmt, wobei es immer ein besonderes dominierendes Grundbedürfnis gibt. Dieses zentrale Bedürfnis gibt an, was in einer Situation für uns das Wesentliche ist, was wir wirklich wollen.
Wie aber lässt sich dieses besondere Grundbedürfnis herausfinden? Erst einmal müssen wir die Situation als Ganzes betrachten und uns vor allem eine Frage stellen: »Was ist hier die eigentliche Sehnsucht? Was ist hier das wahre seelische Bedürfnis, das Wesentliche?« Haben wir erst einmal dieses vorherrschende Grundbedürfnis ergründet, lassen sich in der Folge auch tragfähige Antworten entwickeln, die auch das »Was-wir-wollen« befriedigen.
Es ist nämlich diese Ausrichtung des Gesprächs auf ein verbindendes, gemeinsames seelisches Bedürfnis, das die Brücke zum Miteinander schlägt. So kann sich ein Raum für einen konstruktiven, bereichernden Austausch eröffnen. In der Folge stellt sich plötzlich für jeden einzelnen die Frage: Was kann ich zur Entwicklung einer guten Lösung beitragen? Wenn nun an dieser Stelle des Prozesses alle an einem Strang ziehen, dann ist das Gewinner-Verlierer-Denken überwunden.
Am Ende eines guten Gesprächs kann etwas sehr Unterschiedliches erreicht werden: das Gefühl, aufgemuntert oder einfach nur angehört worden zu sein, eine Situation gemeinsam betrachtet zu haben, eine Entscheidung oder eine Lösung gemeinsam entwickelt zu haben, einen Konflikt gelöst, einen Streit geschlichtet zu haben … Letztlich kann jeder Austausch zu einem guten Gespräch werden.
FÜR DAS gute-gespräche-konzept HABE ICH einen bestimmten Gesprächsprozess entwickelt. Dieser wird im Verlauf des Buches detailliert erläutert, samt dem methodischen Rüstzeug für die einzelnen Prozessschritte. Zur Veranschaulichung dienen eine Reihe von praktischen Beispielen. Bei meiner Tätigkeit als Berater geht es immer wieder darum, tragfähige und einvernehmliche Lösungen herbeizuführen. Deshalb lege ich auch besonderen Wert auf eine reibungslose wie auch verbindliche Kommunikation. Mit meinem Konzept möchte ich eine wirkliche Hilfestellung für die unterschiedlichsten, auch täglichen Gesprächssituationen bieten. Ich greife dabei gängige Methoden der Dialog- und Gesprächsführung auf und verbinde sie zu etwas Neuem. Über die Jahre habe ich meine Methode und die Resultate, die sie erbrachte, in privaten und beruflichen Situationen immer wieder überprüft und kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert.
Doch dieses Konzept ist mehr als nur eine weitere Gesprächsmethode. Es ist eine Lebenseinstellung, eine neue Kultur des Miteinanders, mit der wir das Gewinner-Verlierer-Denken überwinden können, mit der wir in einem kooperativen, freudigen Austausch selbst bereichernde Lösungen für unsere täglichen Fragen finden können.
Was sind Gute Gespräche?
UM MEINE METHODE LEICHT UND VERSTÄNDLICH zu veranschaulichen, möchte ich auf ein bekanntes Paar der Philosophiegeschichte zurückgreifen: XANTHIPPE und SOKRATES. In fiktiven Dialogen zwischen den beiden, die ich in unsere heutige Zeit verlegt habe, möchte ich erläutern, wie sich gute Gespräche gestalten lassen:
XANTHIPPE: Sokrates, wir haben uns jetzt vorgenommen, ein gemeinsames Projekt zu entwickeln – und zwar die Methode der Guten Gespräche zu entwickeln. Schließlich haben wir uns ja ein Leben lang gestritten. Sag, was stellt du dir eigentlich bei einem guten Gespräch vor? Und wie können wir gute Gespräche führen?
SOKRATES: Ganz allgemein kann man einmal sagen: Gute Gespräche sind eine Art des Austauschs, um im Miteinander etwas zu erreichen.
XANTHIPPE: Ach lass diesen komplizierten Kram! Da gibt es doch schon die ganze Rhetorik, die diversen Formen der psychologischen Gesprächsführung, NLP, Konstruktivismus, systemische Gesprächsführung und so weiter und so fort, ein total unüberschaubarer Dschungel. Es sieht ja fast so aus, als ob jeder, der etwas auf sich hält, sich auch noch mit einer neuen Methode zur Gesprächsführung verewigen will, und die soll natürlich die einzig Wahre sein. Das geht doch an unserem Alltag komplett vorbei. Jetzt sag mal einfach kurz, knapp und bündig: Wie funktionieren denn diese guten Gespräche?
SOKRATES: In der Methode der Guten Gespräche fragen sich die Gesprächspartner: Was ist unsere gemeinsame Sehnsucht? Was ist unser zentrales Bedürfnis? Und dann suchen sie mit ihrer Antwort eine gute gemeinsame Lösung.
XANTHIPPE: Aha, also wenn wir uns jetzt die Frage stellen: »Was soll es heute Mittag zu essen geben?«, dann können wir auch darüber ein Gutes Gespräch führen und sogar zu einer guten Entscheidung kommen?
SOKRATES: Ja, genau. Und das wichtige dabei ist: Das Ergebnis wird für uns beide passen. Du versuchst also nicht, mich wieder zu einem Currygericht zu überreden, das du dann freudig zubereitest und verzückt genießt, während ich nur lustlos im Reis rumstochere und insgeheim denke: Wie schön wäre jetzt doch eine Pizza! Und ich versuche auch nicht, dich zu was zu überreden. Also, das heißt ganz konkret: Wir fragen uns einfach: Was wollen wir beide heute Leckeres kochen?
XANTHIPPE: Ach, ich möchte mal wieder Apfel-Möhrenrohkost essen.
SOKRATES: Ja, mit leckeren Rumrosinen! Und dazu passen prima Bratkartoffeln.
XANTHIPPE: Und ein Spiegelei!
SOKRATES: Oder Sülze mit Remouladensauce.
XANTHIPPE: Ja, Sülze ist auch lecker, aber ich glaube ein Spiegelei reicht, oder sagen wir besser zwei.
SOKRATES: Und dazu braucht es ein Bier!
XANTHIPPE: Auf jeden Fall!
SOKRATES: Was ist einzukaufen?
XANTHIPPE: Also wir brauchen Eier, Äpfel und Möhren. Holst du das gerade?
SOKRATES erledigt den Einkauf, danach stehen die beiden in der Küche und bereiten das Essen zu. Das Kochen macht Spaß und das Essen schmeckt lecker.
XANTHIPPE: Aber was soll daran jetzt ein gutes Gespräch gewesen sein?
SOKRATES: Wir haben gemeinsam die Frage gestellt: Was ist gerade unser gemeinsames Anliegen? – Wir hatten beide Hunger und wollten etwas essen. Daher fragten wir uns: »Was soll es heute Mittag zu essen geben?« Für dieses gemeinsame Bedürfnis haben wir zusammen eine gute Lösung gefunden, wir haben ein leckeres Essen zubereitet.
XANTHIPPE: Es war jetzt also nicht das Thema, dass ich dich ganz prinzipiell von meiner Meinung überzeuge oder du mich von deiner. Stattdessen gingen wir von dem gemeinsamen Bedürfnis in unserer konkreten Situation aus: Uns beiden war es wichtig, ein gutes Essen zu bekommen. Du hattest deine Vorstellungen eingebracht und ich meine. Gemeinsam prüften wir die Vorschläge und entwickelten eine Lösung, die für uns beide passte.
Also Sokrates, so macht das Kochen richtig Spaß! Und ehrlich gesagt, ich habe den leisen Verdacht, die Sache mit den Guten Gesprächen ist gar nicht mal so blöd.
1 | DIE SCHWIERIGE AUSGANGSLAGE: GESPRÄCHE
IRGENDWIE IST ES DOCH VERHEXT: Alle sehnen sich zwar nach guten Gesprächen, aber irgendwie kommt es nicht dazu, allzu oft treten Schwierigkeiten auf. Es scheint fast so zu sein, als ob es einfacher sei, schwere, belastende und irgendwie verkorkste Gespräche zu führen als leichte und gute Gespräche. Dieses Dilemma ist schon alt. So wussten bereits XANTHIPPE und SOKRATES (469 v.Ch. bis 399 v. Ch.) im antiken Griechenland, ein Lied davon zu singen:2
Als SOKRATES wieder einmal spät abends heimkam, fand er die Haustür verschlossen und er rief nach seiner Ehefrau. XANTHIPPE öffnete die Tür und überhäufte ihren Mann mit wilden Vorwürfen, ihre Schimpftiraden wollten kein Ende nehmen. Nachdem SOKRATES dies alles eine Weile gleichmütig über sich hatte ergehen lassen, schüttete ihm XANTHIPPE zu guter Letzt noch einen Kübel Spülwasser über den Kopf. Doch SOKRATES erwiderte darauf nichts weiter, und während er sich den Kopf abwischte, sagte er nur im Stillen zu sich: »Ich wusste es ja: Nach so einem Donnerschlag musste noch ein tüchtiger Regenguss kommen.«
Mit dieser unerschütterlichen Haltung konnte SOKRATES es mit seiner zänkischen und keifenden Frau aushalten. Auch wenn seine Freunde Mitleid zeigten oder ihm den guten Rat gaben, etwas zu ändern, blieb SOKRATES gelassen, ruhig und ausgeglichen, tat gar nichts und beschwichtigte sogar noch seine besorgten Freunde. So meinte beispielsweise der athenische Feldherr ALKIBIADES: »Die keifende XANTHIPPE ist unausstehlich!« Worauf SOKRATES antwortete: »Auch du lässt dir doch das Geschrei der Gänse gefallen.«
SOKRATES’ Schüler ANTISTHENES riet ihm: »Warum erziehst du denn nicht auch deine XANTHIPPE, sondern lebst mit einer Frau zusammen, die von allen jetzt Lebenden, ja ich glaube auch von allen, die je gelebt haben und je leben werden, die schwierigste ist?« Darauf entgegnete SOKRATES: »Ein rechter Reiter trainiert ja auch nicht auf den allerbravsten, sondern auf schwer zu bändigenden Pferden; entsprechend übe ich mich an meiner XANTHIPPE. Denn erst wenn ich das Zusammenleben mit dieser XANTHIPPE aushalte, werde ich mit allen anderen Menschen leicht auskommen können.«
Gefragt, ob er die Heirat mit der XANTHIPPE bereue, antwortete SOKRATES mit der Empfehlung: »Heiratet auf jeden Fall! Kriegt ihr eine gute Frau, dann werdet ihr glücklich. Ist es eine schlechte, dann werdet ihr Philosophen, und auch das ist für einen Mann von Nutzen.« Allerdings suchte er nahezu jede Gelegenheit, dem häuslichen Gewitter zu entkommen. Er traf sich mit seinen Freunden zu philosophischen Gesprächen oder tauchte in das Athener Stadtleben ein, schlenderte über Märkte, Plätze und Sportstätten und redete überall mit den Leuten.
Er war ein rechter Müßiggänger, und auch das wurmte XANTHIPPE, die für die Erziehung der Kinder, für den Haushalt, die Einkäufe zuständig war und dafür sorgte, dass etwas Ordentliches zu essen auf den Tisch kam. Dabei hätte sie wohl gerne die Unterstützung ihres Gatten gehabt, aber der war einfach Philosoph, er ging keinem bürgerlichen Beruf nach.
BEI SEINEN SCHÜLERN WAR SOKRATES hochgeschätzt. In Gesprächen konfrontierte er sie immer wieder durch provozierende und durchaus unverschämte Fragen; so zeigte er ihnen die Grenzen und die Unzulänglichkeit ihrer eigenen Vorstellungen und Ansichten auf, entlarvte ihre Illusionen, um der verborgenen Wahrheit näher zu kommen. Die Schüler mochten seine Methode, wohingegen diese den Mitgliedern des Athener Senats eher suspekt blieb. SOKRATES wurde schließlich angeklagt, die Moral der Jugend zu verderben, doch in seiner Verteidigungsrede sprach er zu den Richtern wie zu seinen Schülern. Er deckte nicht nur auf, dass die Anklage gegen ihn unzutreffend war, sondern auch, dass deren Vorstellungen und Meinungen überhaupt unzureichend waren. Natürlich hat niemand es gerne, so öffentlich bloßgestellt zu werden, auch die Athener Richter nicht. Sie verurteilten SOKRATES zum Tode, und der leerte mit Würde und Gelassenheit den Schierlingsbecher.
Knapp 2.500 Jahre später – XANTHIPPE und SOKRATES sitzen auf ihrer Wolke im Himmel und haben sich längst versöhnt –, erinnern sich beide amüsiert an die Streitigkeiten von damals. Doch wenn sie heute auf die Erde blicken, stellen sie fest: Es hat sich nichts geändert! Immer noch zanken und streiten die Menschen. SOKRATES packt die Wut, und er fasst einen Entschluss:
SOKRATES: Hier muss etwas geschehen! Xanthippe, wir müssen den Menschen zeigen, wie sie wirklich gute Gespräche führen können und ihr Miteinander besser in den Griff kriegen.
XANTHIPPE: Ja, das denke ich auch. Es ist an der Zeit!
SOKRATES: Seit unserem damaligen Leben ist viel Zeit vergangen. Wir haben viel dazugelernt und viele Erfahrungen sammeln können.
XANTHIPPE: Lass uns doch den Menschen auf der Erde sagen, wie wir es geschafft haben, uns zu versöhnen.
SOKRATES: Und natürlich, wie wir seitdem miteinander reden.
XANTHIPPE: Genau! Und womit fangen wir an?
SOKRATES: Lass uns damit beginnen, dass wir uns fragen, was eigentlich ein schweres, belastendes Gespräch ausmacht. Was genau ist es denn, was dabei immer zu Schwierigkeiten führt?
XANTHIPPE: Sozusagen als mahnendes Beispiel …
SOKRATES: Anschließend zeigen wir, wie ein gutes Gespräch funktioniert.
XANTHIPPE: … und welche Hürden zu überwinden und welche Fallstricke zu vermeiden sind.
SOKRATES: Es gibt allerdings sehr viele verschiedene Gründe für schwierige Gesprächssituationen.
XANTHIPPE: … die meistens aus ganz einfachen Missverständnissen resultieren.
SOKRATES: Das stimmt, aber oftmals liegen die Ursachen tiefer.
XANTHIPPE: Du denkst an konkrete Meinungsverschiedenheiten, die durch unterschiedliche Vorstellungen, Ansichten oder Urteile hervorgerufen werden?
SOKRATES: Unbedingt! Wir müssen wissen, für jede Schwierigkeit im Gespräch gibt es einen ganz spezifischen Grund. Der ist aber meist nicht sofort erkennbar.
XANTHIPPE: Ich glaube, eine wichtige Ursache liegt weniger in der Sprache oder in der Wahl der Worte als vielmehr in den Gedanken, die wir in einer Gesprächssituation haben.
SOKRATES: Es ist sogar so, dass unser Denken und unsere Vorstellungen maßgeblich bestimmen, wie unsere Gespräche verlaufen.
XANTHIPPE: Aber sind wir denn in unserem Denken nicht frei und eigenständig? Bestimmen wir denn nicht selbst, was wir denken? Können wir unsere Gespräche denn nicht so ausrichten und gestalten, wie wir wollen?
SOKRATES: Theoretisch schon, aber in der Praxis sind unsere Gedanken, meist unbewusst, vor allem von unseren Rollen im Alltag geprägt. Die Psychologen haben dafür ein Modell entwickelt. Sie nennen es »Schubkastendenken« 3. Danach richtet sich unser Verhalten maßgeblich nach unseren Vorurteilen aus, nach den Rollen, die wir im Leben ausüben, den Etiketten, die wir Situationen anheften, und nach den Schubladen, in die wir unsere Erfahrungen und Kenntnisse einordnen. Nach diesem Modell bestimmen Etiketten, Schubladen und Rollen auch unsere Gespräche ganz maßgeblich.
ÜBER ROLLEN, ETIKETTEN UND SCHUBLADEN
XANTHIPPE: Was heißt Etiketten und Schubladen, was meinst du damit? Geht es da um Informationen? Um all die vielen Einflüsse, die jeden Tag auf uns einströmen, die Meinungen und Ansichten, die Erfahrungen anderer und all diese Berge von Wissen? Wie gehen wir damit eigentlich um? Wie bringen wir das alles zusammen, damit wir uns gut zurechtfinden?
SOKRATES: Dafür brauchen wir eine bestimmte Ordnung. Ein Ordnungssystem, das uns im Alltag eine zuverlässige Übersicht, Orientierung und Ausrichtung bietet, und das uns zum konkreten Handeln befähigt.
XANTHIPPE: Und wie kommen wir zu dieser Ordnung?
SOKRATES: Nun, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, entwikkeln wir die selbst, und zwar im Laufe unsere Erziehung und während wir etwas lernen. Wir übernehmen diese Ordnung zuerst teilweise von den Eltern, und dann erschaffen wir sie selbstständig weiter, im Kindergarten, in der Schule, noch später, in der Ausbildung, der Arbeit und außerdem auch im Umgang mit anderen Menschen, mit Partnern, Freunden und Kollegen. Jede Erfahrung und jeder Einfluss im Leben ist Teil dieser Ordnung.
XANTHIPPE: Das heißt, alles, was wir lernen und erfahren, alles, was uns von Kindheit an durch unsere Erziehung prägt, stellen wir in einer ganz individuellen Weise in eine bestimmte Ordnung?
SOKRATES: Ja, wir kombinieren all das mit dem, was und wie wir es erleben, wahrnehmen und interpretieren. Letztlich stellt jeder Mensch für sich selbst seine ganz eigene Ordnung her, auf der Basis dessen, was er oder sie äußerlich und innerlich erlebt, und entsprechend der eigenen Fähigkeiten.
XANTHIPPE: Daher also auch die Schubladen, von denen du sprachst. Es handelt sich nicht um eine einzige, allumfassende Ordnung, sondern um individuelle Ordnungssysteme. Darin bezeichnen die Etiketten an den einzelnen Fächern die unterschiedlichen Kategorien, nach denen wir die Welt einteilen. Und in die einzelnen Schubladen ›legen‹ wir alles fein säuberlich getrennt hinein: Wissen, Erfahrungen, Meinungen, Wahrnehmungen. Ich nehme an, unsere Denkmuster, emotionalen Strategien und Handlungsgewohnheiten richten sich nach diesem System?
SOKRATES: Ganz genau! Und dieses Ordnungssystem erheben wir dann zum Maßstab für unser Denken, Handeln und Fühlen. In einer konkreten Situation fragen wir uns also: Was ist jetzt die passende Kategorie, das passende Etikett in meinem Ordnungssystem? In der zugehörigen Schublade finden wir dann das entsprechende Handwerkzeug, um die Situation zu meistern – unsere Kenntnisse, Erfahrungen, Meinungen und unser Wissen.
XANTHIPPE: In der Kindheit und Jugend ist das Ordnungssystem noch sehr flexibel. Da sind wir offen für neue Impulse, interessiert, neugierig und wissensdurstig. Es macht Freude, das Ordnungssystem an die gegebenen Bedingungen immer wieder anzupassen, es zu verbessern, zu erweitern und dadurch immer besser auf die konkreten Situationen auszurichten.
SOKRATES: Ja, so werden wir für das Leben vorbereitet, oder besser gesagt, so bereiten wir uns selbst auf das Leben vor. Das Ordnungssystem ist gewissermaßen das Schema, mit dem wir uns gut in der Welt, in unterschiedlichsten Lebenssituationen orientieren und die verschiedensten Aufgaben meistern können. So hilft es uns auch, aktive Rollen in unserem Leben einzunehmen, in die wir unsere gesammelten Kenntnisse dann einbringen können.
XANTHIPPE: Mit diesem Ordnungssystem können wir Situationen besser einschätzen, wir können so effizienter handeln, schließlich kann sich dadurch ein gewisser Automatismus etablieren.
SOKRATES: Das führt aber auch dazu, dass wir Situationen im Alltag nur noch gewohnheitsmäßig wahrnehmen. Routiniert erfassen wir einzelne Merkmale einer Situation und machen sofort die passende Schublade dazu aus. Unser weiteres Denken und Handeln spult sich dann ganz automatisch entsprechend den in dieser Schublade hinterlegten Methoden und Programmen ab.
XANTHIPPE: Richtig, und wenn sich unsere innere Navigation bewährt hat, ist meist auch Schluss mit dem genauen Betrachten und Hinterfragen aktueller Situationen. Stattdessen vertrauen wir den Schubladen. Doch dann genau wird das Ordnungssystem statisch und starr und verliert seine ursprüngliche Flexibilität.
SOKRATES: Dann identifizieren wir uns mit unseren Schubladen, mit den Positionen und Ansichten, die wir entwickelt haben, und verteidigen diese sogar noch, weil wir doch in der Vergangenheit gute Resultate damit erzielt haben. Wir vergessen aber dabei, das Spezifische einer Situation zu betrachten. Wir fragen uns nicht mehr, was in der konkreten Situation erforderlich ist. Stattdessen erfassen wir sehr schnell einzelne Aspekte und weisen sie automatisch einer Schublade zu. Weder hinterfragen wir uns selbst noch die Situation, und wir reagieren nur noch gewohnheitsmäßig. Wir sehen nicht mehr das, was wirklich gerade geschieht, fühlen nicht mehr das, was uns gerade beeinflusst.
Unser ganzes Denken, Fühlen und Handeln wird von diesen Schubladen bestimmt. Wir kriegen gar nicht mehr mit, wenn sich beispielsweise etwas verändert hat, sich etwas plötzlich neu, anders darstellt und zu ganz anderen Schlussfolgerungen führen müsste. Eine Situation passt vielleicht schon längst nicht mehr in die Schublade, aber aus reiner Gewohnheit pressen wir sie immer noch hinein.
XANTHIPPE: Das erinnert mich an die Geschichte mit dem Braten: Eine junge Ehefrau möchte einen Rinderbraten kochen. Sie teilt den Braten und schmort jede der beiden Hälften in einem eigenen Topf. Der Ehemann fragt erstaunt: »Warum teilst du denn den Braten in zwei Hälften und schmorst jede der beiden Hälften in einem eigenen Topf?« Sie antwortet: »Das macht man doch so. Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Die macht das auch immer so.« Bei nächster Gelegenheit fragt der Mann seine Schwiegermutter, warum sie den Rinderbraten teile und in zwei Töpfen zubereite. Sie antwortet: »Das macht man doch so. Das habe ich schon immer so gemacht. Das habe ich von meiner Mutter so gelernt.« Das junge Ehepaar besucht die Oma, die sich über den Besuch sehr freut. Der junge Ehemann schildert die Situation mit dem Rinderbraten und fragt, warum sie den Braten immer geteilt hätte. Da lacht die Oma und sagt: »Habt ihr etwa immer noch keinen großen Topf, in den der Braten ganz hineinpasst?« 4
SOKRATES: Der Vergleich ist perfekt; genauso ist es! Da werden ewig die alten Gewohnheiten gepflegt, obwohl sie längst überholt sind. Wir brauchen erst einen Anstoß von außen, also jemanden, der uns darauf hinweist, dass unsere Reaktion für die neue Situation nicht mehr angemessen ist.
XANTHIPPE: Ich glaube, das ist noch nicht alles: Verstärkt wird dieser Effekt nämlich häufig auch durch die Neigung, das komplexe Ordnungssystem immer weiter zu differenzieren und uns in Kleinteiligkeit zu verlieren. Wir sind sozusagen »überorganisiert«, stehen in Situationen wie der Ochs vorm Berge und fragen uns, welche der Tausenden Schubladen denn nun die richtige sei. Wir sind mental überfordert und finden auch beim besten Willen keine Handlungsmöglichkeiten mehr.
SOKRATES: Genau das ist die Krux – die Schubladen entwickeln mit der Zeit ein Eigenleben! Sie schaffen eine Scheinrealität und wir vergeuden unsere Energie bei dem Versuch, uns darin noch zurechtzufinden. Wir vertrauen zwar voll auf die Schubladen, finden aber keine passenden Antworten mehr darin.
Auf die Idee, die aktuelle Situation einfach auf herkömmliche Weise bewusst zu erforschen, der eigenen Wahrnehmung zu folgen und dementsprechend zu handeln und zu entscheiden, kommen wir erstaunlicherweise nicht. Kein Wunder: Dazu fehlt uns schlicht das nötige Selbstvertrauen! Wir merken nämlich nicht, dass die Schubladen uns vereinnahmt haben, uns zu ihren Gefangenen gemacht haben. Wir sind nicht mehr in der Lage, eigenständig zu denken und zu handeln.
XANTHIPPE: Wie recht du hast, Sokrates! Im Extremfall ergeht es uns wie dem Mann, der sich für sehr aufgeklärt hielt. Er war überzeugt, niemand könne ihm etwas vormachen. Eines Tages verirrte er sich in der Wüste, und nach vielen Tagen endlosen Laufens sah er, vor Hunger und Durst halb wahnsinnig, in der Ferne eine Oase. ›Lass dich nicht täuschen!‹, sagte er zu sich selbst. ›Du weißt genau, dass das eine Luftspiegelung ist. Die Oase existiert in Wirklichkeit gar nicht, es ist nur eine Fata Morgana.‹ Er kam näher, doch die Oase verschwand nicht. Im Gegenteil, er sah Dattelpalmen, Gras und Wasser, eine Quelle, die zwischen Felsen lag. ›Sei vorsichtig!‹, warnte er sich selbst. ›Das ist alles nur eine Ausgeburt deiner Hungerfantasie.‹ Als er das Wasser sprudeln hörte, dachte er bei sich: ›Aha, ganz typisch! Eine Gehörhalluzination.‹
Am nächsten Tag fanden ihn zwei Beduinen – er war tot. »Kannst du das verstehen?«, fragte der eine. »Die Datteln wachsen ihm doch beinahe in den Mund? Wie ist das möglich?« Der andere antwortete: »Er hat seiner Wahrnehmung nicht getraut, er war ein moderner Mensch.« 5
SOKRATES: Ja, das ist der Irrtum, dem wir aufsitzen: Wir sind unseren Schubladen hörig und so überzeugt, die Situation mit unserem Verstand total im Griff zu haben, dass wir die Illusion nicht einmal erahnen: Vor lauter Denken in Schubladen können wir die Realität nicht mehr erkennen, geschweige denn realistisch handeln.
XANTHIPPE: Mir fällt gerade ein, dass es ja noch den anderen Fall gibt: die fehlende Schublade für eine neue Situation. Wenn sie fehlt, dann fehlt uns erst recht die Orientierung, dann sind wir hilflos, ratlos und wissen nicht, was wir tun sollen. Wir resignieren und fühlen uns elend. Häufig weichen wir solchen unangenehmen Situationen aus, werden teilnahmslos, apathisch, deprimiert und fühlen uns wie ein Opfer. Aber machen wir uns nichts vor, wir fühlen uns zwar unwohl in der Situation, leiden unter ihr, aber in der Regel sind wir gar nicht bereit, die Situation zu verändern.
SOKRATES: Gut beobachtet! eric berne, ein bekannter US-amerikanischer Psychiater, fand dafür ein recht drastisches Bild 6: Stell dir vor, ein Mann steht bis zum Hals in einer Jauchegrube. Auf die Frage, was er sich in seiner Situation wünsche, antwortet der Mann: »Können Sie bitte dafür sorgen, dass niemand Wellen macht?« Er will gar nicht heraus aus der Jauchegrube, die Situation verbessern, das Grundübel beseitigen. Auf keinen Fall! Stattdessen möchte er nur, dass sich die Situation für ihn nicht verschlechtert, dass es »keine Wellen« gibt.
XANTHIPPE: Diese Geschichte kenne ich. Es ist die pure Angst vor Veränderung, die den Mann lähmt. Statt sich herausholen zu lassen, arrangiert er sich lieber mit der Situation. Ähnlich wie sisyphus 7, der von den Göttern damit bestraft wurde, einen großen Felsblock den Berg hinaufzurollen, nur um ihn auf der anderen Seite wieder hinabrollen zu sehen und erneut hinaufzuschleppen – ohne jeden Sinn und Verstand. Er fügte sich und nahm die Aufgabe an, unter Aufbietung all seiner Kräfte, unter größten Mühen und schwerstem Leid. Und immer, wenn der Stein wieder in das Tal hinunter rollte, hatte er nichts Eiligeres zu tun, als hinterherzulaufen und sich erneut der Qual zu unterziehen, den Stein auf den Berg zu wälzen.
SOKRATES: Wie selbstverständlich fügte sich sisyphus in sein scheinbar unvermeidliches Schicksal, ohne sich selbst die Frage zu stellen: Was will ich selbst in dieser Situation? Ein Stück sisyphus steckt wohl in jedem von uns. Wie häufig lassen wir uns für von außen vorgegebene Ziele bereitwillig und ganz automatisch einspannen und überwinden dafür unseren inneren Schweinehund.
XANTHIPPE: Zum Beispiel bei der Arbeit.
SOKRATES: Ja, schon. Doch bei der Arbeit finde ich die Sache ganz in Ordnung, da lasse ich mich durchaus bereitwillig einspannen und bekomme zum Ausgleich ein Gehalt dafür. Immer wenn ich für mich persönlich einen Sinn in der Tätigkeit sehe, bin ich bereit, sie auszuführen und ein angemessenes Opfer dafür zu bringen. sisyphus bekam natürlich kein Gehalt für seine Quälerei, er schuftete für nichts.
XANTHIPPE: Es war eben die Strafe, die ihm die Götter auferlegt hatten, insofern war das der Sinn der Plackerei. Doch was ist mit uns? Wären wir wirklich freie Menschen, so würden wir uns doch selbst immer wieder fragen, ob und wie wir uns auf bestimmte Situationen einlassen. Wir würden es selbst entscheiden! Stattdessen bleiben wir, von unseren »inneren Programmen« geprägt, abhängig von unseren Schubladen und handeln ganz automatisch, ohne eigene Führung, und fühlen uns dabei als elende Opfer der Umstände.
UNSER DENKEN IN SCHUBLADEN
WENN WIR DAS ALLES NOCH EINMAL ZUSAMMENFASSEN, so lautet die Schlussfolgerung: Die äußere Realität und unsere individuellen Vorstellungen davon, unsere inneren Bilder, stimmen nicht zwingend überein. Einerseits werden unsere inneren Bilder von der äußeren Realität, von dem, was wir wahrnehmen, bestimmt. Andererseits überlagern wir die Bilder mit unseren eigenen Erfahrungen, Meinungen und Ansichten, die wir in der Vergangenheit gesammelt und feinsäuberlich in unsere Schubladen abgelegt haben und wie aus einer Konserve hervorholen. Gewissermaßen ist ein solches Bild im gegebenen Moment nicht ganz »frisch«. Es ist verzerrt und überlagert von unseren eigenen alten Vorstellungen. Außerdem sind unsere inneren Bilder höchst individuell; sie stimmen nur bedingt mit den inneren Bildern von anderen überein, die diese von derselben Situation ableiten. Schließlich ticken andere ja nicht genauso wie wir.





























