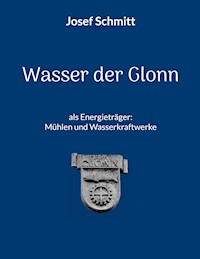
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende Band beleuchtet auf sehr anschauliche Weise die Bedeutung der Wasserkraft für die Marktgemeinde Glonn und illustriert, wie die Wasserkraftnutzung vom technischen Fortschritt begleitet wird. Nach einem sehr schön illustrierten, geschichtlichen Rückblick vermittelt Josef Schmitt leicht verständliche, umfassende Informationen zu den technischen Details der Wasserkraftnutzung früher und heute, behandelt aber auch die Gefahren, die die Wasserenergie in sich birgt. Besondere Aufmerksamkeit widmet der Autor den einzelnen Mühlen und Wasserkraftwerken auf dem Glonner Gemeindegebiet, die er im Laufe der Jahre immer wieder und mit viel Engagement fotografiert hat. Aus der Analyse von noch unveröffentlichtem Quellenmaterial gewinnt er bemerkenswerte Erkenntnisse zur wirtschaftlichen Entwicklung im 20. Jahrhundert in Glonn. Ein Buch für alle, die sich für die Ortsgeschichte der Marktgemeinde Glonn, vor den Toren Münchens, interessieren, für Technologieentwicklung am Beispiel der Mühlen und Wasserkraftwerke und auch für anspruchsvolle Dokumentarfotografie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort
Ortsgeschichte von Glonn
Energieträger Wasser
Hochwasserschutz
Herkunft und Nutzung des Wassers, Abwasser: Zusammenfassung im Schaubild
Werke an der Glonn
Steinmühle
Kottmühle
Stegmühle
Wasl-Mühle
Christlmühle
Wasserkraftwerk Glonnthal
Werke am Kupferbach
Wasserkraftwerk Waldstraße
Wiesmühle
Schleifmühle
Hammerschmiede
Furtmühle
Weitere wasserbedürftige Betriebe an der Glonn
Lohmühle-Gerber-Färber
Literatur
VORWORT
Der vorliegende Band enthält Josef Schmitts letztes Publikationsprojekt. Als jahrzehntelanger Freund, der schon in zwei von Josefs früheren Veröffentlichungen das Nachwort beisteuern durfte, bin ich nun von Isabella Arens, Josefs Witwe, beauftragt worden, die hinterlassenen Unterlagen zu „Wasser der Glonn“ zu sichten und bis zu einer ersten Drucklegung zu begleiten.
Josef Schmitt verfolgte sein Vorhaben trotz einer schweren Erkrankung mit bewundernswertem Engagement. Sein Tod kam überraschend und zur Unzeit. Bedauerlicherweise blieb so das Projekt unabgeschlossen, ein Fragment. Andererseits erscheint seine Arbeit als sehr verdienstvoll und so weit fortgeschritten, dass sie der Marktgemeinde Glonn und der interessierten Öffentlichkeit zumindest als Teilpublikation zur Verfügung stehen sollte.
Der Leser findet nach einer schön illustrierten ortsgeschichtlichen Einführung ein sehr informatives, zugleich anschauliches Kapitel zum Thema „Energieträger Wasser“, das die technischen Details der Wasserkraftnutzung erläutert und dabei auch die verschiedenen Phasen der Industrialisierung bis zur heutigen Digitalisierung einbezieht, ebenso die aktuelle Auseinandersetzung mit anderen Energieträgern wie Kernenergie oder Wasserstoff. Im großen zweiten Abschnitt dokumentiert Josef Schmitt ausführlich in Wort und Bild mit vollem technischem Verständnis die einzelnen Mühlen und Wasserkraftwerke auf dem Glonner Gemeindegebiet, also an Glonn und Kupferbach. Dabei gelingen ihm im Falle von Kottmühle, Stegmühle, Christlmühle oder etwa Wiesmühle recht anspruchsvolle Beispiele ästhetisch-künstlerischer Industriefotografie. Und wenn er wie im Fall der Waslmühle Zugang zu bisher nicht veröffentlichtem Quellmaterial hat, so entwickelt sich dessen Präsentation im historischen Kontext weiter zur überzeugenden betriebs- und volkswirtschaftlichen Analyse. Vor diesem abwechslungsreichen zweiten Abschnitt bietet Schmitt einen differenzierten Überblick über den Stand der Hochwasserschutz-Maßnahmen im Gebiet von Kupferbach und Glonn; außerdem findet der Leser hier ein umfassendes Diagramm zu den Hauptzweigen desWasservorkommens, der Wassernutzung sowie der Abwasser-Zusammenführung im Bereich der Glonn.
Eine ausführliche Behandlung der Themen Trinkwasser, Feuerlöschwasser und Abwässer bleibt einer anderen „Feder“, also einer/m anderen Autor:in vorbehalten. In jedem Fall wünsche ich dem sehr interessanten Projekt für die Zukunft viel Glück!
Dr. Werner Sedlak, Ebersberg
Ortsgeschichte von Glonn
Quellgebiet der Glonn
Ein munteres Bächlein speist sich in der Schlucht bei Ursprung aus sieben und mehr, meist unscheinbar kleinen Quellmündern. Ihr Wasser beziehen diese zu einem erheblichen Teil von Grundwasserzuflüssen aus der östlichen Münchener Schotterebene [vgl. Kölling und Tomsu (2003), S.4]. Zudem liegen die Glonnquellen in einer ohnehin grundwasserreichen Zone zwischen den Endmoränenzügen des eiszeitlichen Inngletschers, nämlich in dem gegen Ende der Würmeiszeit entstandenen Leitzach-Gars-Talzug [Klinger (1982)]. Weil sich in den Hanglagen und den Auen der Glonn günstige Lebensbedingungen fanden, ließen sich hier schon in der Jungsteinzeit Menschen nieder. Beim Bau des Hauses Münchner Str. 6 im Dorf Glonn fand man unter anderen Siedlungsresten Keramikscherben, die der Münchshöfener Kulturepoche (4500 bis 3900 v.Chr.) zuzurechnen sind. Die Kelten nannten den dort entspringenden Fluss „Glana“.
Münzfunde aus der Zeit der römischen Kaiser Claudius (41 bis 54) und Nero (54 bis 68) zeugen von einer Besiedlung an den Ufern der Glonn in der Antike. Am Glonner Bäckerberg stieß man bei Bauarbeiten auf Tuffplattengräber aus der Zeit um 700 n.Chr. Im Jahr 770 wird das Gewässer in den Freisinger Traditionsnotizen als „flumen clana“, der Fluss Clana, bezeichnet.
Vom Namen des Flusses kommt auch der Name der bei den Quellen entstandenen Siedlung Glonn. Diese wird erstmals am 31. März 774 in einer Schenkungsurkunde des Ratpot, Sohn des Criminus, erwähnt [Traditionen des Hochstifts Freising Nr. 66 ff., Niedermair (1991)]. In dieser Urkunde überträgt Ratpot seine eigene Kirche an die Marienkirche zu Freising.
Das Kirchlein St. Georg in Georgenberg steht unter Denkmalschutz. Es handelt sich um einen barocken Saalbau, der etwa um 1723 auf einem romanischen Kern entstanden ist.
Westseite der Kirche St. Georg
52 Jahre später kann im Jahr 826 als erste Kirche der Umgebung in Georgenberg ein Oratorium und ein Priester Hadhmunt nachgewiesen werden. Daher und aus der Landschaftsbeschreibung in der Urkunde wird angenommen, dass es sich bei der Schenkung um die Kirche in Georgenberg, also um Glonn handeln muss. Weitere Funde von Tuffplattengräbern belegen die Besiedlung des Gebietes durch das Mittelalter hindurch.
Erdfunde lassen darauf schließen, dass es im Umkreis der Quellen und des weiteren Bachverlaufes eine kontinuierliche, wenn auch nicht lückenlose Besiedlung seit über 5000 Jahren gibt.
Georgenberg mit Kirche
Anfang der Urkunde von 774 [Koller (1974)]
Kirche St. Georg
Blick auf Glonn mit Schloss Zinneberg, Gemälde von Markus Messner, 1855
Glonn-Panorama mit Wilder Kaiser
Schloss Zinneberg, Kupferstich von Michael Wening, 1750
In der nachrömischen Zeit, im aufgehenden Mittelalter, bildete sich das feudalistische System der Grundherrschaften als wirtschaftliches und politisches Herrschaftssystem heraus. Die weltlichen und kirchlichen Grundherren, Adel und Klöster, hatten privilegierten Anspruch auf den Besitz von Grund und Boden und auf die darauf lebenden Menschen und Tiere.
Oberhalb des Dorfes auf dem Zinneberg saß seit dem 11. Jahrhundert der Ortsadel „da Glana“. Auf Grund des Wasserreichtums war es naheliegend, Mühlen entlang der Glonn zu installieren. Die Mühlen wurden von den weltlichen oder den klerikalen Grundherren errichtet und die Müller wurden von ihnen belehnt. Diese Lehensgüter konnten nicht vererbt werden. Die leibeigenen Bauern waren verpflichtet ihr Getreide in den Mühlen ihrer Grundherren mahlen zu lassen. So hatten die Müller viele Jahrhunderte ein verlässliches Einkommen.
Im Spätmittelalter wurden vier Glonner Mühlen in den Schwabener Gerichtsliteralien erwähnt: die Wiesmühle im Jahr 1416 als Mul under Polkhayn (Balkham), weiterhin die Kottmühle, Furtmühle und Glonnthalmühle. Nach weiteren 85 Jahren werden sieben Mühlen auf dem Glonner Bann aufgezählt: Furtmüller, Wiesmüller, Waslmüller, Christlmüller, Stegmühle, Steinmühle und Kottmühle [Kuchelbuch (1501)].
Von den Streitigkeiten zwischen Christl-, Kott-, Stein- und Stegmühle wurde 1517 in den Gerichtsliteralen des Landgerichts Wolfratshausen berichtet. Es ging damals um eine Auseinandersetzung zwischen dem Kloster Ebersberg, den Pienzenauern, die zu dieser Zeit auf Schloss Zinneberg saßen, und dem Kloster Rott, die jeweils das Grundrecht an einer der betroffenen Mühlen besaßen. Ebenfalls aus dem Jahr 1517 stammt eine Urkunde, in welcher eine „Oswoltmühle“ erwähnt wird, die wahrscheinlich in der Nähe des heutigen Pfarrhofes lag, wo zu jener Zeit wahrscheinlich der Bachlauf der Glonn vorbeiführte.
Die letzte Murnau-Werdenfelser Dreinutzungsrinder Herde von Bäckermeister Josef Winhart
Ehemaliger Stall, heute ein Café mit „böhmischer“ Gewölbedecke
Im blutigen europäischen Religions- und Machtkrieg des 17. Jahrhunderts, dem Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648, hatte der Ort eine gewisse Bedeutung durch Schloss Zinneberg erlangt, das sich damals durch Heirat im Besitz der Fugger befand. Ganz sicher gab es hier Geld zur Finanzierung des Krieges zu erbeuten, denn 1632 wurden Schloss und Dorf von den Schweden „bis auf eine Badstube“ niedergebrannt. Die bäuerliche Bevölkerung wurde ausgelöscht, die Existenzgrundlagen zerstört, das Pfarrarchiv ging verloren.
Erst im 18. Jahrhundert erreichte Deutschland wieder den Bevölkerungsstand von 1618. Dank seiner Tuffsteinbrüche, der sich allmählich wieder ansiedelnden Handwerker, Bauern und Müller entwickelte sich auch Glonn stetig aufwärts. Um das Jahr 1790 wurden die 4 Jahrmärkte von Kreuz nach Glonn verlegt. Auf Schloss Zinneberg verdienten Handwerker und Tagelöhner aus dem Dorf ihr Brot, sofern sie nicht als Leibeigene unbezahlte Frondienste zu leisten hatten. Mitte des 19. Jahrhunderts, nach der Liberalisierung des Gewerbes, lebten in Glonn ca. 1200 Menschen.
Johann Baptist Dunkes, der von 1840 bis 1868 Lehrer in Glonn war, schrieb in seinen dokumentarischen Aufzeichnungen: „Das Pfarrdorf Glonn besteht dermalen aus 54 Häusern, darunter die Pfarrkirche, den Pfarrhof, das Schul- und zugleich Meßner-Haus. Den nötigen Lebensbedarf liefern ein Wirth, Bäcker u. Metzger welche gegenwärtig in sehr rentablen Betriebe stehen und den hiesigen Handwerkern und Taglöhnern brüderlich Verdienst zukommen lassen. Zur Zeitbefinden sich hier 3 Krämergerechtsame, davon eine i.J. 1858 vom Krämer Josef Angerer und Josef Obermair käuflich um 1500 fl. an sich gebracht wurde; dann ein Drechsler, ein Seiler, ein Weber, 1 Schreiner, 3 Schneider, 1 Lederer, ein Färber mit Huklerei, 1 Sattler, 2 Schuhmacher, 1 Messerschmied, 1 Waffen- und Hufschmied, 1 Mehlber, 7 Müller, 1 Bothe zugleich Stellwagenführer, 1 Säckler, 1 Mühlarzt, 1 Schlosser, 1 Schäffler; selbst die Kunst ist hier vertreten durch einen Maler-Vergolder-und Anstreicher, sowie für die Gesundheit durch zwei geschickte Ärzte, einen praktischen Arzt und einen Chirurgen und Geburtshelfer und 1 Hebamme bestens gesorgt ist. Die übrigen Familien sind Taglöhner und nur 1 Bauer steht als bedeutender Ökonom in der Mitte des Dorfes.“
1876 zählte man in Glonn schon 8 Wirtschaften. Von diesen existierte der Neuwirt von 1862 bis 2022 am längsten. Die Erhebung Glonns zur Postmeisterei 1864 und der Eisenbahnanschluss 1894 über Grafing nach München verbesserten die Infrastruktur und die Erwerbslage. 1901 wurde Glonn schließlich zum Markt erhoben.
Die Entwicklung der Zahl der Glonner Einwohner und Häuser [Bayerisches Landesamt für Statistik (2019)] in den letzten 200 Jahren zeigen folgende Diagramme. Seit 1945 wuchs die Bevölkerung deutlich an. Waren es zunächst die Heimat -Vertriebenen des 2. Weltkrieges, die hier angesiedelt wurden, so ist es in den vergangenen Jahren der Siedlungsdruck aus der „boom town“ München, der zu dieser Entwicklung beigetragen hat.
Im Jahr 2019 gab es in Glonn 1625 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, davon 18 in der Land- und Forstwirtschaft. Der weitaus größte Arbeitsmarkt liegt heute beim Handel, den Versorgungsbetrieben und dem produzierenden Gewerbe. 30% der Arbeitsplätze besetzen Ortsansässige und ca. 70 % der Arbeitsplätze besetzen Einpendler. Den etwa 1140 Einpendlern stehen 1680 Auspendler gegenüber.
Gemäldeausstellung von Givi und Giorgi Vashakidze, Tbilisi/ Georgien, Galerie Klosterschule, 1996.





























