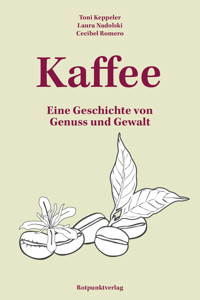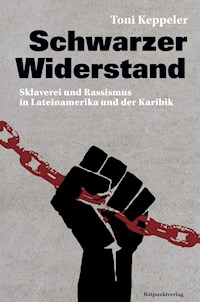Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Leben in Megastädten wird mit dem Klimawandel immer beschwerlicher. Die urbanen Moloche sind Hitzeinseln unter Smogglocken, das Trinkwasser geht zur Neige, ganze Straßenzüge senken sich. Die Gründe sind überall dieselben: Versiegelung der Landschaft, Übernutzung des Grundwassers. Kaum irgendwo ist das so gut dokumentiert wie in Mexiko-Stadt mit seinen über zwanzig Millionen Einwohner:innen. Dass die Metropole heute verdurstet und gleichzeitig unter Überschwemmungen leidet, ist das Ergebnis kontinuierlicher menschlicher Eingriffe. Jeder einzelne davon schuf größere Probleme, als er zu lösen vorgab. Toni Keppeler und Laura Nadolski zeichnen diese Geschichte und ihre wissenschaftlichen Hintergründe nach und vergleichen sie mit Problemen in anderen Megastädten. Sie erzählen sie anhand des Axolotl. Dieses kuriose Tierchen, ein Schwanzlurch, hat eine schier unglaubliche Regenerationsfähigkeit; ihm können sogar Herz und Gehirn nachwachsen. Es kommt in freier Wildbahn nur in Mexiko-Stadt vor und ist akut vom Aussterben bedroht. Doch es gibt Wege, den Axolotl zu retten. Warum nicht auch Mexiko-Stadt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Toni Keppeler, Laura Nadolski
Wasserstress
Toni KeppelerLaura Nadolski
Wasserstress
Noch sind Mexiko-Stadtund der Axolotl nicht verloren
Rotpunktverlag
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 bis 2025 unterstützt.
© 2025 Rotpunktverlag, Zürich
www.rotpunktverlag.ch
Lektorat: Andreas Simmen
Korrektorat: Günther Fässler
eISBN 978-3-03973-062-9
1. Auflage 2025
Das gedruckte Buch enthält Karten im Inhalt und Umschlag.
Inhalt
Der verschwundene HimmelWorum es in diesem Buch geht.
1. Die Stadt auf der InselWie Tenochtitlán entstand, und warum es damals unendlich viele Axolotl gab.
Das mythische Tier
Der Adler auf dem Kaktus
2. Die schwimmenden GärtenWie ein äußerst effektives biologisches Landwirtschaftssystem von Wasserverschmutzung, Siedlungsdruck und eingeführten Fischen kaputt gemacht wurde.
Die drei großen Gefahren
3. Der Lurch in GefangenschaftWie man den Axolotl zum Salamander machen wollte und warum immer weniger Tiere erfüllen können, was sich Genetiker von ihnen versprechen.
Das Wundertier der Genforschung
4. Das Wasser als FeindDie Seen im Hochtal von Mexiko wurden trockengelegt, und doch wird die Stadt immer wieder überflutet und hat gleichzeitig viel zu wenig Wasser.
Wohin mit so viel Abwasser?
Die teuerste Wasserversorgung der Welt
5. Unter dem Pflaster liegt der StrandWarum der Boden unter Mexiko-Stadt und unter vielen anderen Megastädten unsicher ist.
Ozeanwellen in der Stadt
6. Die Drei-Minuten-DuscheWarum in Mexiko-Stadt das Wasser rationiert wird und es trotzdem zu Überschwemmungen kommen kann.
Was Wassernot für Ofelia Silverio bedeutet
7. Die Stadt und der KlimawandelWarum es in der Metropole immer heißer und trockener wird – und was dagegen getan werden könnte.
Der Treibhauseffekt
Verschiedene Szenarien (RCP)
Hitzeinseln
Die klimatische Zukunft von Mexiko-Stadt
Was getan werden kann
8. Rettungsversuche für den AxolotlSoll man Labortiere auswildern oder die letzten in freier Wildbahn lebenden zusammen mit ihrem Habitat retten?
Zurück zur Landwirtschaft der Azteken
Wer den Axolotl rettet, kann auch Größeres tun
Literatur
Anmerkungen
Autor:innen
Der verschwundene HimmelWorum es in diesem Buch geht.
Das Hochtal im Zentrum von Mexiko ist 2250 Meter über dem Meeresspiegel gelegen. Der Talgrund dehnt sich auf rund zweitausend Quadratkilometern aus, wovon die Hälfte einst von fünf Seen bedeckt war, die sich vom Nordwesten in den Südosten erstreckten. Sie waren nur in der Trockenzeit als jeweils selbständige Gewässer zu erkennen. In der Regenzeit flossen sie ineinander über. Der bei weitem größte unter ihnen war der in der Mitte gelegene Texcoco, und auf einer Insel mitten in diesem See hatten die Azteken ihre Hauptstadt Tenochtitlán errichtet. Als sie der spanische Raubritter Hernán Cortéz 1519 bei seinem Eroberungszug durch Mexiko zum ersten Mal in Augenschein nahm, war er so von ihr eingenommen, dass er geradezu um Worte ringen musste, um sie zu beschreiben.
»Ich will aber doch einiges von dem erzählen, was ich gesehen habe, wenn ich auch überzeugt bin, dass man es nicht glauben wird, da wir ja selbst, die wir es mit eigenen Augen gesehen haben, es mit unserer Vernunft nicht begreifen können«, schrieb er an seinen König Carlos I., der im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation als Kaiser Karl V. bekannt war.1 Er berichtet von einem Platz, »so groß wie zweimal ganz Salamanca, der rundum mit Säulenhallen umgeben ist, wo sich täglich mehr als sechzigtausend Einwohner treffen, Käufer und Verkäufer von Lebensmitteln, von Kleinodien aus Gold und Silber, Blech, Messing, Knochen, Muscheln, Hummerschalen und Federn. Außerdem verkauft man behauene und unbehauene Steine, Kalk- und Ziegelsteine und Bauholz«.2 Seine Aufzählung will kein Ende nehmen.
Auch die Umgebung hat Cortéz tief beeindruckt, vor allem »zwei Berge, sehr hoch und wunderbar. Ende August tragen sie noch so viel Schnee, dass von ihren Gipfeln nichts anderes als eben Schnee sichtbar ist. Aus dem einen, der der höchste ist, stieg eine Dampfwolke empor, einem großen Hause gleich, und so groß ist anscheinend die Gewalt, mit der sie hervordringt, dass nicht einmal der starke Wind, der dort ständig weht, sie zu beugen vermag.«3
Der Berg mit der Dampfwolke ist der im Südosten des damaligen Tenochtitlán gelegene weit über fünftausend Meter hohe Popocatépetl. Der andere, gleich nördlich davon und fast so hoch, ist der Itzaccíhuatl. Und obwohl der Popocatépetl vom Zentrum der einstigen Hauptstadt der Azteken gut achtzig Kilometer entfernt ist, lag er von dort aus gesehen so gut wie immer in klarem Licht: der bewaldete Sockel in dunklem Grün, der schwarze Kegel des Vulkans mit seiner strahlend weißen Kappe aus Schnee und oft mit der ebenso weißen Wolke, darüber ein leuchtend sattblauer Himmel.
Die Azteken nannten damals ihr Herrschaftsgebiet Cem Ãnáhuac, und der mexikanische Dichter und Essayist Alfonso Reyes bezeichnete das Hochtal am Fuß der hohen Berge in seiner 1917 erschienenen historischpoetischen Beschreibung Visión de Anáhuac aus der Zeit rund um die spanische Eroberung, als »la región más transparente«. Carlos Fuentes, der vier Jahrzehnte jüngere Schriftstellerkollege von Reyes, machte dieses Zitat 1958 zum Titel seines monumentalen Gesellschaftsromans über Mexiko-Stadt. Man konnte dies symbolisch auf den radiologischen Blick beziehen, mit dem der Autor die damaligen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Stadt durchleuchtete. Man kann es aber auch wörtlich nehmen, wie es die deutsche Übertragung tat: »Landschaft in klarem Licht«. So verstanden erscheint der Titel ironisch, denn klares Licht gab es in Mexiko-Stadt schon 1958 nicht mehr. Der Popocatépetl lag vom Zentrum aus gesehen im Dunst. Heute ist er nur noch an jenen wenigen Tagen im Jahr zu sehen, an denen ein starker Wolkenbruch den Schmutz der Multimillionenstadt aus der Luft gewaschen hat und gleich danach die Sonne erstrahlt.
Der Schriftsteller Juan Villoro schreibt in seinem 2019 erschienenen Essayband über Mexiko-Stadt4, das alte Tenochtitlán habe zwei Himmel gekannt, den strahlend blauen oben und seine ebenso strahlende Spiegelung im Texcoco-See. Beide Himmel sind heute verschwunden. Der oben versteckt sich hinter einem Vorhang aus Smog, und den Texcoco als Spiegel gibt es nicht mehr. Dort, wo er einmal war, wuchern heute Asphalt und Beton, so endlos, dass es Villoro schwindlig wird. »El vértigo horizontal« ist der Titel seines Buches, »der horizontale Schwindel«.
Die Geschichte von Mexiko-Stadt, auf den Trümmern von Tenochtitlán erbaut, ist eine Geschichte von fünfhundert Jahren menschlicher Eingriffe in natürliche Kreisläufe. Man habe dabei, schrieb der deutsche Forschungsreisende Alexander von Humboldt, der sich 1803 und 1804 in Mexiko-Stadt aufhielt, »das Wasser bloß als Feind betrachtet, gegen den man sich entweder durch Dämme oder durch Ausleerungskanäle verteidigen muss«. Schon damals waren die Folgen verheerend. »Schöne Weiden gewannen nach und nach die Ansicht dürrer Steppen. In ganz großen Strichen zeigt der Boden des Tals nichts anderes mehr als eine Kruste von verhärtetem Ton ohne Vegetation und mit häufigen Rissen«, schrieb er in seinem Mexico-Werk5.
An der Feindschaft des Menschen gegenüber dem Wasser hat sich seither im Grund nichts geändert. Nur sind aus den einstigen dürren Steppen hermetisch versiegelte Stadtlandschaften geworden, und auch die zeigen Risse, die sich bisweilen so schnell auftun und so breit und so tief sind, dass Kleinbusse darin verschwinden können. Das Wasser, das der Mensch zum Leben braucht, wurde Mexiko-Stadt und seinem Untergrund so gründlich ausgetrieben, dass in ganzen Stadtteilen seit über einem Jahrzehnt kein Tropfen mehr aus den Leitungen kommt. Millionen von Menschen werden notdürftig mit Tanklastern versorgt. Zuletzt wurde in der gesamten Stadt Trinkwasser strikt rationiert. Die Metropole verdurstet.
Nicht nur Mexiko-Stadt leidet unter akutem Wassermangel. In vielen Multimillionenstädten der Welt wurde auf der Suche nach schnellen Lösungen das eigentliche Problem mittel- und langfristig nur noch größer gemacht. Kaum irgendwo aber ist dies eine gut dokumentierte Geschichte von fünfhundert Jahren, und kaum irgendwo wird in naher Zukunft der vom Menschen verursachte Klimawandel die Lage so dramatisch zuspitzen wie hier. Am Beispiel von Mexiko-Stadt kann aufgezeigt werden, was auch in anderen Metropolen geschehen kann, wenn sich der Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen nicht grundlegend ändert.
Was Mexiko-Stadt weltweit einzigartig macht, ist ein kurioses Tierchen mit einem in europäischen Ohren lustig klingenden Namen: der Axolotl. Es handelt sich um einen Schwanzlurch, von dem einst viele Millionen in den Seen im Hochtal von Zentralmexiko schwammen. Die in ausgewachsenem Zustand rund 25 Zentimeter große Amphibie, die ein bisschen aussieht wie ein freundlicher Salamander mit Kopfschmuck, war einst eine wichtige Proteinquelle auf dem Speiseplan der Azteken.
In ihrer Mythologie spielte das Tier eine zentrale Rolle, und auch heute sieht der Anthropologe Roger Bartra in ihm eine Verkörperung des nationalen Charakters von Mexiko. Für die Wissenschaft, vor allem für Genetiker, ist er eines der wichtigsten Labortiere. Er hat eine Fähigkeit, die ihn vor allen anderen höheren Lebewesen auszeichnet: Schneidet man ihm eine Gliedmaße ab, wächst diese innerhalb weniger Tage nach. Selbst innere Organe, die Wirbelsäule oder Teile des Gehirns kann der Axolotl ersetzen. Forscher sind seinem Geheimnis auf der Spur, haben es aber noch nicht gelüftet. So können die erstaunlichen Fähigkeiten dieses Tieres für die Humanmedizin noch nicht genutzt werden.
Neuerdings ist der Axolotl auf dem Fünfzig-Pesos-Schein abgebildet, in kleiner Auflage erst, weshalb Mexikaner bereit sind, ein Vielfaches dafür zu bezahlen, um das Wertpapier dann einzurahmen und aufzuhängen. Mexikaner lieben ihren Axolotl – und haben ihn doch fast ausgerottet. Nur noch wenige Hundert leben im Rest des einstigen Xochimilco-Sees, gut zwanzig Kilometer südlich des Zentrums von Mexiko-Stadt. Im Lauf der Jahrhunderte ist der Lebensraum des Lurchs mehr und mehr verschwunden. Die kümmerlichen Reste wurden mehr und mehr verschmutzt. Dem Axolotl fehlt heute zum Überleben dasselbe wie den Menschen in Mexiko-Stadt: genügend sauberes Wasser. Und auch die Gründe, warum dies so ist, sind bei Mensch und Tier dieselben.
So verknüpft sich die Geschichte, die zum großen Durst in Mexiko-Stadt geführt hat, mit der des langsamen Aussterbens des Axolotl. Beide sollen parallel zueinander erzählt werden. Dieser Erzählstrang wird immer wieder Anlass geben zu hintergründigen Erklärungen und Bezügen zu vergleichbaren Problemen in anderen Megastädten. Was die Zukunft angeht, so wird sie nach Prognosen von Klimatologen in Mexiko-Stadt wie auch in vielen anderen Regionen der Welt noch heißer und noch trockener sein. Keine schönen Aussichten. Und doch kann etwas getan werden, nicht nur in der weltweiten Klimapolitik, sondern auch konkret an Ort und Stelle. Und auch für den Axolotl, dessen Verschwinden schon besiegelt zu sein schien, gibt es noch Hoffnung.
Die Autoren haben sich beim Verfassen des Buchs aus Gründen der besseren Lesbarkeit für das generische Maskulinum entschieden. Wo immer es verwendet wird, sind damit weibliche, männliche wie auch andere Geschlechtsidentitäten gemeint.
1. Die Stadt auf der InselWie Tenochtitlán entstand, und warum es damals unendlich viele Axolotl gab.
Der Metropolitanraum von Mexiko-Stadt ist die größte Siedlung auf dem amerikanischen Kontinent. Mehr als 23 Millionen Menschen leben dort. Vielleicht sind es auch schon 25 Millionen, so genau weiß das niemand. Diesen Moloch gibt es nur, weil es Xochimilco gibt, ein großes Feuchtgebiet, gut zwanzig Kilometer südlich des Zentrums. Über Jahrhunderte war dies der Ort, an dem der Mais und das Gemüse wuchsen, womit die Menschen in der Stadt, die heute Mexiko-Stadt heißt, versorgt wurden. Dort leben auch die letzten Exemplare des wundersamen Tierchens, das die Azteken in ihrer Sprache – dem Nahuatl – Axolotl nannten, und so nennt man es noch heute. Korrekt ausgesprochen wird es in dieser Sprache wie »Ascholotl«, mit Betonung auf dem zweiten »o« und kaum hörbarem »l« am Ende.
Der Axolotl, eine Amphibie, ist für Mexiko-Stadt genauso fundamental wie Xochimilco (gesprochen wie »Sotschimilco« mit Betonung auf der zweitletzten Silbe). Hätte es den Axolotl nicht gegeben, hätten die Azteken die lange Wanderung nicht überlebt, an deren Ende sie ihre Hauptstadt Tenochtitlán gründeten. Es gab Zeiten, da war dieser Lurch ihre einzige Proteinquelle. Die spanischen Eroberer errichteten dann auf den Trümmern von Tenochtitlán Mexiko-Stadt. Der Name war eine Referenz an die ursprünglichen Bewohner, die sich selbst nicht »Azteken«, sondern »Méxica« nannten. Für sie war der Axolotl nicht nur Nahrung. Er spielte auch in ihrer Mythologie eine zentrale Rolle.
Das Tierchen gleicht einem Salamander, nur dass es nie an Land geht, sondern sein ganzes Leben im Wasser verbringt. Wissenschaftlich heißt es Ambystoma mexicanum und ist tatsächlich ein entfernter Verwandter des Tigersalamanders (Ambystoma tigrinum). Es ist ein Schwanzlurch aus der Familie der Querzahnmolche und wird im Erwachsenenalter in der Regel 23 bis 28 Zentimeter lang. Einzelne Exemplare können sogar bis zu 40 Zentimeter erreichen. Es hat einen runden Kopf mit breitem Maul und weit auseinanderstehenden Äuglein und wirkt auf Menschen wie ein freundliches Kuscheltier. Sein lang gestreckter Rumpf hat vier Beinchen und an den Enden Finger ähnlich denen eines Froschs; an den Vorderbeinen sind es je vier, an den Hinterläufen fünf. Sein Leib endet in einem langen seitlich platt gedrückten Schwanz mit einem Flossensaum, weshalb der Axolotl ein guter und ausdauernder Schwimmer ist. Besonders verwunderlich sind sechs fächerartige Gebilde in seinem Nacken, drei links und drei rechts, die ein bisschen wie kleine ausgefranste Geweihe aussehen. Es handelt sich dabei um Kiemenäste.
Der Axolotl hat drei Möglichkeiten, Sauerstoff aufzunehmen: aus dem Wasser durch diese Kiemenäste oder über seine durchlässige Haut, und wenn er an die Wasseroberfläche schwimmt, kann er Luft durch das Maul in seine Lunge einsaugen. Der Lurch liebt sauerstoffreiches Wasser und fühlt sich bei Temperaturen zwischen 11 und 17 Grad am wohlsten. Er ist nachtaktiv. Den Tag über versteckt er sich meist im Schlamm oder unter Wasserpflanzen auf dem Grund der Kanäle am Xochimilco-See. Er ist dafür perfekt getarnt. Axolotl sind schwarz oder graubraun wie Schlamm, mit schwarzen Flecken. Am Bauch sind sie etwas heller als am Rücken und an den Seiten. Hin und wieder gibt es auch weiße, fast durchsichtige Albinos. Die Tiere sind Lauerjäger. Auf dem Grund versteckt warten sie darauf, dass Larven von Insekten oder winzige Krebse und Schnecken vorbeikommen, und saugen sie dann blitzschnell ein. Vegetarische Nahrung interessiert sie nicht.
Anders als der Tigersalamander, der zunächst als Larve im Wasser lebt, um dann – gewissermaßen in der Pubertät – eine Metamorphose zu durchleben und zum schwarz-gelb gefleckten Landtier zu werden, bleibt der Axolotl sein ganzes Leben lang eine Larve. Er ist so etwas wie eine Kaulquappe, die nie zum Frosch werden will. Doch obwohl er in seiner biologischen Entwicklung ein ewiges Kind bleibt, wird er doch geschlechtsreif und kann sich fortpflanzen. Man nennt diese Besonderheit Neotenie, und sie kommt nur sehr selten vor, etwa beim Grottenolm (Proteus anguinus), einem in den Höhlengewässern von Slowenien und Kroatien lebenden Schwanzlurch. Zwischen ihm und dem Axolotl gibt es keine verwandtschaftlichen Beziehungen.
Wenn ein Männchen und ein Weibchen dieses Lurchs aneinander Gefallen finden, schubsen sie sich zunächst stimulierend gegenseitig an der Kloake, jener Körperöffnung im Unterleib, durch die alle Ausscheidungen und Sekrete der Verdauungs- und Geschlechtsorgane ihren Weg ins Freie nehmen. Von solchem Vorspiel genügend erregt, tanzen sie im Wasser um sich herum, bis das Männchen wegschwimmt, dem Weibchen aber dabei einladend mit dem Schwanz zuwinkt. Das Männchen lässt dann aus seiner Kloake eine Kapsel voller Sperma fallen, die sogenannte Spermatophore. Das Weibchen saugt diese mit ihrer Kloake auf und legt später zwischen hundert und dreihundert befruchtete und mit einem glibberigen Gelee überzogene Eier auf Wasserpflanzen und Steinen ab. Nach zehn bis vierzehn Tagen springen diese Eier auf, die Jungtiere kommen heraus. Axolotl-Eltern betreiben keine Brutpflege. Ihre Kinder sind von Anfang an auf sich allein gestellt. Überleben sie, sind sie nach einem Jahr selbst geschlechtsreif.
Axolotl sind eine sehr junge Tierart; sie ist erst vor 6000 bis 10’000 Jahren entstanden. Zum Vergleich: Die Gattung des Homo ist seit rund 300’000 Jahren belegt. Sieben Varianten des Lurchs sind in Mexiko bekannt, eine ist sogar bis hinauf nach Kanada verbreitet. Sie leben alle in abgeschlossenen Biosphären. Sie wurden wahrscheinlich durch tektonische Verschiebungen auf der Erdkruste getrennt und nahmen dann jeweils eine eigenständige Entwicklung. Die meisten dieser Gattungen durchlaufen eine Metamorphose und werden zu Salamandern.
Am Pátzcuaro-See im mexikanischen Bundesstaat Michoacán züchten Dominikanerinnen die dort vorkommende Gattung Ambystoma dumerilii, die etwas größer und dicker ist als ihre Verwandten in Xochimilco. Die Nonnen pressen die Tierchen aus und verkochen den so gewonnenen Saft zu einem Sirup. Er soll gegen alle Arten von Atemwegerkrankungen helfen. Man kann die Fläschchen, deren Etikett von einem Axolotl geziert wird, auf volkstümlichen Märkten finden. Der Glaube, dass Extrakte des Schwanzlurchs lindernd auf mannigfache Beschwerden wirken können, ist weitverbreitet; wissenschaftliche Belege dafür gibt es nicht. So lieferte der katholische Priester José Antonio de Alzate y Ramírez, der sich auch mit Naturwissenschaften, Geschichte und Kartografie beschäftigte, 1790 in der Gazeta de Literatura de México ein Rezept, das er seiner Mutter abgeschaut hatte: Man häute ein paar Axolotl und koche die Haut mit wenig Wasser, so lange, bis sich diese fast aufgelöst hat. Dann drücke man den Sud durch ein Tuch. Heraus komme eine gelatineartige Flüssigkeit, die man mit Zucker verrühre. Dieser Sirup helfe gegen die Schwindsucht. Man nehme ihn zweimal am Tag. De Alzate versichert, dass diese Medizin auch ihm selbst geholfen habe.
Solche Säfte kann man aus jeder Art des Axolotl gewinnen. Ob sie helfen, sei dahingestellt. Die fast unglaubliche Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren, hat aber nur der Ambystoma mexicanum aus Xochimilco. Andere Schwanzlurche dieser Größe werden vier oder fünf Jahre alt. Ein Ambystoma mexicanum kann es wegen dieser Regenerationsfähigkeit auf bis zu fünfundzwanzig Jahre bringen.
Das mythische Tier
Es erscheint fast natürlich, dass einem so wundersamen Tier göttliche Eigenschaften zugeschrieben werden. In der Mythologie der Azteken spielt es bei der Entstehung der Welt, so, wie sie heute ist, eine wichtige Rolle. Bernardino de Sahagún, ein spanischer Missionar und Ethnologe, der 1529 nach Mexiko kam, hat diesen Mythos im siebten Buch seiner Historia general de las cosas de la Nueva España nacherzählt6: Es war zu der Zeit, in der es weder Tag noch Nacht gab. Da trafen sich die Götter in Teotihuacán, einem Ort, rund 45 Kilometer nördlich der heutigen Stadt Mexiko. Die dortigen Pyramiden werden jedes Jahr von Hunderttausenden Touristen besucht. An diesem heiligen Ort beratschlagten die aztekischen Götter, wer denn nun dafür verantwortlich sein solle, die Erde zu beleuchten. Sie entzündeten ein großes Feuer und der Gott Nanauatzin stürzte sich freiwillig hinein. Er glühte und verbrannte, und als der Gott Tecuciztécatl, der das Feuer entzündet hatte, dies sah, folgte er ihm in die Flammen. Aus dem Feuerschein des Nanauatzin entstand die Sonne, aus dem des Tecuciztécatl der Mond.
Doch es gab ein Problem: Die beiden Himmelskörper standen unbeweglich nebeneinander am Firmament. So beratschlagten die Götter, wie man sie in Bewegung setzen könne, auf dass die Sonne den Tag beleuchte und der Mond der Nacht seinen Schimmerglanz gebe. Sie fanden keine andere Lösung, als sich allesamt ins Feuer zu stürzen. Nur einer wollte nicht mitmachen: Xolotl. Dieser Gott fürchtete den Feuertod.
Xolotl ist der Zwillingsbruder oder auch das andere Gesicht des Quetzalcoatl, jenes mondänen Schlangengotts mit dem grün schillernden Gefieder des Quetzalvogels. Er wurde nicht nur von den Azteken, sondern auch von den Maya und Tolteken verehrt. Quetzalcoatl ist der Gott des Windes, des Himmels und der Erde; ein Schöpfergott, der zuständig ist für alles Schöne und Erhabene. Xolotl ist das glatte Gegenteil davon, ein hässlicher Gott, der meist so dargestellt wird, wie er im Nationalmuseum für Anthropologie in Mexiko-Stadt steht. Das Abbild dort ist ein aus Basalt geschlagener fast quadratischer Hundekopf von rund je einem Meter Länge, Breite und Höhe. Er hat zahllose Falten und auf dem Kopf zwei rechteckige Wulste. Er ist der Gott des Blitzes, des Todes und des Unglücks. Sein Name in der Nahuatl-Sprache kann mit »Monster« oder »Ungeheuer«, aber auch mit »Narr« oder »Spielzeug« übersetzt werden.
Xolotl wollte sich nicht ins Feuer stürzen. Er weinte, die Augen schwollen ihm an, und schließlich floh er von der Götterversammlung in Teotihuacán. Er versteckte sich zunächst in einem Maisfeld und verwandelte sich dort in den Strunk einer Maispflanze. Doch seine Häscher machten ihn ausfindig. Gerade noch rechtzeitig konnte Xolotl davonlaufen und tarnte sich in einem Magueyfeld, indem er sich in eine jener Agaven verwandelte, aus denen der Mezcalschnaps gebrannt wird. Doch auch dort wurde er entdeckt. Schließlich sprang er ins Wasser und wurde zum Axolotl. Der Name des Tiers ist eine Zusammensetzung von atl (Nahuatl für Wasser) und Xolotl, dem Namen des Gotts. Man kann diese Wortverbindung also als »Wassermonster«, »Wassernarr« oder »Wasserspielzeug« übersetzen.
Doch auch diese Tarnung half Xolotl nicht. Seine Häscher fanden ihn, nahmen ihn gefangen und schlachteten ihn. Sein Opfer schien zunächst vergeblich gewesen zu sein. Sonne und Mond standen noch immer starr nebeneinander am Firmament. Doch dann kam ein Wind auf. Die beiden Himmelskörper kamen in Bewegung und wurden auseinandergetrieben. Seither strahlt die Sonne am Tag, und des Nachts schimmert der Mond. Und seither beschäftigt der Axolotl, dieses seltsame Tierchen, die Azteken und später europäische Forschungsreisende.
Bernardino de Sahagún kannte nicht nur die Sage vom Xolotl, er kannte auch den Lurch, in den sich der Gott verwandelt hatte. »Es gibt Tierchen im Wasser, die man Axolotl nennt. Sie haben Füße und Hände wie Eidechsen, einen Schwanz wie ein Aal, und auch ihr Körper ist so. Sie haben einen sehr breiten Mund und einen Bart im Nacken. Sie sind ein schmackhaftes Essen.«7 Die erste wissenschaftliche Beschreibung stammt von dem Arzt Francisco Hernández. Im Band drei seiner gesammelten Werke mit dem Titel »Historia de los animales de la Nueva España« (erschienen 1571 bis 1577) ist auch die erste Zeichnung des Tiers zu finden.8