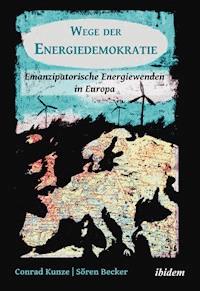
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Energiewende verdrängt schon jetzt Atom- und Kohlekraftwerke in Europa und wird diese in nicht allzu ferner Zukunft ganz ablösen können. Hermann Scheer hat unablässig betont, dass dieser Übergang auch das Soziale und Politische zum Besseren verändern kann. Kunzes und Beckers Studie bietet einen allgemein verständlichen Überblick zu hervorragenden demokratischen Energiewenden innerhalb der Europäischen Union. Die Autoren machten sich auf die Suche nach jungen Energieprojekten, die sich auszeichnen, indem sie die Energiewende mit einem Gewinn für die Bereiche Partizipation, kollektiver Besitz, lokale Wirtschaft oder Ökologie verbinden. Anhand einer Auswahl von zwölf Beispielen werfen Conrad Kunze und Sören Becker einen Blick auf das entstandene Paralleluniversum der kleinen Alternativen und wagen einen Ausblick auf die Entwicklungen und Möglichkeiten der kommenden Jahre. Erneuerbare Energien sind nicht nur ein Mittel gegen den Klimawandel, sie können, richtig genutzt, auch mehr und mehr Teil einer größeren gesellschaftlichen Veränderung sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Wege der Energiedemokratie
Emanzipatorische Energiewenden in Europa
Conrad Kunze und Sören Becker
Cover, Illustrationen und Infografiken:
Lidia Beleninova
Interviews, Online-Recherche und Übersetzungen:
Gerry Billing für Skandinavien
Carla Detona für Italien
Mihaela Lenuta für Spanien
Irune Penegaricaño für Frankreich
Online-Recherche:
Gwendolyn Buttersack für Griechenland
Dimana Shishkova für Bulgarien
Finanzierung und Auftrag:
Rosa-Luxemburg-Stiftung,Büro
Inhalt
Sprachpolitik:
In der unpersönlichen Rede ist der Text, in Anlehnung an die Sprachpolitik der Universität Leipzig, durchgehend feminin.
Die Autoren danken Dr. Agnes Przewozny und dem Institut für Tierzucht in den Tropen und Subtropen der Humboldt-Universität zu Berlin für die Bereitstellung eines Arbeitsraumes im damals noch sehr grünen und schönen Charitégelände. Dr. Sabine Hielscher hat wichtige Tipps zu Großbritannien gegeben, und bei der Recherche in Osteuropa half Tina Bär,einen Überblick zu gewinnen. Das Transition Town Network Europe hat mit einer Rundmail an Ansprechpartnerinnen in ganz Europa und den entsprechenden Antwortschreiben ebenfalls bei der Suche nach geeigneten Beispielen geholfen. In Spanien haben Dr. Gabriel Weber und seine Kollegen wichtige Hinweise gegeben, und Prof. Wulf Boie hat wertvolle Hintergrundinformationen zu Schottland beigesteuert. Prof. Ulrich Brand, Dr. Matthias Naumann und Dr. Hans Thie haben mit Kritik und Vorschlägen das Manuskript inhaltlich verbessert. Marie Luise Welz und Stefan Mey haben ehrenamtlich lektoriert und kritisiert.Für das professionelle und sehrzuverlässige Lektorat danken wir außerdem besonders Dr. Stephan Lahrem vonTEXT-ARBEIT.Ein Dank gebührt dem Lehrstuhl für Environmental Governance der Universität Freiburg und dem Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung für den gegebenen Freiraum, das Manuskript bis zur Druckreife zu bringen. Das Brüsseler Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Person von Marlis Gensler und Klaus Sühl hat die Finanzierung der empirischen Vorarbeiten und die Begleichung der Publikationskosten ermöglicht. Schließlich ist zu erwähnen, dass die Studie nicht hätte entstehen können ohne die vielen Interviewpartnerinnen und deren Bereitschaft, Auskunft zu geben.
Die Transformation des Energiesystems ist weit mehr als nur eine technische Frage. Sie eröffnet die Chance auf eine ökologische Wende und mehr Demokratie in einem wichtigen Wirtschaftszweig. Mit Blick auf die Utopie der Atomkraft als vermeintlicher Heilsbringer in den 1960er Jahren sollten wir gleichwohl auch auf der Hut sein, zu viel Hoffnung auf eine technologische Veränderung zu setzen.[1]Es gibt nach wie vor viele Menschen, die einem übersteigerten Glauben an Technologie anhängen. Auch wenn die Unterschiede zwischen Energiewende und Atomkraft deutlich überwiegen, in diesem Punkt ist ein Blick in die enttäuschten Utopien der Vergangenheit aufschlussreich. Denn eine Politik des Weiter-so ist auch mit erneuerbaren Energien problemlos möglich.[2]Das WüstenstromprojektDesertec oder der Green New Deal vermitteln beispielsweise solch ein ernüchterndes Bild von unveränderlichen Konsummustern und industriellen Produktionsstrukturen: „mehr davon, aber ein bisschen in Grün!“[3]
Selbstverständlich ist es nicht egal, ob Primärenergie aus Atom- oder Windkraft kommt. Großkraftwerke der nuklearen und fossilen Energie ziehen Großinvestitionen nach sich und haben bisher stets zu privaten oder staatlichen Monopolstrukturen geführt. Zudem müssen Atomanlagen geschützt und Proteste gegen die Anlagen und Tagebaue gebrochen werden, weshalb Robert Jungk vor einem „Atom-Staat“ gewarnt hat,[4]dem wir mit Blick auf Kolumbien, Russland und Saudi-Arabien den Kohle- und Ölstaat zur Seite stellen können.[5]
Die Energiewende erlaubt eine Abkehr hiervon. In der Erschließung erneuerbarer Energien sehen Denker wie Hermann Scheer und Elmar Altvater einen der großen Übergänge der menschlichen Geschichte, ähnlich der neolithischen Revolution und der Einführung der kohlebetriebenen Dampfmaschine.[6]Statt weniger Monopole wie bisher können nun viele Tausend kleine Produzentinnen Energie erzeugen, und das ist schon heute keine Zukunftsmusik mehr. Zahlreiche Windparks in Dänemark gehören den Anwohnerinnen, britischeTransition Townsermöglichten viele kleinere Solaranlagen, und italienische Genossenschaften gehörten zu den Ersten, die im Land erneuerbaren Strom produzierten. Im Gegensatz zu Atom- und Kohlekraft ist das in jedem Fall ein ökologischer Gewinn.
Ob die Energiewende auch ein sozialer Gewinn ist, hängt von ihrer gesellschaftlichen Einbettung und der Organisation der erneuerbaren Produktion ab. Wenn wir die Energiewende in Anlehnung an Karl Polanyi als „große Transformation“ bezeichnen,[7]so attestieren wir ihr, eine Veränderung im umfassenden Sinne zu sein. Das Verhältnis von Wirtschaft, Technologie und Gesamtgesellschaft wäre, so die damit verbundene These, in einer postfossilen Energiewirtschaft nicht mehr das gleiche.
Um dies genauer zu untersuchen, haben wir in der Europäischen Union nach kleinen, schon funktionierenden demokratischen Energiewenden gesucht.In den letzten beiden Jahrzehnten sind in Europas Regionen, Dörfern und Städten neue Formen der Assoziation entstanden, sowohl für die Produktion und den Konsum von Energie als auch für die Finanzierung und den Besitz kleiner und größerer Energiewenden. Fast immer sind sie wesentlich demokratischer, sozial gerechter und ökologischer als der fossile Energiesektor.So wie der deutsche Atomausstieg nicht der Einsicht einer Regierung entsprang, sondern der Erfolg einer breiten Protest- und Bürgerinnenbewegung war, so wird eine wirklich ökologische, demokratische und soziale Energiewende nur auf dem Boden von Demokratisierung und sozialen Bewegungen entstehen.
Freilich, die größten Projekte unter dem Titel Energiewende, besonders außerhalb Europas, fügen sich bisher fast geräuschlos in die Logik des Marktes ein und schreiben die autoritären und monopolisierten Eigentumsverhältnisse unverändert fort. Dennoch gibt es innerhalb der Energiewende viele kleine Alternativen, die den Samen der Veränderung in sich bergen. Sie eröffnen einen Möglichkeitsraum von schon realen und viel weiter denkbaren Praktiken, in denen soziale Gerechtigkeit und ökologische Transformation vereint sind.[8]Diesem Aufbruch haben wir einen Namen gegeben: Energiedemokratie.
Wir stellen 16 Beispiele vor, die den „Raum einer objektiv realen Möglichkeit“ (Ernst Bloch)[9]dokumentieren. Gemeinsam ist ihnen das Ziel, die Energiewende[10]als politisches Projekt für eine breite gesellschaftliche Veränderung zu nutzen. In lokalen Nischen und überregionalen Genossenschaften wächst so ein „Paralleluniversum der kleinen Alternativen“[11]heran. Dieses Buch ist daher weniger eine theoretische Abhandlung als ein Aufzeigen dessen, was bereits möglich ist. Auch sollen die vorgestellten Praktiken Mut machen, dass selbst bei einer Verschlechterung der politischen Rahmenlage mit Geschick und Ausdauer emanzipative Energieprojekte verwirklicht werden können.
So wie die vorgestellten Beispiele ein Anfang eines möglichen größeren Übergangs sind, so ist auch unser Konzept mit dem Namen Energiedemokratie ein Vorschlag für eine zu führende Debatte. Die Frage nach dem guten Leben und der Rolle der Energiewende darin kann und soll nicht allein von Wissenschaftlerinnen beantwortet werden. Für ein umfassenderes Gespräch über die gewünschte Energiewende hoffen wir, immerhin einige Handreichungen und einen Überblick bieten zu können.
Dieses Buch gliedert sich in sechs Teile. Nach diesem einleitenden Kapitel stellen wir im zweiten unser Konzept von Energiedemokratie vor. Kapitel drei porträtiert die untersuchten Beispiele, die in drei Kategorien unterteilt sind: Genossenschaften, in den Peripherien angesiedelte sowie unkonventionelle Projekte. Kapitel vier diskutiert zunächst die Gegenthese, dass die Energiewende eine Schimäre sei, und entwickelt einige Modelle, um typische Gemeinsamkeiten und Unterschiede zusammenzufassen. Die Kapitel fünf und sechs schließen mit einerZusammenfassungund einem Ausblick in die nähere Zukunft.
Wenn wir nach nicht monopolförmiger Organisation von Energie suchen, brauchen wir einen Zugang, der sowohl die technologische und die ökonomische als auch die soziale Ebene einschließt. Die Verbindung dieser unterschiedlichen Elemente finden wir in „soziotechnischen Regimes“, eine Bezeichnung, die wir der Transitionstheorie entlehnen.[12]Diese Denkfigur verbindet technische Artefakte mit Gesetzen und Politiken, mit kollektivem Wissen und dem Handeln der Menschen, die sie benutzen.[13]Eine Eigenschaft soziotechnischer Regime ist ihre Beharrungskraft.[14]Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Wie oft wurden schon gute Vorschläge vorgebracht, um die Zahl der vom Autoverkehr verursachten Unfalltoten durch ein strengeres Tempolimit zu reduzieren, und wie oft wurde dies schon abgeschmettert. An diesem Beispiel lässt sich zeigen, in welche sozialen Felder die eine Technologie Automobil eingebettet ist. Würden Film, Presse und Kulturindustrie Assoziationen produzieren, die beim Anblick eines Autos an Intensivstation und Friedhof denken ließenstatt an sportliche junge Männer, die Champagner verspritzen, wäre die emotionale Verbundenheit zum Auto und zum Tempo 30 wohl eine andere. Dazu kommen bekanntlich ADAC, Verband der Automobilindustrie, die Industrie- und Handelskammern und so weiter: ein ganzes Netz von Beharrungskräften und Sinnstiftern, die einen beweglichen Blechhaufen von einem Artefakt zu einer kulturspezifisch praktizierten Technologie erheben. Weniger bekannt, doch grundsätzlich ähnlich finden sich solche Einbettungen für alle Technologien. Sie sorgen dafür, dass strukturelle Veränderungen, also nicht der Wechsel zum Bioethanol, wohl aber der Wechsel zum geteilten Auto oder gar zum öffentlichen Verkehr, abgewehrt werden, egal wie gut und vernünftig sie sein mögen. Neuerungen entwickeln sich daher oft in geschützten Nischen und nicht in direkter Konkurrenz. Ein prominentes historisches Beispiel ist der Übergang vom Segelschiff zum Dampfschiff. Die traditionellen Werften für Segelschiffe im Süden Englands sträubten sich im 19. Jahrhundert jahrzehntelang gegen den Technologiewechsel, sodass die damals neuen Dampfschiffe schließlich in neuen Werften im industriell unbedeutenden Nordosten Englands gebaut wurden.[15]Dass sich solche Geschichten wiederholen, zeigen die Beispiele der Hobbybastler und Atomkraftgegner, die die ersten Windräder und Solarzellen vor drei Jahrzehnten noch selbst gefertigt haben, als die Energieindustrie sich nicht weiter dafür interessierte.[16]
Der Blick in die Geschichte zeigt auch, dass die einzelnen ihrer Zeit vorauseilenden Entwicklungen sich schließlich selbst zu einem neuen soziotechnischen Regime verbinden können und verbinden müssen, um den Status quo herausfordern und ablösen zu können.[17]Das ist selbstverständlich kein Automatismus, sondern hängt maßgeblich von den politischen Bedingungen, von Möglichkeiten der Förderung und der Stärke der Antagonistinnen ab.[18]Im Falle von Energie sind das offensichtlich die bekannten Monopolisten, genauer gesagt:Oligopolisten, da sie ja bei aller Zentralisierung noch mehreresind: Eon, Endesa, Scottish Power usw. im Strom- und Gasmarkt,Texaco, BP, Shell,Gazprom,Chevron in der Öl- und Gasextraktion sowie die Atomindustrie vertreten zum Beispiel durch Energie de France oder Rosatom. Wenig verwunderlich, dass angesichts solch bewährter Gegenspielerinnen die Energiewenden nicht auf der Ebene offizieller nationalstaatlicher oder europäischer Energiepolitik frontal angreifen, wo ihre fossilen Widersacherinnen meist Teil der Staatsarchitektursind.
Energiewenden, zumal emanzipatorische, gibt es daher viel häufiger auf lokaler,subnationaler Ebene, wo wir gezielt gesucht haben. Dort wird erprobt, was morgen vielleicht schon in einer Region, einem Land oder in Europa funktionieren kann. Es scheint, dass die nationalen Energiepolitiken noch lange Zeit von fossilen Interessen dominiert sein werden und einige Energiewenden die vielen Hindernisse der nationalen Politik auf der subnationalen Ebene besser umgehen können. Das bedeutet natürlich nicht, dass die nationale Politik dem tatenlos zusieht, was sich exemplarisch zeigte am Votum der Großen Koalition für die sogenannte Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) – gegen die Einwände der Bundesländer.
Über Demokratie zu schreiben ist ein Wagnis, denn der Begriff ist ein leerer Signifikant. Je nach Standpunkt und Interesse wird er anders gefüllt. Bei aller Heterogenität der Interpretationen teilen wir jedoch die Position, wonach der gegenwärtige Zustand der parlamentarischen Demokratie in Europa und die Richtung ihrer Entwicklung als Postdemokratie und Postpolitik beschrieben werden können.[19]Wir haben uns gleichwohl für das Wort Demokratie entschieden, weil es unabhängig von der Zeitdiagnose ein Versprechen und eine Hoffnung auf die Veränderbarkeit bestehender, schlechter Verhältnisseund die Möglichkeit von Gerechtigkeit enthält.[20]Vor diesem Hintergrund sehen wir Energiedemokratie als normativen Begriff, der das Versprechen der Emanzipation vom schlechten Bestehenden in sich trägt.
Energiedemokratie wurde bisher in den sozialen Bewegungen als Kampagnenbegriff diskutiert.
So definiert die Osnabrücker Klimaallianz:
„Energiedemokratie bedeutet, gemeinsam ohne vorherrschende Profitinteressen über Weichenstellungen der Energiewende entscheiden zu können. Dazu gehören
1)weitgehende Dezentralität und Konzernunabhängigkeit,
2)Verteilungsnetze und Stadtwerke in kommunaler Hand (erste Modelle partizipativer Stadtwerke werden diskutiert),
3)moderierte, partizipative Foren zum Interessenausgleich,
4) gewerkschaftliche Mitbestimmung.“[21]
Und das Lausitzer Klimacamp 2012 einigte sich auf folgende Definition:
„Energiedemokratie bedeutet, sicherzustellen, dass jedeR Zugang zu genug Energie hat. Die Energie muss jedoch so produziert werden, dass sie weder Umwelt noch Menschen schädigt oder gefährdet. Das bedeutet konkret, fossile Rohstoffe im Boden zu lassen, Produktionsmittel zu vergesellschaftenund demokratisieren und unsere Einstellung zum Energieverbrauch zu ändern.“[22]
Beide Definitionen stellen starke Forderungen auf, an denen die gegenwärtige Situation im Bereich Energie gemessen werden kann. Da der geforderte Zustand nicht existiert, wir aber dennoch die ersten Schritte dahin beobachten und messen wollten, haben wir das Konzept Energiedemokratie noch weiter aufgeteilt in fünf idealtypische Dimensionen einer emanzipativen Energiewende: Beteiligung, Eigentum und Besitz, Wertschöpfung und Beschäftigung, Ökologie und Suffizienz sowie Emanzipation als explizite Politik. Im Folgenden werden die Dimensionen einzeln vorgestellt.
2.1.1Beteiligung
Beteiligung meint alle Formen, die Bürgerinnen auch zwischen den formalen Wahlen an wichtigen politischen Entscheidungen und Prozessen teilhaben zu lassen. Dieser Anspruch bedeutet für die Energieversorgung, vorund während neuer Projekte mitentscheiden zu können, was wo gebaut wird und was mit den erzielten Gewinnen geschieht. Inwiefern das jeweils der Fall war, haben wir anhand der formellen Strukturen der OrganisationundEntscheidungsfindung ermittelt, aber auch über die gelebte Beteiligungspraxis und das Selbstverständnis der dort Aktiven.
Von unserem Suchschema deutlich zu unterscheiden sind die oft anzutreffenden Formen von Pseudopartizipation: Am grünen Tisch wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit entschieden, danach gibt es einen „Bürgerdialog“, es wird „informiert“ und das Konzept „kommuniziert“, und vielleicht darf die Einzelne hier und da etwas sagen, ohne dass aber vorgesehen wäre, schon fertige Pläne ernsthaft zu verändern.[23]Dem steht die Idee der Selbstorganisation in Initiativen und Projekten gegenüber.[24]
Gemäß dem empirischen Charakter der Untersuchung werden die tatsächlich beobachtbaren Entwicklungen vorgestellt, die eine Verbesserung demokratischer Mitgestaltung oder sogar Selbstbestimmung bedeuten, sodass auch kleine und kleinste Partizipationsgewinne gezählt werden.[25]Es handelt sich um eine Darstellung des Ist-Zustandes von 2013/14 und damit um eine Verortung der aktuellen Praxis, nicht aber um einen Appell zur Bescheidenheit.
2.1.2Eigentum und Besitz
Die Frage von Mitentscheidungsmöglichkeiten wird auch durch Eigentumsverhältnisse bestimmt, die in vielen Beiträgen zur Energiewende und in der Transitionsforschung allgemein ausgeblendet bleiben. Wem gehören die Energieproduktionsanlagen, wer kontrolliert die Netze, wer vertreibt Strom und Wärme, wohin fließt der Profit und wieder:Wer bestimmt darüber? Die gegenwärtige Antwort für die meisten europäischen Länder lautet: wenige private Oligopole und in manchen Fällen staatliche Großunternehmen wie Vattenfall. Vattenfall, die baden-württembergische EnBW oder die österreichischen Elektrizitätswerke zeigen, dass Staatsbesitz allein weder ein soziales Tarifsystem oder die Freiheit von Korruption noch eine umweltfreundliche Energiewende garantiert.
Die Frage einer gerechteren Organisation von Eigentum und Besitz ist zweifellos so schwierig zu beantworten wie die nach besserer Demokratie. Ausgehend von der Prämisse, dass Eigentum und Besitz hochgradig fetischisierte soziale Verhältnisseund folglich – dennoch – in allerlei Richtung wandelbar sind,[26]haben wir nach Praktiken von Besitz und Eigentum gesucht, die Alternativen eröffnen, soweit dies gegenwärtig möglich ist.
Unserer Analyse liegt eine politische und normative Setzung zugrunde, die wir explizit ausführen möchten:Da die Energieversorgung alle Menschen als Konsumentinnen betrifft, sollte die Energieversorgung kollektiv und öffentlich statt partikular und privat organisiert sein. Wir sind allerdings skeptisch, ob der Verweis auf die Nationalisierung der wichtigsten Infrastrukturen schon eine erschöpfende Antwort auf die Frage gibt,wie genaudas Kollektivgut Energie zu gestalten ist.Nicht nur die zahlreichen Fälle von Stadtwerken, Wärme-, Gas- und Stromnetzen, die innerhalb einer Legislaturperiode, manchmal nur mit der Unterschrift einer Bürgermeisterin, verkauft und privatisiert wurden – oft genug zuungunsten der Nutzerinnen und Wählerinnen –, auch die verpasste oder blockierte Energiewende großer Staatsbetriebe spricht gegen traditionellen Staatsbesitz als einfache Lösung.[27]
Im Bereich Energie finden wir zwei praktizierte Alternativen: neue partizipative Formen kommunal-öffentlichen Besitzes und Genossenschaften. Während die Energiegenossenschaften in manchen Ländern schon weit verbreitet sind, steckt das Konzept eines erneuerten öffentlichen Besitzes vielleicht nicht mehr in den Kinderschuhen, aber doch noch in der Pubertät. Ein besonders ambitioniertes Vorhaben war das grüne und soziale Stadtwerk des Berliner Energietischs.
Stadtwerke Berlin, Deutschland
Genossenschaftliches, privates oder städtisches Eigentum
In Berlin wurde im Jahr 2013 heftig gerungen, wie die Versorgung mit Strom in den nächsten Jahrzehnten eingerichtet sein wird. Vier Möglichkeiten standen zur Auswahl. Erstens könnte alles so bleiben, wie es ist: Ein Monopolist, Vattenfall, besitzt und bewirtschaftet das Stromnetz und die größten Kraftwerke, die aus Kohle umweltschädlich Energie gewinnen. Zweitens könnte Berlin dahin zurückkehren, wo es schon einmal war: zu einem Stadtwerk, das zu 100 Prozent im Besitz der öffentlichen Hand ist, mit begrenzten Ambitionen, die verlorene erste Position auf dem Berliner Markt mit 100 Prozent Grünstrom zurückzuerobern.[28]Drittens könnte eine neue Genossenschaft, die BürgerEnergieBerlin (BEB), das Stromnetz übernehmen und dessen Betreiberin werden. Und schließlich, viertens, hätte der Energietisch den Senat per Volksentscheid fast zwingen können, ein soziales und ökologisches Stadtwerk zu gründen und in dem Zuge das Stromnetz wieder selbst zu bewirtschaften. Fast, denn das Volksbegehren ist am 3. November 2013 knapp gescheitert. 25Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten aus ganz Berlin waren nötig, damit der Text über das Stadtwerk automatisch Gesetzeskraft erlangt hätte. Gesammelt wurden immerhin 599.588 Ja-Stimmen, das waren 24,1 Prozent.[29]Obwohl die meisten Berlinerinnen den Vorschlag begrüßten und 83 Prozent der Teilnehmerinnen mit Ja gestimmt haben, wurde das Quorum ganz knapp verfehlt. Berlin wäre die erste Großstadt gewesen, die das ökologische und emanzipatorische Potenzial der Energiewende ausgeschöpft hätte.
Auch wenn daraus nun vorerst nichts wird, lohnt sich ein genauer Blick auf das Berliner Modell. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stadtwerken hätte die Energietischvariante eine Privatisierungsbremse enthalten. Ein Beirat, gebildet aus Konsumentinnen, Umweltausschuss des Senats und Arbeiterinnen des Stadtwerks, hätte die wichtigsten Entscheidungen treffen sollen. Ein abermaliges „Verramschen“ des Stadtwerks wäre, so die Kalkulation der Energietischlerinnen, durch die Konsumentinnen und Arbeiterinnen vereitelt worden. Ferner sollten die Konsumentinnen ein Drittel des Beirates stellen und sich im eigenen Interesse für sozial gestaffelte Energiepreise und gegen Energiearmut einsetzen. Die Bürgerinnen hätten ihre Stimme nicht mehr per Wahl an den Senat delegiert, sondern direkt für das Stadtwerk und seinen Beirat kandidiert und ihn gewählt. Der Beirat wäre keine Zierde, sondern höchstes beschlussfassendes Gremium gewesen, was ein großer Fortschritt im Sinne direkter Demokratie gewesen wäre. Zusätzlich wäre das neue Stadtwerk der Bekämpfung von Energiearmut und einer Vollversorgung mit ökologischem Strom verpflichtet gewesen.[30]Wie eine Umfrage zeigt, waren der sozial gerechte Stromtarif und das Element direkter Demokratie für 70 Prozent der Wählerinnen entscheidende Gründe für das Stadtwerk, noch vor ökologischen Gründen.[31]
Die Schritte zur Erarbeitung und Durchsetzung des Modells waren ebenso beispielhaft. Im sogenannten Berliner Energietisch haben sich soziale und ökologische Gruppen aus der Stadt zusammengeschlossen und alle zwei Wochen ihre Delegierten zur beschlussfassenden Vollversammlung ins Haus der Demokratie geschickt. Dort wurde das Modell weitgehend im Konsensverfahren erarbeitet und die Kampagne geplant.
Der Berliner Energietisch hat die noch junge gesetzliche Möglichkeit des Volksentscheids strategisch genutzt. Im Jahr 2012 konnten die Energietischlerinnen, unterstützt von Tausenden Freiwilligen, 30.000 und im Frühjahr 2013 nochmals 265.000 Unterschriften sammeln, womit der Volksentscheid herbeigeführt wurde. Daraufhin musste der Senat entscheiden, wann die Landeswahlleitung den Volksentscheid ansetzen soll. Auf Drängen der Berliner CDU wurde dafür nicht der Termin der Bundestagswahl am 22. September ausgewählt, sondern der 3. November. Am 22. September wäre das notwendige Quorum von 620.000 Wählerinnen wahrscheinlich so einfach erreicht worden wie in Hamburg, wo ein ähnlicher Volksentscheid am selben Tag erfolgreich war.
Die Aufgabe bestand daher weniger darin, die Mehrheit zu überzeugen, sondern ausreichend viele Menschen überhaupt am Sonntag in die Wahlkabine zu bringen. Die Kampagne dafür lief im Oktober 2013 auf Hochtouren, die Plakate des Energietischs hingen in vielen Stadtvierteln, Bündnis90/Die Grünen ließen ihre Plakate vom Bundestagswahlkampf absichtlich hängen, damit sie vom Energietisch überklebt werden konnten, und die Partei DIE LINKE hat ihre Plakate selbst mit Werbung für den Volksentscheid überklebt.[32]Wäre das Quorum genommen worden, wäre der Senat gesetzlich verpflichtet gewesen, das ökologisch-soziale Stadtwerk einzurichten und zu versuchen, das Stromnetz zu rekommunalisieren.
Nach der knappen Niederlage verbleibt als zweitbeste Alternative die Genossenschaft BürgerEnergieBerlin. Wir halten sie für eine Verbesserung, da auch sie kollektiver und demokratischer ist als ein privates Monopol. Ein Vorbild für die Synthese beider Konzepte ist die Kleinstadt Wolfhagen. Eine bürgerschaftlich getragene Genossenschaft hat ein Viertel des Stadtwerks über





























