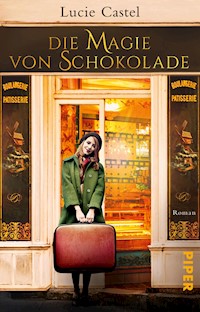8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausgerechnet an Weihnachten finden sich die Schwestern Scarlett und Mélanie eingeschneit am Londoner Flughafen wieder. Nachhause in die Bretagne werden sie es wohl nicht mehr schaffen. Doch dann lernen die beiden Willam kennen, einen perfekten englischen Gentleman, der sie in sein Haus in Kensington einlädt. Aber hier steht plötzlich Williams ganze englische Familie vor der Tür – der Auftakt zu einem völlig verrückten Weihnachtsfest, voll von gefühlsmäßigen Verwicklungen und tragikomischen Überraschungen, an dessen Ende sich wundersamerweise zwei Hände unter dem Mistelzweig finden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
© 2017 by HarperCollins France, Paris Die Originalausgabe erschien bei HarperCollins France, Paris Titel der französischen Originalausgabe: Pas si simple © 2018 für die deutschsprachige Ausgabe: Thiele Verlag in der Thiele & Brandstätter Verlag GmbH, München und Wien Covergestaltung: Guter Punkt, München Covermotive: © Alexey Fedorenko und © Julia Velychko Konvertierung: CPI books GmbH, Leckwww.thiele-verlag.com
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
We wish you a merry Christmas … and a happy new year!
KAPITEL 1
Mit einem wütenden Fußtritt öffne ich die Tür der Flughafentoilette. Ich meine wirklich wütend, denn ich befinde mich gerade mitten in einem Shakespeare’schen Drama. Ich hänge am Flughafen Heathrow fest, auf der anderen Seite des Ärmelkanals, wie es so schön heißt. Meine Schwester Mélie habe ich draußen auf dem Flur stehen lassen. Sie hat wild gestikuliert, um mir irgendetwas mitzuteilen, aber ich habe sie nicht beachtet. Seit sie mit fünf oder sechs Jahren vom Baum gefallen ist – sie wollte damals beweisen, dass ein Mensch nicht fliegen kann, obwohl die Menschheit dies schon seit der Erschaffung der Welt weiß –, hat Mélie eine ganz eigene Art zu kommunizieren, die nur sie selbst verstehen kann.
Ich trete also gegen die verdammte Tür und stürze zum Papierspender, um den Chai Latte abzuwischen, der mir über die enge weiße Jeans gelaufen ist. Zugegeben, es war nicht die beste Idee, für die Reise so helle Sachen mitzunehmen. Man könnte sagen, ich war geistig nicht ganz auf der Höhe, als ich beschloss, sie anzuziehen. Weißer Schnee, weiße Hose, das kam mir einfach passend vor. Jetzt wäre mir fast noch mein Smartphone auf den Boden gefallen. Ich kann sehr schlecht zwei Dinge auf einmal tun, deswegen schimpfe ich ins Telefon: »Ich habe keine Ahnung, Maman, es sind Engländer, und das sind merkwürdige Leute. Das Problem kommt vor allem daher, dass sie auf einer Insel leben. Wenn man so lange schon auf einer Insel lebt, dann richtet die zu enge Verwandtschaft zwangsläufig irgendwann Schaden an. Ich hatte den Eindruck, der Mann wusste, wovon er sprach, als er mir versicherte, dass die Flugzeuge bald starten. Wie meinst du das, ob er ehrlich wirkte? Verdammt, wie soll ich das wissen? Entschuldige, ich wollte nicht verdammt sagen … Nein, Sie machen immer dasselbe Gesicht, Maman! Ob sie in Panik sind, glücklich oder unglücklich … Wenn man wüsste, was in ihren Köpfen vorgeht, würde man bei sämtlichen Entscheidungen in Europa nicht dauernd auf der Stelle treten. Nein, ich halte keine Predigt, das ist reiner Sarkasmus, das ist etwas anderes.«
Na toll, nun redet sie auch noch vom lieben Gott, als ob der sich für den Flugverkehr interessieren würde! Meine Mutter stammt aus Italien. Sie hat die meiste Zeit ihres Lebens in der Bretagne verbracht, aber wenn es um Streit, emotionale Erpressung, die Fußballweltmeisterschaft oder Essen geht, ist sie eine zweihundertprozentige Italienerin. Diesmal, muss ich sagen, verstehe ich sie sogar. Es ist ein besonderes Datum, der 23. Dezember, es ist zehn Uhr morgens, und bisher weiß ich nicht, wann Mélie und ich darauf hoffen dürfen, nach Hause fliegen zu können. An jedem anderen Tag im Jahr wäre das nicht so schlimm, aber vor Weihnachten hat jede Verspätung gleich apokalyptische Ausmaße. Weihnachten ist in der Familie Archer heilig. Das war schon immer so, aber in diesem Jahr noch mehr als sonst, denn es ist das erste Weihnachtsfest ohne Papa. Wenn nicht alle aus unserer Familie – bestehend aus drei Leuten, abzüglich Hund und Kaninchen – bei der Feier zusammen wären, würde meine Mutter das nicht verschmerzen. Das ist vermutlich der Grund, weshalb sie jetzt nicht mehr bloß zweimal täglich, sondern fünfmal innerhalb von zwei Stunden anruft. Ihre ständige Telefoniererei hat übrigens auch dazu geführt, dass ich meinen Tee verschüttet habe, den ich mühsam nach langem Schlangestehen bei Starbucks ergattert hatte, und so musste ich in die erstbeste Toilette flüchten, die dieser Flughafen zu bieten hat.
An diesem stadtähnlichen, unübersichtlichen Ort mit den vielen Hallen, Ebenen und verschiedenen Fluren wimmelt es nur so von Reisenden, und es werden immer mehr. Nur auf der Toilette ist niemand. Die Leute haben große Angst, neue Hinweise über Start- und Landezeiten zu verpassen, sodass sie wie Fischschwärme vor den Anzeigetafeln verharren. Spätestens in zwei Stunden wird sich bei einigen von ihnen jedoch die Blase bemerkbar machen. Wer Glück hat, den wird die Natur erst in vier Stunden erwischen. Nur diejenigen, die nicht der Versuchung erlegen sind, ihre Langeweile mit dem Konsum von Getränken zu erschlagen, werden vor den Anzeigetafeln übrigbleiben. Na ja, was soll ich sagen? Ich habe gerade einen ganzen Chai Latte family size getrunken.
Meine Mutter redet noch immer. Ich habe es schon fast vergessen, so vertraut ist mir ihr Geplapper.
»Pass auf«, sage ich entnervt, »ich muss jetzt Schluss machen, mein Akku ist gleich leer. Ich rufe wieder an, sobald ich mehr weiß … Nein, ich weiche dir nicht aus, ich kann dir sonst wirklich nichts sagen … Was soll das heißen, und Cholera? Natürlich interessiert mich, wie es ihr geht. Nein, Maman, überhaupt nicht, ich dachte nur, das hat jetzt nicht die allerhöchste Priorität.«
Cholera ist unser Widderkaninchen. Ich hatte keine Ahnung, dass auch die Natur Humor hat, bis ich zum ersten Mal ein Widderkaninchen gesehen habe. Ich glaube, Mutter Natur hat sich eines Morgens gesagt: Wie wäre es, wenn ich ein Nagetier mit einer Trauerweide kreuze? Meine Mutter und meine Schwester sind die reinsten Tiernärrinnen, jede auf ihre Weise. Meine Mutter nennt die Männchen immer Rhett, nach dem Helden aus Vom Winde verweht. Das ist ihr Lieblingsfilm, und sie hat es so weit getrieben, dass sie meine Schwester und mich Scarlett und Mélanie genannt hat. Meine Schwester hingegen benennt Kaninchen am liebsten nach schweren, ansteckenden Krankheiten. Wir leben im Moment unter der Herrschaft von Rhett IV.und Cholera der Glückseligen, deren Vorgängerin Pest jung gestorben ist. Cholera hatte neulich eine kleine Operation: Sie haben ihr die Ohren gekürzt, damit sie besser laufen kann. Ich habe lange den grenzenlosen Fortschritt der Chirurgie unterschätzt. Und jetzt habe ich vergessen, danach zu fragen, wie es dem armen Tier geht. Wenn es eine Skala für diplomatisches Talent gäbe, befände ich mich ganz sicher im unteren Bereich.
Meine Mutter redet noch immer ununterbrochen auf mich ein. Ich komme nicht mehr dazwischen, die Sache ist gelaufen. Ich versuche es trotzdem, ich habe nämlich ein paar Argumente: Seit einem Monat arbeite ich in London an einem gigantischen Architekturprojekt, schlafe durchschnittlich vier oder fünf Stunden pro Nacht und stehe ziemlich unter Druck. Aber meine Mutter ist nicht zu beeindrucken. Also lege ich den Kopf in den Nacken, hole tief Luft – so tief, dass man denken könnte, dies sei mein letzter Atemzug –, sehe einen Moment in den Spiegel und fange an zu schreien.
Unweit von meinem Gesicht starrt mich ein anderes an. Das Gesicht eines Mannes. Unsere Blicke begegnen sich, und zwischen uns entsteht eine Atmosphäre wie kurz vor dem Show-down im Western. Nur das erstickte Geschrei meiner Mutter kann diesen Moment stören, in dem sich entscheidet, wer von uns beiden am richtigen Ort ist.
»Maman«, sage ich entschlossen. »Ich rufe zurück.«
Ich versuche souverän zu bleiben, ziehe die Augenbrauen indigniert hoch und sage auf Englisch: »Entschuldigung, aber ich glaube, Sie haben sich in der Tür geirrt.«
Er kneift die Augen zusammen und sieht mich einen Augenblick bewegungslos an wie ein Reptil. Ich schätze ihn auf um die dreißig.
»Verzeihen Sie die Frage«, antwortet er in perfektem Französisch, »aber ich wäre wirklich neugierig zu erfahren, wie Sie die hier benutzen.«
Er lächelt maliziös und weist auf eine Reihe von Pissoirs, die ich beim Hereinkommen wohl übersehen habe. Ich bin so verblüfft, dass ich zunächst kein intelligentes Wort herausbringe.
»Ich kann Ihnen ein paar Vorschläge machen, wenn Sie mögen«, sagt er mit einem breiten Grinsen.
Das Ganze scheint ihm Spaß zu machen, das ist immerhin etwas. So erlebt wenigstens er einen guten Moment.
»Als Sitze für Babys«, erkläre ich unverfroren. »Aber sie sind noch in der Testphase. Es fehlt der Sicherungsgurt. Das Ganze bedeutet jedenfalls einen enormen Zeitgewinn für Mütter, die ihre Kinder nicht allein lassen können, wenn sie auf die Toilette müssen.«
»Aha.« Er denkt eine Weile nach, und ich frage mich, wie gestört man sein muss, um sich auf die Herrentoilette zu verirren. Dann fällt mir auf, dass der Typ, der mir hier plötzlich in die Quere gekommen ist, verdammt süß ist.
»Aber wie kann man sicher sein, dass die Babys nicht gestohlen werden?«, fragt er jetzt, und seine Augen funkeln belustigt.
»Nun, an dem Gurt ist ein Schlüssel. Der Gurt ist allerdings noch nicht montiert, denn …«
»Es ist noch die Testphase.«
»Genau!«
Er nickt und trocknet sich die Hände ab.
Ich bleibe einfach stehen und weiß gar nicht, warum. Doch, in Wahrheit weiß ich es ganz genau. Aus purem Stolz.
»Sind Sie Architektin oder Anwältin?«, fragt er plötzlich.
Nichts als Klischees.
»Architektin.«
»Bitte sagen Sie, dass Sie nur in Frankreich Ihr Unwesen treiben.«
Ich zucke die Schultern, beschließe, diese merkwürdige Diskussion zu beenden, und murmele ein kaum verständliches »Auf Wiedersehen«.
Mélie wartet draußen auf mich, zur Salzsäule erstarrt, wie abwesend. Als sie mich sieht, scheint etwas in ihr zu erwachen und ihre Lebensmechanik wieder in Gang zu setzen. »Konntest du mir nicht sagen, dass ich mich in der Tür geirrt habe?«, rufe ich.
Da wiederholt sie die wilden Gesten von vorhin, als ich gerade dabei war, die Toilettentür aufzustoßen. »Das war doch deutlich genug«, sagt sie mit ihrer metallenen Stimme.
»Natürlich nicht! Wenn Gestikulieren ein gutes Kommunikationsmittel wäre, hätte man nicht die Sprache erfinden müssen. Das hier ist der Beweis dafür, dass die Menschheit sie dringend benötigt, um Nuancen auszudrücken.«
»Und die Gebärdensprache?«
»Äh, na ja, Taube oder Stumme haben eben nicht die Wahl.«
Während wir zur Halle von Terminal 5 gehen, rede ich weiter. »Da war ein Typ drin. Ich habe ihn gar nicht reinkommen sehen. Maman macht mich noch mal wahnsinnig.«
»Groß, schlank, elegant und verführerisch. Ganz normal, dass du ihn nicht bemerkt hast.«
»Ich verstehe die Logik nicht ganz.«
»Oh doch, das tust du.«
Meine Schwester ist Psychologin, Spezialgebiet Sexualwissenschaft. Warum ist sie bloß nicht Maskenbildnerin im Zirkus geworden, um traurige Clowns zu schminken, wie sie es wollte, bis sie fünfzehn war?
»Und dir ist nicht mal kurz durch den Kopf gegangen, in die Toilette zu gehen, um mir Bescheid zu sagen?«
»Was einem durch den Kopf geht, bleibt definitionsgemäß nicht darin, sondern bewegt sich durch ihn hindurch.«
»Super.«
Ich habe das Gefühl, dass dieser Tag nicht nur schlimm angefangen hat, sondern sich zur Katastrophe auswachsen könnte. Und was das angeht, sollte man sich immer auf seine Eingebung verlassen.
KAPITEL 2
Als wir die Halle erreicht haben, suche ich in der riesigen Menschenmenge nach einem Platz, an dem wir unser Lager aufschlagen können. Etwas sagt mir, dass die Warterei erst jetzt so richtig beginnt. Offensichtlich kann der Homo scientificus imaginatus mit ein paar Schneeflocken umgehen, aber nicht mit einer Invasion von Schneeflocken. Sobald ein bestimmtes Volumen überschritten wird, erinnern Flugzeuge plötzlich an französische Züge, wenn Streik ist: Sie stehen einfach herum. Vor einer halben Stunde wurde uns mitgeteilt, dass alle Flieger Verspätung haben. Seitdem werden immer neue Verspätungszeiten angezeigt. Fünf Minuten, zehn Minuten, eine Stunde.
Ich sehe die starren Gesichter der Reisenden, die alle in dieselbe Richtung schauen: auf die Anzeigetafeln. Von weitem sieht es so aus, als würden die Mitglieder einer Sekte auf ihren Guru warten. Mir läuft ein Schauer über den Rücken, denn der Guru sagt seit einiger Zeit nichts mehr, und das ist ein schlechtes Zeichen. Der Vorteil ist, dass die Leute sich eher in die Mitte der Halle begeben und so Sitzplätze frei werden. Ich entdecke zwei, gleich links. Ich fasse meine Schwester an der Hand und ziehe sie hinter mir her. Wir haben Glück: keine Familie in der Nähe, also keine Kinder, die überall herumlaufen und plärren. Auf der einen Seite sitzen eine Reihe von Geschäftsleuten, manche von ihnen hinter einer Zeitung verschwunden, und auf der anderen eine Gruppe Senioren. Geografisch betrachtet ist dieser Platz perfekt. Man braucht sich nur ein bisschen zur Seite zu beugen, um die Anzeigetafeln zu sehen. Mélie und ich stellen unsere Taschen als Schutzmauer auf und lassen uns auf den Sitzen nieder. Mein Handy klingelt. Ich schaue meine Schwester an, und die nickt zustimmend. Ich warte, bis die Mailbox anspringt, auch wenn ich weiß, dass keine Nachricht hinterlassen wird. Eine Viertelsekunde später klingelt es bei Mélie.
»Ja, Maman«, antwortet sie im Ton eines Spracherkennungsautomaten. »Wo Scarlett ist? Auf der Toilette. Ja, immer noch. Maman, ich weiß nicht, was sie für ein Problem hat. Die Toiletten in Heathrow sind sehr groß, wahrscheinlich fühlt sie sich wohl dort, sie braucht doch immer viel Raum.«
Ich bin mir sicher, dass meine Augen gleich aus den Höhlen treten. Ich kann nicht umhin zu flüstern: »Ja, hau mich nur in die Pfanne!«
»Kannst du das noch mal sagen, Maman? Da ist so ein Störgeräusch. Keine Ahnung, woher es kommt.«
Mit den Lippen forme ich ein lautloses »Ich hasse dich«, und Mélie versteht es sofort.
»Wie geht es eigentlich Cholera? Heilen ihre Ohren? Ja? Sie kann problemlos laufen? Das ist ja wunderbar. Keine Sorge, auch wenn sie nicht fragt, wie es ihr geht, macht sie sich doch Gedanken. Sie hat einfach gerade sehr viel im Kopf.«
Großartig! Nun machen mir schon zwei Leute Vorwürfe wegen der Ohren dieses verfluchten Kaninchens.
»Ach, ich glaube nicht, dass wir hier noch lange festhängen, Maman«, behauptet Mélie für meinen Geschmack etwas zu selbstsicher. »Die schlimmsten Verspätungen dauern doch höchstens zwei Stunden. Bis Heiligabend ist ja noch Zeit; ich muss jetzt Schluss machen, mein Akku ist gleich leer. Ja, Maman, in Ordnung, ich sage ihr, dass sie ruhig atmen soll.«
Ich verdrehe die Augen. Meditieren, Yoga und Emotionskontrolle sind für mich ein rotes Tuch, als wäre ich allergisch gegen jede Art von Gefühlsbändigung.
»Du sollst ruhig atmen«, erklärt Mélie, nachdem sie aufgelegt hat.
»Ich bin doch ruhig. Dieses Atemprogramm ist etwas für Krisensituationen.«
»Nun ja … Nachdem Bruce Banner Hulk geworden ist, denkt er auch nicht mehr daran, dass er sich jetzt beruhigen sollte.«
»Träume ich oder vergleichst du mich gerade mit einem grünen Riesen, der alles, was ihm begegnet, zerstört und wie wild brüllt?«
»Du träumst nicht.«
Ich seufze und durchsuche unsere Taschen nach etwas Essbarem. Während ich noch vornübergebeugt darin herumwühle, höre ich, wie sich ein Mann an meine Schwester wendet: »Ich habe einen Ersatzakku, wenn Sie möchten.«
Es ist der Typ aus der Toilette!
»Sieh mal, Scarlett, das ist der Mann, der in der richtigen Toilette war.«
Ach tatsächlich …
»Na, wunderbar, großartig.«
Ich richte mich wieder auf und lächele derart verkrampft, dass ich fast meine Zähne knirschen höre. Wenn ich so weitermache, fallen mir noch welche aus.
»Das ist wirklich sehr nett von Ihnen«, ermutigt meine Schwester den Fremden, verrückt wie sie ist. »Ich heiße übrigens Mélanie Archer, und das ist meine Schwester Scarlett. Sie weiß Ihr Angebot auch sehr zu schätzen, auch wenn sie es nicht so zum Ausdruck bringen kann. Sie hat ihre Emotionen gerade nicht so im Griff, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Warum ist sie damals bloß auf den verdammten Baum geklettert?
»Ich finde auch, dass wir jetzt unbedingt über mein Sternzeichen und die Ergebnisse meiner letzten Urinuntersuchung reden sollten, dann wissen Sie alles«, gebe ich schnippisch zurück.
»William Hill«, stellt er sich vor, und das belustigte Lächeln, das seine Lippen umspielt, gibt seinen unbewegten Zügen etwas Menschliches. »Ich bin Zwilling, und wegen Ihrer Ergebnisse: Ich empfehle Bluetooth, das geht schneller als das Flughafen-WLAN.«
William! Oh mein Gott, er ist Engländer!
»Sind Sie Brite?«
»Bis ins Mark, fürchte ich, aber wir haben uns ein bisschen gemischt, um die zu nahe Blutsverwandtschaft zu mildern. Meine Großmutter ist Französin.«
Ganz ruhig atmen, Scarlett. Jetzt ist tatsächlich der richtige Augenblick dafür gekommen.
»Also, wegen dem, was ich vorhin am Telefon über die Engländer gesagt habe …«
»Entschuldigung angenommen.«
»Ich wollte mich gar nicht entschuldigen!«
Wenn es um bissige Bemerkungen geht, bin ich unschlagbar.
»Doch, das wollten Sie.«
»Die Kommunikation zwischen euch funktioniert ja bestens«, mischt sich Mélie munter ein, »das ist sehr gut, denn wir werden eine ganze Weile gemeinsam warten müssen.«
Ich werfe ihr einen drohenden Blick zu. Ich tue das regelmäßig, seit ich zwölf bin, aber es hat noch nie etwas bewirkt.
»Hör auf, Mélie, male nicht den Teufel an die Wand, das bringt nur Unglück.«
»Tja, zu spät«, sagt sie in apokalyptischem Ton und deutet auf etwas vor ihr.
Ich folge mit den Augen ihrem Finger, der auf die Infotafel zeigt, und mir fährt der Schreck in die Glieder. Bei allen Abflügen steht jetzt statt »verspätet« »auf unbestimmte Zeit verspätet«. Der Teufel steckt im Detail.
»Darf ich Ihnen einen Tee anbieten?«, fragt William lächelnd. Auf seinem Gesicht liegt der zufriedene Ausdruck einer Katze, die vor einem Wollknäuel sitzt.
KAPITEL 3
Ich lege meine Füße auf das Bordcase meiner Schwester – für einen Moment fühlt es sich tatsächlich so an, als säße ich in einem Stressless-Sessel – und starre auf die Anzeigetafel, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Nach dem Wirbel, der durch den Hinweis »unbestimmt« entstanden ist, steht die Menge noch immer unter Schock. Ich auch. Ich glaube zwar nicht, dass wir zu spät zu den Weihnachtsvorbereitungen kommen, aber ich weiß, dass Maman das Schlimmste befürchtet. Das ist typisch für sie: immer an das Schlimmste denken, das passieren könnte, nie an das Beste, weil es offenbar Unglück bringt, wenn man glaubt, dass etwas gut gehen könnte. Als würde Optimismus die kosmischen Kräfte beleidigen.
Mélie ist gerade auf der Suche nach einem menschlichen Wesen, das am Flughafen arbeitet, um mehr über das sibyllinische Wort »unbestimmt« zu erfahren, das alle Leute so fertigmacht. Sie ist nicht die Einzige, die diese Idee hatte. Ich bin sicher, so schnell kommt sie nicht wieder. Ich habe ihr diese Aufgabe gern überlassen, denn Diplomatie ist nicht meine Stärke. Mélie verbringt ihre Zeit damit, Frauen davon zu überzeugen, dass sie sexuelle Lust erlernen können, und Männer, dass sie ihre Erektion gedanklich steuern können. Wenn das nicht die pure Überzeugungskraft ist, frage ich mich, was es sonst sein soll. Meine Schwester hat mir immer vorgeworfen, mein Urteil über ihren Beruf sei zynisch. Ihrer Meinung nach kommt das daher, dass ich von Geburt an in Sachen Liebe verklemmt bin, als wäre meinem DNA-Code etwas Kleingedrucktes hinzugefügt worden. Ich hingegen würde es nicht verklemmt nennen, sondern eher enttäuscht. Angesichts der Oberflächlichkeit der meisten zwischenmenschlichen Beziehungen bin ich tatsächlich desillusioniert. Liebesbeziehungen gehören dazu, und ich sehe keinen Grund, sie anders zu beurteilen. Natürlich gibt es auch schöne Geschichten – Bücher und Filme können es uns gar nicht genug glauben machen. Ich bin aber überzeugt, dass nicht alle für solche Geschichten geschaffen sind. Ich bin es jedenfalls nicht.
Etwas neben mir bewegt sich und unterbricht meine Überlegungen. William hat seine Zeitung wieder zusammengefaltet, und sein durchdringender Blick richtet sich nun auf einen bestimmten Punkt. Er hat ein geradezu royales Profil. Dieses besondere Erscheinungsbild mancher Engländer, an dem man die ganze Geschichte ihres Königtums ablesen kann, ist mir schon öfter aufgefallen. William ist groß und schlank, was hilfreich ist, wenn man mit Schwung und Eleganz einen Anzug tragen will. Seine Augen sind dunkel, sein Haar ist von hellem Kastanienbraun, mit einigen fast goldbraunen Strähnen, woran man erkennen kann, dass er aus dem Norden stammt. Er achtet auf sich, und wie er auf andere wirkt, scheint ihm wichtig zu sein. Alles sitzt perfekt. Sein Haarschnitt ist frisch, er ist ordentlich rasiert, und an seinem Anzug sieht man kein Fältchen. Er muss offenbar immer alles unter Kontrolle haben. Genau wie ich. Wenn es einem gelingt, sein Aussehen im Griff zu haben, läuft alles andere wie von selbst. Ich will nicht leugnen, dass er ziemlich attraktiv ist. Aber Schönheit und die Art, wie sich jemand bewegt, sind zwei Dinge, denen ich nicht zu viel Bedeutung beimessen will, denn sie sind manchmal trügerisch.
Warum starrt er mich so an?
»Alles in Ordnung?«
Ich weiß nicht, warum ich ihn das frage. Wir kennen uns schließlich kaum.
»Mögen Sie Theater?«, fragt er in entspanntem Ton.
»Ja schon, na ja, es kommt darauf an. Wenn drei Stunden lang antiquiertes Englisch gebrüllt wird, dann sind für mich, das gebe ich gern zu, die zwei Stunden fünfzig Minuten nach Beginn der Vorstellung ohne Aspirin ziemlich schwierig.«
»Das liegt daran, dass Sie von zarter Konstitution sind«, entgegnet er, und bevor ich etwas antworten kann, fährt er fort. »Wie sieht es mit Vaudeville aus? Ein Volksstück mit Improvisation, und im Hintergrund ein soziales Drama?«
Wovon redet der bloß?
Gut reden kann er, dass muss man ihm lassen. Seine ernste Stimme, die bestens mit seinem englischen Pass harmoniert, und seine tadellose Aussprache ergeben eine Art zu reden, die nicht weniger hypnotisierend ist als die Schlange auf dem Baum im Garten Eden oder ein Versicherungsagent.
»Irgendwann verstehe ich sicher, was Sie meinen, aber im Moment schwimme ich ein bisschen.«
»Ich spreche von dem, was sich gerade vor unseren Augen abspielt, dort …«
Er zeigt auf eine Gruppe von Menschen, die uns gegenübersitzt. Eine Familie, bestehend aus einem Paar unter dreißig und vier kleinen Kindern. Der Mann und die Frau sehen sich ähnlich, sie sehen aus wie zwei frischgebackene goldbraune Brioches. Die Kinder hüpfen herum, als hätten sie Drogen genommen. Die Eltern wirken müde und überfordert, und an ihren Blicken sehe ich, dass ihnen von vier Kindern mindestens drei zu viel sind. Auf der anderen Seite das genaue Gegenteil. Eine junge Frau, die direkt einem Modejournal entsprungen zu sein scheint, und ein Mann, offenbar ihr Freund, der aussieht wie ihr metrosexuelles Gegenstück. Ihre Gepäckstücke stammen alle von demselben bekannten Luxuslabel, ebenso wie ihre Kleider. Sie erinnern mich an die Sandwich-Leute, die Werbeplakate für eine bestimmte Firma durch die Straßen tragen. Die beiden Sippen sind wie Wasser und Öl, ganz nahe beieinander, aber sie vermischen sich nicht. Jetzt verstehe ich, was William mir sagen will. Die junge Mutter hat gerade eines ihrer Kinder bewaffnet. Wie konnte sie nur! Sie hat ihm einen riesigen Orangensaft gegeben. Der Becher ist fast halb so groß wie der kleine Engel.
»Ich wette, der süße Troll schafft es.«
Ich weiß aus eigener Erfahrung: Je kleiner sie sind, desto hartnäckiger sind sie.
»Ich glaube, Sie unterschätzen die Gazelle mit den manikürten Händen«, antwortet er mit der Selbstsicherheit eines Buchmachers, der das Wettgeschäft wie seine Westentasche kennt.
Mein Herz schlägt schneller, ohne dass ich weiß, warum.
»Wenn sie in der Serengeti herumliefe, wäre Ihre Gazelle in der Nahrungskette nicht gerade weit oben. Vielleicht knapp über dem Springhasen.«
»Sie sind eine Liebhaberin von Tierreportagen?«
»Und mit Schlafstörungen geschlagen. Sie auch?«
»Als Sharkuran, die jüngste Hyäne im Rudel, von ihrer eigenen Schwester verraten und verbannt wurde, habe ich zwei Wochen gebraucht, um mich davon zu erholen. Sie war unschuldig.«
Ich starre ihn an. Auf seinem schmalen Gesicht ist keine Regung zu sehen. Ich weiß, dass er scherzt, er wirkt dabei aber so seriös und cool, dass ich anfange, daran zu zweifeln.
»Eine neugierige Frage: Schlafen Sie schlecht, weil Sie einen stressigen Beruf haben, oder sind Sie einfach ein Serienmörder, der meistens nachts unterwegs ist?«
Ich nehme wieder dieses Funkeln in seinen dunklen Augen wahr. Ich weiß nicht, ob ich es angenehm oder beunruhigend finde.
»Ich habe eine Kunstgalerie in London.«
»Ach tatsächlich, wo denn?«
Ich zeige wahrscheinlich zu viel Interesse. Meine spontane Art hat sich schon oft als Nachteil erwiesen.
»Unweit der Oxford Street.«
Verdammt gute Adresse.
Jetzt ist mir klar, warum er einen so gut geschnittenen Anzug trägt.
»Vorsicht, in die Serengeti kommt Bewegung«, verkündet er.
Ich wende mich den beiden Familien zu und sehe so etwas wie ein Attentat. Der kleine Troll will sich an seiner Schwester rächen wegen eines in seinen Augen ungeheuren Verbrechens und ahnt dabei nicht, welche Gefahr droht. Dann plötzlich der Sturz. Er bleibt an den Rollen eines der Koffer hängen, und ich beobachte, wie der riesige Becher, einer Duschgel-Werbung gleich, in Zeitlupe durch die Luft fliegt. 2,7 Sekunden später – ich will exakt sein wegen des Polizeiberichts, den es hinterher ganz sicher geben wird – breitet sich der Inhalt des Bechers auf der gesamten Kollektion kostbarer Gepäckstücke aus. Es erfolgt eine unheilvolle Sekunde, in der die Zeit stehen bleibt. Dann ertönt durchdringendes Geschrei. Die Gazelle mit den Louboutins hat zwar keine Reißzähne, dafür aber eine kräftige Stimme. Und das Drama nimmt seinen Lauf. Die Männer der beiden Sippen fühlen sich auf den Plan gerufen einzugreifen, die beiden Frauen werfen sich Beschimpfungen an den Kopf.
Gerade als mein Sitznachbar mir ein englisches Slang-Wort erklärt, das ich nicht verstanden habe, kommt meine Schwester wieder. Offenbar hat das Schimpfwort etwas mit einer Ziege zu tun. Ich frage Mélie sofort, wie der Stand der Dinge ist.
»Und?«
»Ich weiß nicht, was da gerade passiert, aber alle scheinen ziemlich gereizt zu sein«, antwortet sie seufzend.
Mit fällt auf, dass William sie genauso ansieht wie ich.
»Mélie, hast du die Sache nicht mitgekriegt, oder was? Alle Flüge sind auf unbestimmte Zeit verschoben.«
»Warum sagst du mir das? Das weiß ich doch, aber ich sehe keinen Zusammenhang mit der Aggression der Leute.«
Der Sturz, der verdammte Sturz vom Baum.
»Egal, hast du etwas herausbekommen können?«
»Worüber?«
»Darüber, wie lange die Verspätung dauert.«
»Nein.«
Ich lasse alle Luft aus meiner Lunge entweichen.
»Ich weiß nur, dass sich der Scheesturm voraussichtlich am Nachmittag beruhigt und am frühen Abend alle Flüge starten können.«
»Das heißt, wir warten hier bis heute Abend?«
»Ja.«
Ich stütze mein Kinn auf und denke eine Weile nach. Dann frage ich: »Hat jemand eine Idee für einen Plan B?«
»Wir könnten versuchen, vom Bahnhof St. Pancras aus den Eurostar zu bekommen«, schlägt William vor. »Ich sehe mal nach, welche Züge noch fahren.«
Ich werfe meiner Schwester einen Blick zu; ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde, dass er uns in seinen Plan B einschließt. Einerseits finde ich es amüsant, dieses Abenteuer mit ihm fortzusetzen, andererseits bin ich mir nicht sicher, ob es mich stört, ihn länger in meiner Nähe zu haben.
»Vergessen wir den Plan B. Bis zum 3. Januar ist alles ausgebucht. Plan C also.«
»Plan C?«, fragt meine Schwester. »Es gibt doch immer nur einen Plan B.«
»Ich fürchte, wir müssen diese Tradition durchkreuzen«, entgegnet William in liebenswürdigem und, wie ich finde, aufrichtigem Ton, der mich fast rührt; nicht alle Menschen sind aufgeschlossen genug, um mit meiner Schwester zu diskutieren.
Plötzlich habe ich eine Idee.
»Also gut, wenn wir den Ärmelkanal weder in der Luft noch unter Wasser durchqueren können, dann bleibt uns nur noch, übers Meer zu fahren.«
»Mit der Fähre? Ich sehe nach, ob es noch Schiffe gibt«, sagt William.
»Sehr nett von Ihnen«, meint meine Schwester. »Ihre Reise muss ja sehr wichtig sein, wenn Sie sie nicht aufschieben können.«
»Ich will einen Künstler treffen und mit ihm einen Exklusivvertrag abschließen. Ich weiß, dass andere Galerien auch an ihm dran sind. Wenn ich es verschiebe, bekommen meine Konkurrenten den Vertrag. Wenn es nötig wäre, würde ich sogar nach Frankreich schwimmen. Aber das möchte ich vermeiden, auf hoher See bin ich kein guter Schwimmer, und bei bedecktem Himmel, also im Winter und in einem solchen Schneesturm …«
Ich kann nicht anders, als zu sagen: »Sie sind also eher der Typ Mimose.«
»Ich bin Engländer. Nicht durchdachte und riskante Manöver überlassen wir gerne den Deutschen und den Franzosen.«
Volltreffer. Ich sehe so unbeteiligt wie möglich in seine Richtung.
»Na, was sagt das Smartphone-Orakel?«
»Dass es am 25. um acht Uhr morgens eine Fähre gibt.«
»Und vorher nichts?«, fragt Mélie. »Zum Beispiel am 24.?«
»Ich fürchte, da gibt es überhaupt nichts.«
Meine Schwester und ich tauschen einen verzweifelten Blick. Der 25. ist definitiv zu spät für das Herz unserer Mutter.
»Hat die Stewardess dir zugesichert, dass es gegen Abend wieder Flüge gibt?«
»Ja, sie hat gesagt, diese Art Unwetter würden meistens nur ein paar Stunden dauern.«
»Na gut, jetzt ist es zehn nach elf. Also müsste der Himmel bis heute Abend frei sein.«
Ich versuche mir das selbst einzureden, denn ich kenne mich mit Meteorologie nicht aus. Eigentlich beweist diese ganze Misere, dass sich niemand so richtig auskennt. Alle tun nur so.
»Na gut«, sage ich entschieden, »lasst uns Tickets für die Fähre reservieren, für den Fall, dass die Flugzeuge heute nicht mehr starten. Wenn alles gut geht, haben wir ein bisschen Geld verloren und unsere Mutter vor einem Infarkt und unheilvollen göttlichen Kräften bewahrt.«
Wir beschließen, Fahrscheine von Dover aus zu nehmen. Ich bin noch nie mit dieser Fähre gefahren, bis heute habe ich gar nicht daran gedacht, dass es sie überhaupt gibt. Da ich mich auf der Website nicht zurechtfinde, beugt sich William zu mir herüber und zeigt mir, wie ich auf den Link zur Ticketreservierung komme. Er riecht nach Vetiver und Zedernholz. Ich sehe die Kontur seines Kiefers und seine leicht vorspringenden Wangenknochen. Er muss sich herunterbeugen, denn ich bin viel kleiner als er. Würde in unserem Rücken die Sonne scheinen, wäre ich durch seine breiten Schultern im Schatten. Sein Arm berührt den meinen leicht, und mein Herz schlägt etwas schneller. So schnell jedenfalls, dass ich es bemerke. Aus dem Augenwinkel nehme ich seinen Oberkörper wahr, dessen Form ich unter dem offenen Sakko und dem eng sitzenden Hemd erahne. Ich bin abgelenkt, für ein paar Sekunden.
»So, Mélie, wir haben die Tickets. Du kannst es Maman mitteilen.«
»Ich bin schon beim letzten Anruf drangegangen«, sagt sie abwehrend.
»Ja, aber ich habe die Tickets gekauft.«
»Ich habe dafür mit der Stewardess geredet, und sie war wirklich ätzend.«
»Und ich habe alles im Internet gesucht«, wirft William ein. »Ich bin nicht sicher, ob ich die Spielregeln verstanden habe, aber ich finde es lustig.«
Ich seufze.
»Sagt mal«, fragt meine Schwester, »könnt ihr mir vielleicht erklären, warum zwei Frauen neben einem Haufen Louis-Vuitton-Koffer versuchen, einander die Haare auszureißen?«
»Das ist das Gesetz der Natur, Mélie, und es ist grausam. Ich habe auf den Troll gesetzt, du kannst dir deinen Favoriten noch aussuchen.«
»Übrigens, ich stelle fest, dass meine Gazelle dabei ist zu gewinnen«, verkündet William triumphierend.
Diese verdammte natürliche Auslese.
KAPITEL 4
Wie alle anderen, die inzwischen seit mindestens fünf Stunden in Heathrow festsitzen, warten wir darauf, dass ein meteorologisches und technisches Wunder geschieht. Das Flughafenpersonal hat uns auf hinterhältige Weise in ständiger Spannung gehalten: Die Flieger starten nicht, es könnte aber jederzeit losgehen. So bleiben wir da, wo wir sind, und geben die Hoffnung nicht auf. Manche Reisende haben überlegt, ob sie nach London zurückkehren sollen, doch die Angst, dass auch der Shuttle nicht fährt, ist zu groß. Ich habe den Eindruck, dass die Menschenmenge in unserer Halle nicht weiter wächst. Die Nachricht, dass sämtliche Flüge gestrichen wurden, muss die Leute erreicht haben, bevor sie losgefahren sind, und sie haben keinen Fuß vor die Tür gesetzt. Die Glücklichen!
»Ich würde jetzt gern chinesische Nudeln essen«, sagt Mélie. Sie hat einen ausgeprägten Hang zu plötzlichen Äußerungen ohne jeden Zusammenhang.
»Gute Idee«, meint William zustimmend, es bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig, denn Mélie sieht ihn durchdringend an.
Ich seufze erneut, und die beiden glauben, das bedeute Zustimmung. Nicht dass mich das stören würde, aber eigentlich tut es das doch. Ich kann mich gerade selbst nicht leiden. Seit heute Morgen bin ich genervt, weil wir das Hotel nicht rechtzeitig verlassen haben. Dann kam noch die Nachricht hinzu, dass die Flüge auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Ich bin wütend. Ich mag es, wenn die Dinge klar und kohärent sind, aber wenn ich William ansehe, weiß ich nicht, was mit mir los ist. Etwas anderes macht meinem Ärger Konkurrenz. Und das gefällt mir nicht. Ich hasse mich dafür, dass ich ihm immer wieder in die Augen schaue und mich frage, wie sie nur so dunkel sein können. Also wirklich, manchmal sieht man ja wenigstens noch die Pupille und kann sich eine Vorstellung von jemandes Gedanken und Launen machen. Aber in seinen Augen erkennt man gar nichts; es sind zwei schwarze Murmeln, die intensiv leuchten, einen ansehen und auseinanderzunehmen scheinen. Jedenfalls habe ich dieses unangenehme Gefühl. Was sieht er von seinem Platz aus? Ich weiß nicht, ob ich es gern wissen würde, oder ob ich darum bete, dass ihm seine Macht nicht bewusst ist. Ich muss zugeben, dass diese Begegnung fast einem kleinen Wunder gleicht. Normalerweise bin ich nämlich nicht sehr umgänglich und eindeutig sexistisch, was dazu führt, dass die meisten Männer im besten Fall Gleichgültigkeit in mir hervorrufen, im schlechtesten Fall tiefe Traurigkeit. Sie können nichts dafür. Es liegt an meiner Art, sie zu sehen. Meine Schwester sagt mir, die eigenen Fehler würden nicht dadurch gemildert, dass man sie anerkennt. Das ist falsch. Einmal hat ein Weiser oder ein umherirrender Mönch gesagt: »Zugegebene Fehler sind schon halb vergeben.« Wenn wir also gerade schon dabei sind, will ich ganz offen sein: Frauen mag ich kaum mehr.
Da ich aber an die Kraft weiblicher Solidarität glaube, gebe ich mir Mühe.
Und jetzt geschieht tatsächlich ein Wunder. Ich habe keine Lust, William seine schönen, seltsam schwarzen Augen auszukratzen, und ich verdrehe auch meine Augen nicht, und ich kommentiere seine Worte nicht mit einem spöttischen »Ach wirklich?«. Tief in meinem Innern gefällt mir die Vorstellung, hier mit ihm auf unbestimmte Zeit abgemalt zu sein. Und dieses Gefühl macht mich nervös.
Wir sitzen inzwischen an den riesigen rechteckigen Tischen des Restaurants Wagamama, und meine Schwester hat mich geschickt neben William platziert. Mélie ist mit meinem Gehirn vernetzt und weiß bestens Bescheid über die Fragen, die ich mir stelle. All das amüsiert sie zweifellos. Aber das liegt in ihrer Natur. Kleine Schwestern werden nur geboren, um die älteren Geschwister zu ärgern.
»Erzählen Sie mal«, sagt William und wendet sich mir zu, »an welchem Architekturprojekt arbeiten Sie denn gerade in London?«
Ich reiße die Augen auf, und diese Reaktion scheint ihn zu verwirren.
Ende der Leseprobe