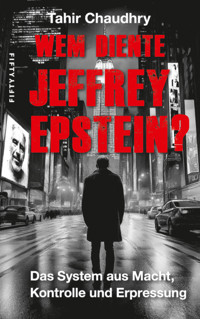
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: fifty fifty Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am Morgen des 10. August 2019 wird Jeffrey Epstein in seiner Gefängniszelle eines New Yorker Hochsicherheitstraktes tot aufgefunden. Offizielle Todesursache: Suizid. Seitdem ranken sich wilde Spekulationen um den Tod Epsteins. Denn sein Einfluss reichte bis in die höchsten Kreise von Politik, Wirtschaft und Kultur. Epstein war weit mehr als ein millionenschwerer Sexualstraftäter, der bewiesenermaßen diesen Kreisen auch minderjährige Sexualpartner zuführte. Dieses Buch berichtet ausführlich davon, dass Jeffrey Epstein nicht nur seinen persönlichen Neigungen nachging, sondern als Werkzeug für die mächtigsten Akteure unserer Zeit diente.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ebook Edition
Inhalt
Cover
Vorwort
1 Der Honigfallenleger
Quellen
2 Insel der Sünde
Quellen
3 Kleines Haus, große Träume
Quellen
4 Ein rätselhafter Finanzjongleur
Quellen
5 Der goldene Käfig
Quellen
6 Die letzten Züge
Quellen
7 Tödliches Geheimnis
Quellen
8 Lady Ghislaine
Quellen
9 Robert Wexstein
Quellen
10 Wexners Dämonen
Quellen
11 Freunde, Komplizen und Mitwisser
Quellen
Nachwort
Quellen
Dank
Orientierungsmarken
Cover
Inhaltsverzeichnis
Tahir Chaudhry
Wem diente Jeffrey Epstein?
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN: 978-3-946778-40-0
1. Auflage 2024
© Fiftyfifty Verlag Imprint der Buchkomplizen GmbH, Siemensstr. 49, 50825 Köln
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Das Buch ist meiner Mutter gewidmet, die mir als Kind Geschichten von Menschen erzählte, deren Mut, Wahrhaftigkeit und Standhaftigkeit beispiellos waren, wie die eines Mannes, dem die Elite des Landes mit dem Tod drohte. Sie boten ihm Reichtümer, hohe Ämter und schöne Frauen an, wenn er nur aufhören würde, die Wahrheit zu verkünden. Doch der Mann antwortete mit Tränen in den Augen: »Bei Gott, selbst wenn sie mir die Sonne in die rechte Hand und den Mond in die linke Hand legten, würde ich nicht von dieser Sache ablassen.«
»Sie sollten sich immer daran erinnern, dass zwei plus zwei gleich vier ist. Seien Sie also vorsichtig. Epstein ist ein schwarzes Loch!«
Seymour Hersh, 87, Reporter-Legende, Pulitzer-Preisträger, arbeitete für die New York Times und Washington Post, veröffentlichte vielbeachtete Recherchen über den Vietnam-Krieg, den Watergate-Skandal und zur Iran-Contra-Affäre.
Vorwort
Ich war ein Großhai, der in seinem Becken kleine Haie herangezüchtet hat, die alle selbst groß und gierig werden wollten. Ich war ein Finanz-Multi-Unternehmer, der mehr als 25 Jahre lang die Vermögen von Konzernen und Superreichen verwaltet hat. Zählen, rechnen, riskieren, optimieren, kaufen und verkaufen – im Geschäft der Geldvermehrung hatte ich eine nahezu intime, fast schon freundschaftliche Beziehung zu Geld. Man häuft es an, hegt und pflegt es, bis es Kinder bekommt. Das ist der Punkt, wo eine wahnhafte Liebe zum Geld entsteht. Die erste Milliarde war mein Ziel. Millionär war ich schließlich schon mit 22. Ein Traum, oder etwa nicht?
Ich war ein lebendes Werbeprospekt. Alles, was man uns in Hochglanzbroschüren als das ultimative Leben verkauft, hatte ich: Landgüter, Schlösser, Jets, Jachten, Autos und Frauen. Jeder Haken auf der Checkliste war gesetzt. Top-Universitätsabschlüsse? Check. Profi-Basketballer? Check. Diplomat? Check. Ich war der Inbegriff dessen, was jeder unter »Erfolg« versteht – ein wandelndes Aushängeschild für das Leben, das alle wollen, aber kaum einer wirklich kennt.
Aber mir reichte das nicht. Ich wollte eine immer größere Nummer sein und an der Spitze stehen. Denn dort wartete die Anerkennung auf mich und, was für mich noch wichtiger ist: Macht. Reflexion? Dafür war keine Zeit.
Und so wurde ich zum Geldvermehrungsroboter, zum Sklaven meines Kapitals und meines Terminkalenders. Ich besaß alle Spielzeuge, die ich mir vorstellen konnte, hatte aber nie Zeit, sie zu genießen. Ich war so tief in meine Arbeit verstrickt, dass ich das Wesentliche im Leben aus den Augen verlor: meine Familie, meine Freunde, meinen Geist, mein Herz, meine Seele. Aber am Ende zählt nur das, was wirklich erfüllt. Der Exzess hingegen frisst dich von innen auf.
Kokspartys in New York und Boston als aufsteigender Wallstreet-Banker. Später Privatjets, Luxusjachten, viel Glanz und wenig innere Substanz. Gelegentliche Bordell-Besuche, natürlich ohne mich selbst mit solchen Eskapaden erpressbar zu machen, sondern um Informationen von den Sexarbeitern zu bekommen beziehungsweise um belastendes Material zu sammeln, gab es auch. Für meine Engagements im Tabledancing in England (69 Club), Sexgeschäft in Berlin (Artemis), Nachtklub in Palma de Mallorca und in der Pornografie (Penthouse-Gruppe) schäme ich mich heute.
Selbst im Genuss sehnt man sich nach noch mehr Verlangen, bis der Reiz komplett weg ist. Die Dosis muss immer höher gefahren werden, weil einen sonst gar nichts mehr flasht. Es ist ein Teufelskreis, der einen langsam, aber sicher kaputt macht. Ein ewiger Wettlauf um mehr Kohle und mehr Statussymbole; ein dämlicher Trip ins Nichts. Aber diese Einsicht kam nicht über Nacht. Es war ein langsamer Prozess, bis ich begriffen habe, wie sinnlos der ganze Zirkus wirklich war, wie armselig ich war.
Deshalb lässt mich der Fall Jeffrey Epstein auf so vielen Ebenen erschaudern.
Ironischerweise begann mein Bezug zu dieser Welt der dekadenten Elite durch den Medienmogul und Doppelagenten Robert Maxwell, den Vater von Epsteins Partnerin Ghislaine, den ich in den 1980er-Jahren kennenlernte. Als Portfolio-Manager bei Fidelity und Analyst für Aktiengesellschaften hatte ich oft die Gelegenheit, Maxwell zu seinen geschäftlichen Aktivitäten zu befragen. Mein Eindruck damals? Ein verwirrter, schlecht informierter Medienmogul, der eher unkoordiniert wirkte. Auffällig war, dass er in unseren Gesprächen immer wieder versuchte, mich seiner Tochter Ghislaine vorzustellen – oder besser gesagt, mich mit ihr zu verkuppeln.
Gott sei Dank war ich damals schon vergeben, sonst hätte ich mich vielleicht auf ein Date mit Londons It-Girl Ghislaine Maxwell eingelassen. Noch schauriger ist der Gedanke, dass ich unter ihrer Fuchtel mit all ihren einflussreichen Netzwerken selbst zu einem zweiten Jeffrey Epstein hätte werden können. Denn die Voraussetzungen dafür waren perfekt: mein eigener schwerer Missbrauch in der Kindheit, elitärer Background, Harvard-Abschlüsse und eine Milliardärskarriere in Aussicht.
Die merkwürdigen Gespräche mit Robert Maxwell führten aber nur dazu, dass ich das Engagement mit ihm deutlich reduzierte. Ich verkaufte zeitnah die Maxwell-Aktien aus meinem Fidelity Broadcast and Media Fonds. Doch auch nach dem angeblichen Suizid von Robert Maxwell blieben Ghislaine und ihr Partner Jeffrey Epstein in meinem Blickfeld. In den 2000er-Jahren gehörte ich laut Manager Magazin zu den fünfzehn aggressivsten und mächtigsten Investoren Deutschlands und beobachtete natürlich meine Konkurrenz – darunter auch Epstein, den Hedgefonds-Manager.
Auch in der Welt der extrem ehrgeizigen Finanzmagnaten arbeitet man manchmal wie ein Wolfsrudel zusammen und tauscht sich über die besten Deals aus, vor allem bei Anlagen und Arbitrage-Geschäften. Angesichts der enormen Mittel, die Epstein verwaltete, hätte ich ihn bei bestimmten Investitionen in London, Zürich oder New York zwangsläufig treffen müssen – so wie andere mächtige Investoren auch.
In Insiderkreisen kursierten damals zwei Fragen: Wie kann ein Studienabbrecher wie Epstein, ein ehemaliger Lehrer gar, mit einer mittelmäßigen Performance so viel Geld verwalten? Und: Kennst du irgendeinen Weltklasse-Hedgefonds-Manager, der so viel feiert wie Jeffrey? Die großen Köpfe der Branche, Leute wie Julian Robertson, George Soros, Stan Druckenmiller und Carl Icahn in New York oder Crispin Odey und Chris Hohn in London, arbeiteten 80- bis 100-Stunden-Wochen. Die hatten keine Zeit für Partys oder Preisverleihungen, selbst wenn die Rolling Stones dort spielten. Wir wussten alle, dass die Konkurrenz im Nacken lauerte, jederzeit bereit, uns vom Milliardärsthron der selbsternannten »Masters of the Universe« zu stürzen.
Heute weiß ich mehr. Epsteins Leistung als Vermögensverwalter war bestenfalls mittelmäßig, aber in Sachen Steueroptimierung? Da war er ein Genie. Und dank der akribischen Recherchen des Journalisten Tahir Chaudhry, der in diesem Buch die letzten Puzzleteile zusammengefügt hat, ist offensichtlich, dass Epstein weit mehr war als nur ein geschickter Finanzakteur – er erfüllte einen viel größeren und düstereren Zweck, als es allgemein angenommen wird. Welcher das war, enthüllt dieses fesselnde Buch in beeindruckender Detailtiefe.
Tahir Chaudhry kenne ich seit der Berlinale 2018, als er im Auftrag der Süddeutschen Zeitung ein Interview mit mir über den Film Generation Wealth führen sollte. Die Wirtschaftsredaktion hatte ihm damals den klaren Auftrag gegeben, mich »fertigzumachen«. Doch Tahir ging mit einer ehrlichen und professionellen Herangehensweise an die Sache. Das passte seiner Redaktion nicht und deshalb wollten sie kein Interview mehr.
Bei unserem zweiten Treffen gestand mir Tahir, dass er keinen Beitrag über mich schreiben könne. Es sei gegen seine Werte, da er zu einem völlig anderen Schluss über mich gekommen sei als seine Redaktion. Da sagte ich zu ihm: »Wenn dieser Artikel über mich nicht sein soll, dann hat Gott uns wegen einer anderen Sache zusammengebracht.« Aus dieser Begegnung entwickelte sich eine Bekanntschaft, gar eine Freundschaft, die auf Respekt und gegenseitiger Wertschätzung basiert.
Schließlich fingen wir an, an einer gemeinsamen intensiven Recherche über Elite-Netzwerke zu arbeiten. Doch das Thema war derart brisant, dass er das Projekt abbrechen musste, nachdem ein Brandanschlag auf sein Haus und seine Familie passiert war – just an dem Tag, an dem wir unsere gesammelten Informationen austauschen wollten. Chaudhry hat »Eier aus Stahl«, aber nicht auf Kosten seiner sympathischen Familie. Dabei befasst er sich oft mit riskanten Themen, wie etwa seine Recherchen über die Unwahrheiten des Jürgen Todenhöfer, die Hintergründe der Maidan-Revolution oder der Krieg in Gaza. Doch bei Epstein hat er sich in die dunkelsten Abgründe einer völlig entgleisten Elite gewagt, die sich wie Vampire an der Unschuld und Reinheit ihrer Opfer labt.
Obwohl Tahir und ich in manchen Dingen unterschiedlicher Meinung sind, teilen wir eine gemeinsame Neugierde: die unermüdliche Suche nach der tiefsten Wurzel der Wahrheit. Pädophilie und der Missbrauch von Kindern sind so alt wie die Menschheit selbst, gut dokumentiert in antiken religiösen Schriften und von hoch angesehenen Theologen vor Jahrhunderten interpretiert. Die Faszination für junges, unschuldiges »Frischfleisch« findet sich nicht nur bei den Griechen und Römern, sondern auch bei den Osmanen, in arabischen Ländern, den italienischen Stadtstaaten und unzähligen anderen Kulturen. Der sexuelle Missbrauch hat nie wirklich aufgehört.
Wer sich tief in diese dunklen Abgründe vorwagt, lebt gefährlich. Viele haben eine erschreckend niedrige Lebenserwartung, während andere, die solche Enthüllungen wagen, aus dem Mainstream verbannt, verteufelt und mit zerstörten Karrieren zurückgelassen werden – ihr Ruf ruiniert, ihr Leben gebrochen. Diese Reise in das Vorzimmer der Hölle sollen mutigere Seelen antreten. Ich habe nicht vor, als Märtyrer zu enden.
Die Tragweite der Enthüllungen über Epstein betrifft jedes zweite oder dritte Mädchen oder Frau in Deutschland, die in irgendeiner Form seelischen, psychologischen oder sexuellen Missbrauch erlebt hat – Tendenz steigend. Bei Jungen und Männern spricht man inzwischen von jedem Fünften. Das geht mir unter die Haut, weil ich selbst im Alter zwischen fünf und zehn Jahren von meinem Vater sexuell missbraucht wurde, während meine Mutter eine Mittäterin war. Gelegentlich wurde ich sogar in der Bekanntschaft »herumgereicht«. Dieses systematische Brechen meines Geistes ging Hand in Hand mit einer ständigen Programmierung von Fördern und Fordern, um mich in einen innerlich zerrissenen, geistig gequälten Überperformer zu formen. Das sollte wohl als Opfer vor Gott genügen. Inschallah.
Tahir Chaudhry deckt im Fall Epstein Netzwerke und Systeme auf, die in der Finanzbranche alles andere als eine Ausnahme sind. Solche schmutzigen Spielchen kenne ich seit fast fünfzig Jahren. Kundenbindung läuft oft über sogenannte »Fickpartys«, meistens in luxuriösen Anwesen oder durch organisierte Besuche in Nobelbordellen und Escort-Services. Manager und Vermögensverwalter verbringen ihre Zeit mit jungen, teils minderjährigen Frauen in edelsten Umgebungen. Das bindet die Kunden, die sich solche Ausschweifungen selbst kaum leisten könnten, eng an die Banken. Die Vermögensverwalter und Broker haben dadurch ein enormes Erpressungspotenzial. Das Leid der Opfer spielt dabei überhaupt keine Rolle – sie werden als nichts anderes als Nutzvieh betrachtet.
Reiche und mächtige Pädophile können hier ihre perversen Fantasien auf Kosten dieser Banker und Broker ausleben – und das offenbar mit minimalem Risiko. Ich kenne mindestens drei große Netzwerke in Berlin, Wien und London, die nach einem ähnlichen Schema wie Epstein arbeiten, um ihr Kapital und ihren Einfluss zu maximieren. Und oft geschieht das auf Kosten minderjähriger Mädchen, die vielleicht für ihre Rolle bezahlt werden, aber keine Ahnung haben, welche verheerenden Konsequenzen Kinderprostitution für sie haben kann. Diese Strukturen sind durch und durch eiskalt, skrupellos und völlig gefühllos.
Die Finanzbranche, einschließlich der ihnen übergeordneten Institutionen wie der Internationale Währungsfonds, die Weltbank und die Zentralbanken, ist fast überall von Geheimdiensten durchdrungen. An diesen Schaltstellen entstehen makroökonomische Informationen von enormer Bedeutung, die für Wall-Street-Insider hochprofitabel sein können. Das ist keine Verschwörungstheorie. In meiner Zeit als Sales Executive und Analyst in der profitabelsten Einheit des weltweit größten Brokers Merrill Lynch war mein Chef der ehemalige Chef der CIA auf den Philippinen. Wir investierten für umstrittene Staatsführer und die Rohstoffindustrie. Für einen hochrangigen liberalen deutschen Politiker verwaltete ich jahrelang ein zweistelliges Offshore-Millionenvermögen. Keine Überraschung, dass mein Name in den Paradise- und Panama-Papers auftauchte – sehr zum Ärger meiner Feinde, die mich fälschlicherweise als Steuerhinterzieher darstellen wollten.
Solche Strukturen spielen nach wie vor eine zentrale Rolle, wenn es um den Transfer, die Verwaltung und die Problemlösung bei schwierigen Geldern geht. Geheimdienste – oder genauer gesagt ihre Business-Intelligence-Einheiten – zapfen diese Quellen an und verkaufen die Informationen an zahlungskräftige Kunden. Darunter sind vor allem die Proprietary Trading Operations kapitalstarker Investmentbanken sowie Hedgefonds, die mit diesem Insiderwissen riesige Gewinne einfahren.
Denn so korrupt das auch klingen mag, sind Informationen über kriminelle Machenschaften oft wertvoller als Nachrichten über bevorstehende Staatsstreiche, Rohstoffpreisverzerrungen oder frühzeitige Kenntnisse wichtiger Wirtschaftsdaten. Dazu gehören selbstverständlich auch Daten zu Korruption, ehelicher Untreue und perversen sexuellen Praktiken – vor allem mit Minderjährigen. Dieses »Information Gathering« betrifft nicht nur Gestalten wie Epstein und Maxwell, sondern zieht auch Schleppnetze im Darknet-Sumpf auf.
Pädophile Täter befinden sich oft auf relativ sicherem Terrain, da der Missbrauch systemisch und weitreichend ist. Sie nutzen ihre erpresserischen Informationen, um Gelder der Täter zu akquirieren und zu verwalten. Das führt zu hohen Gebühren im Investmentbanking, im Brokerage-Geschäft, der Vermögensverwaltung und Steuerberatung. Sobald Regierungsbeamte in diesen Missbrauch involviert und dokumentiert sind, was fast immer der Fall ist, wird die Strafverfolgung der Täter und Organisatoren zunehmend erschwert. Mittäter sorgen dafür, dass belastendes Material nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Wer solche Missstände ignoriert oder duldet, unterstützt nicht nur die Täter, sondern fördert auch die Perversion und den Verfall.
Bitte verbreiten Sie dieses Buch. Je mehr Menschen diese Verflechtungen verstehen, desto größer wird der öffentliche Druck, etwas zu verändern. Dieses Buch betrifft uns alle – es geht nicht nur um die Machenschaften einer abgehobenen Elite, sondern um grundlegende Fragen, die unser aller Menschsein betreffen: Wie würden wir leben, wenn uns nahezu grenzenlose Macht, Zugänge und Mittel zur Verfügung stünden? Würden wir unseren moralischen Kompass beibehalten? Würden wir uns der Verlockung hingeben, alles zu unserem eigenen Vorteil zu nutzen? Jeder von uns muss sich diese Fragen stellen.
Florian Homm
1Der Honigfallenleger
Auf der East 71st Street in der Upper East Side von Manhattan, New York City, steht das berühmt-berüchtigte Anwesen, das bis zum Tod von Epstein im August 2019 die Prominenz und den Geldadel aus aller Welt beherbergt hat. Der Hausherr war laut übereinstimmenden Medienberichten ein millionenschwerer Investmentbanker und Vermögensverwalter. Sein Vermögen wurde auf mehr als 500 Millionen Dollar geschätzt. Welchem Beruf er nachging, bleibt bis heute ein Mysterium.
Epstein war medienscheu. Er gab nie ein offizielles Interview und bis 2002 erschien auch kein Bild von ihm in irgendeiner Publikation. Laut dem Journalisten Landon Thomas Jr., der 2002 das erste Porträt für das New York Magazine über Jeffrey Epstein schrieb, hätte sich Epstein nach einer öffentlichkeitswirksamen Afrika-Reise mit US-Präsident Bill Clinton und den Schauspielern Kevin Spacey und Chris Tucker einen strategischen Fehler eingestanden. Zu einem Freund habe er gesagt: »Wenn es mein oberstes Ziel war, privat zu bleiben, war die Reise mit Clinton ein schlechter Zug auf dem Schachbrett. Das erkenne ich jetzt. Aber wissen Sie was? Selbst Kasparow [die Schach-Legende] macht sie. Man muss einfach weitermachen.«
Epstein machte weiter. Er wurde zum engen Vertrauten von Präsidenten und Adeligen. Er feierte mit Hollywood-Stars, dinierte mit Konzern- und Bankenchefs und diskutierte mit Pionieren der Wissenschaft. Er lud sie zu einem Flug in seinem Privatjet oder für einen Aufenthalt auf seiner Privatinsel in der Karibik ein. Obwohl Epstein seit mindestens 2006 als Pädophiler gebrandmarkt war und kurz darauf sogar als Sexualstraftäter verurteilt wurde, nahmen die reichsten und mächtigsten Männer der Welt seine Einladung an. Warum wurde die High Society von ihm so magnetisch angezogen? Warum suchte sie damals so sehr seine Nähe und heute umso schneller das Weite, wenn der Name Epstein fällt?
Diese Frage stelle ich mir, während ich diese massive, unnötig hohe, aus Eichenholz geschnitzte Tür der 40-Zimmer-Villa von Herbert N. Straus fotografiere. Über dem Eingang thront der Maskaron eines männlichen Gesichts mit wild und schelmisch verzogener Miene. Links und rechts wird es von weiblichen Gesichtern mit sanften, harmonischen Gesichtszügen flankiert. Abgesehen von den wenigen floralen und elegant geschwungenen Elementen ist die cremefarbene Kalkstein-Fassade eher schlicht gehalten.
Manche seiner Nachbarn zahlen für ihre ähnlich überdimensionierten Stadtvillen zwischen 20 000 und 100 000 Dollar Miete im Monat. Epstein musste gar nichts zahlen. Er zog 1996 einfach in die Stadtvilla ein, die sein langjähriger Freund, sein offiziell einziger Kunde, der »Victoria’s Secret«-Gründer Leslie Wexner, für 13,2 Millionen Dollar gekauft hat, um sie dann von Grund auf umzugestalten. Epstein habe die Villa daraufhin für einen symbolischen Preis von einem Dollar übernommen und mit zahlreichen Überwachungskameras und beheizten Bürgersteigen zum Schmelzen von Schnee ausgestattet. Diese, aber auch die Epstein-Villa in Palm Beach, Florida, sollte zu einem Hotspot für die Reichen und Schönen werden. Sie sollte als Schauplatz für Epsteins opulente Partys dienen, bei denen eine Einladung zum begehrten Statussymbol werden sollte.
Es gibt wenige Insider-Berichte von diesen Partys. Einer von ihnen stammt von der US-amerikanischen Journalistin Katie Couric. Sie beschreibt eine Dinnerparty in ihren Memoiren als »Eyes Wide Shut mit einem Twist«. Damit bezieht sie sich auf Stanley Kubricks Film von 1999 über einen elitären Geheimbund, der maskierte Orgien veranstaltet. Couric sei damals aufgefallen, wie jung die Frauen gewesen seien, die die Mäntel der Gäste an der Garderobe annahmen. Und dennoch habe sie sich damals darüber nicht zu sehr den Kopf zerbrochen. Als Couric bei einer Live-Talkshow im Oktober 2023 erneut nach diesem Erlebnis gefragt wird, fügt sie hinzu: »Ich wusste damals noch nichts über Jeffrey Epstein«, und: »Ich hätte vorher besser recherchieren sollen, aber vieles über ihn war noch nicht bekannt.« So ganz stimmt das nicht. Die Party in Epsteins Stadtvilla in Manhattan fand im Dezember 2010 statt, nur wenige Monate nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis. Er war im Juni 2008 wegen Beschaffung und Anwerbung eines Kindes zur Prostitution verurteilt worden.
So ist das mit den ehemaligen »Freunden« Epsteins. Niemand will etwas über ihn gewusst haben, als dieser noch lebte. Deshalb herrscht heute genauso wenig Einsicht bei den Partygästen wie bei Epstein selbst. Der New York Post sagte er nach dem Absitzen seiner 13-monatigen Haftstrafe: »Ich bin kein Sexualverbrecher (›sexual predator‹), Ich bin ein Missetäter (›offender‹). Das ist der Unterschied zwischen einem Mörder und jemandem, der einen Bagel stiehlt.« Epstein muss gar stolz darauf gewesen sein. Immerhin empfand er die Kriminalisierung von Sex mit minderjährigen Mädchen als »kulturellen Irrweg«. Wahrscheinlich hielt er sich auf diesem Feld für eine Art Vorkämpfer. Jedenfalls hing in seiner Stadtvilla fortan eine Leinwand: eine fotorealistische Gefängnisszene mit Epstein zwischen Stacheldraht und Wärtern. Ein scharfer Kontrast zum Leben im Luxus, den seine Gäste offenbar wahrnehmen sollten.
Das markante Wappenschild aus poliertem Messing neben der Eingangstür, das die Initialen »J.E.« trug, ist inzwischen verschwunden. Es gibt einen neuen Besitzer. Es ist der ehemalige Goldman-Sachs-Manager Michael Daffey, der hier mit seiner vierköpfigen Familie einzog. Er kaufte die Villa für 51 Millionen Dollar aus Epsteins Nachlass. Wie lebt es sich in einem Haus, wo über fast zwei Jahrzehnte hinweg Hunderte minderjährige Mädchen durch mächtige Männer aus aller Welt missbraucht wurden? Zu gern würde ich einen Blick hineinwerfen. Ja, es ist journalistische Neugier, um das Gefühl nachvollziehen zu können, das die Gäste beim Anblick der prachtvollen Ausstattung hatten, als sie die Villa betraten. Es muss eine Mischung aus Luxus, Macht und Exklusivität gewesen sein. Die Journalistin Vicky Ward beschrieb 2003 in ihrem Porträt »Der talentierte Mr. Epstein« für Vanity Fair ihr Gefühl mit folgenden Worten: »Dies ist kein einfaches Haus einer reichen Person, sondern eine eklektische, herrische Fantasie hinter hohen Mauern, die keine Grenzen zu kennen scheint.« Laut Ward sei das Interieur der Villa ein Ausdruck von jemandem, der »für die Größe seines Besitzes bekannt sein« wolle. Kronleuchter, Wandteppiche, Statuen, Gemälde, Aktporträts, ausgestopfte Tiere, gläserne, gepolsterte, golden verzierte Möbel und Armaturen auf sieben Stockwerken und 4 700 Quadratmetern.
Fast alle Gäste, die rückblickend die Einrichtung der Villa beschreiben, sprechen auch von gruseligen Details: Die Eingangshalle war mit einer Reihe von einzeln eingerahmten Augäpfeln dekoriert, eine lebensgroße weibliche Puppe hing von einem Kronleuchter, ein ausgestopfter Pudel saß auf dem Flügel eines großen Klaviers und am unteren Ende der Treppe befand sich ein menschliches Schachbrett, dessen Figuren seine Mitarbeiter in aufreizender Kleidung zeigten. Auch seien die großen Porträts von US-Präsident Bill Clinton in einem blauen Kleid – eine Anspielung auf den Lewinsky-Skandal –, vom saudischen König Mohammed bin Salman in seinem traditionellen arabischen Gewand, dem Präsidenten der Arabischen Emirate Mohammed bin Zayed in Badehose und dem Filmemacher Woody Allen nicht zu übersehen gewesen. Mit allen vier Männern, die enge Freunde Epsteins waren, werden sich meine Wege im Laufe der Recherche des Öfteren kreuzen.
Ich laufe wenige Meter westwärts in Richtung Central Park. Das ruft die Erinnerung an das berühmt-berüchtigte Foto von Jeffrey Epstein mit Prinz Andrew hervor, dem zweiten Sohn der verstorbenen Königin Elizabeth II. Im Dezember 2010 wurde es von einem Paparazzo geschossen. Unter dem Vorwand eines harmlosen Spaziergangs hatte Epstein den Prinzen dazu gebracht, sich im Central Park die Beine zu vertreten. Hatte Epstein dem Paparazzo einen Hinweis gesteckt oder hat er es einfach darauf angelegt, mit Prinz Andrew fotografiert zu werden?
Jedenfalls zeigten die Fotos eine enge Beziehung zwischen Epstein und dem britischen Royal. Erst nach dem Tod Epsteins lösten die Bilder öffentliche Empörung und Kritik an Prinz Andrew aus, was im November 2019 zu seiner Entfernung aus öffentlichen Ämtern führte. Dieses Ereignis stellt bis heute das größte Nachbeben des Epstein-Skandals dar. Sein Netzwerk, seine Komplizen und mögliche Hintermänner bleiben weitestgehend vom medialen Druck, juristischen Verfahren oder gar Nachfragen verschont.
Ähnlich verhält es sich mit der Nachbarschaft Epsteins in Manhattan. Ich erkunde sie noch am selben Tag. An der Kreuzung zur East 72nd Street entlanglaufend fällt mir auf, dass ein Haus direkt hinter Epsteins Stadtvilla steht, das sich mit ihr den Innenhof teilt. Müsste den Bewohnern dieses Hauses bei dieser Nähe nicht etwas Außergewöhnliches aufgefallen sein? Würde man meinen. Auch wenn Epstein 2019 starb, seine Nachbarschaft hüllt sich noch immer in Schweigen. Wie finde ich heraus, wer hier wohnt, wenn es hier keine Namensschilder an den Eingangstüren gibt? Kurze Zeit später fällt mir ein Paketzusteller auf, beladen mit einem Stapel verpackter Lieferungen. Neugierig beschleunige ich meine Schritte, um einen Blick auf die Namen zu werfen, die auf den Paketen prangen. Ich lese: Harriet Croman. Das ist die Ehefrau des in New York verhassten Immobilienhais Steven Croman. Die Google-Suche führt zur Website »Stop Croman Coalition«, die sich gegen die aggressiven Geschäftspraktiken der Croman Real Estate richtet, wo auch Sohn Jake Croman tätig ist. Er ist zugleich Mitglied im Vorstand der Eric Trump Foundation, die dem dritten Kind des US-Präsidenten Donald Trump gehört. Weitere Namen, die ich auf den Paketen lese, sind von mächtigen Vertretern der Pro-Israel-Lobby in den USA.
Sind vielleicht diese heiklen Verbindungen der Grund, warum viele Journalisten den Fall Epstein meiden? Das könnte wahrscheinlich erklären, warum es zahlreiche Journalisten vorzogen, nur kleine Schlaglichter auf den Fall zu werfen, sich von den oftmals heiklen Details des Falls fernzuhalten und niemals das gesamte Bild von Epstein zu zeichnen. Deshalb reduzierte sich das Bild in den etablierten Medien auf Epstein als einen »gestörten Perversen«, einen »reichen Pädophilen« oder einen »mysteriösen Mann mit mächtigen Freunden«. Diese Art der Fokussierung verdeckt die tiefere und möglicherweise gefährlichere Wahrheit.
James B. Stewart veröffentlichte wenige Tage nach Epsteins Tod im August 2019 einen Artikel in der New York Times. »Der Tag, an dem Jeffrey Epstein mir erzählte, er hätte Dreck über mächtige Leute«. Der Inhalt war ein Hintergrundgespräch, das Stewart 2011 mit Epstein geführt hatte. Er beschrieb darin, dass Epstein sich der Bedeutung seiner Verbindungen voll bewusst war. Epstein behauptete, viel über mächtige Menschen zu wissen, einiges davon sei möglicherweise rufschädigend oder peinlich gewesen, einschließlich Details über ihre angeblichen sexuellen Neigungen und ihren Drogenkonsum. Epstein erklärte, dass prominente Persönlichkeiten aus der Tech-Elite den Ruf hätten, streberhafte Workaholics zu sein, aber das entspreche bei Weitem nicht der Wahrheit. Das habe er mit eigenen Augen gesehen. Epstein verfügte also über kompromittierende Informationen über mächtige Menschen, die genutzt werden konnten, um sie zu erpressen. In den populären Darstellungen des Falls wie in der Netflix-Serie Filthy Rich, die auf einem Buch von James Patterson basiert, war davon weniger die Rede. Und schon gar nicht von den zahlreichen Verbindungen zu Geheimdiensten, die Epsteins gesamte Biografie durchziehen.
Fakt ist, Epstein war kein Einzelfall. Erpressung hat in der Geschichte der Geheimdienste eine lange Tradition. Einen interessanten Einblick dazu bietet die Truman Library, das Archiv von Harry S. Truman, der von 1945 bis 1953 Präsident der Vereinigten Staaten war. In der Sammlung President’s Secretary’s Files gibt es eine handschriftliche Notiz von Präsident Truman vom 12. Mai 1945: »Liebe Bess … Wir wollen keine Gestapo oder Geheimpolizei. Das FBI tendiert in diese Richtung. Sie verwickeln sich in Skandale um Sexualleben und Erpressung, während sie eigentlich Verbrecher jagen sollten. Edgar Hoover würde sein rechtes Auge geben, um die Führung zu übernehmen, und alle Kongressabgeordneten und Senatoren haben Angst vor ihm. Ich nicht, und das weiß er.«
Dieser Eintrag verdeutlicht, wie sehr sich das Federal Bureau of Investigation von seiner ursprünglichen Idee entfernt hatte. Gegründet 1908, um Kriminalität und Korruption auf nationaler Ebene zu bekämpfen, wächst die Bedeutung des FBI während des Ersten Weltkriegs, weil die Regierung zunehmend die Überwachung von Extremisten und politischen Bedrohungen als entscheidend ansieht. In den 1920er-Jahren tritt J. Edgar Hoover als Direktor an und modernisiert die Behörde, indem er strikte Standards für Ausbildung und Ermittlungsarbeit einführt. Als US-Präsident Franklin D. Roosevelt Hoover in den 1930er-Jahren mitteilt, dass er an einem »umfassenden Bild« der kommunistischen und faschistischen Bewegungen in den USA interessiert ist, sieht Hoover dies als Freibrief. Er nutzt das FBI fortan als Werkzeug zur Überwachung und Kontrolle politischer Akteure und Bewegungen.
Im Zweiten Weltkrieg spielt das FBI eine Schlüsselrolle im Kampf gegen Spionage, während parallel das Office of Strategic Services (OSS) gegründet wird, das sich auf Auslandsspionage spezialisiert. Nach dem Krieg wird das OSS in die CIA umgewandelt, die fortan für internationale Spionage verantwortlich ist, während das FBI sich auf innere Sicherheit und nationale Ermittlungen konzentriert.
Hoover ist zwar bekannt und gefürchtet für seine mächtigen Überwachungs- und Erpressungsstrategien, doch er selbst ist nicht vor Erpressung immun. Seit Langem kursieren Gerüchte über Hoovers Homosexualität, besonders im Hinblick auf seine enge und lebenslange Beziehung zu seinem Stellvertreter Clyde Tolson. Die beiden verbringen fast jeden Tag miteinander, arbeiten Seite an Seite, essen gemeinsam und unternehmen private Reisen.
Laut Anthony Summers’ Buch The Secret Life of J. Edgar Hoover (1993) habe der Romanautor William Styron Hoover und Tolson in einem Strandhaus in Kalifornien gesehen, wo Hoover Tolsons Zehennägel lackierte. Zudem erzählt Harry Hay, Gründer der Mattachine Society, der ersten Schwulenrechtsorganisationen der USA, dass Hoover und Tolson regelmäßig in exklusiven Logen für homosexuelle Männer auf der Del-Mar-Rennbahn in Kalifornien gesessen hätten.
Nach seinem Tod wird Hoover Tolson seinen gesamten Nachlass vermachen und Tolson wird in sein Haus einziehen.
Die Gerüchte haben nicht nur persönlichen, sondern auch erheblichen beruflichen Einfluss auf Hoover. Es wird spekuliert, dass Meyer Lansky, ein führender jüdischer Mafiaboss der sogenannten Kosher Nostra, Hoover aufgrund seiner Homosexualität erpresst. Laut Summers habe Hoover seine Sexualität meistens unterdrückt, aber manchmal habe er sich in Orgien in New Yorker Hotels und Affären mit Teenagern in einer Limousine ausgelassen. Er berichtet von Interviews mit Mafia-Insidern, die darauf hinweisen, dass Lansky durch Erpressung von mächtigen Akteuren wie Hoover politischen und rechtlichen Einfluss erlangt. Ein ehemaliger Mitarbeiter Lanskys behauptet, dass Lansky in den 1940er-Jahren kompromittierende Fotos von Hoover in einer »schwulen Situation« beschafft habe. Diese Bilder sollen es Lansky ermöglicht haben, Hoover erfolgreich unter Druck zu setzen, wodurch dieser FBI-Ermittlungen gegen Lanskys kriminelle Aktivitäten zurückgehalten habe. Selbst Lanskys Witwe wird später bestätigen, dass ihr Mann Beweise für Hoovers Homosexualität sammelte und nutzte, um das FBI in Schach zu halten.
2019 veröffentlichte FBI-Akten enthüllen, dass Lansky über Jahre hinweg umfassend vom FBI überwacht wurde. Das wird die Frage aufwerfen, warum er nie strafrechtlich verfolgt wurde. Konnte sich Lansky erfolgreich durch Erpressung vor Ermittlungen schützen? Anthony Summers zitiert in The Secret Life of J. Edgar Hoover mehrere Primärquellen, die bestätigen, dass Lansky Erpressung gezielt einsetzte, um Politiker, Polizisten und Richter zu beeinflussen. Diese Erpressungsmaterialien wurden oft bei Orgien beschafft, die von dem Gangster Lewis Rosenstiel und seinem Anwalt Roy Cohn organisiert wurden.
Rosenstiel war ein enger Freund von Hoover und Gründer von Schenley Industries, der durch sein Alkohol-Imperium während der Prohibitionszeit (1920–1933) zu einem der mächtigsten Akteure in der Spirituosenbranche wurde. Seine Ehefrau Susan Kaufman bestätigte in den frühen 1970er-Jahren während der Anhörung des Gesetzgebungsausschusses für Kriminalität des Staates New York unter Eid, dass ihr Ehemann Lewis Rosenstiel in den 1950er-Jahren Hotelpartys veranstaltet hat, bei denen »männliche Kinderprostituierte« anwesend waren. Zu den Gästen sollen mächtige Politiker, Regierungsbeamte und Männer aus der Unterwelt gehört haben.
Rosenstiels Freund Roy Cohn galt in den 1970er- und 80er-Jahren als Mentor von Donald Trump. Zu seinen Freunden zählten auch Epsteins Anwalt und Freund Alan Dershowitz und Kosmetikunternehmerin Estée Lauder, die Mutter von Ronald Lauder, der Teil der Mega Group war, die Epstein später zum Aufbau seines Netzwerks nutzte. Als eine Art Informations-Broker pflegt er eine langjährige Verbindung zur CIA und zu US-Präsidenten wie Ronald Reagan oder Bill Clinton.
Für Hoover ist die schwarze Bürgerrechtsbewegung eine der größten Bedrohungen für die nationale Sicherheit der USA. Weil deren Führungsfiguren ab Mitte der 1950er-Jahre die bestehenden Machtstrukturen, die das Land aus Hoovers Sicht zusammenhalten, radikal infrage stellen, startet er eine verdeckte Operation. Ab 1956 nutzt er das geheime FBI-Programm COINTELPRO zur systematischen Überwachung und Störung von politischen Organisationen sowie Privatpersonen, die er als subversiv einstuft.
Ein großes Netzwerk, das das FBI ergänzt, ist die Anti-Defamation League (ADL), die 1913 von der B’nai B’rith, einer jüdischen Wohltätigkeitsorganisation, zur Bekämpfung des Antisemitismus gegründet worden war. Darüber schreibt der kanadische Diplomat und emeritierte Professor Peter Dale Scott in The American Deep State. Laut dem Anwalt und Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums Alfred M. Lilienthal arbeitet die ADL »eng mit der israelischen Geheimdienstbehörde Mossad und manchmal mit dem FBI oder der CIA zusammen«. Die ADL habe auch Martin Luther King Jr. ausspioniert und ihre gesammelten Informationen an Hoovers Büro übermittelt. Laut Henry Schwarzschild, einem ADL-Beamten von 1962 bis 1964, sei diese Zusammenarbeit »allgemein bekannt und beiläufig akzeptiert« gewesen.
Ein besonders perfides Beispiel ist der »Suicide Letter«, den das FBI 1964 an Martin Luther King Jr. schickt. Dieser anonym verfasste Brief ist Teil von Hoovers Verleumdungskampagne. Er soll King psychologisch unter Druck setzen und enthält Drohungen: »Es gibt nur eine Sache, die du tun kannst. Du weißt, was das ist. Es gibt nur einen Ausweg für dich. Du hast 34 Tage, bevor diese Affären der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Du bist fertig. Es gibt nur einen Ausweg, der dir offen steht.« Dieser Brief, der eine verschleierte Aufforderung zum Selbstmord darstellen soll, wird durch belastende Tonaufnahmen begleitet, die das FBI in King’s Hotelzimmern gemacht hatte, um ihn bei Bedarf öffentlich zu diskreditieren.
Auch andere Bürgerrechtsaktivisten, wie Malcolm X und Fred Hampton, werden gezielt überwacht und auch Opfer von FBI-Operationen. Während die Hintergründe der Ermordung von King und Malcolm X bis heute umstritten sind, spielte das FBI im Fall von Fred Hampton, einem Anführer der Black Panther Party, eine direkte Rolle in seiner Ermordung im Jahr 1969.
Laut Peter Dale Scott nutzt Hoover seine Macht, um sich selbst gegenüber Präsidenten abzusichern. In The American Deep State beschreibt Scott, wie Hoover gezielt kompromittierende Informationen über John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson und andere prominente Politiker sammelte, um sie unter Kontrolle zu halten und seine eigene Position als FBI-Direktor zu sichern. Hoovers geheime Akten, die sogenannten Official & Confidential Files, umfassten etwa 17 000 Seiten und verleihen ihm eine nahezu unantastbare Stellung im politischen System der USA. Nach seinem Tod im Mai 1972 soll seine langjährige Sekretärin, Helen W. Gandy, die geheimen Akten gemäß seinen Anweisungen vernichtet haben.
Die Sexspionage, also der gezielte Einsatz von Verführung und Sexualität zur Informationsbeschaffung, hat in der Geschichte der Geheimdienste eine lange Tradition. Der Begriff »Honeytrap« (Honigfalle) beschreibt dabei eine bewusst inszenierte sexuelle Begegnung, die später zur Erpressung des Opfers genutzt wird. Männliche Agenten, die solche Verführungen einsetzen, werden als »Raven« (Raben) bezeichnet, während ihre weiblichen Pendants »Swallow« (Schwalben) genannt werden. In der Terminologie der DDR-Geheimdienste galten Männer dieser Art als »Romeo-Agenten« und Frauen als »Venus-Agentinnen«.
Eines der bekanntesten Beispiele für diese Methode ist Margaretha Zelle, eine niederländische exotische Tänzerin, die unter dem Bühnennamen Mata Hari bekannt war. Mit ihrem Charme, ihrer Schönheit und ihren tänzerischen Fähigkeiten verführte sie während des Ersten Weltkriegs zahlreiche Männer für den deutschen Militärgeheimdienst. Durch ihre Verbindungen zu hochrangigen englischen und französischen Offizieren sollte sie militärische Geheimnisse erfahren, die sie anschließend an die Deutschen weitergeben sollte. Fortan führte sie Beziehungen zu hochrangigen Militärs, Politikern und anderen einflussreichen Männern in vielen Ländern, die sie oft über internationale Grenzen führten. Mata Hari wurde 1917 enttarnt, verhaftet, wegen Spionage angeklagt und hingerichtet.
Ein weiteres berüchtigtes Beispiel ist der ägyptische Jude Eli Cohen, der als einer der bekanntesten israelischen Spione in den 1960er-Jahren in Syrien aktiv war. Cohen infiltrierte für den Mossad die höchsten politischen und militärischen Kreise Syriens, indem er sich als der wohlhabende syrisch-argentinische Geschäftsmann Kamel Amin Thaabet ausgab. Cohen gelang es, das Vertrauen der syrischen Elite zu gewinnen, indem er prunkvolle Partys und Sexorgien in seinem Apartment organisierte, wo er Alkohol und Prostituierte anbot. Hochrangige Militärs, Politiker und sogar Verwandte des syrischen Präsidenten nahmen daran teil. Hier knüpfte Cohen intime Beziehungen, die ihm Zugang zu sensiblen militärischen Informationen verschafften. Aufgrund seiner wertvollen Kontakte und seiner großzügigen Gastfreundschaft wurde er zum engen Berater des syrischen Präsidenten Amin al-Hafiz befördert. Dadurch erhielt Cohen sogar die Möglichkeit, geheime militärische Einrichtungen wie die Stellungen auf den Golanhöhen zu besichtigen. Obwohl Cohen zunächst erfolgreich war, wurde seine Tätigkeit zunehmend riskanter. 1965 enttarnte ihn der syrische Geheimdienst und er wurde in Damaskus öffentlich hingerichtet. Die Informationen, die er übermittelt hatte, trugen maßgeblich zum Sieg Israels im Sechstagekrieg 1967 bei.
Seit 2019 sind immer mehr Details über Jeffrey Epstein ans Licht gekommen, doch ihre schiere Menge macht es nahezu unmöglich, den Durchblick zu behalten und die Zusammenhänge klar zu erkennen. Deshalb stelle ich mich in diesem Buch der heiklen Herausforderung, alle Puzzleteile zusammenzusetzen, ohne Angst davor zu haben, welches Bild sich daraus ergeben könnte. Es soll eine Bestandsaufnahme sein, die tief in ein komplexes System aus Macht, Kontrolle und Erpressung eintaucht, um ein umfassendes und schonungsloses Porträt von Jeffrey Epstein zu zeichnen.
Epsteins Tod im August 2019 hinterließ viele Fragen unbeantwortet. Seit fünf Jahren versuche ich mich den Antworten zu nähern: War es wirklich Selbstmord? Wer war dieser Mann? Was waren seine Motive? Wer waren seine Komplizen? Welche Machtstrukturen ermöglichten es ihm, so lange ungeschoren zu bleiben? Wer waren die Nutznießer von Epsteins dunklen Geheimnissen? Und vor allem: Wem diente Epstein wirklich?
Diese Fragen bringen mich unweigerlich zu weiteren Überlegungen: Was wäre, wenn das Ganze noch tiefer reicht? Könnte es sein, dass Epstein als eine Art Türsteher eines elitären Zirkels agierte, bei dem Erpressung der Klebstoff war, der diesen geheimen Bund zusammenhielt? War der Zugang nur für diejenigen erlaubt, die erpressbar waren, um sicherzustellen, dass sie stets kontrollierbar blieben und nicht aus der Reihe tanzten? Wurde so eine Elite geschaffen, deren Zusammenhalt auf Manipulation beruhte, um sicherzustellen, dass alle einer verborgenen Agenda folgen, die den Interessen dieser Machtelite diente?
Die wenigsten Menschen leugnen die Macht der Religion, des Geldes, der Technologie, der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Medien und der Werbung. Sie sind sich wohl bewusst über Kriminalität, Korruption, Manipulation und Vertuschung. Doch wenn es um elitäre Zirkel mit Superreichen, Mega-Konzernen und Geheimdiensten geht, reagieren viele von ihnen ablehnend. Warum? Es ist einfacher, bekannte Strukturen zu akzeptieren. Der Gedanke an verborgene Macht könnte die eigene Realität erschüttern. Er bedroht ihr eigenes Gefühl von Kontrolle und Sicherheit. Sie wollen soziale Akzeptanz und fürchten sich vor Ausgrenzung.
Ein wahrer Journalist, ein Wahrheitssucher muss diese Gefühle ausblenden. Tatsächlich muss er im besten Sinne ein »Verschwörungstheoretiker« sein. Allein die Tatsache, dass es eine Konzentration von Macht, Geld und Einfluss gibt, ist Beweis genug, dass Verschwörungen existieren. Deshalb kann er es nicht unterlassen, hinter die Fassade zu blicken, verborgene Zusammenhänge zu erkennen und das scheinbar Offensichtliche infage zu stellen.
Doch das bedeutet nicht, blind zu spekulieren. Ein Journalist muss Indizien sorgfältig zu einem stichhaltigen Bild verdichten, Fakten festigen und sein Fundament so aufbauen, dass es selbst kritischer Überprüfung standhält. Nur indem er sich von Wunschvorstellungen löst und konsequent nach Wahrheit strebt, kann der Journalismus seine Wächterfunktion erfüllen und als unabhängiges Instrument der Aufklärung und Kontrolle gegenüber den Herrschenden agieren, um Machtmissbrauch aufzudecken und im besten Fall zu verhindern.
Quellen:
Thomas Jr., Landon: »Jeffrey Epstein: International Moneyman of Mystery«. In: New York Magazine, 28. Oktober 2002, online unter:, abgerufen am 27. Juli 2024.
Couric, Katie: Going There. Little, Brown and Company, New York, 2021.
White, Christopher: »EXCLUSIVE: ›Wexner will do anything for me!‹«. In: Daily Mail, 21. Juli 2022, online unter:, abgerufen am 27. Juli 2024.
Sutherland, Amber: »Billionaire Jeffrey Epstein: I’m a sex offender, not a predator«. In: New York Post, 25. Februar 2011, online unter:, abgerufen am 27. Juli 2024.
»Longhand Note of President Harry S. Truman, May 12, 1945«. In: Truman Library, online unter:, abgerufen am 27. Juli 2024.
Mclaughlan, Scott: »Who Was J. Edgar Hoover?«. In: The Collector, 13. August 2024, online unter:, abgerufen am 27. Juli 2024.
Goodman, Amy: »The FBI vs. Martin Luther King – Inside J. Edgar Hoover’s ›Suicide Letter‹ to Civil Rights Leader«. In: Democracy Now!, 18. November 2014, online unter:, abgerufen am 27. Juli 2024.
Goodman, Amy: »The Assassination of Fred Hampton – New Documents Reveal Involvement of FBI Director J. Edgar Hoover«. In: Democracy Now!, 1. Februar 2021, online unter:, abgerufen am 27. Juli 2024.
Scott, Peter Dale: The American Deep State: Wall Street, Big Oil, and the Attack on U.S. Democracy. Rowman & Littlefield, Lanham, 2017.
Anon.: »A Byte Out of History J. Edgar Hoover’s ›Official & Confidential‹ Files«. In: FBI Archives, 7.November 2005, online unter:, abgerufen am 27. Juli 2024.
Smith, Nicholas Faith: The Bronfmans: The Rise and Fall of the House of Seagram. St. Martin’s Press, New York, 1993.
Webb, Whitney: »Hidden in Plain Sight: The Shocking Origins of the Jeffrey Epstein Case«. In: Unlimited Hangout, 18. Juli 2019, online unter:, abgerufen am 27. Juli 2024.
Summers, Anthony: The Secret Life of J. Edgar Hoover. G.P. Putnam’s Sons, New York, 1993.
Little, Becky: »Roy Cohn – From ›Red Scare‹ Prosecutor to Donald Trump’s Mentor«. In: History.com, 12. März 2019, online unter:, abgerufen am 27. Juli 2024.
Shipler, David K.: »Terrorist Plots Hatched by the F.B.I.«. In: New York Times, 28. April 2012, online unter: https://archive.ph/2020.10.14-182337/https://www.nytimes.com/2012/04/29/opinion/sunday/terrorist-plots-helped-along-by-the-fbi.html#selection-517.37-517.105, abgerufen am 27. Juli 2024.
Polmar, Norman, und Thomas Allen: Spy Book: The Encyclopedia of Espionage. Random House, New York, 1998.
Burke, Joanna: Femmes Fatales: Women, Murder, and Masculinity in Victorian Culture. University of Chicago Press, Chicago, 2004.
Bergman, Ronen: »Israel’s Secret Operation to Recover the Watch of a Legendary Spy«. In: New York Times, 5. Juli 2018, online unter:, abgerufen am 27. Juli 2024.
Black, Ian: Israel’s Secret Wars: A History of Israel’s Intelligence Services. Grove Press, New York, 1991.
Thomas, Gordon: Gideon’s Spies: The Secret History of the Mossad. St. Martin’s Press, New York, 1999.
2Insel der Sünde
Der Morgen ist strahlend heiß, als der kleine Flieger heftig schwankend zur Landung ansetzt. Jeder Windstoß fühlt sich wie ein Schlag in die Magengrube an. In den Gesichtern der Passagiere herrscht Anspannung. Ihre Augen wandern unsicher von ihren Sitznachbarn über die Flugbegleiter zu den Fenstern. Unten offenbart sich ein surreales Gemälde: ein tiefblauer Ozean mit funkelnden Wellen umschlingt das satte Grün der tropischen Wälder, die sich über die geschwungenen Hügel der Insel erstrecken. Als die Reifen donnernd das Rollfeld berühren, schallt die Stimme des Piloten durch die Lautsprecher: »We’ve just landed safely in Saint Thomas. The local time is 9:40 AM, with a warm 85 degrees Fahrenheit (29 Grad Celsius).«
Saint Thomas ist eine der drei Hauptinseln, welche die U.S. Virgin Islands, die Amerikanischen Jungferninseln, in der Karibik bilden. Sie sind ein Territorium der USA, die Währung ist der US-Dollar und die Bewohner sind US-Staatsbürger, zahlen in Amerika aber keine Einkommenssteuer. Die Inseln liegen östlich von Puerto Rico, etwa 1 000 Kilometer vom amerikanischen Festland entfernt. Ein winziger Punkt auf der Weltkarte. Der Cyril E. King Flughafen ist das Tor zu diesem ganz eigenen, kleinen Kosmos. Auf der wackeligen Flughafentreppe bläst den Passagieren ein heißer Föhn ins Gesicht. Er schmeckt salzig. Die Sonne steht fast senkrecht am Himmel. Der Ort verpasst den Äquator nur um eine Daumenbreite auf dem Globus.
Während die Grenzbeamten unsere Reisepässe kontrollieren, stelle ich mir vor, wie Jeffrey Epstein durch die Passkontrolle kam. Auf dem neunstündigen Flug von Frankfurt am Main nach Miami hatte ich das Buch von einem der Opfer von Epsteins Missbrauchsring gelesen. In





























