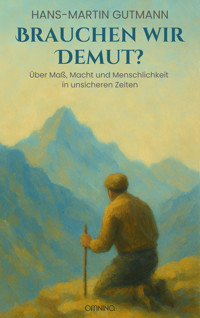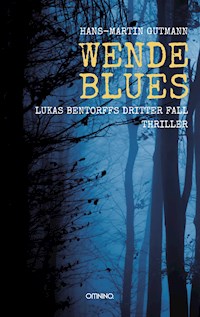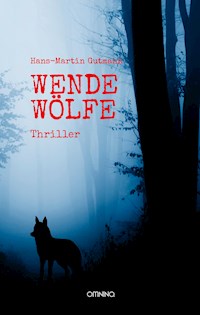
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Omnino Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
November 1989. Die Mauern fallen. Viele sind euphorisch. Aber es sind alte Rechnungen offen. Plötzlich liegt ein Leichenteil im Garten von Lukas Bentorff, Dorfpastor im Salzgitter-Gebiet. Ein ortsbekannter Kopf – ohne seinen Körper. Der Pastor, dem Leben seiner Gemeinde zugewandt, wird selbst angegriffen. Die niemals schlafende dörfliche Gerüchteküche bringt ihn mit dem Mord in Verbindung. Als Lukas Bentorff versucht, eine geheimnisvolle Fremde zu finden, die ihn entlasten könnte, überschlagen sich die Ereignisse ... Bentorff findet sich am Ende in einem unheilvollen Netz von neuen und alten Nazis und gerät ins Fadenkreuz polnischer Gruppen, die Rache nehmen wollen. Die Grenzen sind offen … Wohl einer der intelligentesten Thriller der letzten Jahre. Unbedingt empfehlenswert mit der liebenswürdigen Figur des Pastors, der in einer verschlafenen Region nach der „Wende“ plötzlich zum Helden eines Politkrimis zwischen Nazis und Polen wird. Jenseits aller Klischees verbindet Hans-Martin Gutmann Zeitfragen mit gelungenem Thrill.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hans-Martin Gutmann
Wendewölfe
Thriller
Ich widme diesen Roman meinem Freund und Dichterfürsten meinem Mit-Kabarettisten bei den „Spöttingern“
Reinhard Umbach
Danke. Auch dafür, dass ich mir einige Deiner wunderbaren Gedichte „ausgeliehen“ habe.
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-95894-168-7 (Print) // 978-3-95894-169-4 (E-Book)
© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2020
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
Handlung, Personen sowie die Dörfer Groß und Klein Samtleben in diesem Roman sind frei erfunden. Übereinstimmungen mit tatsächlichen Handlungen, Personen und Orten wären rein zufällig und sind nicht beabsichtigt.
1.
Im Kirchraum entsteht Unruhe. Ich sehe Frieder Moosbach zur Tür hereinkommen. Er ist schwer angetrunken. Eine Weile bleibt er unschlüssig stehen, dann steuert er einen der freien Plätze in den vorderen Reihen der Zuhörenden an.
Wenn das man gut geht.
Ich setze die Predigt fort.
In der Kirchengemeinde in Groß Samtleben ist Tradition, in der dunklen Jahreszeit an einem Donnerstagmorgen im Monat einen Abendmahlsgottesdienst zu feiern. Da kommen immer etwa zehn bis zwanzig Leute. Nicht viele. Aber die kommen regelmäßig. Sie hängen an diesem gottesdienstlichen Zusatzangebot neben den Sonntagsgottesdiensten.
Ich bin hier jetzt seit etwa einem Jahr Gemeindepfarrer. Ich kenne die Gesichter der Frauen und Männer, die heute den Gottesdienst besuchen. Aus dem Kirchenchor. Aus Treffen der Gemeindekreise und von Hausbesuchen.
Der Gottesdienst ist fortgeschritten. Ich predige über Jesaja 53. Das Lied vom Gottesknecht. Eingebettet in eine Meditation über die Figur des Barrabas aus den neutestamentlichen Passionsberichten. Barrabas ist aus dem Gefängnis entlassen. Er zieht mit dem Pöbel, um die Kreuzigung des Jesus von Nazareth zu sehen, und in der Begegnung mit diesem geschundenen Menschen fällt ihm der Vers aus dem Buch des Jesaja wieder ein, fast vergessen, aus den Erzählungen eines Priesters in frühen Kindertagen, und er gewinnt erst jetzt für ihn Bedeutung: „Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen …“ (Jesaja 53,52).
Frieder Moosbach sitzt schwankend in der ersten Reihe der Kirchenbänke. Ab und zu rülpst er leise. Mir gehen beim Lied nach der Predigt ein paar Erinnerungsbilder durch den Kopf. Die erste Begegnung mit Frieder Moosbach. Der Umzugswagen steht vor dem Pfarrhaus. Ich habe Arbeitsklamotten an. Da kommt ein Mann auf mich zu. Er wohnt im Dorf. Wie sich bald herausstellt, direkt in der Nachbarschaft. „Kannste mir mal den Schraubenzieher geben?“ Damit war der Kontakt hergestellt.
Frieder Moosbach wohnt zusammen mit seiner Mutter in einem etwas heruntergekommenen Fachwerkhaus in der Nachbarschaft. Beide sind Alkoholiker, der Sohn und die Mutter. Früher, bis vor 20 Jahren, ist das die reichste Familie im Ort gewesen. Der Vater, Hermann Moosbach, hatte ein Geschäft für Herrenmoden und insbesondere Hüte. Er war einer der Honoratioren des Dorfes, bis das Geschäft vor zehn Jahren schließen musste. Nach der Trennung von seiner Frau lebt er noch im Dorf, ein paar Häuser weiter.
In seinen guten Tagen hat er diese junge Kindergärtnerin geheiratet, fast fünfundzwanzig Jahre jünger als er. Es war schwierig in der Ehe. Noch heute kann man es bei Dorffesten, spät nachts an der Sektbar, erleben, dass sich Männer aus Samtleben damit brüsten, die damals sehr hübsche junge Frau „rumgekriegt“ zu haben.
Die Familie ging ökonomisch bankrott, aus anderen Gründen. Zumindest soweit ich das weiß. Auch dazu gibt es Gerüchte. Wie auch immer. Die plausibelste Erzählung: Samtleben ist in die entstehende Industriestadt Salzgitter eingemeindet worden. Das dörfliche Geschäft für Herrenmoden und Hüte kann sich gegenüber der Konkurrenz im städtischen Einkaufszentrum nicht halten. Der Sohn Frieder ist jetzt schon seit zehn Jahren arbeitslos. Im Dorf wird er missachtet. Seit unserem ersten Kontakt hat sich Frieder Moosbach auf mich bezogen. Er steht jede Woche, manchmal jeden Tag vor dem Pfarrhaus und will irgend etwas erzählen. Wenn die Kirchglocken läuten, ist er der erste, der wissen will, wer gestorben ist. Ob es mir lieb ist oder nicht: Es ist eine Beziehung zwischen uns entstanden, dichter als zu vielen anderen Mitgliedern der Kirchengemeinde. Den Gottesdienst hat Frieder Moosbach noch nicht besucht.
Bis heute Abend.
Das Abendmahl beginnt.
„Die Herzen in die Höhe. Wir erheben sie zum Herren … Durch welchen Deine Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte, die Himmel und aller Himmel Kräfte samt den seligen Seraphim mit einhelligem Jubel dich preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbetend ohne Ende lobsingen: heilig, heilig ist Gott …“
Die Seelen der Kommunizierenden sind jetzt im Himmel. Ich spreche die Einsetzungsworte.
Wir beten gemeinsam das Vater Unser. Frieder Moosbach sucht sich schwankend einen Platz im Kreis der Feiernden. Als der Kelch bis zu ihm gekommen ist, beginnt er mit schwerer Zunge zu sprechen: „Herr Pastor, wir sind – … immer … gute Freunde gewesen. Nich wahr. Nix für ungut. Auf gute Nachbarschaft. Wennse mal was brauchen, wennse mal Hilfe brauchen, einen Nagel reinhauen oder so, können Se immer zu mir kommen.“
Die Himmelsreise endet mit einer Bruchlandung. Die Abendmahlsgäste sind verunsichert. Sie sehen verärgert aus. Missbilligende Blicke treffen Frieder Moosbach und mich. Erstmal die Lage beruhigen, denke ich. Ich werfe einen langen Blick auf mein Gegenüber, mit möglichst viel Freundlichkeit, Beruhigung und Ermahnung. Aber irgendwie erheitert mich dieser Auftritt auch. Ich spüre den Impuls, Frieder Moosbach zu verteidigen. Sicher: Das war eine Störung. Die Situation ist zerbrochen. Das geht nicht. Aber er hat doch auch recht, oder? In all seiner Betrunkenheit hat Frieder Moosbach Verbundenheit und Verpflichtung als wesentlichen Inhalt des Abendmahles ausgesprochen. Ist das falsch?
Zurück ins Pfarrbüro.
Vom Kirchengebäude geht der Weg zum Pfarrhaus durch den riesigen Pfarrgarten. Ich bewundere die letzten roten Blätter des Herbstes. Die ersten Aufbrüche beginnenden neuen Lebens. Noch ist das der reine Genuss. Wenn ich daran denke, dass auf diesem zweieinhalbtausend Meter großen Grundstück sieben Obstbäume stehen, wird mir ganz anders. Der Gärtner ist im vergangenen Herbst gekündigt worden. Kostengründe. Vera, meine Freundin aus Göttinger Zeiten – Geliebte stimmt schon längere Zeit nicht mehr – hat mir schon im letzten Herbst den Stinkefinger gezeigt, als ich mit der vorsichtigen Anfrage herüberkam, ob sie mit mir gemeinsam Birnen, Äpfel und Pflaumen abernten und einkochen möchte …
Im Dorf kannst du als Pastor sofort einpacken, wenn du den Garten nicht in Ordnung hältst. Und unglückseligerweise liegen Kirche und Pfarrhaus samt Pfarrgarten mitten im Ort und sind von allen Seiten einsehbar. Jeder kriegt mit, wenn hier das Obst vergammelt. Selbst schon, wenn der Rasen nicht gemäht wird. Aber soweit sind wir zum Glück noch nicht ins Jahr vorgedrungen …
Ich betrete das Pfarrbüro. „Ich habe für alle Kaffee gekocht“, verkündet Frau Weimer.
Sabine Weimer, Küsterin in der Kirche und Raumpflegerin im Pfarrhaus und Seele des ganzen Betriebs. Ich wüsste nicht, wo mir ohne sie der Kopf stehen würde. Jetzt steht sie mit dem Telefonhörer in der Hand neben meinem Schreibtisch im Dienstzimmer. „Es sind alle da. Nebenan. Ich habe hier Frau Trautwein in der Leitung …“
Sabine Weimer wirft mir einen wissenden Blick zu. Sie hat Veras Telefonate schon öfter für mich abgefangen.
„Ich kann jetzt nicht. Können Sie Frau Trautwein bitten, in einer halben Stunde anzurufen?“
Ich gehe ins Nachbarzimmer. Das ganze Erdgeschoss dieses riesigen vor zweihundert Jahren für eine mindestens zehnköpfige Pfarrersfamilie gebauten Hauses ist öffentlicher Bereich. Dienstzimmer, zwei große Räume, Küche, Toiletten. Die beiden großen Räume sind nur durch eine Schiebetür getrennt. Bei Großveranstaltungen – Gemeindeversammlung, Gottesdienst im Winter, Gemeindeseminar – werden die Räume zusammengelegt.
Die Pfarrwohnung ist im Stock darüber. Das Haus ist viel zu groß für einen alleinlebenden Pastor. Damals, als das Gebäude errichtet wurde, war die Größe angemessen. Auch das riesige Grundstück war ökonomisch sinnvoll. Pfarrer bekamen wenig Gehalt. Garten samt Vieh und Pferd wurden den Pfarrern und ihren Familien gestellt, um die Grundversorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen.
Ich bin alleinstehend. Zumindest offiziell. Für mich ist das alles ein bisschen überdimensioniert.
Ich gehe ins Nachbarzimmer. „Habt Ihr das schon gehört?“ „...Nein, das glaub ich doch nicht …!“
Freundliche Klönatmosphäre.
Marga Kleinschmidt, die Gemeindesekretärin, hat die Gesprächsführung übernommen, bis ich aus dem Gottesdienst zurück bin. Der neueste Klatsch aus dem Dorf.
Alle erheben sich. Ich werde freundlich begrüßt. Anwesend: Elisabeth Bothe, die Rechnungsführerin der Gemeinde, letzte Woche war ihr Siebenundsiebzigster. Großer Auftritt der Honoratioren des Dorfes zum Geburtstagskaffee. Zum Glück weiß Frau Bothe, dass ich morgens noch keinen Schnaps trinke. Das ist sonst das normale Ritual bei Geburtstagsbesuchen: „Ach, kommen Sie doch, Herr Pastor. Einer wird Ihnen nichts schaden.“ Und zwei Minuten später: „Ach, kommen Se schon, auf einem Bein kann man nicht stehen …“
Zum Glück bin ich auf dem Dorf groß geworden und kenne diese Spiele. Es gilt als großer Erfolg, wenn der Pastor mittags schon einen im Tee hat. Ich bitte in diesen Situationen immer um einen Kaffee. Der muss in der Regel erst zubereitet werden, die Gastgeber haben zu tun und sind froh, dass sie mir etwas anbieten können. Frau Bothe kennt mich aber und hat mir sofort fraglos einen Kaffee eingegossen.
„Und, Herr Pastor? Wie viele Leute waren heute im Gottesdienst?“ Die Frage kommt von Irmtraut Sassnitz. Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Milchbäuerin. Das Herz auf dem rechten Fleck. Das musste ich aber erst einmal rauskriegen. Wenn sie einen scharf anspricht, hat man zuerst immer das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Jedenfalls mir geht das so.
Damit ist die Runde komplett, alle anwesend, die beim Dienstfrühstück dabei sind. Sabine Weimer, Marga Kleinschmidt, Elisabeth Bothe, Irmtraut Sassnitz und ich. Wir treffen uns einmal in der Woche. Es geht um die Gemeindefinanzen. Die Sitzung des Kirchenvorstandes muss vorbereitet werden. Es geht um alles, was in der Gemeinde anliegt. Vor allem aber: Es wird geklönt. Dorftratsch, Gerüchte, das Neueste aus dem Leben von Groß Samtleben. Ich mag diese Art zu arbeiten. Was wirklich geklärt und entschieden werden muss, ereignet sich eher nebenbei. Im Fluss der Erzählstränge kommt das vor, ist aber nicht dominierend. Trotzdem schaffen wir meistens das Nötige.
„Vielleicht zwanzig Leute“, beantworte ich die Frage. „Und es gab einen kleinen liturgischen Unfall. Frieder Moosbach war in der Kirche. Einigermaßen schwer betankt.“ Ich erzähle die Szene. Schmunzeln, Gelächter.
„Eigentlich ist das nicht zum Lachen“, meint Sabine Weimer. „Ich weiß das noch ziemlich genau. Frieders Vater Hermann hatte gerade Schulentlassungsfeier, als ich eingeschult wurde. Damals hatten die noch Geld wie Heu. Friedrich Otto, also der Großvater von Frieder, war großer Nazi. Der hat in der Nazizeit schwer Geld gemacht. Als sein Sohnemann Hermann mit Siebzehn nach zwei Ehrenrunden endlich aus der Volksschule raus war, wurde das gefeiert, als wäre der gerade der Herr Doktor geworden. Das halbe Dorf war eingeladen. Damals gab es noch den Dorfkrug, wisst ihr, wo jetzt die Pizzeria versucht auf die Beine zu kommen. Bis zum frühen Morgen wurde getanzt und getrunken. Und heute? Alles futsch. Hermann kann mir richtig leidtun. Seine Frau hat ihm den Rest gegeben.“
„Das wissen wir ja nun wirklich nicht, wer wem den Rest gegeben hat.“ Elisabeth Bothe macht eine Handbewegung, als würde sie den Gesprächsfaden abschneiden wollen. „Hermann war doch schon um die fünfundvierzig, als er die Marlene geheiratet hat. Die hat er irgendwo bei einem Saufabend in Braunschweig aufgegabelt. So viel jünger als er. Die hat diesen Mann doch immer verachtet. Am Anfang konnte er sie beeindrucken mit seinem Geld und mit dem Geschäft für Herrenmoden und dem ‚Ersten Haus am Ort‘ und all dem Zirkus. Aber die Ehe war doch schon kaputt, bevor es mit dem Geschäft bergab ging. Ihr müsst doch bloß mal beim Handwerkerfest nach Mitternacht an der Sektbar stehen und euch anhören, wer von den strammen Kerlen aus Samtleben Marlene ‚rumgekriegt‘ haben will …“
„Das wollen wir gar nicht hören.“
Elisabeth Bothe wird richtig ernst. „Ach was. Ich möchte nicht wissen, was dieser ehrenwerte Hermann mit seiner jungen Frau angestellt hat. Ich bin ja nochmal fast zehn Jahre älter. Hermann war neunzehn, als der Krieg losging. Wie sein Vater strammer Nazi. Und dann diese Peinlichkeit, dass er nicht eingezogen wurde. Oder zumindest erst in den letzten Kriegstagen, als sie wirklich jeden genommen haben. Hermann hat im ganzen Dorf rumerzählt, dass er fürs Vaterland sterben will. Und dann haben sie bei ihm Tuberkulose entdeckt. Da musste unser Kriegsheld zu Hause bleiben. Und was hat er gemacht? Er hat im Dorf Krieg gespielt. Ich glaube den Gerüchten, die damals im Dorf rumgingen. Überall waren polnische Fremdarbeiter auf den Höfen. Junge Männer und Frauen. Hermann soll mindestens in drei Fällen Frauen auf brutale Weise misshandelt haben. Und dann hat er dafür gesorgt, dass sie ins Lager 21 kamen, damit sie ihn nicht verpfeifen konnten …“
Lager 21. Mir kommt ein Seniorennachmittag vor fast genau einem Jahr in den Sinn. Ich hatte ein paar Texte zum Vorlesen mitgebracht, nach Kaffee und Kuchen und Klönschnack. Die alten Leute mögen das, wenn ich ihnen was vorlese. Weil der 9. November 1988 hinter uns lag, der fünfzigste Jahrestag der Novemberpogrome, habe ich aus Anna Seghers „Das siebte Kreuz“ gelesen. Nach einer kleinen Pause kam das Gespräch in Gang. Für mich sehr erhellend. Die Frauen erzählten, wie es im Dorf war während der Kriegstage. Die Männer waren an der Front, und die Frauen hatten die Leitung in den landwirtschaftlichen Betrieben und im Haus. Sie waren es, die den Laden am Laufen hielten. In diesem Gespräch am Seniorennachmittag haben die Frauen auch von ihrer Angst vor dem Lager 21 erzählt. Nur die Frauen erzählen davon. Ich habe die anwesenden Männer befragt. Die behaupten, von diesem Lager nie etwas gehört zu haben. Vielleicht stimmt das, soweit sie an der Front waren. Ich habe es dabei belassen und nicht nachgehakt. Es war interessant genug, was die Frauen erzählten. Lager 21, das „Arbeitserziehungslager“ Watenstedt-Hallendorf, war ein Straflager für ausländische Zwangsarbeiter. Mitten im Salzgitter-Gebiet. Die Frauen in meinem Seniorenkreis bestanden darauf, dass das damals alle wussten und Angst davor hatten, auch in der deutschen Bevölkerung. Es kam richtig zu einem Streit mit den Männern, die bestritten, dass es so etwas gegeben habe. Irgendwann hatte Minna Schulze das Wort ergriffen, mittlerweile über neunzig, und ihr widersprach niemand so einfach. „Erinnert ihr euch, dass die Nazis eine bevorzugte Weise hatten, die Leute zu Tode zu bringen? Die haben sie zu Fuß bis nach Salzgitter-Drütte marschieren lasen und dort gezwungen, in der glühenden Schlacke zu arbeiten. Das hat so gut wie keiner überlebt.“
„Noch Kaffee?“ Sabine Weimer unterbricht mit einer dampfenden Kanne frisch gebrühtem Kaffee das Gespräch. Es entsteht eine Pause.
„Lass mal gut sein, Elisabeth.“ Sabine Weimer lässt sich das Wort nicht einfach nehmen. „Hermann hat auch nette Züge. Das Leben hat ihm schwer mitgespielt.“
„Können wir auch mal von was anderem reden als von der Nazizeit?“ Irmtraud Sassnitz schaltet sich ein. Ich kenne ihre Sorge, dass die Stimmung im Dorf schlecht ist und kippen könnte. Es wird Stimmung gemacht, seitdem eine historische Untersuchung über die Enteignung jüdischen Besitzes in Groß Sassnitz von der Braunschweiger Uni veröffentlicht wurde. Die Familien, die damals die Nutznießer waren und die Häuser der jüdischen Vorbesitzer heute immer noch bewohnen, haben einiges Gewicht im Dorf. „Außerdem haben wir mit dem aktuellen ‚Lager‘ genug Probleme, nicht wahr? Der Gemeindeabend letzte Woche zu ‚Schacht Konrad‘ war gut besucht, oder?“
Auf dieses Thema springen alle an. Groß und Klein Samtleben liegen nur wenige Kilometer entfernt von dem geplanten Endlager für radioaktive Abfälle in der alten Grube ‚Schacht Konrad‘. Die Landwirte im Dorf machen sich Sorgen, ob sie ihre Produkte noch vermarkten können, wenn die aus radioaktiv belastetem Boden heraus wachsen. Zuckerrüben und Weizen. Auch die Vermarktung der Fleischproduktion wird beeinträchtigt, wenn die Kühe auf Wiesen über Stollen voller radioaktivem Müll grasen. Die Dorfbevölkerung ist politisch eher uninteressiert. Bis auf einige Leute, die zur Gemeinde erst Kontakt aufgenommen habe, seitdem ich als Pastor vor Ort bin. Die Grünen gibt es in der Bundesrepublik jetzt seit neun Jahren, und trotz der konservativen Grundstimmung im Dorf gab es bei der letzten Kommunalwahl einen Achtungserfolg. Genau. Wegen ‚Schacht Konrad‘. Es geht den Leuten im Dorf nicht um Parteinahme zu ökologischen Fragen im Allgemeinen. Aber wenn es an die eigenen Verdienstmöglichkeiten geht, verstehen sie keinen Spaß.
Wir sprechen eine Weile über den Gemeindeabend. Große Zufriedenheit über die große Resonanz und die angeregte Stimmung. Zum Abschluss wurden die beiden Kästen Bier, die ich von der Gemeinde zur Verfügung gestellt hatte, innerhalb einer halben Stunde geleert. Man konnte schließlich das eigene Wort nicht verstehen, so angeregt wurde debattiert. Als ich die Leute gegen Mitternacht rausgeschmissen habe, verabschiedeten sich alle mit Handschlag, einige angeheitert.
„Wieviel hat uns der Abend gekostet?“
Das ist das Signal, zu den Dienstgeschäften zu kommen. Elisabeth Bothe teilt ihre handschriftliche Aufstellung von Ausgaben und Einnahmen der letzten vier Wochen aus. Für den Gemeindeabend Kosten für zwei Kästen Bier und zehn Tüten Kartoffelchips. Das lässt sich verkraften. Wir haben andere Probleme, die die Gemeindekasse schwer belasten. Vor allem die Restauration des Flügelalters in der Schlosskirche zu Groß Samtleben …
2.
Ich bin rechtschaffen müde, als ich mich eine gute Stunde später in die Mittagspause verziehe. Eine Treppe hoch, und schon ist meine täglich x-mal wiederkehrende Tour von den Diensträumen des Pfarramtes in meine Wohnung geschafft. Die Treppe kostet mich heute allerdings einiges an Anstrengung. Gottesdienst und danach Dienstfrühstück … Zum Glück kommt das nur einmal im Monat vor.
Ich gönne mir einen kleinen Whisky und nehme das Glas mit zum Sofa. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass das nicht überhand nimmt mitten am Tage. Aber ich habe das im Griff. Glaub ich wenigstens.
Ich will gerade sanft eindösen, da fällt mir ein, dass Vera angerufen hat und wahrscheinlich auf meinen Rückruf wartet. Ich wuchte mich wieder hoch und gehe rüber in mein privates Arbeitszimmer. Auf dem Weg gehe ich in der Küche vorbei und hole mir noch einen Schluck Whisky. Brauche ich jetzt. Die Wohnung ist viel zu groß für mich. Ich habe drei Zimmer versiegeln lassen, um Miete zu sparen. Ich nutze das größte Zimmer, das die Gemeinde extra für meinen Einzug mit Parkett belegt hat, als Wohnzimmer. Ziemlich gemütlich mit meinem hundertundzwanzig Jahre alten Grotjahn-Steinweg-Flü-gel, einem riesigen Sofa, einer Sitzecke, einem vor sich hindämmernden Asparagus, einer alten Kommode, die ich von einer Erbtante übernommen habe. Neben dem Wohnzimmer bewohne ich ein ebenso großes privates Arbeitszimmer mit Blick auf den barocken Kirchturm. Sehr animierend beim Vorbereiten der Gottesdienste und beim Schreiben von Predigten. Außerdem das Schlafzimmer, das Vera in dem ganzen Jahr, in dem ich hier lebe und arbeite, vielleicht zweimal von innen gesehen hat. Und dann wollte sie nicht mit mir schlafen, weil sie bei dem einen Besuch Kopfschmerzen hatte und das andere Mal ihre Tage. Küche und Bad mit einer großen steinernen Badewanne. Mein Ruheort für harte Zeiten.
In der Küche lümmelt sich Kalle rum, der halbjährige Kater. Mitten in der Katerpubertät und entsprechend kratzbürstig. Irgendwann vor einem halben Jahr hatte ich die Eltern einer meiner Konfirmandinnen besucht, sehr nette Menschen auf einem der kleineren Bauernhöfe im Dorf. Die haben mir die damals gerade sechs Wochen alten Katzengeschwister Kalle und Lilo geschenkt. „Damit sie nicht so allein sind, Herr Pastor.“ Kalle inszeniert sich als Draufgänger, kackt mindestens einmal die Woche in den Flur, holt sich seine Abreibung und tut dann unendlich beleidigt. Er ist, soweit ich das sehen kann, strohdumm. Einmal hat er beim Nachbarn in der Scheune Motoröl aufgeleckt und konnte eine Woche lang nicht leben und nicht sterben. Ich war jeden Tag ein paar Stunden mit ihm beim Tierarzt. Das verbindet. Seine Schwester Lilo ist unauffällig, clever und eine rasante Jägerin. Leider neigt sie dazu, ihre Beute ab und zu unter meinem Schreibtisch auszuweiden. Sie mag am liebsten Amseln.
Essen. Eine unfassbare Sauerei. Blut, Federbüschel, ausgeweidetes Vogelfleisch unter dem Schreibtisch. Und eine gefährlich knurrende Katze, die auf Lob und Belohnung wartet. Ich habe eine Vorrichtung vom Küchenfenster zum Dach des Pfarrhauses gebaut. Die Katzen können selbsttätig nach draußen. Vom Dach des Pfarrhauses über das Dach der Garage bis zu den Zweigen des Birnbaumes, der sein Geäst über dem Garagendach ausbreitet.
Ich schütte mir zwei Finger breit ein und nehme das Glas mit zum Telefon im Arbeitszimmer. Bushmills. Irischer Whisky. Ich trinke ausschließlich schottischen oder irischen Whisky. Aber dafür ordentlich. Amerikanischen Whisky rühre ich nicht an. Kein Antiamerikanismus. Bloß klare Erkenntnis in die Notwendigkeit guten Geschmacks.
„Hallo Vera, schöne Frau. Wie geht’s, wie steht’s?“
Ich habe schon leicht einen im Tee.
Vera ertrage ich schon seit einiger Zeit nur mit Whiskeyunterlage.
„Wie schön, dass du anrufst, mein Schatz.“
Mein Schatz? Ich suche Ironie in ihrer Stimme. Es ist aber was anderes. Sie klingt aufgekratzt, ein wenig atemlos. Und verunsichert.
Eigenartige Mischung.
„Ich freu mich auch, deine Stimme zu hören.“
Ich bin vorsichtig. Unsere letzte Begegnung von Angesicht hat in einem ziemlichen Desaster geendet. Sie ist grußlos ins Auto gestiegen und weggefahren, nachdem sie mir erklärt hat, dass sie mein Leben auf diesem Dorf völlig inakzeptabel findet. Dass sie nicht versteht, wie ich meine wissenschaftliche Karriere habe aufgeben können für dieses Sparflammen-Leben.
Sparflammen-Leben. Sollte zum Unwort unseres aktuellen Beziehungsjahres werden. Als ob das Leben zwischen Bibliothek, Kneipe, Proseminaren und mehr oder weniger auf die eigene Karriere konzentrierten Freunden in Göttingen das wilde freie Leben wäre. Ich war idiotisch genug, sie bei dieser letzten Face-to-Face-Begegnung zu fragen, ob sie mich heiratet. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Wahrscheinlich wollte ich dieses Lähmende, Unklare, Bedrückende unserer Begegnungen aufbrechen. Vera hat auf diese Frage überhaupt nicht geantwortet. Sie hat genauer gesagt von da an bis zu ihrer Abreise kein Wort mehr mit mir gesprochen.
„Schatz, was hast du heute so gemacht? Hattest du gute Begegnungen bei deiner Arbeit?“
Meine Güte. Sie hat mich noch nie nach meiner Arbeit gefragt, seitdem ich Dorfpastor bin. Sie hat mir vielmehr Vorträge gehalten, warum es in diesem Lebensabschnitt wichtig ist, an der wissenschaftlichen Karriere zu arbeiten.
Wenn du überhaupt mal was aus seinem Leben machen willst …
Kinder kommen bei einer solchen Lebensplanung natürlich nicht in Frage. Das war vor vier Jahren, in der Verliebtheitsphase unserer Beziehung, mal Thema gewesen. Udos Songzeile „und meinetwegen dreizehn Kinder, alle total verrückt“ hatte uns damals ins Träumen gebracht. „Oh Baby, ich bin absolut verzückt.“
Das war mal.
Verdammt lang her.
„Vera, was willst du? Was ist los? Ich bin müde. Kannst du bitte auf den Punkt kommen?“
Okay. Das ist nicht nett.
Ich habe keine Lust, nett zu sein.
Ich habe keine Kraft dazu.
Sie schaltet sofort um. Ihre Stimme wird ein paar Grade kälter.
„Ich dachte, es interessiert dich, dass ich mit Egon nach Florenz fahren werde.“
Mann.
Das sitzt. Florenz war immer unsere gemeinsame Stadt. Das alte Hotel mit Blick auf den Dom, wo wir uns bis zur Besinnungslosigkeit geliebt haben …
Egon. Dieser aufgepumpte Politikfunktionär. Mittelpunkt der Anti-AKW-Proteste und der Demonstrationen gegen die Nachrüstung Anfang der achtziger Jahre in Niedersachsen. Seitdem angehender Star bei den Grünen. Solange ich noch in Göttingen war, saß er Abend für Abend im Café Kadenz und hielt Hof, gewährte seine Gunst mal dieser und mal jener, alle schönen Frauen Göttingens kamen vorbei und wollten ein gutes Wort von ihm erhaschen.
Vera hat sich Egon geangelt.
Das ist ja mal ne Nachricht.
Ich werde den Teufel tun und zu diesem Namen irgendwas verlauten lassen.
Scheißkerl. Eingebildeter Idiot.
„Und wann?“ Ich habe meine Stimme halbwegs unter Kontrolle.
„Egon und ich wollen übermorgen los. Wir wollen drei Wochen bleiben …“
Höre ich einen fragenden Unterton? Eine leise Bitte um Zustimmung oder wenigstens um Verständnis?
Ich schlucke jedes Gefühl runter. Ich will nicht mehr. Nicht jetzt. Nie mehr. Soweit ich das jetzt entscheiden kann.
„Na denn mal los“, sage ich möglichst unbeteiligt. „Die Stadt kennst du ja. Da kannst du ja richtig toll Reiseführerin spielen. Und Egon kann was für seine wissenschaftliche Karriere tun …“
„Lukas, bitte...“
„Was?“
Plötzlich höre ich ein Schluchzen. „Kannst du mir nicht Glück wünschen?“
„Okay, ich wünsch dir Glück“, sage ich und lege auf.
Ich fühle nichts.
Zumindest im Moment nicht.
Ich gehe runter und gucke in der Garage nach, ob mir Susanne Fischer was zum Essen hingestellt hat.
Susanne Fischer, sechsundvierzig Jahre, Hausfrau in Groß Samtleben. Mitglied im Kirchenchor. Ihr Ehemann ist Rechnungsführer in einem der beiden Karnevalsvereine des Dorfes. Zwanzig Jahre älter als sie. Längst pensioniert. Längst viel zu weit aus dem Leim gegangen. Trockener Alkoholiker, trauriger Star der Groß Samtlebener Karnevalssitzungen.
Susanne Fischer ist vermutlich in mich verliebt vom ersten Tag an. Als der Umzugswagen gerade weggefahren war, stand sie mit Brot und Salz in der Tür. „Herr Pastor, wir sind alle sooo froh, dass sie da sind.“
Ich versuche so gut es geht, mich nicht verstricken zu lassen.
Ich bitte sie bei jeder Chorprobe, damit aufzuhören, mir Mittagessen in die Garage zu stellen. „Aber Sie sind doch so allein, Herr Pastor.“
Es hilft nichts. Sie macht damit weiter.
Meistens versuche ich, die verkochten Kartoffeln und die Mehlschwitzen-Soße und zerfaserten Gulaschstückchen Kalle und Lilo unterzujubeln.
Sobald ich ihnen das in den Napf packe, hauen sie durchs Küchenfenster ab und verschwinden über die Dächer.
Heute brauche ich diese Liebesgabe.
Für meine Seele.
Weichgekochte Nudeln mit roter Soße und Gehacktes. Okay.
Ich gieße mir das Whiskeyglas halbvoll, wärme das Essen in der Pfanne an, verspeise alles und geh schlafen.
Bis zur Kirchenvorstandssitzung heute Abend bin ich wegen Erledigung geschlossen.
3.
Am nächsten Morgen komm ich schlecht aus den Federn.
Der Wecker klingelt um sieben.
Ich habe definitiv zu viel getrunken gestern, auch noch nach der Sitzung des Kirchenvorstandes.
War unproblematisch. Bis auf zwei Punkte.
Es bleibt dabei, dass wir für das riesige Pfarrgrundstück keinen neuen Gärtner einstellen.
Aus Kostengründen. Wir haben ein strukturelles Haushaltsdefizit. Ein Gärtner – viel zu teuer.
Ich werde bis zur nächsten Sitzung ein Dienstschaf beantragen. Oder zwei.
Ich habe nicht Theologie studiert, um den Rasen zu mähen.
Eingebildet? Vielleicht.
Diesen Satz würde ich nie erwähnen. Im Kirchengemeinderat nicht. Im Dorf auch nicht.
Und der eigentlich haarige Punkt: Die Restauration des Flügelaltars aus dem 16. Jahrhundert in der Schlosskirche. Der Altar stammt aus der Vorgängerkirche, die für den Barockbau aus Anfang des 18. Jahrhunderts abgerissen wurde, und wurde in den 1870ern bei einer Visitation zufällig auf dem Dachboden gefunden.
Wunderschön. Unschätzbar wertvoll. Und mittlerweile dringend restaurationsbedürftig.