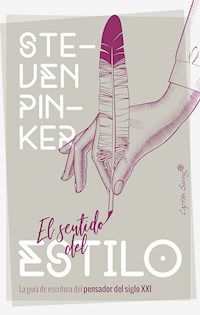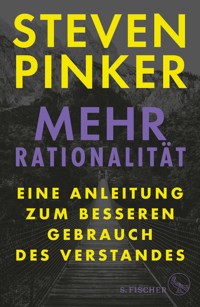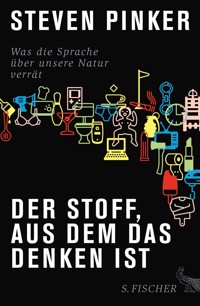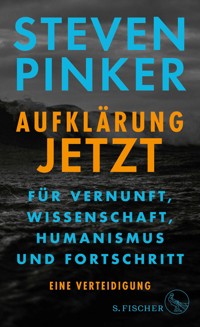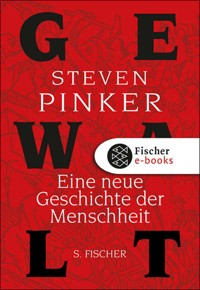19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie Gemeinsames Wissen unsere Gesellschaft bildet – die erste umfassende Theorie Von der Börse über internationale Beziehungen bis hin zu privaten Verabredungen: Tagtäglich treffen wir Annahmen darüber, was andere Menschen wissen und denken, und richten unser Handeln danach aus – oft, ohne uns dessen bewusst zu sein. Steven Pinker befasst sich in seinem neuen Buch damit, wie wir den Wissensstand anderer Menschen einschätzen. Anhand von zahlreichen Beispielen aus der Spieltheorie, der Geschichte und unserem Alltag zeigt er so klar wie unterhaltsam, dass unsere alltäglichen Interaktionen auf komplexesten Überlegungen beruhen – und warum diese Tatsache unser Zusammenleben entscheidend prägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Steven Pinker
Wenn alle wissen, dass alle wissen...
Gemeinsames Wissen und sein verblüffender Einfluss auf Geld, Macht und das tägliche Leben
Über dieses Buch
Wie Gemeinsames Wissen unsere Gesellschaft bildet – die erste umfassende Theorie
Von der Börse über internationale Beziehungen bis hin zu privaten Verabredungen: Tagtäglich treffen wir Annahmen darüber, was andere Menschen wissen und denken, und richten unser Handeln danach aus – oft, ohne uns dessen bewusst zu sein. Steven Pinker befasst sich in seinem neuen Buch damit, wie wir den Wissensstand anderer Menschen einschätzen. Anhand von zahlreichen Beispielen aus der Spieltheorie, der Geschichte und unserem Alltag zeigt er so klar wie unterhaltsam, dass unsere alltäglichen Interaktionen auf komplexesten Überlegungen beruhen – und warum diese Tatsache unser Zusammenleben entscheidend prägt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Steven Pinker, geboren 1954, studierte Psychologie in Montreal und an der Harvard University. 20 Jahre lang lehrte er am Department of Brain and Cognitive Science am MIT in Boston und ist seit 2003 Professor für Psychologie an der Harvard University. Steven Pinkers Forschungen beschäftigen sich mit Sprache und Denken, daneben schreibt er regelmäßig u.a. für die »New York Times« und den »Guardian«. Sein Werk ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel »When Everyone Knows that Everone Knows...Common Knowledge and The Mysteries of Money, Power, and Everday Life« bei Scribner, New York, ein Imprint von Simon & Schuster, LLC
© 2025 by Steven Pinker. All rights reserved.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg nach einer Idee von Daniele Roa / Penguin Press
ISBN 978-3-10-491719-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Vorwort
Kaiser, Elefanten und dicke Klöpse
Gemeinsames Wissen und gesunder Menschenverstand
Spiel und Spaß
Die Gedanken eines Gedankenlesers lesen
Das Institut für Sozialbeziehungen
Lachen, weinen, erröten, anstarren und mit Blicken töten
Andeutungen
Der Cancel-Instinkt
Radikale Ehrlichkeit, rationale Heuchelei
Anhang
Literatur
Register
Für meine Studierenden
Vorwort
Als Kognitionswissenschaftler denke ich schon mein Leben lang darüber nach, wie Menschen denken. Demgemäß fasziniert mich ganz besonders, wie Menschen über das nachdenken, was andere Menschen denken, und wie sie darüber nachdenken, wie andere Menschen über das nachdenken, was sie denken, und wie sie darüber nachdenken, wie andere Menschen über das nachdenken, worüber sie nachdenken, was sie denken. Obwohl uns solche Überlegungen schwindelig machen, stellen wir sie, zumindest stillschweigend, Tag für Tag an. Der Fachbegriff dafür, der sich letztlich durchgesetzt hat, lautet gemeinsames Wissen (common knowledge).
Die Theorie des gemeinsamen Wissens, deren Ursprünge in der Spieltheorie und Philosophie liegen, hilft uns, eine Vielzahl von rätselhaften Phänomenen des sozialen Miteinanders besser zu verstehen. Zum ersten Mal bin ich darauf gestoßen, als ich The Stuff of Thought (dt. Der Stoff, aus dem das Denken) ist geschrieben habe. Sprache fasziniert mich, und so hatte ich mich schon lange gefragt, warum wir so oft nicht klipp und klar sagen, was wir meinen, sondern uns in Anspielungen und Doppeldeutigkeiten ergehen und dabei auf die Fähigkeit unseres Gegenübers vertrauen, zwischen den Zeilen zu lesen. Damals habe ich behauptet, dass unverhohlene Offenheit im Gegensatz zu vornehmen Umschreibungen gemeinsames Wissen erzeugt und gemeinsames Wissen soziale Beziehungen besiegeln kann oder auch einmal für deren Ende sorgt.
Im vorliegenden Buch führe ich diese Theorie weiter aus und zeige, inwiefern gemeinsames Wissen auch grundlegende Merkmale gesellschaftlicher Organisation – wie politische Macht und Finanzmärkte – erklärt, darüber hinaus spezifisch menschliche Verhaltensweisen wie Lachen und Weinen sowie unzählige Kuriositäten des privaten und öffentlichen Lebens, wie Spekulationsblasen und Kurseinbrüche, Aggression im Straßenverkehr, anonyme Spenden, lange Abschiedszeremonielle, Revolutionen aus dem Nichts, Cyber-Mobbing und die akademische Cancel Culture. Nach dem Lesen des Buches durchschauen Sie hoffentlich Phänomene, die ich mir nie erklären konnte, wie Gaslighting, Kardashian-Prominenz (berühmt zu sein, weil man berühmt ist), gespielte Empörung (»Ich bin entsetzt, schockiert, ich musste feststellen, dass hier Glücksspiele stattfinden!«), »rote Linien« in internationalen Beziehungen und der psychologische Unterschied zwischen »CC« und »BCC« im E-Mail-Verkehr.
Ich hoffe Sie davon überzeugen zu können, dass dieser Rundumschlag kein Symptom von Größenwahn ist. Mit dem Konzept des gemeinsamen Wissens lässt sich tatsächlich ungeheuer viel erklären. Dieses mentale Meisterwerk liegt einem Markenzeichen der menschlichen Natur zugrunde: Individuen vermögen ihre Entscheidungen so aufeinander abzustimmen, dass alle davon profitieren, und dies versetzt unsere Spezies in die Lage, funktionierende Gemeinschaften zu bilden – von Ehepaaren bis zu Staaten. Ob wir harmonieren oder uns entzweien, beruht, so werde ich hoffentlich aufzeigen können, auf unserem Bemühen, gemeinsames Wissen zu schaffen, aufrechtzuerhalten oder zu verhindern.
Dies ist das zweite meiner populärwissenschaftlichen Werke, in dem meine eigene Forschung im Vordergrund steht, und wie auch das Buch Words and Rules (dt. Wörter und Regeln) widme ich es meinen Doktoranden und Postdocs, die die Studien gemeinsam mit mir durchgeführt haben. Wer an einer Hochschule lehrt, schätzt am allermeisten, von den eigenen Studierenden lernen zu dürfen. Ich hatte das Glück, dass die folgenden Personen ihr Wissen mit mir teilten: Julian De Freitas, Peter DeScioli, Omar Sultan Haque, Moshe Hoffman, Yuhui Huang, James Lee, Miriam Lindner, Maxim Massenkoff, Jason Nemirow, Laura Niemi, Lawrence Ian Reed, Kyle Thomas und Dylan Tweed. Ein besonderes Dankeschön geht an Peter DeScioli für seine scharfsinnigen und tiefgründigen Kommentare zum ersten Manuskriptentwurf.
Mehrere Personen unterstützten mich geduldig mit ihren Fachkenntnissen: Scott Aaronson, Robert John Aumann, Herbert Clark, Peter DeScioli, Rebecca Goldstein, Dacher Keltner, Eric Maskin, Dov Samet und Jeannie Suk Gersen. Andere lieferten Kommentare zu Kapitelentwürfen: Charleen Adams, Cory Clark, Tyler Cowen, Alan Fiske, Komi Frey, Robin Hanson, Moshe Hoffman, Greg Lukianoff, Michael Macy, Jason Nemirow, Bruce Schneier, Dan Sznycer und Jessica Tracy. Antworten auf Fragen oder Anregungen erhielt ich von Paul Bloom, Yi-Chia Chen, Eve Clark, Jeffry Frieden, Bill Gates, Andrew Gelman, Joshua Goldstein, Marc Hauser, Coleman Hughes, Jillian Jordan, Peter Kinderman, Gary King, Sarah Kious, Louis Liebenberg, Lucy Matthew, Dani Passow, Dan Schacter, Richard Shweder, Lawrence Summers, Philip Tetlock, Jeffrey Watumull, David Wolpe und Hirschy Zarchi. Bob Woods half mir fachkundig bei der Beschaffung von Forschungs- und Bibliographie-Material. Ich danke ihnen allen.
Dank gilt auch Rick Horgan, meinem Redakteur bei Scribner, für Ermunterung und Anleitung sowie meinem Freund und Literaturagenten John Brockman. Ein besonderer Dank geht an Katya Rice, die das Manuskript korrekturgelesen hat, für unsere nunmehr zehnte Zusammenarbeit in vierzig Jahren.
Drei Menschen, denen ich bereits Bücher gewidmet habe, sind während der Entstehung dieses Buches verstorben. Zum ersten Mal geht ein Buch von mir in den Druck, dessen Entwurf nicht von meiner Mutter und wichtigsten imaginären Leserin, Roslyn Wiesenfeld Pinker, begutachtet wurde. Von uns gegangen sind auch meine lieben Freunde und Inspirationsquellen John Tooby und Donald Symons. Sie alle haben diesem Buch mit Beispielen, Ideen und Stimmen ihren Stempel aufgedrückt. Schmerzlich vermisst werden überdies Daniel Dennett und Daniel Kahneman, die mich stark beeinflusst haben.
Die für mich wichtigste Quelle geistiger Inspiration ist zugleich meine Lebenspartnerin, und ich danke Rebecca Newberger Goldstein dafür, dass sie mir fortwährend zeigt, was wirklich zählt – sei es bei der Arbeit oder im privaten Leben. Es ist mir eine Freude, auch allen anderen Mitgliedern meiner liebevollen Familie meinen Dank auszusprechen: Yael, Solly, Danielle, Kai, Susan, Martin, Eva, Carl, Eric, Rob, Kris, Jack und David.
1
Kaiser, Elefanten und dicke Klöpse
Was ist gemeinsames Wissen und warum ist es von Bedeutung?
Als der kleine Junge sagte, der Kaiser habe ja gar nichts an, verkündete er etwas, was ohnehin schon alle wussten. Und trotzdem erfuhr dadurch jeder auch etwas Neues. Indem er herausposaunte, was alle Schaulustigen in Hörweite sehen konnten, sorgte er dafür, dass sie nun wussten, dass auch alle anderen wussten, was sie selbst wussten, dass alle anderen wiederum das wussten und so weiter. Und das veränderte ihre Haltung gegenüber dem Kaiser, von unterwürfiger Ehrerbietung zu Spott und Hohn.[1]
Hans Christian Andersens unsterbliches Märchen macht sich eine folgenschwere logische Unterscheidung zunutze. Bei privatem Wissen weiß Person A etwas und Person B weiß es auch. Bei gemeinsamem Wissen weiß A etwas und B weiß es auch, aber darüber hinaus weiß A, dass B es weiß, und B weiß, dass A es weiß. Und außerdem weiß A, dass B weiß, dass A es weiß, und B weiß, dass A weiß, dass B es weiß, und immer so weiter.[2]
»Des Kaisers neue Kleider« dramatisiert zwei Merkmale des gemeinsamen Wissens, die es nicht nur zu einem umwerfenden logischen Konzept machen, sondern auch zu einem Schlüssel für das Verständnis menschlichen sozialen Lebens. Zum einen muss man gemeinsames Wissen nicht durch endloses Grübeln über die Vorgänge im Hirn anderer Personen herleiten (»Ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass du weißt …«), wozu kein Sterblicher jemals in der Lage wäre. Es kann sekundenschnell durch ein nicht zu ignorierendes Ereignis, zum Beispiel einen öffentlich geäußerten Satz, übermittelt werden. Zum anderen ist der Unterschied zwischen privatem Wissen, auch wenn viele darüber verfügen, und gemeinsamem Wissen nicht bloß eine logische Spitzfindigkeit; es kann die Wissenden in koordiniertem Handeln vereinen und manchmal den gesellschaftlichen Status quo als falsch entlarven.
Die folgenden kleinen Cartoons, in denen Wissen als Sehen dargestellt wird, sollen bei der Differenzierung der verschiedenen Arten von Wissen helfen. Im ersten geht es um privates Wissen. Beide Beobachter sehen etwas, aber keiner sieht, dass auch der andere es sieht.
Als Nächstes geht es um einen Zustand, den wir als reziprokes Wissen bezeichnen: Beide Beobachter sehen das Ereignis und darüber hinaus, dass auch der andere es sieht. Doch da beide den jeweils anderen durch ein Schlüsselloch beobachten, kann man nicht von gemeinsamem Wissen sprechen, denn keiner von beiden weiß, dass er beim Sehen gesehen wurde.
Der letzte Cartoon illustriert gemeinsames Wissen. Beide sehen, dass der jeweils andere das Ereignis sieht, und darüber hinaus, dass sie selbst dabei vom anderen gesehen werden. Daraus können sie eine beliebig lange Seh-Ereignis-Kette ableiten.
Was geht in den Köpfen der Beobachter vor sich, wenn sie sich in einer Situation befinden, die gemeinsames Wissen erzeugt? Es muss nicht gleich eine Matrjoschka-Puppe gefüllt mit »Er weiß, dass sie weiß, dass er weiß, dass sie weiß …« sein:
In unserem Kopf dreht sich bereits alles, wenn wir auch nur zwei Ebenen von ineinander verschachtelten Gedanken zu bewältigen haben, und gemeinsames Wissen erfordert unendlich viele davon, die unmöglich in einen begrenzten Schädel passen. Höchstwahrscheinlich genügt uns die simple Intuition, dass das Ereignis »öffentlich« oder »vor aller Augen« stattfindet:
In diesem Buch möchte ich Ihnen die schwer zugängliche, aber bedeutsame Forschung über gemeinsames Wissen sowie einige eigene Ideen dazu nahebringen und aufzeigen, inwiefern dieses Konzept viele rätselhafte Phänomene in unseren öffentlichen Angelegenheiten wie auch im Privatleben erhellt. Die mir bekannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit dem Konzept beschäftigt haben – Mathematiker, Ökonomen, Philosophen, Linguisten, Informatiker –, sehen darin allesamt einen entscheidenden Schlüssel zum Verständnis der sozialen Welt. Es ist ihnen jedoch nicht leichtgefallen, ihre Erkenntnisse einem breiten Publikum zu vermitteln, und sie fragen sich oft, wie es dem menschlichen Geist gelingt, einen scheinbar höchst abstrusen Zustand des Wissens in den Griff zu bekommen. Dieses Buch versucht aus dem Blickwinkel der Psychologie und Kognitionswissenschaft, fehlende Antworten zu finden.[3]
Die wichtigsten Ideen sind folgende. Erstens: Es besteht ein logischer Unterschied zwischen gemeinsamem Wissen (im fachsprachlichen Sinne) und privatem Wissen. Etwas in der Öffentlichkeit zu erfahren, selbst wenn bereits alle darüber Bescheid wissen, kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Zweitens: Die wichtigste Veränderung, die gemeinsames Wissen bewirkt, ist die Fähigkeit zur Koordination – zwei oder mehr Personen mit gemeinsamem Wissen können dank komplementärer Entscheidungen, zu denen sie bei privatem Wissen allein nicht den Mut gehabt hätten, voneinander profitieren. Drittens: Weil gemeinsames Wissen so machtvoll ist, sind Menschen intuitiv dafür empfänglich, fast so, als besäßen wir ein Sinnesorgan für dieses logische Konzept. Viertens: Dieses Bewusstsein hat unsere Spezies befähigt, unser Verhalten in sozialen Netzwerken wie Gemeinschaften, Ökonomien und Nationen zu koordinieren. Demnach erklären sich zahlreiche Eigentümlichkeiten öffentlichen Lebens – seine automatisierten Rituale, Konventionen und Normen – als Lösungen für Koordinationsprobleme. Gleiches gilt für einige krankhafte Auswüchse des öffentlichen Lebens, darunter Modefimmel, Mobs, Paniken, Spekulationsblasen und Schweigespiralen. Sechstens: Persönliche Beziehungen – unsere Bande zu Familie, Freundinnen, Geliebten, Vorgesetzten, Untergebenen, Nachbarn, Kolleginnen und Transaktionspartnern – sind ebenfalls Koordinationsspiele und müssen durch gemeinsames Wissen zementiert werden. Und schließlich: Weil all diese koordinativen Gleichgewichte mit Vergünstigungen und Verpflichtungen einhergehen, finden wir häufig Schlupflöcher, indem wir verhindern zu erfahren, was alle wissen, Rituale erschaffen, um Freundlichkeit zu heucheln, vorgeben, keine Ahnung zu haben, erraten, worauf jemand hinauswill, und unangenehme Gedanken beiseiteschieben. Anders gesagt: Viele private und politische Spannungen entstehen aus dem Bestreben, gemeinsames Wissen zu verbreiten oder zu unterdrücken.
Weil gemeinsames Wissen der Dreh- und Angelpunkt dieses Buches ist, muss ich ein paar Worte über den Begriff common knowledge verlieren, den ich hier nicht in seiner alltagssprachlichen Bedeutung verwende. In der englischen Umgangssprache meint man damit etwas, das viele oder die meisten Leute wissen, insbesondere offene Geheimnisse, wie »It’s common knowledge that the police around here can be bribed«, also »Es weiß doch jeder, dass die hiesige Polizei bestechlich ist«. Das ist praktisch das Gegenteil von dem, was der Fachterminus aus der Spieltheorie und Philosophie besagt, den wir hier unter die Lupe nehmen. Ebenso verwirrend ist, dass common knowledge im fachsprachlichen Sinne (oder auch der deutsche Begriff gemeinsames Wissen, Anm.d. Übers.) nicht wörtlich zu verstehen sind, sprich als »Wissen, dass Menschen miteinander gemein haben«, denn das könnte identischem privaten Wissen entsprechen, bei dem alle das Gleiche wissen, ohne zwangsläufig zu wissen, dass auch die anderen es wissen.
Transparenter ist da schon der Begriff mutual knowledge, also wechselseitiges Wissen, womit gemeint ist, dass Menschen ihr Wissen bewusst spiegeln oder bündeln. In der Linguistik verwendet man den Ausdruck manchmal, wenn man sich auf das gemeinsame Wissen zweier Gesprächspartner bezieht, und in diesem Sinne habe ich ihn in Der Stoff, aus dem das Denken ist verwendet.[4] In der Fachliteratur hat mutual knowledge jedoch nach und nach eine andere Bedeutung erhalten – entweder »verbreitetes privates Wissen« (wie in der ersten Abbildung) oder »Ebenen von reziprokem Wissen« (wie in der zweiten).[5] Weitere Ausdrücke für common knowledge sind unter anderem open knowledge, conspicuous knowledge, public knowledge, interactive knowledge, shared reality, shared awareness, collective consciousness und common ground. Der Begriff common knowledge hat sich jedoch, auch wenn er irreführend ist, unter den Fachleuten etabliert und darum verwende ich ihn hier ebenfalls.
Erfreulicherweise bietet dieses Zugeständnis die Gelegenheit, den großen Einfluss von gemeinsamem Wissen im menschlichen Leben aufzuzeigen, und zwar gleich anhand der Sprache selbst. Im gängigen Vokabular sind Logik und Grammatik oft nebensächlich. Niemanden kümmert es, dass zügellos ursprünglich »ohne Zügel« bedeutete oder dass man in einem Badezimmer nicht unbedingt baden kann. Und wie Voltaire witzelte, war das Heilige Römische Reich weder heilig noch römisch noch ein Reich. Wörter oder feststehende Ausdrücke besitzen eine Bedeutung nicht, weil man diese aus den Wortbestandteilen ableitet, sondern weil man schlicht davon ausgeht, dass jeder sie genauso interpretiert wie man selbst.[6]
Sprache hat den Zweck, unsere Handlungen zu koordinieren – so geben Sie mir den Pfeffer, wenn ich Pfeffer haben möchte, und das Salz, wenn ich Salz haben möchte. Die Sprache ermöglicht uns das, weil sie eine Konvention ist, eine stillschweigende Vereinbarung zwischen den Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft, Wörter so zu gebrauchen, dass sie auf bestimmte Konzepte referieren. In unserem Beispiel wird die Lautfolge [ˈp͡fɛfɐ] verwendet, um auf Pfeffer zu verweisen, und [zalts], um auf Salz zu verweisen, obwohl es auch genau andersherum hätte kommen können, wenn sich Sprecher des Althochdeutschen vor langer Zeit auf die entgegengesetzte Kombination geeinigt hätten. Ich kann voll Vertrauen um Salz bitten, weil ich weiß, dass Sie das Wort genauso interpretieren wie ich, und Sie Ihrerseits – das ist entscheidend – wissen, dass ich das weiß. Wenn Sie wüssten, dass Salz »Salz« bedeutet, aber glaubten, dass ich der Meinung sei, dass Salz »Pfeffer« bedeutet, würden Sie mir stattdessen Pfeffer reichen. Und ich weiß, dass Sie wissen, dass ich das weiß, und immer so weiter.
Seitdem uns der Linguist Noam Chomsky auf die Feinheiten der Syntax hingewiesen hat, erfüllt uns die menschliche Sprache mit Ehrfurcht, weil es so unfassbar viele Bedeutungen gibt, die wir durch das Kombinieren von Wörtern zu Sätzen ausdrücken können.[7] Die Fähigkeit eines einzelnen Wortes, das Denken verschiedener Menschen zu koordinieren, ist genauso ehrfurchtgebietend. So schreibt der Dichter Craig Morgan Teicher: »Sprechen ist ein unvergleichlicher Akt des Vertrauens. Woher wissen wir, dass, wenn ich Maus sage, Sie nicht an ein Stoppschild denken? Die Antwort ist klar: Wer diese Frage stellt, wer auch immer es ist, zerbricht sich den Kopf an einem weichen Gedanken.«[8] Die weniger offensichtliche Antwort lautet, dass die Bedeutung eines Wortes gemeinsames Wissen der Sprecher dieser Sprache ist. Kinder setzen das von Anfang an stillschweigend voraus; wie könnten sie ihre Muttersprache beherrschen lernen, wenn sie befürchten müssten, dass Maus für sie »Maus« bedeutet, für jemand anderen aber »Stoppschild« und für weitere Personen etwas noch ganz anderes?[9] Experimente der Psychologen Gil Diesendruck und Lori Markson haben gezeigt, dass Kinder sich darüber tatsächlich keine Sorgen machen. Sie brachten Dreijährigen Wörter für ungewöhnliche Objekte bei, wie etwa mef für eine Knödelpresse; wie sie feststellten, gingen die Kinder sofort davon aus, dass eine fremde Person wusste, was das Wort bedeutete. Das heißt aber nicht, dass Kinder ausnahmslos ihr eigenes Wissen mit dem anderer Menschen gleichsetzen – wenn die Dreijährigen einen neuen Fakt über ein Objekt lernten (zum Beispiel »damit spielt meine Katze gern«), gingen sie nicht davon aus, dass eine fremde Person das auch wusste.[10] In unserem Leben sind Wörter das früheste und allgegenwärtige Zeugnis von gemeinsamem Wissen.
Wenn man sagt, dass zwei Menschen »nicht mehr miteinander reden«, hält uns das vor Augen, dass Sprache die grundlegendste soziale Tätigkeit ist, und so öffnet uns die Logik sprachlicher Konventionen das Tor zu Fragen über unser sonstiges soziales Leben. Die elementarste Frage lautet, warum wir überhaupt soziale Wesen sind. Menschen plaudern, arbeiten, spielen, bauen und lernen in Gemeinschaft, ob sie verwandt sind oder nicht. Das ist eine Seltenheit im Tierreich, wo meist Blutsbande für Zusammenhalt sorgen. Welche evolutionären Vorteile hat es, zusammen herumzuhängen, so dass einer dem anderen etwas Gutes tun kann?
Beim Nachdenken über diese Frage unterscheiden Evolutionsbiologen zwischen den beiden Arten, auf die man von der Unterstützung eines anderen profitiert. Hilft ein Organismus auf eigene Kosten einem anderen, spricht man von Altruismus. Wer Richard Dawkins’ Klassiker The Selfish Gene (dt. Das egoistische Gen) von 1976 oder die Dutzenden anderer Bücher über Kooperation gelesen hat, die in seinem Fahrwasser erschienen sind, weiß, dass Altruismus eines der großen Rätsel der Biologie ist, weil es auf den ersten Blick den Anschein hat, dass er sich niemals durch natürliche Selektion entwickelt haben kann. Warum lausen Affen sich gegenseitig und opfern ihre Zeit, indem sie einander Parasiten aus dem Fell pflücken, wenn ein egoistischer Affe sich doch genüsslich lausen lassen könnte, ohne seinerseits einen anderen zu lausen, wodurch er die großzügigen Mitglieder seiner Gruppe aus dem Feld schlagen und nachfolgende Generationen mit seinen egoistischen Genen überfluten würde, was schließlich das Aussterben des Lausens, oder anders gesagt des »Groomings«, zur Folge hätte?
Die verbreitete Lösung für dieses Rätsel lautet reziproker Altruismus – die Strategie, zunächst einmal zu kooperieren (in diesem Fall einen anderen auf Verlangen zu lausen) und danach andere so zu behandeln, wie man selbst von ihnen behandelt wurde: Entscheide dich für Kooperation mit denjenigen, die kooperativ waren, und gegen Kooperation bzw. für »Defektion« (in diesem Fall nicht zu lausen) bei denen, die nicht kooperativ waren.[11] In der Spieltheorie lässt sich dieses Problem modellhaft als Gefangenendilemma darstellen, als hypothetisches Szenario, in dem zwei voneinander isolierte kriminelle Spießgesellen aus Angst, vom anderen verraten zu werden, keine andere Chance haben, als ihrerseits ihn zu verraten, womit sie schlechter dastehen, als wenn sie beide kooperiert hätten. (Mehr davon im nächsten Kapitel.) Werden die Partner wiederholt diesem Dilemma ausgesetzt, sind Strategien des reziproken Altruismus (»Tit for Tat«) den ausbeuterischen überlegen, da Verräter letztlich von vorteilhafter Kooperation ausgeschlossen werden.[12]
Psychologinnen und Psychologen haben darauf hingewiesen, dass einige unserer geistigen Fähigkeiten – unser Vermögen, sich an andere Menschen und ihr Verhalten uns gegenüber zu erinnern, unser Gespür für Fairness sowie unsere moralischen Empfindungen wie Mitgefühl, Dankbarkeit und Empörung – scheinbar auf fast unheimliche Weise für eine Strategie der Gegenseitigkeit geschaffen sind und sich vermutlich als Anpassungen an die Fallstricke der altruistischen Kooperation entwickelt haben. Was uns betrifft, war das nicht Lausen, sondern die unzähligen Weisen, auf die wir mit Waren, Dienstleistungen und Gefälligkeiten handeln, wie Tauschgeschäfte, Fahrgemeinschaften und Babysitting. Mitgefühl drängt uns beim ersten Zug dazu, zu kooperieren, Dankbarkeit dazu, Kooperation mit Kooperation zu belohnen, und Empörung, Defektion mit Defektion zu vergelten.
Dies alles ist mittlerweile längst bekannt; ich für meinen Teil habe die Geschichte bereits in fünf Büchern erzählt.[13] Sie fesselt uns, weil sie ein Evolutionsparadox auflöst und weil sie eine prominente Bühne der menschlichen Natur ins Rampenlicht holt – nämlich die mit all unseren Dramen von Fairness, Verschuldung, Verpflichtung, Austausch, Schuld, Anerkennung und Verrat. Doch erst in letzter Zeit ist mir aufgegangen, dass die Geschichte der Kooperation nur zum Teil erklärt, was Menschen zu sozialen Wesen macht. Die zweite Komponente ist Koordination.[14]
Wenn ein Organismus einem anderen einen Nutzen verschafft, muss ihm das nicht zwangsläufig Kosten verursachen – möglicherweise profitiert er auch davon. Biologen bezeichnen diese zweite Art des Helfens als Mutualismus. Er ist beispielsweise zu beobachten, wenn ein Vogel, Madenhacker genannt, Zecken vom Rücken eines dankbaren Zebras pickt. Der Madenhacker bekommt eine Mahlzeit serviert, das Zebra wird von weniger Plagegeistern gepeinigt und jeder hat etwas davon (nur die Zecken nicht). Reziprozität, also Gegenseitigkeit, ist hier nicht vonnöten – der Madenhacker verlangt nicht, dass das Zebra als Gegenleistung Zecken aus seinem Gefieder knabbert. Aus diesem Grund scheint Mutualismus nicht mit dem erregenden Schauer des Altruismus einherzugehen. Jede Partei zieht offenkundig Nutzen aus der Beziehung, und so besteht für beide ein Anreiz, dem Arrangement seinen Lauf zu lassen. Es lautet nicht »Wenn du mir den Rücken kratzt, kratz ich dir deinen«, sondern »Eine Hand wäscht die andere«.
Dennoch ist die Evolution der mutualistischen Koordination keineswegs langweilig. Sie wartet mit einem weiteren höchst kniffligen evolutionären Rätsel auf, für das es eine andere, aber gleichermaßen aufschlussreiche Erklärung gibt.
Das Leben ist voller Gelegenheiten zur Koordination mit anderen Menschen, aus der beide Seiten Nutzen ziehen. Wir einigen uns auf Zeit und Ort für ein Treffen, steuern zu einem gemeinsamen Essen alle etwas aus der eigenen Küche bei, verteilen die Verantwortung für die Durchführung eines Projekts auf mehrere Schultern, erfinden Spitznamen für digitale Meeting Rooms und schleppen eine schwere Couch zusammen die Treppe hoch. Wie beim Madenhacker und dem Zebra besteht keinerlei Anreiz zum Betrug oder zu der Befürchtung betrogen zu werden – wenn Koordination funktioniert, hat jeder was davon. Das heißt allerdings nicht, dass sie leicht herbeizuführen ist. Die Koordination kann scheitern, wenn Menschen nicht auf derselben Wellenlänge sind, auch wenn sie dasselbe wollen. Terminpläne kollidieren, es kommt zu Missverständnissen, gemeinsame Ziele fallen durchs Raster oder viele Köche verderben den Brei.
Lassen Sie uns ein Spiel betrachten, das die Koordination auf reine Logik reduziert, so wie das Gefangenendilemma bei der Kooperation.[15] Beim Spiel Rendezvous verabreden Jakob und Charlotte, die gern etwas miteinander unternehmen, zusammen einen Kaffee zu trinken, aber bevor sie sich auf einen Ort geeinigt haben, verstummt Jakobs Handy, weil der Akku leer ist. Beide wissen, dass Jakob häufig zur Mokkabar geht und Charlotte meistens die Kaffeemühle aufsucht, aber keiner von beiden hat eine klare Präferenz. Sie möchten einfach nur beide am selben Ort landen. Weil Jakob annimmt, dass es Charlotte zur Kaffeemühle zieht, macht er sich dorthin auf den Weg, aber dann wird ihm klar, dass sie davon ausgehen wird, dass er lieber zur Mokkabar will. Deshalb läuft er nun in diese Richtung, bis ihm aufgeht, dass sie wahrscheinlich voraussieht, dass er glaubt, dass sie sich für die Kaffeemühle entscheidet. Also macht er wieder kehrt, bis ihm dämmert, dass sie schließlich begreift, dass er weiß, dass ihr klar ist, dass er am liebsten in der Mokkabar sitzt, und so nimmt er erneut Kurs dorthin. Währenddessen dreht sie in fruchtlosem Einfühlungsvermögen die gleichen hektischen Pirouetten.
Beachten Sie, dass im Spiel Rendezvous kein Interessenkonflikt besteht – beide wollen dasselbe. Vertrauen und Misstrauen, Großzügigkeit und Eigennutz, Ehrlichkeit und Betrug, das Empfangen und Vergelten guter Taten stehen überhaupt nicht zur Debatte. Jakobs und Charlottes Problem ist keineswegs eines der Motivation, sondern der Kognition. Was sie schmerzlich vermissen, ist gemeinsames Wissen. Es genügt nicht, dass beide wissen, was der jeweils andere wahrscheinlich beabsichtigt. Jeder muss wissen, dass der andere weiß, was er selber weiß, und immer so weiter.
Der bequemste Lieferant von gemeinsamem Wissen, Sprache, steht ihnen nicht zur Verfügung. Doch noch ist nicht alles verloren. Die nächstbeste Lösung lautet gemeinsame Salienz, oder auch: ein fokaler Punkt. Nehmen wir an, die Mokkabar hat im Zuge einer Werbeaktion alle Kioske der Umgebung mit entsprechenden Plakaten zugepflastert oder Jakob und Charlotte haben erst kürzlich noch über das Café gesprochen oder es wurde in den Nachrichten erwähnt oder liegt an der belebtesten Kreuzung der Stadt. Nichts davon liefert von sich aus einen »guten Grund«, sich dort zu treffen, doch die bloße Tatsache, dass dieser Ort beiden gerade wahrscheinlich besonders präsent ist, ist Grund genug und kann sie dazu bringen, ihre Unentschlossenheit zu überwinden und den Weg dorthin einzuschlagen.
Wenn wieder einmal, aus welchen Gründen auch immer, ein Koordinationsdilemma auftritt, werden die Parteien nach irgendeinem fokalen Punkt suchen und dazu neigen, jedwede Lösung, die sich bereits bewährt hat, erneut zu wählen. Diese gemeinsam verinnerlichten Lösungen nennt man Konventionen.[16] So könnten Jakob und Charlotte zu ihrer Rettung auf eine persönliche Konvention zurückgreifen, falls sie wieder einmal nicht miteinander kommunizieren können – zum Beispiel »Ladies first«, um sich in der Kaffeemühle zu treffen, oder »Abwechslung«, um immer dorthin zu gehen, wo sie beim letzten Mal nicht waren.
Zu den naheliegenden Konventionen einer ganzen Gesellschaft gehört, wie wir bereits gesehen haben, das Vokabular einer Sprache. Weitere Beispiele sind das Verkaufsverbot an Sonntagen, die Akzeptanz von Papiergeld im Austausch gegen Waren und Dienstleistungen, die Nutzung von 110-Volt-Geräten oder Rechtsfahren im Straßenverkehr. Bei der letztgenannten Konvention ist es irrelevant, dass die Polizei auf die Einhaltung dieser Regel achtet. Wie in vielen anderen Fällen gibt es für uns auch so bereits einen Anreiz, sie zu befolgen, solange die anderen das ebenfalls tun.
Ein beeindruckendes Narrativ über die Vergangenheit und Zukunft unserer Spezies, das der Historiker Yuval Noah Harari in seinen Büchern Sapiens, Homo Deus und 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert darlegt, beruht auf einer großen Idee, die er folgendermaßen zusammenfasst: »Unsere Welt ist auf Fiktionen aufgebaut. Sie sind allgegenwärtig – Nationen, Unternehmen und Religionen sind der menschlichen Phantasie entsprungen. Und ohne die fiktiven Geschichten, die wir im Kollektiv erzählen, wären wir vielleicht nicht die dominierende Spezies unseres Planeten.«[17] Seine Erklärung hierzu:
Schon seit der Steinzeit dienen selbstverstärkende Mythen dem Zusammenschluss menschlicher Kollektive. Dass der Homo sapiens sich die Erde untertan gemacht hat, war in der Tat vor allem der einzigartigen menschlichen Fähigkeit zu verdanken, Fiktionen zu schaffen und zu verbreiten. Wir sind die einzigen Säugetiere, die zur Kooperation mit unzähligen Fremden in der Lage sind, weil nur wir fiktive Geschichten erfinden, sie verbreiten und Millionen Menschen davon überzeugen können, an sie zu glauben. Solange alle an dieselben Fiktionen glauben, gehorchen wir allesamt denselben Gesetzen und können somit effektiv kooperieren.[18]
Dies ist eine bemerkenswerte Idee, aber ich würde sie etwas anders formulieren. Unsere Welt fußt auf Konventionen, die uns ermöglichen, effektiv zu koordinieren, und die selbstverstärkend sind, weil sie gemeinsames Wissen darstellen. Konventionen wie die englische Sprache, das Christentum, die Vereinigten Staaten von Amerika, der Euro und Microsoft sind nicht wirklich »Fiktionen«. Sie sind sehr real, auch wenn sie nicht physisch greifbar sind. Gemeinsames Wissen erschafft nicht-physische Realitäten.[19]
Während das Dilemma der Kooperation dem menschlichen Drama von Wohltätigkeit, Ausbeutung und Fairness die Bühne bereitet, wartet das Dilemma der Koordination mit seinen eigenen Opern auf, und deren Librettos nähren sich aus Privatheit, Öffentlichkeit, Präzedenzfällen, Ruhm, Modetrends, Normen, Paniken, Ritualen, Frömmigkeit und Empörung. Im Folgenden versucht dieses Kapitel Sie von dieser ehrgeizigen Behauptung zu überzeugen, und zwar anhand von vier Beispielen aus den Nachrichten, die sich am besten im Licht der Logik des gemeinsamen Wissens erschließen. Abschließend betrachten wir kurz, wie sich diese Logik in unserem Bewusstsein und in Gesprächen niederschlägt.
Posts aus den sozialen Medien mit Fehltritten von Prominenten, auf Saugrobotern reitenden Katzen oder blau-schwarzen Kleidern, die für manche Menschen gold-weiß aussehen, sind uns mittlerweile vertraut.[20] Doch dass ein mathematisches Problem zu einem viralen Meme wird, kommt selten vor. Das geschah 2015, als Kenneth Kong, ein Fernsehmoderator aus Singapur, das Foto einer Prüfungsfrage für Fünftklässler des Stadtstaats auf seiner Facebook-Seite postete. Die Denkaufgabe eroberte das Internet im Sturm und fand Verbreitung durch die New York Times, den Guardian und die BBC und erhielt bald einen eigenen Wikipedia-Eintrag.[21] Hier ist sie:
Albert und Bernard haben sich mit Cheryl angefreundet und wollen wissen, wann sie Geburtstag hat. Cheryl gibt ihnen eine Liste mit zehn möglichen Daten:
15. Mai, 16. Mai, 19. Mai
17. Juni, 18. Juni
14. Juli, 16. Juli
14. August, 15. August, 17. August
Dann verrät Cheryl Albert den Monat und Bernard den Tag.
ALBERT: Ich weiß nicht, wann Cheryl Geburtstag hat, aber ich weiß, dass Bernard es auch nicht weiß.
BERNARD: Zuerst wusste ich nicht, wann Cheryl Geburtstag hat, aber jetzt weiß ich es.
ALBERT: Dann weiß ich auch, wann Cheryl Geburtstag hat.
Wann also hat Cheryl Geburtstag?
Versuchen Sie es – es erfordert ein wenig Kopfzerbrechen, lässt sich aber ohne mathematische Kenntnisse lösen. Es hilft, wenn man die Möglichkeiten in einer Matrix anordnet und per Ausschlussverfahren vorgeht.
Tag (ist Bernhard bekannt)
Monat (ist Albert bekannt)
Mai
15
16
19
Juni
17
18
Juli
14
16
August
14
15
17
Wie wir wissen, wurde Bernard der Tag, aber nicht der Monat verraten – er weiß also, in welcher Spalte das Datum von Cheryls Geburtstag steht, aber nicht, in welcher Zeile. Wenn er erfahren hätte, dass ihr Geburtstag »am 18.« ist, wüsste er, dass er am 18. Juni wäre, denn die 18 kommt nur einmal vor. Entsprechend wüsste er, dass er am 19. Mai wäre, weil es nur eine 19 gibt. Albert sagt, er weiß, dass Bernard die Antwort nicht kennt, und darum weiß er auch, dass Bernard weder der 18. noch der 19. genannt wurde, denn dann wäre die Sache klar. Woher aber weiß er, dass Bernard das Datum nicht kennt, wenn er doch nur weiß, welches die richtige Zeile, also der Geburtstagsmonat, ist? Das kann er nur wissen, wenn ihm gesagt wurde, dass es Juli oder August ist, denn dort gibt es diese einfachen Lösungen nicht.
Wenn Sie und ich diese Überlegungen anstellen können, ist auch Bernard dazu in der Lage. Und Bernard hat verkündet, dass er nun weiß, wann Cheryl Geburtstag hat. Woher konnte er das wissen? Nun, es konnte sich nicht um den 14. handeln, denn dann hätte er sich nicht zwischen dem 14. Juli und dem 14. August entscheiden können. Und wenn es der 15. oder der 17. gewesen wäre, hätte Albert keine Chance gehabt, das richtige Datum zu erschließen.
Albert sagt aber, dass er es nun kennt. Das heißt, dass es sich nur um den Monat handeln konnte, in dem nur noch ein möglicher Tag übrig geblieben ist, nämlich Juli, und der fragliche Tag ist der 16. Cheryl hat also am 16. Juli Geburtstag.
Was verrät uns das Cheryl-Problem? Zum einen zeichnet es sich durch ein typisches Merkmal viraler Posts in den sozialen Medien aus: das Moralisieren über eine Story, die sich als falsch entpuppt. In Kommentaren prangerte man entweder die drakonischen Anforderungen an asiatische Schulkinder an oder die geistige Trägheit ihrer westlichen Pendants. In Wahrheit stammte die Aufgabe aber nicht aus dem Lehrplan für Fünftklässler – sie wurde im Rahmen einer Olympiade für die cleversten jugendlichen Mathematiker des Landes gestellt.
Eigentlich habe ich Cheryl aber hier erwähnt, um Ihnen zu zeigen, dass sich Wissen über Wissen in seiner Logik von bloßem Wissen unterscheidet und wie es sich nutzen lässt, um Fakten über die Welt zu erschließen. Überdies wird deutlich, dass Menschen in der Lage sind – auch wenn ungewohnte Situationen einige Anstrengung erfordern –, über die Gedanken anderer Personen über die Gedanken noch anderer Personen nachzudenken. Dieses Talent geht über den Denkprozess hinaus, den Kognitionswissenschaftler als Mentalisieren, Gedankenlesen, intuitive Psychologie oder Theory of Mind bezeichnen (wobei mit »Theorie« hier die Intuition ganz normaler Menschen gemeint ist und nicht das Aufstellen einer wissenschaftlichen Theorie). Man kann bei besagtem Talent vielmehr von rekursivem Mentalisieren sprechen – es handelt sich um das Nachdenken über Gedanken über Gedanken, um das Lesen von Gedanken eines Gedankenlesers. Das Cheryl-Problem fordert uns auf, über Alberts und Bernards privates Wissen über Monat und Tag des Geburtstags nachzudenken, ihr reziprokes Wissen über das private Wissen des jeweils anderen und das gemeinsame Wissen, das ihre Aussagen offenbaren.
Später im Buch beschäftigen wir uns damit, wie gut Menschen tatsächlich darin sind, über das Nachdenken über Gedanken nachzudenken. Vorher üben wir uns in der Fähigkeit, mit Hilfe bestimmter Wissensstände bestimmte Zustände der Welt zu erschließen, und werden zu einer erstaunlichen Schlussfolgerung gelangen: dass rationale, aufrichtige Menschen sich nicht darauf einigen können, sich uneinig zu sein.
Wer die stete Demokratisierung der Computer miterlebt hat, von raumfüllenden Großrechnern über kühlschrankgroße Minirechner, Desktop-PCs und Laptops bis hin zu Smartphones, wird sich erinnern, dass 1984 der dramatischste Entwicklungssprung erfolgte: Apple brachte einen erschwinglichen Personal Computer mit einer graphischen Benutzeroberfläche (GUI) auf den Markt, den Macintosh. Bis dahin war die Bedienung von Heimcomputern schwierig und umständlich. Deren Monitore zeigten 24 Zeilen mit jeweils 80 Zeichen an und ihre Betriebssysteme verlangten Textbefehle wie »rmdir c:\foobar«, deren Syntax man sich einprägen musste, und wenn man sich vertippte, ging nichts mehr. Die ersten Anwender der Apple-Alternative wurden durch Fenster, Symbole, Menüs und die Maus verwirrt, was uns heute alles selbstverständlich erscheint. Damals staunte Richard Dawkins: »In den letzten 25 Jahren habe ich sehr viele Computer intensiv genutzt und mit ihnen programmiert und kann bezeugen, dass sich die Erfahrung, mit dem Macintosh (und ihm nachempfundenen Rechnern) zu arbeiten, qualitativ von allen früheren Modellen unterscheidet. Es fühlt sich mühelos, natürlich an, beinahe so, als sei die virtuelle Maschine eine Erweiterung des eigenen Körpers.«[22]
Dennoch war die Machtübernahme durch die GUI-Computer keinesfalls ein Selbstläufer. Sie waren bereits ein Jahrzehnt zuvor im Xerox Palo Alto Research Center entwickelt worden – man munkelt, dass Steve Jobs die Idee 1979 nach einem Besuch dort klaute – und Apple hatte 1983 eine eigene Version, die Lisa, herausgebracht, die aber floppte. Die Schwierigkeit war, eine exotische neue Plattform massentauglich zu machen. Es mussten so viele Leute einen Rechner kaufen, dass er preisgünstiger wurde, Nutzer-Communities die Möglichkeit zum Austausch von Software und Erfahrungen erhielten und sich ein Markt für Drittanbieter von Peripheriegeräten, Apps und Verbrauchsgütern wie Floppy Disks entwickeln konnte. Ansonsten würden nur wenige Verbraucher wagen, einen, wenn auch »irre tollen«, Rechner zu kaufen, was sie womöglich als isolierte Spinner dastehen ließe. Doch wie konnte Apple genug Geräte verkaufen, um diese »Netzwerkeffekte«, wie Ökonomen sagen, hervorzurufen, wenn bis dahin niemand eines haben wollte?
Apple zerschlug den gordischen Knoten mit einem nur einmal geschalteten Werbespot, und zwar im dritten Viertel des Super Bowl XVIII.[23] Unter der Regie von Ridley Scott, der mit Alien und Blade Runner berühmt geworden war, wurden weder Fenster, Symbole, Menüs oder Mäuse erwähnt noch das Gefühl von Mühelosigkeit und Natürlichkeit – es gab keinerlei Hinweis auf das eigentliche Produkt. Eine Reihe von gleichförmigen grauen Gestalten in Anzügen aus Sackleinen, hinter ihnen Polizisten in Kampfmontur, trottet im Gleichschritt in eine höhlenartige Halle, wo auf einem riesigen Bildschirm das Gesicht eines Mannes zu sehen ist, der Vereinigungsgeschwafel über »Richtlinien zur Informationsreinigung« von sich gibt. Die in Blau-Grau-Tönen gehaltene Szenerie wird wiederholt von Aufnahmen einer blonden Frau in roten Shorts und Tanktop unterbrochen, die geschmeidig in die Halle sprintet. Sie trägt einen großen Vorschlaghammer, den sie wie eine Hammerwerferin in den Bildschirm schleudert. Der explodiert in einem weißen Feuerball, was die dumpfe Menge mit offenen Mündern bestaunt. Aus dem Off erklingt eine Stimme, die eine über den Bildschirm laufende Botschaft vorliest: »Am 24. Januar bringt Apple Computer den Macintosh auf den Markt. Dann werden Sie sehen, warum 1984 nicht wie ›1984‹ sein wird.«[24]
Auch wenn Apple zweifellos bewusst auf den Kontrast zwischen korporativer Gleichförmigkeit und jugendlichem Bildersturm setzte, war dies nicht der wichtigste Sinn und Zweck des Werbespots. Es ging vor allem darum, die Aufmerksamkeit des Publikums beim Super Bowl zu erregen, der in Amerika Kultstatus besitzt und den gleichen Stellenwert hat wie ein kirchlicher Feiertag. Es sahen nicht nur sehr viele Menschen zu, sondern alle wussten auch, dass sehr viele zusahen, und sie alle wussten zudem, dass das alle wussten. Ein Werbespot beim Super Bowl schafft gemeinsames Wissen. Und gemeinsames Wissen ist erforderlich, um eine Konvention zu etablieren, wie etwa die Hardware- und Software-Spezifikationen des Macintosh. Die zig Millionen Menschen, die den Spot sahen, wussten, dass zig Millionen Menschen nun vielleicht von dieser brandneuen Technologie elektrisiert waren.
Die besondere Rolle der Super-Bowl-Werbung als unmittelbarer Erzeuger gemeinsamen Wissens wurde 2001 von Michael Chwe in seinem Buch Rational Ritual erläutert. Chwe wies darauf hin, dass auch andere Start-ups, die von Netzwerkeffekten abhängig waren, ebenfalls sehr viel Werbung beim Super Bowl schalteten – insbesondere während der Dotcom-Blase, als diese Netzwerkeffekte der Schlüssel zum Erfolg waren. So war Monster.com eine der ersten Jobwebsites, die sich die riesige Reichweite des Webs zunutze machten, doch sie brauchte Arbeitsuchende, die erwarteten, dass Arbeitgeber dort Anzeigen schalteten, sowie Arbeitgeber, die erwarteten, dass Arbeitsuchende dort nach Stellenangeboten Ausschau hielten. Die Kreditkarte Discover Card lockte mit hohen Kreditlinien, dem Verzicht auf eine Jahresgebühr und Cashback-Prämien, doch sie war unattraktiv ohne ein Netzwerk von Kaufleuten, die die Karte akzeptierten, wozu diese nur bereit waren, wenn ein Netzwerk von Karteninhabern sie nutzte.
Laut Chwe zieht der Super Bowl auch eine zweite Unternehmenskategorie an, nämlich diejenigen mit Produkten, die von ihrem Markenimage abhängig sind. Amerikanisches Bier ist amerikanisches Bier und Laufschuhe sind Laufschuhe, aber für die Verbraucher ist wichtig, als Personen wahrgenommen zu werden, die Budweiser oder Miller trinken und Nike oder Adidas tragen, und keinesfalls als Käufer von beliebigen No-Name-Produkten. Darüber hinaus genießt man bestimmte Produkte gemeinschaftlich, wie Restaurants, Theaterstücke, Filme und Bücher – es macht mehr Spaß, einen Film anzuschauen, wenn man anschließend mit Freunden darüber reden kann. Für diese sozialen Produkte gilt das Gleiche wie für Technologiestandards oder Kreditkartennetzwerke: Je mehr Personen sie konsumieren, desto mehr Personen möchten sie konsumieren. Chwe konnte zeigen, dass Waren, deren Konsum öffentlich erfolgt, wie Autos, Bier, Mineralwasser, Filme und Kleidung, beim Super Bowl intensiver beworben werden als privat genutzte Waren, wie Batterien, Motoröl und Frühstückscerealien.
Da der Super Bowl (und andere Großereignisse) enorme Publikumsmagneten sind, kann es natürlich auch sein, dass nicht die Aussicht auf gemeinsames Wissen, sondern die schieren Zuschauerzahlen die Werbetreibenden reizt. Mittels statistischer Regressionsanalysen tat Chwe alles, um diese und andere Störfaktoren zu berücksichtigen. Er stellte zweifelsfrei fest, dass Unternehmen, die öffentlich konsumierte Produkte verkauften, eher bereit waren, sie zu bewerben, eher bereit waren, sie bei populären Shows zu bewerben als bei Nischensendungen, und eher bereit waren, mehr pro Zuschauer zu zahlen als Unternehmen, die privat konsumierte Produkte verkauften.
In den Jahrzehnten seit dem »1984«-Werbespot hat sich Werbung beim Super Bowl zu einem Kulturspektakel entwickelt, das fast so viel Aufmerksamkeit erregt wie das Spiel selbst. Damit sind die Spots für Anbieter von Produkten, deren Wert von gemeinsamem Wissen abhängt, noch attraktiver geworden. Der Höhepunkt war möglicherweise der Super Bowl LVI im Jahr 2022, der manchmal als Crypto Bowl bezeichnet wird, weil er mit einer Überfülle an eingängigen Werbeslogans für Kryptobörsen aufwartete, also die Websites oder Apps, auf denen man Kryptowährungen wie Bitcoin kaufen und verkaufen konnte.
Es ist nicht so, dass Kryptowährungen per se von einem durch Werbung erzeugten gemeinsamen Wissen abhängen. Dass sie aber grundsätzlich ein spezifisches gemeinsames Wissen voraussetzen, steht außer Frage; alle Währungen tun das. Ich akzeptiere ein Stück grünes Papier im Austausch für ein altes Sofa, weil ich weiß, dass mein Supermarkt dieses Stück Papier im Austausch für Lebensmittel akzeptiert, was der Fall ist, weil man dort davon ausgeht, dass die Großhändler es ihrerseits akzeptieren werden, und so weiter. Irgendwann wurde das gemeinsame Wissen, dass Währungen einen Wert haben, durch das Versprechen bekräftigt, dass die Regierung einen Dollar für eine festgelegte Goldmenge eintauschen würde, die laut gängiger Auffassung in Fort Knox aufbewahrt wurde. Heutzutage wird dieses Wissen durch eine staatliche Verordnung untermauert, insbesondere durch das Gesetz, dass ein legales Zahlungsmittel zur Begleichung von Schulden akzeptiert werden muss. Ist in einem Staat Währungsstabilität gegeben, kann dieses gemeinsame Wissen selbsterhaltend werden. Die Menschen vertrauen dem US-Dollar, weil sie wissen, dass alle anderen das auch tun und dass die US-Zentralbank hart dafür arbeitet, dass es so bleibt. Bei einer instabilen Regierung jedoch kann das gemeinsame Wissen ins Wanken geraten und dies wiederum zu einer Hyperinflation führen, wobei die Menschen Preise und Löhne in die Höhe treiben, weil sie sehen und davon ausgehen, dass andere dies auch tun. Infolgedessen büßt die Währung ihren Wert rasant ein.
Bei der Kryptowährung wird das gemeinsame Wissen durch ein öffentliches Kontobuch, die Blockchain, bereitgestellt. In einer Blockchain werden alle Transaktionen unlöschbar aufgezeichnet und durch komplexe kryptographische Algorithmen, die transparent sind, sich aber nicht hacken lassen, vor Veruntreuung und Fälschung geschützt. Da jeder die Blockchain sehen und ihre Arbeit verfolgen kann, sind keine Tricks vonnöten, um Menschen dazu zu bringen, von anderen zu erwarten, dass sie erwarten, dass die Kryptowährung einen Wert besitzt.
Künstlich herbeizuführen ist gemeinsames Wissen allerdings, wenn es um die Spekulation mit Kryptowährungen geht. Wie bei allen Währungen darf eine Kryptowährung nur in begrenzten Mengen in Umlauf gebracht werden, um eine Hyperinflation zu verhindern. Dies wird erreicht, indem man zwar erlaubt, neue Kryptowerte zu erschaffen, aber unter erschwerten Bedingungen. Dieses sogenannte »Mining« erfolgt über das Lösen von Rechenaufgaben, die erhebliche Fähigkeiten und viel Zeit erfordern. Wenn Spekulanten antizipieren, dass die Nachfrage das fragliche Angebot übersteigt, befeuert durch die Wahrnehmung, dass Kryptowährungen das Erfolgsmodell der Zukunft sind, kaufen sie sie vielleicht heute, weil sie hoffen, dass sie sie später mit Gewinn verkaufen können. Und das kann nur funktionieren, wenn es irgendwo Käuferinnen und Käufer gibt, die Grund zu der Annahme haben, dass sie die Währung gewinnbringend an wiederum andere Käufer verkaufen können – an »noch größere Dummköpfe«, wie Anlagenanalytiker sagen. Gemeinsames Wissen ist eigentlich nicht das, was zu einer Spekulationsblase führt, da es objektiv nichts zu »wissen« gibt. Vielmehr ist es eine gemeinsame Erwartung, die auf einem ähnlich rekursiven Mentalisieren beruht: Alle erwarten, dass alle etwas erwarten – in diesem Falle, dass der Assetpreis steigt, was (zumindest vorübergehend) dafür sorgt, dass er steigt. Zugleich schöpfen die Börsen bei jeder Transaktion Gewinne ab.
Ein hervorstechendes öffentliches Ereignis wie ein Werbespot beim Super Bowl kann die gemeinsame Erwartung befeuern, und dafür legten die Kryptobörsen 2022 Geld auf den Tisch. Keiner der exorbitant teuren Spots pries die Vorzüge einer Kryptowährung an, wie Vertraulichkeit und Schutz vor Hyperinflation oder vor Konfiszierung durch den Staat, ja, erwähnte sie nicht einmal. Stattdessen wurden Prominente bezahlt, um die gemeinsame Erwartung zu schüren, dass andere Leute in Krypto investieren würden und man das demzufolge auch tun solle.
In einem Spot psalmodiert Matt Damon mit Bergsteigern, Piloten und Astronauten im Hintergrund: »In diesen Momenten der Wahrheit, wenn diese Männer und Frauen – diese gewöhnlichen Sterblichen wie Sie und ich – in den Abgrund spähen, kommen sie zur Ruhe und bewahren kühlen Kopf dank fünf schlichter Worte, die die Kühnen seit der Zeit der Römer vor sich hinflüsterten: Dem Mutigen gehört die Welt.« In einem anderen persifliert der Komiker Larry David sein eigenes schrulliges Selbst an verschiedenen Wendepunkten der Geschichte, wobei er sich über Erfindungen lustig macht, wie die des Rades (»Was tut es?« »Es rollt.« »Aber das kann ein Bagel doch auch, oder? Und den kann man essen!«), der Gabel, der Toilette, des Stimmrechts, der Glühlampe und der Mondmissionen. Zum Schluss verspottet er einen Vertreter der Kryptobörse FTX: »Näää, das sehe ich anders. Und ich irre mich nie bei diesem Zeug – niemals!« Danach ist zu lesen: »Seien Sie kein Larry. Lassen Sie sich Krypto nicht entgehen – die nächste ganz große Sache.«[25]
Natürlich kann sich ein Asset, das durch nichts weiter als gemeinsame Erwartung getragen wird, nur für begrenzte Zeit in lichten Höhen halten. Blasen platzen, wenn einem Markt die noch größeren Dummköpfe ausgehen, die sich die nächste ganz große Sache nicht entgehen lassen wollen, oder wenn berechtigte Zweifel zu gemeinsamem Wissen werden. Dies kann die gemeinsame Erwartung ins Gegenteil verkehren und die Investoren zu den Ausgängen stürzen lassen, um in wilder Hast das Asset abzustoßen, weil sie befürchten, dass andere das auch tun, weil diese befürchten, dass noch andere das ebenfalls tun.
Genau das passierte einige Monate nach dem Crypto Bowl, als der Wert des Bitcoins um 75 Prozent sank und sich Kryptogeld im Wert von 2 Billionen Dollar im Handumdrehen in Luft auflöste. Es kam noch schlimmer. Im November offenbarte eine geleakte Bilanz, dass FTX Kundeneinlagen in seinen eigenen Hedgefonds hatte abfließen lassen, dessen Anlagen hauptsächlich in der aus dem Boden gestampften Kryptowährung FTT gehalten wurden. Das veranlasste den CEO von Binance (einem Börsenkonkurrenten, der ebenfalls beim Super Bowl für sich geworben hatte), Zweifel am Wert von FTT zu säen und seinen eigenen Anteil abzustoßen. FTX hatte Probleme diesen zurückzukaufen und brachte damit die selbsterfüllende gemeinsame Erwartung eines rapiden Wertverlusts ins Rollen, oder, anders gesagt, eine Bankenpanik. Innerhalb weniger Wochen meldete FTX Konkurs an, sein Gründer und CEO, Sam Bankman-Fried, wurde verhaftet und des Telekommunikationsbetrugs sowie der Geldwäsche angeklagt, und Blockchain-Investitionen sagte man einen Krypto-Winter voraus (der allerdings nicht lange anhielt – viele Kryptowährungen erholten sich wieder).
Die FTX-Implosion von 2022 sorgte dafür, dass auf die Maschinerie des gemeinsamen Wissens, die mitschuldig an der Pleite war, einige Pfeile schwarzen Humors abgeschossen wurden. Wie sich herausstellte, hatte Larry David recht gehabt. »Näää, das sehe ich anders« sowie »1984 wird nicht wie ›1984‹ sein« wurden zu zwei der hellsichtigsten Werbeslogans der Geschichte.
Einer der besten Witze aus dem Quell subversiven Humors in der Sowjetunion geht so: Ein Mann steht im Bahnhof von Moskau und verteilt Flugblätter an Passanten. In Windeseile wird er von Männern des KGB festgenommen und die entdecken, dass auf den Flugblättern überhaupt nichts draufsteht. »Was soll das?«, herrschen sie ihn an. Der Mann erwidert: »Was soll man da schon schreiben? Das liegt doch auf der Hand!«
Der Witz des Witzes ist, dass der Flugblattverteiler gemeinsames Wissen erzeugt.[26] Jeder weiß, dass das kommunistische Regime ineffizient und repressiv ist, aber man kann nicht sicher sein, dass auch alle anderen zu diesem Schluss gekommen sind. Nun macht ein Mann, der öffentlich darauf hinweist, dass es Gründe zur Unzufriedenheit gibt, diese Unzufriedenheit und ihre Wahrnehmung publik, auch wenn er die Gründe selbst gar nicht offenlegen muss.
Die Verhaftung des Mannes – und allgemein die Unterdrückung der freien Rede, der Presse und von Versammlungen in Autokratien – wirft die Frage auf, warum Diktatoren solch panische Angst vor Meinungsäußerungen haben. Man könnte ja eigentlich annehmen, dass Despoten ihren machtlosen Untergebenen zubilligen könnten, nach Herzenslust zu lamentieren. So schrieb Mao Zedong, dass die politische Macht »aus den Gewehrläufen kommt«.
In Wirklichkeit gibt es einen sehr guten Grund, warum Diktatoren keinen Dissens tolerieren. Die elenden Untertanen eines tyrannischen Regimes lassen sich nicht vorgaukeln, dass sie glücklich sind. Und wenn sich zig Millionen unzufriedene Bürger gemeinsam erheben, vermag keine Brachialgewalt der Welt sie aufzuhalten. Dass die Bürger sich nicht in Massen ihren Herrschern widersetzen, liegt daran, dass ihnen die Voraussetzung dafür fehlt, ihr Handeln zum gegenseitigen Vorteil zu koordinieren – nämlich gemeinsames Wissen.[27] Möglicherweise verbergen die meisten Bürger ihre politische Meinung aus Furcht, bestraft zu werden, und folglich weiß niemand, dass die Mehrheit der Mitbürger genauso unzufrieden ist wie man selbst. Vielleicht denken sogar alle fälschlicherweise, dass jeder dem Regime treu ergeben ist – eine Kombination aus privatem Wissen und gemeinsamem Irrglauben, was man als pluralistische Ignoranz oder Schweigespirale bezeichnet.[28] Und selbst wenn man mutmaßen würde, dass die eigene Unzufriedenheit von den anderen geteilt wird, gäbe es keinerlei Anlass anzunehmen, dass die anderen diese Unzufriedenheit zur selben Zeit wie man selbst zum Ausdruck bringen würden, um so das Regime zu entmachten, und man somit nicht Gefahr liefe, der Einzige zu sein, der das preisgibt, was dazu führen würde, als Verräter entlarvt und weggesperrt zu werden.
Dagegen kann eine öffentliche Demonstration das gemeinsame Wissen erzeugen, das zur Koordination von Widerstand erforderlich ist. In der Menschenmenge kann jede Demonstrantin und jeder Demonstrant nicht nur die anderen sehen, sondern auch sehen, dass alle anderen die anderen sehen. Mit dem Schwinden der pluralistischen Ignoranz kann der Protest zur Lawine werden und immer mehr Überläufer aufnehmen, die ihre Loyalität nur vorgetäuscht hatten. Auf diese Weise sind alle Demonstrierenden nun in der Lage, ihre Handlungen zu koordinieren – sei es durch buchstäbliches Erstürmen des Palasts oder durch das Lahmlegen der Staatsmaschinerie mittels Arbeitsniederlegungen und Boykotts. So sagte Gandhi im gleichnamigen Film von 1982 zu einem britischen General: »Irgendwann werden Sie bestimmt gehen. Verstehen Sie, 100000 Engländer werden nicht die Kontrolle über 350 Millionen Inder ausüben können, wenn diese sich weigern, mit ihnen zusammenzuarbeiten.«[29]
Sie gingen tatsächlich. Genau diese Dynamik brachte im 20. und 21. Jahrhundert weitere 150 Regime dazu, vor gewaltlosen, aber koordinierten Protestierenden zurückzuweichen, wegzurennen oder panisch davonzustürzen.[30] In den Jahrzehnten um die Wende zum 21. Jahrhundert gaben diese Revolutionen, die oft nach Farben, Pflanzen oder weichen Stoffen benannt wurden, der Welt ein neues Gesicht.[31] Der Politologin Erica Chenoweth zufolge gab es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr gewaltfreie Widerstandsbewegungen als gewalttätige, die mehr als doppelt so häufig erfolgreich verliefen (51 versus 25 Prozent), selbst wenn sie sich gegen brutale Diktaturen richteten. (Dieser Trend ist Teil des langfristigen Rückgangs der Gewalt, den ich in The Better Angels of Our Nature (dt. Gewalt) dokumentiert habe.) Ein wichtiger Beschleuniger für diese Entwicklung war die Nutzung von Medien, die die Netzwerke des gemeinsamen Wissens stetig weiter vergrößern, wie Fotokopierer, Fax, Internet, World Wide Web und die sozialen Medien.
Laut Chenoweth ist die Erfolgsquote von gewaltlosen bürgerlichen Widerstandsbewegungen in den letzten beiden Dekaden gesunken (obwohl sie die gewalttätigen immer noch übertrumpfen). Ein Grund hierfür ist die »Lernkurve des Diktators«: Autokraten haben dazugelernt, was die Zerschlagung bürgerlicher Widerstandskampagnen betrifft – zum Beispiel durch Kontrollieren der sozialen Medien.[32] Am raffiniertesten geht die Regierung Chinas vor, die Zehntausende Zensoren beschäftigt, welche jeden neuen Eintrag in den sozialen Medien lesen und diejenigen löschen, die ihnen gefährlich erscheinen. Bezeichnenderweise sind das nicht die Posts, in denen die Regierung kritisiert wird. Vielmehr nutzt die Regierung gerissen dieses Feedback, um Beamte zu ersetzen, die ihrem Auftrag, die Massen zu besänftigen, nicht zufriedenstellend nachkommen. Es werden Posts beseitigt, die zum Koordinieren von Handlungen geeignet scheinen, wie Ankündigungen von Protesten, Kundgebungen und Graswurzelbewegungen, selbst wenn die Autoren diese kritisieren.[33]
Die Versuche von Diktatoren, gemeinsames Wissen im Keim zu ersticken, haben Aktivisten zu immer kreativeren Maßnahmen angestachelt, es zu erzeugen – was oft die Regierung dahingehend reizt, harmlose Aktivitäten zu kriminalisieren. Dazu gehören Applaudieren, Gesänge, das Aufspannen von Schirmen, Eimer über dem Kopf, das Entblößen von Brüsten, das gleichzeitige Klingeln von Handys, Fähnchen an Katzenschwänzen, Schaukämpfe mit Schwertern oder das Braten von Eiern und Würstchen auf der ewigen Flamme eines Kriegsdenkmals.[34] In einem satirischen Blogpost aus Belarus wurde berichtet: »Eine Erzieherin wurde der Unruhestiftung für schuldig befunden, weil sie ihren Kindergartenkindern ›Backe, backe Kuchen‹ beigebracht hatte.«[35] Und ein Witz wurde wahr, als die russische Polizei 2022 eine Frau verhaftete, die ein leeres Schild hochhielt.
Ein zu Zeiten der Sowjetunion verbreiteter Ausspruch, der manchmal Alexander Solschenizyn zugeschrieben wurde, lautete: »Wir wissen, dass sie lügen, Sie wissen, dass sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Und sie lügen immer weiter.«[36] Vielleicht haben sie immer weitergelogen, weil selbst drei Ebenen wechselseitigen Wissens nicht für das gemeinsame Wissen ausreichten, das das Volk gebraucht hätte, um sich koordiniert gegen die Lügen aufzulehnen.
Am 20. Dezember 2013 kam Justine Sacco, eine junge Kommunikationschefin des Medien- und Internetunternehmens IAC, zu fragwürdigem Ruhm.[37] Bei einem Zwischenstopp auf der Flugreise von New York nach Südafrika, wo sie an einer Familienfeier teilnehmen wollte, twitterte sie eine Reihe von Witzeleien über ihre Umgebung und Mitreisenden. Der letzte Tweet vor dem Besteigen des Flugzeugs lautete: »Auf nach Afrika. Hoffentlich kriege ich nicht AIDS. War nur Spaß. Ich bin weiß!« Wie jeder aus dem Kontext hätte erschließen können, leugnete Sacco weder, dass auch Weiße an HIV/AIDS erkranken, noch tat sie die Tragödie dieser Epidemie im subsaharischen Afrika gefühllos ab. Indem sie vielmehr so tat, als sei sie eine ignorante weiße Touristin, kommentierte sie sarkastisch die Ungerechtigkeit der rassistischen Ungleichheit bei der Ausbreitung der Krankheit und das Versagen der Welt, darauf zu reagieren. Das war vielleicht geschmacklos, aber nicht rassistisch.
Ein Redakteur der New York Times hat mir einmal das Zweite Gesetz des Journalismus verraten: Verzichte unbedingt auf Ironie, weil die meisten Leser sie nicht verstehen.[38] Sacco, so schien es, brauchte das Zweite Gesetz nicht zu fürchten. Sie war keine Journalistin und die läppischen 170 Follower ihres Twitter-Accounts kannten sie vermutlich gut genug, um die Ironie zu verstehen. Doch die Twitter-Features »Retweet« und »Trends« waren noch recht neu und den Nutzerinnen und Nutzern war kaum bewusst, mit welch atemberaubender Geschwindigkeit diese Features einen Tweet in Umlauf bringen konnten. (Der Ausdruck viraler Tweet war erst ein Jahr zuvor viral gegangen.)[39] Einer von Saccos Followern verpetzte sie beim Redakteur eines Techindustrie-Blogs, der postete den Scherz und leitete ihn an seine 15000 Follower weiter, von denen viele ihn ihrerseits weiterleiteten. Zwischen dem Moment, in dem Sacco das Flugzeug bestieg, und dem Moment, in dem sie wieder landete, war aus ihrem Witzchen der Twitter-Trend Nummer Eins geworden.
In Anbetracht des Zweiten Gesetzes überraschte es vielleicht nicht, dass die meisten der zigtausenden Tweets, die auf den Scherz reagierten, voller Empörung waren:
Angesichts des widerlichen rassistischen Tweets von @JustineSacco werde ich heute an @care spenden.
Wie konnte man @JustineSacco einen PR-Job geben? Das Niveau ihrer rassistischen Ignoranz passt eher zu Fox News. #AIDS kann jeden treffen!
Ich arbeite für IAC und ich möchte, dass @JustineSacco nie wieder etwas mit unserer Kommunikationsabteilung zu tun hat. Nie wieder.
[Von ihrem Arbeitgeber:] Dies ist ein abscheulicher, beleidigender Kommentar. Die fragliche Angestellte ist derzeit auf einem Auslandsflug und nicht erreichbar.
Verblüffender war vielleicht die Schadenfreude, die ekstatische Züge annahm, als sich Leute ausmalten, dass Sacco nun womöglich vor den Trümmern ihrer Existenz stehen würde:
Das schönste Weihnachtsgeschenk für mich wäre, @JustineSaccos Gesicht zu sehen, wenn ihr Flugzeug landet und sie ihre Mailbox checkt.
O Mann, @JustineSacco wird den bittersten Ich-schalte-mein-Handy-ein-Moment aller Zeiten erleben, wenn sie landet.
Wir werden dabei sein, wenn diese @JustineSacco-Schlampe gefeuert wird. In ECHTZEIT. Bevor sie auch nur AHNT, was passiert, wird sie gefeuert.
Echt jetzt. Eigentlich will ich nach Hause und ins Bett, aber jeder hier in der Bar ist so gespannt auf #HasJustineLandedYet. Kann mich nicht vom Handy losreißen. Kann jetzt nicht gehen.
Also, kann denn niemand in Kapstadt zum Flughafen gehen und ihre Ankunft tweeten? Mach schon, Twitter! Ich hätt gerne Bilder von #HasJustineLandedYet.
Trotz einer öffentlichen Entschuldigung wurde Sacco rausgeworfen. Freunde und Familie wandten sich gegen sie. Hotelbedienstete drohten mit Streik, falls sie auftauchen würde. Paparazzi verfolgten sie, Männer weigerten sich, mit ihr auszugehen. Newsseiten durchforsteten ihren Twitter-Feed nach weiteren peinlichen Witzen und machten sich über sie lustig, als sie versuchte, ihren Ruf und ihre Karriere zu retten. Bei einem Interview beschrieb sie den emotionalen Tribut, den sie zahlte, mit den Worten: »Ich habe geweint, bis ich nur noch Haut und Knochen war.«
Man sagt, die Affäre um Justine Sacco habe die Cancel Culture des 21. Jahrhunderts eingeläutet, in deren Zuge Karriere und Ruf einer Person wegen rechtlich geschützter und oft harmloser Äußerungen, die jemandem sauer aufgestoßen sind, zerstört werden. Zu diesen Vergehen gehören Zitate, Flachwitze, Likes in den sozialen Medien, ironische Bemerkungen, historische Berichte über Rassismus, Infragestellungen von Rassismusvorwürfen, Advocatus-Diaboli-Argumentationen zu Lehrzwecken, falsch verstandene Komplimente, mit fundierten Quellen belegte Behauptungen und, als kafkaeske Falle, begründete Kritik an genau den Maßnahmen, die zur Bestrafung der Kritiker ergriffen werden. In einer Datenbank auf »canceledpeople.org« sind über 200 Beispiele und die betreffenden Strafen aufgelistet, die meist aus Beurlaubung oder Entlassung bestehen. In einer anderen Datenbank, die sich auf die akademische Welt konzentriert, finden sich mehrere Hundert weitere Beispiele (darauf komme ich in Kapitel 8 zurück).[40] Obwohl die meisten Kündigungen auf der Unterstellung von Fanatismus beruhten, war es für einen vernünftigen Menschen in buchstäblich keinem Fall möglich, den Zuwiderhandelnden vorsätzliche Vorurteile oder Böswilligkeit gegenüber einer Randgruppe vorzuwerfen. Ein Literaturprofessor, der beurlaubt wird, weil er in einer Lehrveranstaltung bei einer Diskussion über rassistische Beleidigungen eine rassistische Beleidigung aus einem Roman von James Baldwin zitiert, ist schlicht kein Rassist. Ebenso wenig ein LKW-Fahrer, der entlassen wird, weil er das Okay-Zeichen gemacht hat, aber ihm nicht klar ist, dass es von einigen Mitgliedern der amerikanischen alternativen Rechten als Symbol für White Power verwendet wird. Und all deren Leben zu zerstören verhalf selbstverständlich keinem einzigen afroamerikanischen Menschen oder Mitglied einer anderen Randgruppe zu einem besseren Leben.
Im Jahr 2022 verfasste ein entnervter Sozialpsychologe namens Jonathan Haidt einen Essay für The Atlantic mit dem Titel »Why the Past 10 Years of American Life Have Been Uniquely Stupid« (»Warum sich die letzten 10 Jahre amerikanischen Lebens durch unübertroffene Dummheit auszeichnen«).[41] Haidt legte den Finger auf eine augenscheinliche Wunde. Nahezu die Hälfte der Kündigungen aus der Datenbank erfolgten aufgrund von Postings in den sozialen Medien und viele weitere als Reaktion auf ein Trommelfeuer empörter Posts in den sozialen Medien, die die Situation als unhaltbar beschrieben. Haidt gab nicht den Plattformen der Medien selbst die Schuld, sondern vielmehr den Generatoren der Viralität, die 2009 implementiert worden waren – den Buttons für Like, Share und Retweet. Er verglich diese Neuerungen mit dem Verteilen von 1 Milliarde Pfeilgewehren. Die Heckenschützen können sich ihre moralische Überlegenheit und Stammestreue kostengünstig selbst signalisieren, indem sie auf ein unpopuläres Ziel schießen. Die Angriffe erfolgen nicht direkt persönlich, sondern anonym über Tastatur und Bildschirm und werden demzufolge nicht von unseren normalen Hemmungen in Schach gehalten, einen Menschen von Angesicht zu Angesicht zu verunglimpfen. Dumpfbacken besitzen plötzlich ein Mittel, über die Gebildeten zu triumphieren, und Trolle können ihrem Freizeitvergnügen unerkannt frönen.[42] Die Heckenschützen können der Reihe nach die Vorsitzenden von Organisationen unter Druck setzen, sodass diese sich feige zu Konzessionen bereit erklären, um der Schießerei Einhalt zu gebieten, denn ein isolierter Angriff lässt sich übersehen, aber Hunderte oder Tausende sind schwerer zu ignorieren.
Diese Erklärung klingt überzeugend, aber meiner Meinung nach geht sie nicht weit genug. Haidt wies auf die schiere Anzahl der Beobachtenden hin, die durch die Share-Optionen erzeugt werden, da jedes Share immer noch mehr Shares nach sich zieht. Viralität sorgt aber nicht nur für eine exponentielle Zunahme der Zahl der Beobachter. Sie ruft auch ein Gefühl gemeinsamen Wissens hervor. Freilich schaffen die Plattformen der sozialen Medien nicht buchstäblich ein nationenweites gemeinsames Wissen, so wie es in der Ära der drei TV-Networks ABC, CBS und NBC der Fall war, weil ihre Posts nicht landesweit ausgestrahlt, sondern in personalisierten Feeds übermittelt werden. Doch da man mittlerweile weiß, dass die Plattformen hunderte Millionen Nutzer haben, virtuelle Communities mit ähnlichen Interessen und ähnlichem Politikverständnis vernetzen und jeder Post dank der Share-Buttons im Feed jeder beliebigen anderen Person landen kann, fühlen sich die Botschaften wie gemeinsames Wissen an, zumindest im Kreis der Personen, die einem wichtig sind. Wenn man einen Post sieht, der weitergeleitet oder geteilt wurde, weiß man, dass auch viele andere Empfänger ihn sehen und diese das ebenfalls wissen, und immer so weiter. Überdies erzeugt Viralität tatsächlich oft gemeinsames Wissen. Erscheint ein viraler Post in der Rubrik »Neuigkeiten« oder »Trending« oder »Explore«, kann es sein,