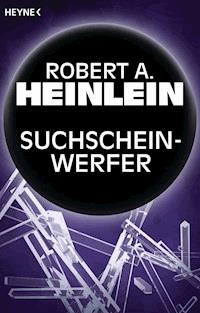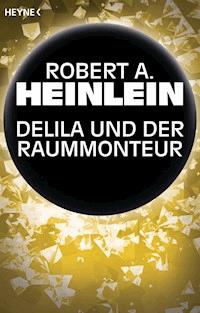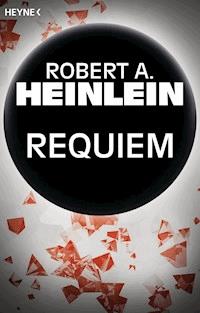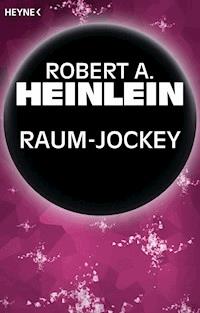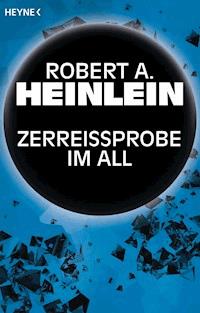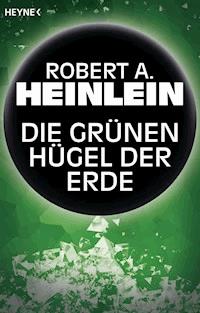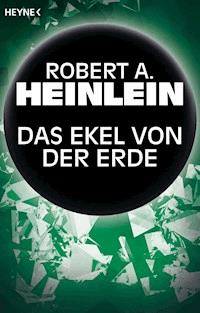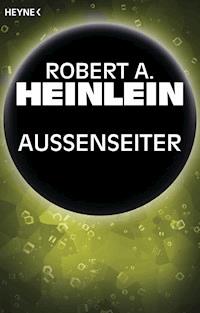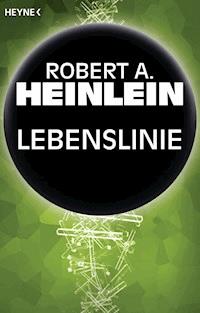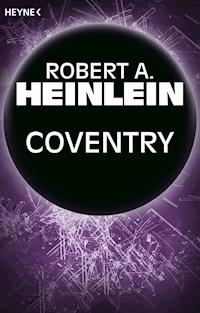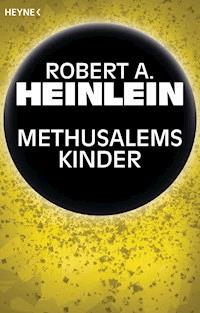1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Vom Gläubigen zum Revolutionär
John Lyle ist ein junger Offizier in der Garde des Propheten, des theokratischen Präsidenten der Erde. Sein blinder Glaube an den vermeintlich göttlichen Führer bröckelt immer mehr, besonders, nachdem John sich in eine der Jungfrauen des Propheten, Schwester Judith, verliebt. Als die Affäre auffliegt, werden sie hart bestraft, und John erkennt immer mehr, dass seine einzige Chance, Judith je wiederzusehen, im Umsturz des bestehenden Systems liegt …
Der Roman „‚Wenn das so weitergeht …‘“ erscheint als exklusives E-Book Only bei Heyne und ist zusammen mit weiteren Stories und Romanen von Robert A. Heinlein auch in dem Sammelband „Die Geschichte der Zukunft“ enthalten. Er umfasst ca. 190 Buchseiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ROBERT A. HEINLEIN
»WENN DAS SO WEITERGEHT …«
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
DAS BUCH
John Lyle ist ein junger Offizier in der Garde des Propheten, des theokratischen Präsidenten der Erde. Sein blinder Glaube an den vermeintlich göttlichen Führer bröckelt immer mehr, besonders, nachdem John sich in eine der Jungfrauen des Propheten, Schwester Judith, verliebt. Als die Affäre auffliegt, werden sie hart bestraft, und John erkennt immer mehr, dass seine einzige Chance, Judith je wiederzusehen, im Umsturz des bestehenden Systems liegt …
Der Roman »Wenn das so weitergeht …« erscheint als exklusives E-Book Only bei Heyne und ist zusammen mit weiteren Stories und Romanen von Robert A. Heinlein auch in dem Sammelband »Die Geschichte der Zukunft« enthalten.
DER AUTOR
Robert A. Heinlein wurde 1907 in Missouri geboren. Er studierte Mathematik und Physik und verlegte sich schon bald auf das Schreiben von Science-Fiction-Romanen. Neben Isaac Asimov und Arthur C. Clarke gilt Heinlein als einer der drei Gründerväter des Genres im 20. Jahrhundert. Sein umfangreiches Werk hat sich millionenfach verkauft, und seine Ideen und Figuren haben Eingang in die Weltliteratur gefunden. Die Romane »Fremder in einer fremden Welt« und »Mondspuren« gelten als seine absoluten Meisterwerke. Heinlein starb 1988.
www.diezukunft.de
Diese Erzählung ist dem Band Robert A. Heinlein: »Die Geschichte der Zukunft« entnommen.
Titel der Originalausgabe: »If This Goes On …«
Aus dem Amerikanischen von Rosemarie Hundertmarck
Copyright © 1940 by Street & Smith Publications, Inc.
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Covergestaltung: Stardust, München
Satz: Schaber Datentechnik, Wels
ISBN: 978-3-641-16984-8
1
Es war kalt auf dem Wall. Ich schlug meine erstarrten Hände zusammen und hörte aus Angst, den Propheten zu stören, gleich wieder damit auf. In dieser Nacht hatte ich meinen Posten genau vor seinen Privaträumen, und diesen Posten hatte ich mir errungen, indem ich bei der Wachablösung mehr als die übliche Sorgfalt auf vorschriftsmäßige Kleidung und zackiges Benehmen verwandt hatte … Aber jetzt wünschte ich mir durchaus nicht, Aufmerksamkeit auf mich zu lenken.
Ich war damals jung und nicht allzu helle – ein frisch von West Point gekommener Legat und Gardist bei den Engeln des Herrn, der Leibgarde des inkarnierten Propheten. Bei meiner Geburt hatte meine Mutter mich der Kirche geweiht, und als ich achtzehn war, hatte mein Onkel Absolom, ein Senior-Laienzensor, vom Ältestenrat eine Berufung an die Militär-Akademie für mich erwirkt.
In West Point hatte es mir gefallen. Oh, ich hatte an dem üblichen Gemecker unter den Kameraden teilgenommen, an den beinahe rituellen Beschwerden, die es bei allen militärischen Einrichtungen gibt, aber in Wahrheit sagte mir der klösterliche Tagesablauf zu: Aufstehen um fünf, zwei Stunden Gebet und Meditation, dann Unterricht in den zahlreichen Themen einer militärischen Ausbildung, Strategie und Taktik, Theologie, Mob-Psychologie, Mirakel für Anfänger. Am Nachmittag übten wir mit Vakuum-Gewehren und Lasern, exerzierten mit Panzern und ertüchtigten unsere Körper.
Mein Abschlusszeugnis war keins von den besten, und ich hatte im Grunde nicht damit gerechnet, zu den Engeln des Herrn berufen zu werden, obwohl ich mich darum beworben hatte. Aber ich hatte immer erstklassige Noten in Frömmigkeit bekommen und war recht gut in den meisten praktischen Fächern. Ich wurde also erwählt. Es erfüllte mich mit einem beinahe sündhaften Stolz – das heiligste Regiment unter den Heerscharen des Propheten, in dem noch der unterste Dienstgrad aus Offizieren bestand und dessen Chef, des Propheten triumphierendes Schwert, der Marschall aller Heerscharen war. An dem Tag, als mir der glänzende Schild und der Speer verliehen wurden, Waffen, die nur die Engel trugen, gelobte ich, sobald die Beförderung zum Captain mir das Recht dazu gab, einen Antrag auf Zulassung zum Priesteramt zu stellen.
In dieser Nacht nun, Monate später, glänzte mein Schild immer noch hell, aber auf meinem Herzen war ein Fleck. Irgendwie war das Leben in New Jerusalem nicht so, wie ich es mir in West Point vorgestellt hatte. Palast und Tempel brodelten vor Intrigen und Politik; Priester und Diakone, Staatsminister und Palastfunktionäre beteiligten sich anscheinend alle an dem Gerangel um Macht und die Gunst des Propheten. Sogar die Offiziere meines eigenen Korps waren davon angesteckt. Unser stolzes Motto »NON SIBI, SED DEI« hatte jetzt in meinem Mund einen üblen Beigeschmack bekommen.
Nicht etwa, dass ich selbst ohne Sünde gewesen wäre. Zwar hatte ich an dem Kampf um weltliche Vorteile nicht teilgenommen, aber ich hatte etwas getan, wovon ich in meinem Innern wusste, dass es schlimmer war: Ich hatte eine geweihte Schwester mit Verlangen angesehen.
Bitte, verstehen Sie mich besser, als ich mich damals selbst verstand. Ich war körperlich ein erwachsener Mann, an Erfahrung jedoch ein Kind. Meine Mutter war die einzige Frau, die ich jemals näher gekannt hatte. Als Junge, bevor ich nach West Point ging, hatte ich mich im Junioren-Seminar vor Mädchen beinahe gefürchtet. Meine Interessen verteilten sich auf die Schule, meine Mutter und den Cherubim-Trupp unserer Gemeinde, in dem ich Patrouillenführer und eifriger Gewinner von Medaillen auf allen Gebieten vom Holzschnitzen bis zum Auswendiglernen aus der Bibel war. Wenn es eine Medaille über das Thema Mädchen zu gewinnen gegeben hätte … Aber das gab es natürlich nicht.
Auf der Militär-Akademie sah ich absolut keine weiblichen Wesen, auch hatte ich nicht viel an schlechten Gedanken zu beichten. Meine menschlichen Gefühle waren noch eingefroren, und meine gelegentlichen unruhigen Träume betrachtete ich als Versuchungen des Satans. Aber New Jerusalem ist nicht West Point, und den Engeln war es weder verboten zu heiraten, noch schickliche und gesetzte Beziehungen zu Frauen zu unterhalten. Sicher, die meisten meiner Kameraden kamen nicht um Heiratserlaubnis ein, da das die Versetzung zu einem der regulären Regimenter bedeutet hätte und viele von ihnen den Ehrgeiz hatten, Militärpriester zu werden. Doch verboten war es nicht.
Auch den Laien-Diakonissen, die in Tempel und Palast die hauswirtschaftlichen Arbeiten verrichteten, war eine Heirat nicht verboten. Die meisten waren alt und reizlos. Sie erinnerten mich an meine Tanten und kamen als Gegenstand romantischer Träume nicht infrage. Ich plauderte gelegentlich mit ihnen auf den Fluren, daran war nichts Böses. Aber ich fühlte mich auch von keiner der wenigen jüngeren Schwestern besonders angezogen – bis ich Schwester Judith begegnete.
Vor mehr als einem Monat hatte ich auch an dieser Stelle Wache gestanden. Es war das erste Mal, dass mir der Platz vor den Privaträumen des Propheten zugewiesen worden war, und wenn mich das anfangs auch nervös gemacht hatte, beunruhigte mich in diesem Augenblick doch weiter nichts als die Möglichkeit, der Wachhabende könne auf seiner Runde vorbeikommen.
An diesem Abend hatte weit hinten im inneren Flur genau gegenüber meinem Posten ein helles Licht geleuchtet, und ich hatte gehört, dass Leute in Bewegung waren. Ein Blick auf mein Armband-Chronometer – ja, das mussten die Jungfrauen sein, die dem Propheten dienten. Das ging mich nichts an. Jeden Abend um zehn Uhr hatten sie Schichtwechsel – ich nannte es ihre »Wachablösung«, obwohl ich die Zeremonie nie gesehen hatte und nie zu sehen bekommen würde. Eigentlich wusste ich nicht mehr darüber, als dass diejenigen, die die nächsten vierundzwanzig Stunden Dienst hatten, zu dieser Zeit Lose um das Vorrecht zogen, den inkarnierten Propheten zu bedienen.
Ich hatte kurz hingehört und mich abgewandt. Vielleicht eine Viertelstunde später schlüpfte eine zarte Gestalt, eingehüllt in einen dunklen Mantel, an mir vorbei, stellte sich an die Brüstung und sah zu den Sternen empor. Ich zog sofort meinen Laser und steckte ihn verlegen wieder weg, denn ich sah, dass es eine Diakonisse war.
Ich hielt sie für eine Laien-Diakonisse; ich schwöre, dass es mir nicht in den Sinn kam, sie könne eine heilige Diakonisse sein. Nirgendwo in meinem Parolebuch stand geschrieben, ich müsse Schwestern, die nach draußen kamen, wieder hineinschicken, aber ich hatte noch nie gehört, dass eine es getan habe.
Sie hatte mich wohl gar nicht gesehen, bevor ich sie ansprach. »Friede sei mit Ihnen, Schwester.«
Sie zuckte zusammen und unterdrückte einen Aufschrei. Dann raffte sie ihre Würde zusammen und antwortete: »Und mit Ihnen, kleiner Bruder.«
Erst da bemerkte ich auf ihrer Stirn das Siegel Salomons, das Zeichen der Familie des Propheten. »Verzeihung, ältere Schwester. Ich hatte es nicht gesehen.«
»Ich bin nicht gekränkt.« Mir kam es vor, als wolle sie sich gern unterhalten. Natürlich schickte es sich nicht für uns, ein Privatgespräch zu führen. Ihr sterbliches Sein war dem Propheten ebenso geweiht wie ihre Seele dem Herrn, aber ich war jung und einsam – und sie war jung und sehr hübsch.
»Bedienen Sie heute Abend den Heiligen, ältere Schwester?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, die Ehre ist an mir vorbeigegangen. Mein Los wurde nicht gezogen.«
»Es muss ein großes und wundervolles Vorrecht sein, ihm persönlich zu dienen.«
»Zweifellos, obwohl ich es nicht aus eigenem Wissen sagen kann. Mein Los ist bisher noch nie gezogen worden.« Impulsiv setzte sie hinzu: »Das macht mich ein bisschen nervös. Ich bin noch nicht lange hier, wissen Sie.«
Obwohl sie im Rang über mir stand, rührte es mich, dass sie ihre weibliche Schwachheit zugab. »Ich bin überzeugt, dass Sie sich lobenswert betragen werden.«
»Ich danke Ihnen.«
Wir plauderten weiter. Wie sich herausstellte, war sie noch nicht einmal so lange in New Jerusalem wie ich. Sie war auf einer Farm im oberen Staat New York aufgewachsen, und im Albany-Seminar war sie dem Propheten geweiht worden. Ich wiederum erzählte ihr, dass ich im mittleren Westen geboren bin, keine fünfzig Meilen vom Brunnen der Wahrheit entfernt, wo der Erste Prophet sich inkarnierte. Dann teilte ich ihr mit, mein Name sei John Lyle, und sie antwortete, sie werde Schwester Judith genannt.
Ich hatte den Wachhabenden und seine verflixten Runden völlig vergessen und hätte die ganze Nacht weiterplaudern können, als mein Chronometer die Viertelstunde läutete. »Ach du meine Güte!«, rief Schwester Judith aus. »Ich hätte sofort in meine Zelle zurückkehren müssen.« Sie wollte forteilen, doch dann blieb sie noch einmal stehen. »Sie werden mich doch nicht verraten … John Lyle?«
»Ich? Oh, niemals!«
Für den ganzen Rest der Wache hatte ich an sie gedacht. Als der Wachhabende tatsächlich vorbeikam, war ich eine Spur weniger zackig als sonst.
Das ist sehr wenig, um darüber den Kopf zu verlieren, nicht wahr? Doch ein einziges Glas ist sehr viel für einen Abstinenzler; ich war nicht imstande, Schwester Judith aus meinen Gedanken zu verbannen. In dem nun folgenden Monat sah ich sie ein halbes Dutzend Mal. Einmal fuhr ich auf einer Rolltreppe an ihr vorbei; sie fuhr nach unten und ich nach oben. Wir sprachen nicht einmal miteinander, aber sie erkannte mich und lächelte. In meinen Träumen stand ich diese ganze Nacht auf der Rolltreppe, aber es gelang mir nicht, sie zu verlassen und mit Schwester Judith zu sprechen. Die anderen Begegnungen waren ebenso nichtssagend. Einmal hörte ich ihre Stimme mir leise zurufen: »Hallo, John Lyle«, und ich drehte mich gerade noch rechtzeitig genug um, dass ich eine Gestalt in einem Kapuzenmantel an meinem Ellbogen vorbei durch eine Tür gehen sah. Einmal beobachtete ich sie, wie sie die Schwäne im Burggraben fütterte. Ich wagte es nicht, mich ihr zu nähern, aber ich glaube, sie hat mich gesehen.
Der Tempel-Herold druckte die Diensteinteilung der Schwestern ebenso wie unsere. Ich stand alle fünf Tage Wache; die Jungfrauen losten einmal die Woche. So fielen unsere Wachen etwas über einen Monat später wieder zusammen. Ich sah ihren Namen – ich schwor, ich würde an diesem Abend bei der Wachablösung wieder den Ehrenposten vor den Räumen des Propheten erringen. Ich hatte keinen Grund zu der Annahme, dass Judith zu mir auf den Wall hinauskommen würde – aber im Herzen war ich überzeugt, sie werde es tun. Niemals hatte ich in West Point mehr Spucke und Politur verbraucht; ich hätte meinen Schild als Rasierspiegel benutzen können.
Aber nun war es beinahe halb elf, und es gab noch kein Zeichen von Judith, obwohl sich die Jungfrauen pünktlich um zehn hinten im Flur versammelt hatten. Meine Anstrengungen hatten mir nichts anderes als das wenig beneidenswerte Privileg eingebracht, dass ich an der kältesten Ecke des Palastes Wache schieben durfte.
Wahrscheinlich, dachte ich düster, kommt sie jedes Mal, wenn sich ihr die Gelegenheit bietet, heraus und flirtet mit dem Posten, der gerade Dienst hat. Ich führte mir bitter vor Augen, dass alle Frauen Gefäße der Sünde sind, und das schon seit Adam und Eva. Wer war ich, dass ich mir einbildete, sie habe mich für eine besondere Freundschaft ausgewählt? Wahrscheinlich war es ihr heute Abend einfach zu kalt.
Ich hörte Schritte, und mein Herz tat einen Satz vor Freude. Aber es war nur der Wachhabende, der die Runde machte. Ich hielt meine Pistole schussbereit und rief ihn an; seine Stimme schallte zurück: »Wache, was bringt die Nacht?«
Ich antwortete mechanisch: »Frieden auf Erden« und setzte hinzu: »Es ist kalt, älterer Bruder.«
»Der Herbst liegt in der Luft«, pflichtete er mir bei. »Sogar im Tempel ist es kühl.« Er ging vorbei. Seine Pistole und sein mit Lähmbomben gefüllter Patronengurt schlugen im Takt seiner Schritte an seine Rüstung. Er war ein netter alter Esel und blieb meistens für ein paar freundliche Worte stehen. Heute Abend hatte er es wahrscheinlich eilig, in die Wärme des Bereitschaftsraums zurückzukommen. Ich versank wieder in meinen deprimierten Gedanken.
»Guten Abend, John Lyle.«
Fast wäre ich aus den Stiefeln gesprungen. In der Dunkelheit des Eingangs stand Schwester Judith. Ich brachte mühsam hervor: »Guten Abend, Schwester Judith«, und sie kam auf mich zu.
»Schsch!«, warnte sie mich. »Es könnte uns jemand hören. John … John Lyle – endlich ist es geschehen. Mein Los ist gezogen worden!«
Ich fragte: »Hä?«, und setzte lahm hinzu: »Meinen Glückwunsch, ältere Schwester. Möge Gott sein Angesicht über Ihrem heiligen Dienst leuchten lassen.«
»Ja, ja, danke«, antwortete sie rasch. »Aber, John … ich hatte die Absicht, mir ein paar Augenblicke Zeit zu stehlen, um mit Ihnen zu plaudern. Jetzt geht das nicht – ich muss gleich in den Ankleideraum zur Unterweisung und zum Gebet. Ich muss laufen.«
»Dann beeilen Sie sich besser«, stimmte ich zu. Ich war enttäuscht, dass sie nicht bleiben konnte, glücklich für sie, dass ihr die Ehre widerfahren war, und ich frohlockte, dass sie mich nicht vergessen hatte: »Gott sei mit Ihnen.«
»Ich musste es Ihnen einfach erzählen.« Das Leuchten in ihren Augen verstand ich als heilige Freude. Deshalb überraschten mich ihre nächsten Worte. »Ich habe Angst, John Lyle.«
»Was? Angst?« Plötzlich fiel mir ein, wie mir zumute gewesen war und wie meine Stimme sich überschlagen hatte, als ich zum ersten Mal eine Kompanie drillte. »Fürchten Sie sich nicht, die Kraft wird Ihnen gegeben werden.«
»Oh, das hoffe ich! Beten Sie für mich, John.« Und schon war sie verschwunden, unsichtbar geworden in dem dunklen Flur.
Ich betete tatsächlich für sie und versuchte mir auszumalen, wo sie sich befand, was sie tat. Aber da ich über das, was in den Privatgemächern des Propheten vorging, so wenig wusste wie eine Kuh über das Kriegsgericht, gab ich es bald auf und dachte einfach an Judith. Etwa eine Stunde später wurde meine Träumerei durch einen schrillen Schrei innerhalb des Palastes unterbrochen, dem Unruhe und Laufschritte folgten. Ich rannte den inneren Flur hinunter und fand eine Gruppe von Frauen, die sich um den Eingang zu den Räumen des Propheten zusammendrängten. Zwei oder drei andere trugen jemanden aus diesen Räumen heraus. Im Flur blieben sie stehen und legten ihre Bürde auf den Fußboden.
»Was ist los?«, fragte ich und zog meine Pistole.
Eine ältere Schwester trat zu mir. »Es ist nichts. Kehren Sie an Ihren Posten zurück, Legat!«
»Ich habe einen Schrei gehört.«
»Das ist nicht Ihre Angelegenheit. Eine der Schwestern verlor das Bewusstsein, als der Heilige ihre Dienste verlangte.«
»Wer ist sie?«
»Sie sind ziemlich neugierig, kleiner Bruder.« Sie zuckte die Achseln. »Schwester Judith, wenn Sie es unbedingt wissen wollen.«
Ohne zu überlegen, platzte ich heraus: »Lassen Sie mich ihr helfen!«, und machte einen Schritt vorwärts. Sie verstellte mir den Weg.
»Haben Sie den Verstand verloren? Ihre Schwestern werden sie in ihre Zelle zurückbringen. Seit wann kümmern sich die Engel um nervöse Jungfrauen?«
Ich hätte sie mit einem Finger zur Seite schieben können, aber sie hatte recht. Ich trat zurück und, so ungern ich es tat, begab ich mich wieder auf meinen Posten.
Die nächsten paar Tage ging mir Schwester Judith nicht aus dem Sinn. Wenn ich dienstfrei hatte, wanderte ich in der Hoffnung, einen Blick auf sie zu erhaschen, in den Teilen des Palastes umher, die ich betreten durfte. Sie mochte krank oder in ihre Zelle verbannt worden sein, denn was sie getan hatte, galt sicher als schwerer Verstoß gegen die Disziplin. Aber ich sah sie nicht.
Meinem Stubenkameraden Zebadiah Jones fiel meine Niedergeschlagenheit auf, und er versuchte, mich ihr zu entreißen. In West Point war er drei Klassen über mir und ich einer seiner Kadetten gewesen; jetzt war er mein bester Freund und einziger Vertrauter. »Johnnie, alter Junge, du siehst aus wie ein Toter bei seinem eigenen Leichenschmaus. Was bedrückt dich?«
»Mich? Gar nichts. Vielleicht ein bisschen Verdauungsbeschwerden.«
»So? Komm, machen wir einen Spaziergang! Die Luft wird dir guttun.«
Ich ließ mich von ihm ins Freie locken. Er redete nur über Alltägliches, bis wir auf der breiten Terrasse anlangten, die den Südturm umgibt, und keine optischen oder akustischen Überwachungsgeräte mehr zu befürchten brauchten. »Komm schon, erzähl es mir!«
»Ach, Zeb, ich kann es niemand anderem aufbürden.«
»Warum nicht? Wozu ist ein Freund da?«
»Äh … du wirst schockiert sein.«
»Das bezweifele ich. Das letzte Mal schockiert war ich, als ich vier Karten von einer Farbe zusätzlich zum As zog. Es stellte meinen Glauben an Wunder wieder her, und seitdem bin ich immer verhältnismäßig immun gewesen. Mach schon! Nennen wir es eine vertrauliche Mitteilung – der ältere Berater und all dieser Quatsch.«
Ich ließ mich von ihm überreden. Zu meiner Überraschung schockierte es Zeb wirklich nicht, dass ich mich für eine heilige Diakonisse interessierte. Also erzählte ich ihm die ganze Geschichte und ergänzte sie mit meinen Zweifeln und Problemen, all den schwarzen Gedanken, die ich seit dem Tag gehegt hatte, als ich mich in New Jerusalem zum Dienst meldete.
Er nickte gleichmütig. »Ich verstehe, welche Wirkung es auf dich hat, da ich dich kenne. Sag mal, du hast doch nichts davon bei der Beichte erwähnt?«
»Nein«, gestand ich verlegen.
»Dann lass es auch weiterhin bleiben! Major Bagby ist weitherzig, schockieren würdest du ihn nicht – aber er könnte sich verpflichtet fühlen, deine Geschichte an seine Vorgesetzten weiterzumelden. Du wirst dich der Inquisition nicht stellen wollen, auch wenn du ein alabasterweißes Unschuldslamm wärest. Vielmehr, gerade weil du unschuldig bist – ja, du bist es; jeder hat zuweilen unfromme Gedanken. Aber der Inquisitor erwartet, Sünde zu finden, und wenn er keine findet, gräbt er weiter.«
Bei der Vorstellung, dass ich der Befragung unterzogen werden könnte, hätte sich mir beinahe der Magen umgedreht. Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen. Zeb fuhr ruhig fort: »Johnnie, mein Junge, ich bewundere deine Frömmigkeit und deine Unschuld, aber ich beneide dich darum nicht. Manchmal ist zu viel Frömmigkeit ein schlimmeres Handicap als zu wenig. Du entsetzt dich darüber, dass man die Politik ebenso braucht wie das Psalmensingen, um ein großes Land zu regieren. Nun sieh mich an! Mir sind die gleichen Dinge wie dir aufgefallen, als ich neu hier war. Aber ich hatte nichts anderes erwartet und war nicht schockiert.«
»Aber …« Ich verstummte. Seine Bemerkungen klangen schmerzhaft nach Häresie; ich wechselte das Thema. »Zeb, was meinst du, worüber mag Judith an dem Abend, als sie dem Propheten diente, so erschrocken sein, dass sie in Ohnmacht fiel?«
»Woher soll ich das wissen?« Er streifte mich mit einem Blick und sah wieder weg.
»Ich dachte, du könntest eine Ahnung haben. Du hörst doch sonst immer allen Palastklatsch.«
»Nun … ach, vergiss es, alter Junge! Es ist wirklich nicht wichtig.«
»Du weißt es also?«
»Das habe ich nicht gesagt. Meine Vermutungen könnten der Wahrheit ziemlich nahekommen, aber mit Vermutungen ist dir ja nicht gedient. Also vergiss es!«
Ich blieb stehen, trat vor ihn und sah ihn an. »Zeb, wenn du irgendetwas darüber weißt – oder vermutest –, will ich es hören. Es ist wichtig für mich.«
»Immer mit der Ruhe! Du hattest Angst, mich zu schockieren; vielleicht möchte ich jetzt dich nicht schockieren.«
»Was meinst du? Sag es mir!«
»Immer mit der Ruhe, habe ich gesagt. Denke daran, wir sind auf einem Spaziergang, uns drückt nicht eine einzige Sorge, wir reden über unsere Schmetterlingssammlungen und fragen uns, ob es heute Abend wieder gekochtes Rindfleisch geben wird.«
Immer noch schäumend, ließ ich mich von ihm weiterziehen. Er fuhr friedlicher fort: »John, du bist offensichtlich nicht der Typ, der etwas erfährt, einfach indem er sein Ohr auf den Boden legt – und die Inneren Mysterien hast du noch nicht studiert, nicht wahr?«
»Das weißt du doch. Der Psycho-Offizier, der die Klassifizierung vornimmt, hat mich noch nicht zugelassen. Ich weiß nicht, warum.«
»Ich hätte dich einmal in meine Bücher hineinschauen lassen sollen, als ich dafür büffelte. Nein, das war, bevor du deine Abschlussprüfung machtest. Zu schade, denn sie erklären alles in viel zartfühlenderer Sprache, als ich es fertigbringe – und rechtfertigen jede Einzelheit gründlich, falls dir an der Dialektik der religiösen Theorie etwas liegt. John, was stellst du dir unter den Pflichten der Jungfrauen vor?«
»Nun, sie bedienen ihn, kochen sein Essen und so weiter.«
»Vor allem Letzteres: ›Und so weiter.‹ Diese Schwester Judith – ein unschuldiges kleines Mädchen vom Lande, wie du sie beschreibst. Voll frommen Eifers, meinst du nicht?«
Ich erwiderte etwas steif, dass mich gerade diese Eigenschaft zu ihr hingezogen habe. Vielleicht glaubte ich es selbst.
»Es könnte ja sein, dass sie erschrak, einfach weil sie eine ziemlich weltliche und zynische Diskussion zwischen dem Heiligen und – oh, sagen wir – dem Finanzverwalter mitanhörte, über Steuern und Zehnte und den besten Weg, sie aus den Bauern herauszuquetschen. Es könnte etwas in der Art gewesen sein, obwohl die Schriftführerin für eine solche Konferenz kaum eine grasgrüne Jungfrau sein würde, die zum ersten Mal Dienst tut. Nein, es ist beinahe sicher, dass es das ›Und so weiter‹ war.«
»Ich kann dir nicht folgen.«
Zeb seufzte. »Du bist wirklich einer von Gottes Unschuldigen! Heiliger Name, ich dachte, du wüsstest es und wärst nur zu prüde, um es zuzugeben. Sogar die Engel treiben es zuweilen mit den Jungfrauen, wenn der Prophet mit ihnen fertig ist. Ganz zu schweigen von den Priestern und Diakonen. Ich weiß noch, wie …« Er unterbrach sich plötzlich; sein Blick war auf mein Gesicht gefallen. »Wisch dir diesen Ausdruck ab! Willst du, dass wir jemandem auffallen?«
Ich versuchte, mich zusammenzunehmen, und schreckliche Gedanken jagten sich in meinem Kopf. Zeb fuhr gelassen fort: »Ich vermute – wenn es für dich von solcher Bedeutung ist –, dass deiner Freundin Judith der Titel ›Jungfrau‹ im rein körperlichen Sinn noch ebenso zusteht wie im spirituellen. Vielleicht bleibt sie sogar Jungfrau, wenn der Heilige so böse auf sie ist, wie er wahrscheinlich war. Sie ist sicher ebenso vernagelt wie du und verstand die symbolischen Erklärungen nicht, die man ihr gab. Und dann verlor sie die Fassung, als der Zeitpunkt gekommen war, zu dem es nichts mehr misszuverstehen gab, woraufhin er sie hinauswarf. Kein Wunder!«
Wieder blieb ich stehen und murmelte Bibelworte vor mich hin, von denen ich gar nicht gewusst hatte, dass ich sie kannte. Zeb blieb ebenfalls stehen und betrachtete mich mit einem Lächeln zynischer Toleranz. »Zeb«, sagte ich, und ich flehte ihn beinahe an, »das ist ja schrecklich. Schrecklich! Sag mir bloß nicht, dass du es billigst!«
»Ob ich es billige? – Mann, das ist alles Teil des Plans! Es tut mir leid, dass du nicht zum höheren Studium zugelassen worden bist. Gib acht, ich werde dir einen Schnellkurs verpassen. Gott verschwendet nichts. Richtig?«
»Das ist fundierte Doktrin.«
»Gott verlangt von einem Menschen nichts, was über seine Kraft geht. Richtig?«
»Ja, aber …«
»Schnauze! Gott befiehlt dem Menschen, fruchtbar zu sein. Da der inkarnierte Prophet besonders heilig ist, wird von ihm auch verlangt, besonders fruchtbar zu sein. Das ist die Quintessenz; mit den Feinheiten kannst du dich befassen, wenn du das Thema studierst. In der Zwischenzeit sage ich dir: Wenn der Prophet sich im Fleisch demütigen kann, um seine Pflicht zu tun, wer bist du, dass du Krawall schlagen willst? Beantworte mir das!«
Natürlich konnte ich darauf nicht antworten, und wir setzten unsern Spaziergang schweigend fort. Ich musste zugeben, dass Zebs Erklärungen logisch waren und dass sich seine Schlussfolgerungen auf offenbarten Grundsätzen aufbauten. Das Problem war, dass mir die Schlussfolgerungen nicht mundeten. Ich hätte sie sehr gern ausgespuckt wie etwas Giftiges, das ich geschluckt hatte.
Schließlich tröstete ich mich mit dem Gedanken, dass Zeb sicher war, Judith sei nichts passiert. Ich fühlte mich langsam besser, redete mir zu, Zeb habe recht und es sei nicht meines Amtes, entschieden nicht meines Amtes, über die Moral des heiligen inkarnierten Propheten zu richten.
Doch meine Gedanken liefen im Kreis. Meine Erleichterung über Judith rührte doch allein von der Tatsache her, dass ich sie mit sündigen Blicken betrachtet hatte, und es konnte unmöglich eine Vorschrift für die eine heilige Diakonisse und eine andere Vorschrift für alle übrigen geben. Schon fing ich wieder an, mich unglücklich zu fühlen, als Zeb plötzlich anhielt. »Was war das?«
Wir eilten an das Geländer der Terrasse und blickten nach unten. Der Südwall liegt nahe an der eigentlichen Stadt. Eine Menge von fünfzig oder sechzig Leuten stürmte den Hang herauf, der zu den Palastmauern führt. Vor ihnen rannte mit abgewandtem Kopf ein Mann in einem langen Kaftan. Offensichtlich war sein Ziel das Tor der Freistätte.
Zebadiah beantwortete seine eigene Frage. »Darum geht der Lärm – der Pöbel steinigt einen Paria. Wahrscheinlich war er so leichtsinnig, sich nach fünf außerhalb des Gettos erwischen zu lassen.« Er starrte hinab und schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass er es schaffen wird.«
Zebs Voraussage bewahrheitete sich im gleichen Augenblick. Ein großer Stein traf den Mann zwischen den Schulterblättern, er stolperte und fiel. Sofort waren sie über ihm.
Er kämpfte sich auf die Knie hoch, wurde von einem Dutzend Steinen getroffen und brach zusammen. Er gab einen gebrochenen, hohen Klagelaut von sich, dann zog er einen Zipfel des Kaftans über seine dunklen Augen und die kräftige römische Nase.
Ein paar Minuten später gab es nichts mehr zu sehen als einen Haufen Steine und einen daraus hervorragenden Fuß in einem Pantoffel. Er zuckte und war still.
Mit einem Gefühl der Übelkeit wandte ich mich ab. Zebadiah bemerkte meinen Gesichtsausdruck.
»Warum«, fragte ich zu meiner Verteidigung, »halten diese Parias an ihrer Ketzerei fest? Sonst scheinen sie ganz harmlose Menschen zu sein.«
Zeb hob eine Braue. »Vielleicht halten sie es nicht für Ketzerei. Hast du nicht gesehen, dass der Mann sich seinem Gott anbefahl?«
»Aber das ist nicht der wahre Gott.«
»Er muss anderer Meinung gewesen sein.«
»Aber sie alle müssen es besser wissen; wir haben es ihnen oft genug gesagt.«
Zeb lächelte auf so aufreizende Art, dass es aus mir heraussprudelte: »Ich verstehe dich nicht, Zeb – hol mich dieser und jener, wenn ich es tue! Vor zehn Minuten hast du mich in den richtigen Glaubenssätzen befestigt, und jetzt scheinst du die Ketzerei zu verteidigen. Bring das mal auf einen Nenner.«
Er zuckte die Achseln. »Oh, ich kann den advocatus diaboli recht gut spielen. In West Point habe ich den Debattier-Klub geleitet, weißt du noch? Irgendwann werde ich ein berühmter Theologe sein – wenn der Großinquisitor mich nicht vorher kassiert.«
»Nun … hör mal … Hältst du es für richtig,die Gottlosen zu steinigen? Oder nicht?«
Er wechselte abrupt das Thema. »Hast du bemerkt, wer den ersten Stein geworfen hat?« Das hatte ich nicht, und ich sagte es ihm. Ich erinnerte mich nur noch, dass es ein Mann in ländlicher Kleidung gewesen war, weder eine Frau noch ein Kind.
»Es war Snotty Fassett.« Zebs Oberlippe kräuselte sich.
An Fassett erinnerte ich mich nur zu gut. Er war zwei Klassen über mir gewesen und hatte aus meinem Kadettenjahr eine Zeit gemacht, die ich vergessen wollte. »So ist es also zugegangen«, antwortete ich langsam. »Zeb, ich glaube, Geheimdienstarbeit könnte ich nicht verkraften.«
»Sicher nicht als agent provocateur«, stimmte er zu. »Wie dem auch sei, ich glaube, dass der Rat solche gelegentlichen Vorfälle braucht. Diese Gerüchte über die Loge und all das …«
Ich hakte bei seiner letzten Bemerkung ein. »Zeb, meinst du, dass an dieser Loge etwas dran ist? Ich kann nicht glauben, dass es irgendeinen organisierten Widerstand gegen den Propheten gibt.«
»Nun – draußen an der Westküste hat es nachweislich einige Unruhe gegeben. Ach, vergiss es! Unsere Aufgabe ist es, hier Wache zu halten.«
2
Aber es war uns nicht vergönnt, das zu vergessen. Zwei Tage später wurden die inneren Wachen verdoppelt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wirklich Gefahr bestand, denn der Palast war so unangreifbar, wie nur je eine Festung erbaut worden ist, und die Tiefgeschosse hätten sogar Atombomben standgehalten. Außerdem wurde jeder, der den Palast betrat – auch dann, wenn er vom Tempelgrundstück kam –, angerufen und ein Dutzend Mal überprüft, bevor er den wachehabenden Engel vor den Räumen des Propheten erreichte. Nichtsdestotrotz, in den oberen Rängen wurde man nervös; irgendetwas musste vor sich gehen.
Es freute mich jedoch sehr, dass ich als Zebadiahs Partner eingeteilt wurde. Die doppelte Stundenzahl Wache stehen zu müssen fiel nicht so schwer, wenn man ihn zur Unterhaltung dabeihatte. Zumindest traf das auf mich zu. Der arme Zeb musste sich von mir während der langen Nachtstunden unaufhörlich nerven lassen. Ich redete von Judith und wie unglücklich ich mit den Zuständen in New Jerusalem sei. Schließlich fuhr er mich an:
»Hör mal zu, du Dummkopf! Liebst du sie?«
Ich versuchte auszuweichen. Bisher hatte ich nicht einmal mir selbst eingestanden, dass meine Gefühle für sie über ein Interesse an ihrem Wohlergehen hinausgingen. Er schnitt mir das Wort ab.
»Entweder du liebst sie, oder du liebst sie nicht. Entscheide dich! Falls ja, wollen wir uns praktischen Dingen zuwenden. Falls nein, hör auf, von ihr zu faseln!«
Ich holte tief Atem und wagte den Sprung. »Ich glaube, ja, Zeb. Man sollte es nicht für möglich halten, und ich weiß, dass es Sünde ist, aber so ist es nun einmal.«
»Und eine Dummheit ist es noch dazu. Aber zur Vernunft zu bringen bist du ja doch nicht. Okay, also du liebst sie. Und nun?«
»Wie bitte?«
»Was willst du tun? Sie heiraten?«
Darüber dachte ich mit solcher Verzweiflung nach, dass ich mein Gesicht mit den Händen bedeckte. »Natürlich möchte ich das«, gestand ich. »Aber wie kann ich?«
»Genau. Du kannst es nicht. Du kannst nicht heiraten, ohne von hier versetzt zu werden, und sie kann überhaupt nicht heiraten. Auch hat sie keine Möglichkeit, ihre Gelübde zu brechen, da sie bereits geweiht ist. Aber wenn du nackte Tatsachen vertragen kannst, ohne zu erröten, habt ihr eine ganze Menge Möglichkeiten. Ihr beiden könntet es sehr angenehm haben – falls du imstande bist, deine infernalische Sittenstrenge zu überwinden.«
Eine Woche zuvor hätte ich gar nicht verstanden, auf was er anspielte. Jetzt wusste ich es. Ich konnte nicht einmal echt wütend darüber werden, dass er mir einen so ehrlosen und sündhaften Vorschlag machte. Er meinte es gut – und etwas von der allgemeinen Verderbnis war schon in meine eigene Seele eingedrungen. Ich schüttelte den Kopf. »Das hättest du nicht sagen sollen, Zeb. So eine ist Judith nicht.«
»Okay. Dann vergiss es! Und sie! Und rede nicht mehr von ihr!«
Ich seufzte müde. »Sei nicht so streng mit mir, Zeb. Ich weiß einfach nicht, wie ich damit fertig werden soll.« Ich sah nach rechts und nach links, dann riskierte ich es und setzte mich auf die Brüstung. Unser Posten war nicht in der Nähe der Wohnung des Heiligen, sondern auf dem Ostwall; Captain Peter van Eyck, unser Wachhabender, war zu fett, um öfter als einmal pro Wache so weit zu kommen, also durfte ich es wagen. Ich war todmüde, weil ich in letzter Zeit nicht viel geschlafen hatte.
»Entschuldige.«
»Sei nicht böse, Zeb. So etwas ist nichts für mich, und ganz bestimmt ist es nichts für Judith – für Schwester Judith.« Ich wusste, was ich mir für uns beide wünschte: Eine kleine Farm mit vielleicht hundertsechzig Morgen Land wie die, auf der ich geboren worden war. Schweine und Hühner und barfüßige Kinder mit glücklichen, schmutzigen Gesichtern, und Judith, deren Gesicht aufleuchtete, wenn ich vom Feld kam, und die sich dann mit der Schürze den Schweiß vom Gesicht wischte, damit ich sie küssen konnte … Keine andere Verbindung mit der Kirche und dem Propheten mehr als die sonntäglichen Versammlungen und der Zehnte.
Aber es konnte nicht sein, niemals. Ich schlug es mir aus dem Sinn. »Zeb«, fuhr ich fort, »nur um meine Neugier zu befriedigen – du hast angedeutet, dass so etwas immerfort vor sich geht. Wie? Wir leben hier in einem Goldfischglas. Ich kann es mir nicht vorstellen.«
Er grinste mich so zynisch an, dass ich ihn am liebsten geohrfeigt hätte, aber seine Stimme klang nicht höhnisch. »Nimm zum Beispiel deinen eigenen Fall …«
»Kommt nicht infrage!«
»Nur als Beispiel, habe ich gesagt. Schwester Judith ist im Augenblick nicht zu erreichen; sie muss in ihrer Zelle bleiben. Aber …«
»Was? Sie ist verhaftet worden?« Ich dachte entsetzt an die Befragung und was Zeb über die Inquisitoren gesagt hatte.
»Nein, nein, nein! Sie ist nicht einmal eingesperrt. Man hat ihr gesagt, sie solle drinnen bleiben, das ist alles, mit Gebeten, Brot und Wasser zur Gesellschaft. Man reinigt ihr Herz und unterweist sie in ihren spirituellen Pflichten. Wenn sie die Dinge im wahren Licht sieht, wird ihr Los wieder gezogen werden – und diesmal wird sie nicht wieder ohnmächtig umfallen und sich blamieren.«
Ich unterdrückte meine erste Reaktion und versuchte, ruhig darüber nachzudenken. »Nein«, sagte ich. »Judith wird es niemals tun. Auch dann nicht, wenn sie für immer in ihrer Zelle bleiben muss.«
»So? Da wäre ich nicht so sicher. Die Schwestern können sehr überzeugend sein. Wie würde es dir gefallen, wenn man in Schichten für dich betete? Aber nimm einmal an, dass sie tatsächlich das Licht sieht, nur damit ich mit meiner Geschichte weitermachen kann.«
»Zeb, woher weißt du das alles?«
»O Mann, ich bin seit drei Jahren hier! Meinst du, in der Zeit lernt man nicht, sich hintenherum Informationen zu beschaffen? Du hast dir Sorgen um sie gemacht – und bist mir damit auf die Nerven gegangen, wenn ich so sagen darf. Also habe ich die Vögelchen gefragt. Aber weiter im Text. Sie sieht das Licht, ihr Los wird gezogen, sie erweist dem Propheten den heiligen Dienst. Danach versammelt sie sich mit allen anderen einmal in der Woche, und ihr Los wird höchstens einmal im Monat gezogen. Innerhalb eines Jahres – es sei denn, der Prophet entdeckt an ihr einen ganz besonderen Seelenliebreiz – erscheint ihr Name nicht mehr auf der Liste der Teilnehmerinnen an der Auslosung. Es ist nicht einmal notwendig, solange zu warten, obwohl es diskreter wäre.«
»Das alles ist schändlich!«