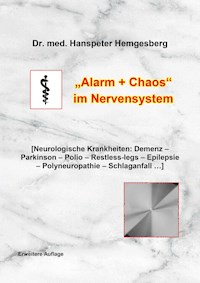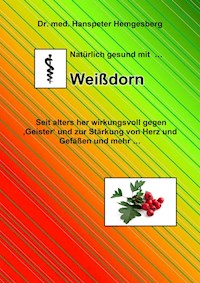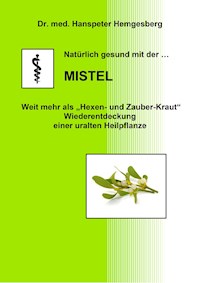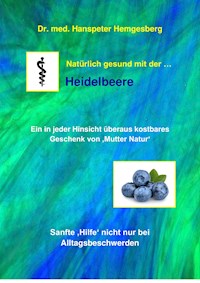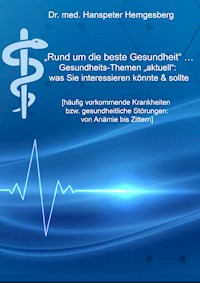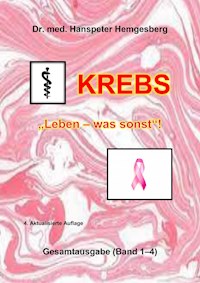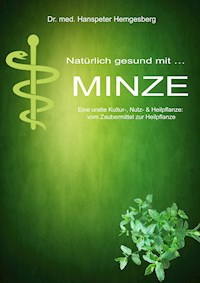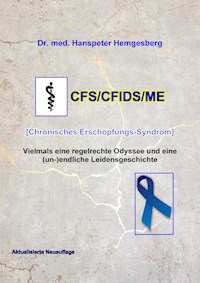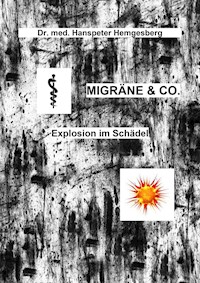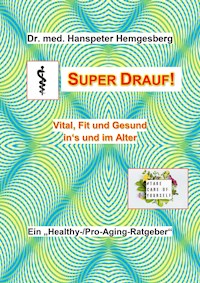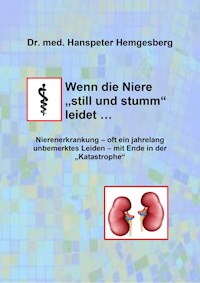
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Nierenerkrankungen können hoch-fulminant & akut auftreten; sie werden aber auch nicht selten als sogen. "Zufallsbefund" diagnostiziert im Rahmen einer anstehenden Untersuchung wegen einer anderen Erkrankung – z.B. bei Diabetes mellitus –. So gehen einige Nierenerkrankungen über Jahre unentdeckt – "maskiert" und "still" & "schleichend" – dahin und dann ist es leider oftmals "zu spät"! Liegt eine akute bakterielle Infektion zugrunde oder ist ein Bluthochdruck oder ein Diabetes mellitus bekannt, ist es zu einem akuten Harnverhalt gekommen, dann führt der Weg des Kranken sofort & sogleich zum Arzt. Anders verhält es sich vielmals bei solchen Nierenerkrankungen, die zumal über eine mehr oder minder lange Anfangszeit keine oder so gut wie keine und besonders keine auf eine Nierenerkrankung hinweisenden Symptome verursachen. Dann wird diese "stille Krankheit" vielmals zufällig entdeckt. Leider ist es dann – was die kompletten Heilungschancen angeht – nicht selten bereits "5-nach-12!" Daher: Bei unklaren Beschwerden oder solchen Beschwerden, die dem Patienten bisher nicht bekannt waren, lieber 10x zu früh & zu oft, als nur 1x zu spät zum Arzt! Und stets:"Die Beschwerden nicht bagatellisieren und "auf die lange Bank schieben", sondern ernst nehmen und baldigst kompetente Hilfe aufsuchen!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wenn die Niere „still und stumm“ leidet …
Nierenerkrankung – oft ein jahrelang unbemerktes Leiden – oft mit einem Ende in der „Gesundheits-Katastrophe“
Nierenerkrankungen können hoch-fulminant und akut auftreten; sie werden aber auch nicht selten als sogen. „Zufallsbefund“ diagnostiziert z.B. im Rahmen einer anstehenden Untersuchung wegen einer anderen Erkrankung – z.B. bei Diabetes mellitus –.
So gehen einige Nierenerkrankungen über Jahre unentdeckt – „maskiert“ und „still“ und „schleichend“ – dahin und …
… dann ist es leider oftmals „zu spät“!
Liegt eine akute bakterielle Infektion zugrunde oder ist ein Bluthochdruck oder ein Diabetes mellitus bekannt, ist es zu einem akuten Harnverhalt gekommen, dann führt der Weg des Kranken sofort & sogleich zum Arzt.
Anders verhält es sich vielmals bei solchen Nierenerkrankungen, die zumal über eine mehr oder minder lange Anfangszeit, keine oder so gut wie keine und besonders keine auf eine Nierenerkrankung hinweisenden Symptome verursachen.
Dann wird diese „stille und stumme Krankheit“ vielmals zufällig entdeckt. Leider ist es dann – was die kompletten Heilungschancen angeht – nicht selten bereits „5-nach-12!“
Daher:
Bei unklaren Beschwerden oder solchen Beschwerden, die dem Patienten bisher nicht bekannt waren, lieber 10x zu früh & zu oft, als nur 1x zu spät zum Arzt!
Und stets:
„Die Beschwerden nicht bagatellisieren, sondern von Anbeginn an ernst nehmen!“
Dieses Buch Wenn die Niere still und stumm“ leidet [mit dem Untertitel Nieren-Erkrankungen - oft ein jahrelang unbemerktes Leiden – mit einem Ende in der „Gesundheits-Katastrophe“ will Sie als Betroffene/-n, allgemein an der eigenen Gesundheit Interessierte/-n und ganz besonders aber auch alle biologisch-naturheilkundlich (und insbesondere ganzheitlich) orientierten Therapeuten informieren und beraten.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Jedoch kann eine Ver-bindlichkeit aus ihnen nicht hergeleitet werden.
Wenn die Niere „still und stumm“ leidet …
Nierenerkrankungen – oft ein jahrelang unberkstes Leiden – mit Ende in der „Katastrophe“
Verfasser:
Dr. med. Hanspeter Hemgesberg
Redaktionelle Mitarbeit + Lektorat
Rosemarie Hemgesberg
Wissenschaftliche Recherche
Andrea Hemgesberg
Aktualisierte Auflage 2021
© Copyright 2021
für die vorgestellten originären ganzheitlichen Behandlungskonzepte „Nieren-Erkrankungen“ und die Benennungen liegen ausschließlich bei
Dr. med. Hanspeter Hemgesberg.
Nutzung - auch auszugs- und teilweise - in Wort, Schrift und allen elektronischen (und auch den zukünftigen) elektronischen Kommunikationssystemen und in irgendeiner sonstigen Form (Fotokopie, Mikrofilm und andere Dokumentations- und Archivierungsverfahren) sowie die Weitergabe an Dritte und/oder die Vervielfältigung und sonstige Verbreitung ist verboten und strafbewehrt!
Gerichtsstand: jeweiliger Wohnort Dr. Hanspeter Hemgesberg
© Copyright 2021
für die Gestaltung des Covers liegt bei Andrea Hemgesberg, Miesbach.
Die missbräuchliche Verwendung ist strafbewehrt!
Gerichtsstand: jeweiligerWohnort Andrea Hemgesberg.
Hinweis:
Bei der farblichen Gestaltung des Covers und der Übernahme der Graphik „Nieren“ und des Äskulap-Stabes handelt es sich um „Lizenz-freie“ Bilder.
ISBN 978-3-7485-9427-7
Widmung
„Geteiltes Leid, ist …“
Meinem lieben Cousin Hans von der Schwäbischen Alb mit dem Wunsch, dass es noch eine lange Zeit weitergehen möge mit Deinem erfüllten Leben!
Vorwort zur aktualisierten Auflage
Warum nach so ‚kurzer Zeit‘ eine Aktualisierung?
Die Frage ist völlig berecntigt.
Zumindest auf den ‚ersten Blick‘.
Aber dann ‚auf den zweiten Blick nicht mehr.
Zum „Warum“ ist rasch geantwortet.
So rasch wie sich ganz generell neue Erkenntnisse in allen Lebensbereichen einstellen, so verhält es sich auch mit neuen medizinischen Erkenntnissen und auch Optionen hinsichtlich Diagnostik und Behandlung.
Dem muss meinerseits Rechnung getragen werden.
Hinzu gekommen ist aber insbesondere aus dem Kreis der Behandlung – weit überwiegend Ärzte und gelegentlich auch einige Heilpraktiker – der Wunsch, die eine oder andere Passage in meinem Buch etwas detaillierter zu besprechen.
Hinzu gekommen ist aber auch, dass ich in Gesprächen mit Kollegen gefragt wurde, warum nicht „die oder jene“ Krankheit in meinem Buch ‚berücksichtigt‘ worden war.
Ich habe versucht, einerseits die Anregungen zu berücksichtigen und andererseits weitere „Nieren-Krankheiten“ in das Buch aufzunehmen.
Da ist es dann nicht ausgeblieben, dass das Buch im Volumen „etwas zugenommen“ hat.
Miesbach/Oberbayern, zu Jahresbeginn 2021
Achten Sie auch sich und Ihre Gesundheit!
Ihr
Dr. med. Hanspeter Hemgesberg
Einführung
Gedicht zum Schmunzeln
Die Nieren
Bei den Menschen und auch Tierenist es wichtig, dass sie funktionieren,weil sie den Wasserhaushalt regulierenund Schädliches nach draußen expedieren.Auch der Blutdruck wird durch sie geregelt,ohne den man schnell dem Grab zu segelt.Den Wert des Blutes, ob alkalisch oder sauer,kontrollieren unsre Nieren genauer.Was im Blut so alles drin ist wird bestimmt,und wenn was fehlt, was man dann nimmt:Natrium, Calcium oder auch Magnesium,Phosphate, Bicarbonate oder Kalium.Die Nieren bilden auch Hormone!Ach, was wären wir bloß ohnedas Renin, Calcitriol, Erythropoetin,ohne Kinin und Prostaglandin?Ja, wir wären arme Tröpfe,dem Tode ausgelieferte Geschöpfe,Ein Leben ohne unsere Nierenmöchte keiner gerne ausprobieren.
[© Jens Wohlkopf – nordeutscher Lokaldichter](Quelle: Das Deutsche Reimlexikon)
Hinweis
Die Erklärungen/Erläuterungen zu allgemeinen medizinischen und besonders auch zu biologisch-naturheilkundlichen Begriffen und Behandlungs-Verfahren – gekennzeichnet mit einem () – finden Sie im Glossar unter Lexikon:„Begiffe verständlich gemacht!“
Ihr
Dr. med. Hanspeter Hemgesberg
„Die Beschwerden stets ernst nehmen“!
Die Leidensspirale für viele „Nierenkranke“ bzw. Menschen, die an einigen Nieren-Erkrankungen leiden [z.B. an einer Niereninsuffizienz]– und nicht selten über viele Jahre „unentdeckt“, weil und wenn ohne charakteristische Beschwerden in den Anfangsjahren verlaufend – zieht sich immer weiter und enger zu und die Folgen – zumal bleibende und gravierende Schädigungen und letztlich unausweichlichen Auswirkungen für den gesamten Organismus „MENSCH“ – sind vielmals einerseits vorprogrammiert und andererseits unausweichlich und zwar immer dann, wenn die Beschwerden bzw. die Erkrankungen an Nieren-Erkrankungen nicht ernst genommen werden.
Einerseits vom Erkrankten selbst [Motto: „Wird schon nicht so schlimm sein!“] und andererseits auch von seinen Behandlern, die nicht frühzeitig eine umfassende Diagnostik mit nachgehender konsequenter und befund-adäquater Behandlung vornehmen!
Für den Erkrankten selbst – letztlich betroffen neben der körperlichen Ebene auch die geistige wie auch die seelische Ebene, kurzum: der gesamte „MENSCH“ in allen seinen Ebenen! –, dann auch „mit“betroffen das persönliche und soziale Umfeld – von Verwerfungen in der Familie/beim Lebenspartner bis zu Konflikten im Berufsleben bis zur Arbeitslosigkeit und dann verbunden mit sozialem Abstieg.
Sicherlich in der gravierendsten Form nicht allzu häufig vorkommend (Gott sei Dank), aber für das Einzelschicksal eine große Härte!
Ganz besonders:
Der Super-GAU
d.h.: dann auch vielmals krankheits-bedingt
Der vorzeitige Tod!
Müsste (zumindest in etlichen Krankheitsfällen) nicht sein, (fast) immer aber nicht als Höchstschadensausmaß!
Setzt aber immer voraus (s.o.), dass die Beschwerden früh (genug) ernst genommen werden und einer fachlich kompetenten Behandlung zugeführt werden.
Das heißt für den „Betroffenen/Nierenkranken“:
In jedem Falle sollten Sie die Beschwerden nicht „auf die leichte Schulter nehmen“ und stets sollten Sie sich hüten vor „zweifelhaften Behandlungsmaßnahmen“ – das heißt aber auch, vor (wenngleich gut gemeinten) Ratschlägen von Freunden und Bekannten!
Weiter noch:
Keine – wie auch immer sich darstellende –
Selbstbehandlungen!
Das heißt für den/die „Behandler“:
Nehmen Sie die vorgetragenen und beklagten Beschwerden ernst, insbesondere immer dann, wenn die vorgetragenen Beschwerden auf eine Erkrankung der Nieren hinweisen.
Stets sollten sich die involvierten Therapeuten an den bewährten Ausspruch des renommierten Arztes, Prof. Dr. Franz Volhardt(1872-1950 – Internist und Doyen der Nephrologe – Direktor der Medizinischen Klinik Uni Frankfurt/ Main ab 1927 bis zur Zwangs-Emeritierung 1938) halten und erinnern:
„Vor die Therapie haben die Götter die Diagnose gesetzt“!
Ziel muss/sollte es sein …
… so früh als möglich Nieren-Erkrankungen zu erkennen und diese einer umfassenden und befund-adäquaten Therapie zuzuführen, um so fortschreitene und irreparable Schäden zu vermeiden.
Hierzu möchte Ihnen– Betroffenen wie Behandlern –dieses Buch ein Ratgeber und eine Informationsquelle sein.
Das heißt aber auch, dass neben den unverzichtbaren Möglichkeiten und Erkenntnissen der wissenschaftlichen Medizin (= Schulmedizin)auch bewährte Möglichkeiten und Chancen der ‚seriösen‘ biologisch-naturheilkundlichen Ganzheitsmedizin ganz bewusst für die einzelnen „Krankheitsbilder“ vorgestellt und besprochen werden.
Aber auch dies muss hier gesagt und festgehalten sein:
Für alle „Nieren-Erkrankungen“ – dies gilt ganz besonders für und bei chronischen Nierenkrankheiten – gibt es keine – kann es auch nicht – „Universalpatent-Therapie“, kein „Ein-für-Alle-und-Alles-und Jedes-Rezept“!
In jedem (Einzel-)Fall muss erst untersucht und dann behandelt werden und zwar stets individuell, selektiv und den sonstigen Erfordernissen und Krankheiten sowie Belastungen Rechnung tragend!
Stets in dieser Reihenfolge:
Erst Diagnostik, dann Therapie!
Fakt ist aber und vielmals bestätigter:
Mit einer umfassenden
„Individuellen, Befund-adaptierten,Ganzheitsmedizinischen multi-modalen Therapie“
– also: den Möglichkeiten der wissenschaftlichen Medizin + der seriösen biologischen Medizin i.S.e. auf mehreren Behandlungs-Säulen bestehenden individuellen befund-angepassten Therapie – lassen sich die Nieren-Erkrankungen im Frühstadium oftmals gänzlich beheben und die Folge-Schäden und -Auswirkungen vielmals vermeiden und verhindern.
Nutzen Sie möglichst alle Möglichkeiten für sich!
Sprechen Sie darüber mit Ihrem Therapeuten!
Sprechen Sie Ihren Therapeuten gezielt auf diese Möglichkeiten an!
Prüfen Sie und treffen Sie (gemeinsam mit Ihrem/Ihren Therapeuten) dann Ihre Entscheidungen bezüglich der vorgesehenen und„maßgeschneiderten/passgenauen“ Therapie!
Nieren-Erkrankungen: Oft eine „schleichende, stille und stumme“ Gefahr!
Nicht gerade wenige Nieren-Erkrankungen verlaufen – insbesondere in der Anfangszeit (und die kann sich ausdehnen über viele Jahre!) – für den Erkrankten still und heimlich und maskiert, d.h. ohne spezielle, sprich: charakteristische und so auf eine Nieren-Erkrankung hinweisende, Schädigung der Nieren.
Übrigens:Das gilt besonders vielmals für und bei Menschen, die an einer chronischen Krankheit leiden, die sich schädigend auf die Nieren-Funktion auswirkt/auswirken kann – wie außer Diabetes mellitus(alle Typen), arterielle Hypertonie und/oder generalisierte arterielle Durchblutungs-Störungen (arterielle Verschlusskrankheit/pDBS).
Das gilt ganz besonders für eine Nieren-Insuffizienz (z.B. aufgrund eines Diabetes mellitus), aber auch für eine Nierenschädigung bei arteriellem Bluthochdruck und leider auch für eine Erkrankung an einem bös-artigen Nierentumor.
Eine Nierenfunktionsstörung infolge einer „Sepsis“ („Blutvergiftung“) und/oder hervorgerufen durch eine „Schock-Niere“ und/oder im Rahmen eines „Multi-Organ-Versagens“ (MODS) wird stets stationär und auch auf einer Intensiv-Abteilung behandelt mit entsprechender umfangreicher Diagnostik
Insbes. wird nach wie m.M.n. zu wenig daran gedacht (und zu wenig entsprechende Untersuchungen durchgeführt) an eine Nieren-Beteiligung durch einige virale und bakterielle Infektionen, durch Umweltgifte, Schwermetalle und Edelmetalle, Nebenwirkungen von Medikamenten und bes. auch durch chron. Konsum von Alkohol und Tabakwaren.
Wenn ich mir hier die Anmerkung erlauben kann und darf:
Gerade, was die Schädigung der Nierenfunktion durch die letzt-genannten Schädigungs-Faktoren angeht, wird noch immer m.M.n. zu wenig Beachtung von Therapeuten auf die „Nebenwirkung mit Langzeit-Folgeauswirkung“ diesbezüglich gelegt!
Daher ist es immens wichtig, Beschwerden im Bereich der Niere – auch immer dann, wenn sie nur gelegentlich auftreten und nur wenige Tage anhalten und/oder, wenn sie einhergehen mit kurzzeitiger Müdigkeit & Schlappheit (gerade diese Beschwerden werden gerne abgetan und erklärt mit beruflicher Überlastung, Stress usw.) – „ernst zu nehmen“ und diese Beschwerden abklären zu lassen.
Bei einigen bestehenden und zumal chronischen Krankheiten – wie u.a. Diabetes mellitus, Hypertonie, Herzinsuffizienz oder Erkrankungen im Rheumatischen Formenkreis – sollte es zum selbstverständlichen „Standard-Repertoire“ der Behandler – d.h. besonders der „Hausärzte“ – gehören, regelmäßig ein Auge zu werfen auf eine evtl. (Mit-) Erkrankung der Nieren.
Nebenbei:
Etliche notwendige Arzneimittel bzw. Wirkstoffe können eine Schädigung der Nieren – bes. in der Langzeit-Anwendung – nach sich ziehen. Dies gilt es unbedingt zu beachten.
Leitsatz sollte unbedingt sein:
„Wehret den Anfängen!“
[diese Aufforderung geht zurück auf den römischen Dichter Ovid [Publius Ovidius Naso – geb. 43 v.Chr, gest. 17 n.Chr.]; er schrieb in seiner Schrift „Remedia amoris“ (Heilmittel gegen die Liebe): … „Principis obsta.“ … und weiter „Sero medicina parata, cum mala per longas convaluere moras“ [Wehret den Anfängen! Zu spat wird die Medizin bereitet, wenn die Übel durch langes Zögern erstarkt sind.]
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen!
Nieren-Erkrankungen: Eine Übersicht
Umfangreich ist der Katalog an Erkrankungen der Nieren.
Der Katalog umfasst dabei „relativ harmlose“ Erkrankungen wie z.B. eine bakterielle Nieren-Infektion bis hin zu schwersten und vielmals irreparablen Erkrankungen wie ein bösartiger Nierentumor – das Nieren-Karzinom –.
Nachstehend eine Übersicht über Nieren-Erkrankungen:
A. Nieren-Insuffizienz (NI)
a. Akutes Nierenversagen (ANV)
b. Chronisches Nierenversagen (CNV)
B. Immunologische Nieren-Erkrankungen
C. Glomeruläre Nieren-Erkrankungen
a. Akutes Nephritisches Syndrom
[akute Glomerulonephritis (AGN) – post-infektiöse Glomerulonephriotis (PIGN)
b. Rapid Progressives Nephritisches Syndrom (RPGN)
c. Idiopathische Renale Hämaturische Syndrome
[IgA-Nephropathie – fokale Glomerulonephritis]
d. Nephrotisches Syndrom (NS)
D. Tubulo-Interstitielle Nieren-Erkrankungen
a. Akute Nicht-infektiöse Tubulo-interstitielle Nephritis
b. Chronische Tubulo-interstitielle Nephritis
E. Nephro-toxische Störungen/Erkrankungen
a. Toxische Nephropathien durch Arzneimittel
[Bakterien (bes. bei wiederholten Infektionen) wie u.a. Yersinien, Mycobacterium tuberculosis, Leptospiren – Viren wie u.a. Epstein-Barr-Virus (EBV), Zytomegalie-Virus (ZMV), Hanta-Virus, Poliomyelitis-Virus, Humanes Immundefizienz-Virus, Polyoma-Virus – Antibiotika wie u.a. AminoglykosideSulfonamide, Neomycin, Tetracycline usw. – Analgetika wie u.a. Salizylate, Nicht-Steroidale Anti-Rheumatika (NSAR) {Diclofenac, Ibuprofen, Phyenylbutazon …} – Anti-Epileptika wie u.a. Trimethadion, Paramethadion, Carbamazepin – Immunkomplexbildner wie u.a. Gold-Salze, Penicillamin, Captopril, Levamisol – Lokalanästhetika wie u.a. Benzocain, Prilocain – Mutterkorn-Alkaloide – Drogen wie u.a. Heroin – Schwermetalle wie u.a. Quecksilber, Blei, Cadmium, Uran, Arsen, Eisen, Chrom, Vanadium, Wismut, Thallium, Selen – Edelmetalle wie Gold – Lösungsmittel wie u.a. Methanol,. Tetrachlorkohlenstoff, diverse Kohlenwasserstoffe … – Wirkstoffe zur Karzinom-Therapie wie u.a. Cyclosporin, Cisplatin, Cyclophosphamid Methotrexat … – Herbizide & Pestizide wie u.a. Dioxin, Zyanid, Organo-Chlor-Verbindungen, Terpene … – Pflanzliche & Tierische Gifte wie u.a. Speisepilze, Schlangen- & Spinnen-Gifte, Insektengifte, Aflatoxine u.a. Substanzen mehr]
F. Infektionen der Nieren
a. Akute Bakterielle Pyelonephritis
(akute infektiöse tubulo-interstitielle Nephritis)
b. Chronische Bakterielle Pyelonephritis
(chronische infektiöse tubulo-interstitielle Nephritis)
G. Vasculäre Erkrankungen der Nieren
a. Akute Vasculäre Erkrankungen
1. Maligne Nephro-Angiosklerose
(maligne Nephrosklerose – maligne Hypertension)
2. Nieren-Infarkt
3. Atheroembolische Nierenerkrankung
4. Nierenrinden-Nekrose
5. Nierenvenen-Thrombose
6. Langsam progressive Gefäßerkrankung
(benigne Nephrosklerose)
b. Renovasculäre Hypertension
H. Nierenerkrankungen bei systemischen und metabolischen Syndromen
a. Anomalien der renalen Transportfunktion
1. Renale tubuläre Azidose (RTA)
2. Renale Glucosurie
3. Nephrogener Diabetes insipidus (NDI)
4. Bartter-Syndrom
(kombinierte Störung des Flüssigkeits-, Elektrolyt- & Hormon-Haushalts)
5. Liddle-Syndrom
(Störung des epithelkialen Transports der Niere)
I. Hereditäre und kongenitale Störungen
a. Zystenbildung
1. Polyzystische Nierendegeneration
2. Zysten im Nierenmark
3. Markschwamm-Niere
b. Hereditäre chronische Nephropathien
1. Hereditäre Nephritis (Alport-Syndrom)
2. Turner-Kieser-Syndrom
J. Obstruktive Nierenerkrankungen
a. Hydronephrose (primäre & sekundäre H.)
K. Harnstein-Bildung
a. Nephrokalzinose
b. Harnsäurestein-Bildung in der Niere
c. Zystinstein-Bildung
L. Bösartige (maligne) Nieren-Tumoren
a. Einwanderung maligner Zellen eines Lymphosarkoms oder bei Leukämie in das Nierenparenchym
a. Nieren(zell)-Karzinom (Grawitz-Tumor – früher: Hypernephrom)
b. Wilms-Tumor (Mischtumor aus embryonalem Gewebe – v.a.bei Kindern)
c. Nieren-Sarkom
Fakt ist:
Während Herz und Lunge im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, führt die Niere im medizinischen Alltag und auch im öffentlichen Bewusstsein eher ein Schattendasein.
Die Möglichkeiten der Prävention werden noch zu wenig genutzt und auch bei der Früherkennung von Nierenerkrankungen könnte einiges besser laufen.
Zurück zum Thema:
Sollten nunmehr alle diese Nieren-Erkrankungen – bei etlichen dieser Krankheiten bestehen unterschiedliche „Grund- bzw. Ausgangs-Krankheiten“ wie z.B. bei der Niereninsuffizienz der Diabetes mellitus() – besprochen werden, dann bräuchte es dazu einen umfangreichen Sammelband.
Daher ist es nur allzu verständlich – der werte Leser, ganz gleich, ob interessierter Laie, ob von einer Nierenkrankheit Betroffener oder auch, ob an Ganzheitsmedizin interessierter Mediziner und Heilpraktiker –, wenn und dass ich mich auf einige wenige – leider aber für die Gesundheit gravierende, weil die Gesundheit in toto tangierende – Nieren-Erkrankungen beschränke.
So werden in den folgenden Kapiteln besprochen:
1. Nierensteine
Dazu – obgleich „keine Krankheit im eigentlichen Sinne“, vielmehr eine „Akut-Situation“ aufgrund einer bestehenden Krankheit bzw. deren Folge & Auswirkung –:
2 Harnverhalt
3. Zystennieren (polyzystische Nierenerkrankung)
4. Chronische Bakterielle Pyelonephritis
5. Chronische Niereninsuffizienz (CNI) / Chronisches Nierenversagen
(CNV)
6. Nieren(zell)-Karzinom.
Nierensteine
Definition
Unter dem Nierenstein-Leiden – Fachname: Nephrolithiasis – ist das Vorkommen von Steinen/Konkrementen in den Nieren zu verstehen.
Die Neprolithiasis zählt zu den Konkrement-/Stein-Vorkommen in den Nieren und den ableitenden Harnwegen – Harnleiter und Harnblase –; den Sammelbegriff für das Vorkommen in den ableitenden Harnwegen nennt man „Urolithiasis“.
Vorkommen, Häufigkeit
Nierensteine treten bei männlichen Erwachsenen 1,5mal so häufig auf wie bei weiblichen.
Die Krankheitshäufigkeit von Nierensteinen beträgt in Mittel- und West-Europa fünf Prozent. Das Verhältnis von betroffenen Männern zu Frauen liegt bei 7 zu 5.
Am häufigsten tritt die Erkrankung zwischen dem 30. und dem 50. Lebensjahr auf.
In den Industriestaaten leben 20 Prozent der Männer und 7 Prozent der Frauen mit einem erhöhten Steinrisiko. Ist bereits ein Nierenstein aufgetreten, so beträgt das Risiko eines Rezidivs(Wiederauftretens) 60 Prozent.
Ursachen und Pathogenese
Die Pathogenese der Harn- und Nieren-Steinbildung ist noch nicht vollständig geklärt.
Eindeutig ist jedoch, dass es sich um ein multifaktorielles Geschehen handelt.
Man diskutiert zwei Hypothesen
1. Kristallisations-Theorie
Konkrementbildung in einer übersättigten Lösung
2. Kolloid-Theorie
Anlagerung von Harnsalzen an harnpflichtige organische Substanzen
Wahrscheinlich liegt eine Kombination beider Theorien vor.
Unumstritten ist die Tatsache, dass eine übersättigte Lösung vorliegen muss. Dazu kommt, dass in allen Steinarten harnpflichtige organische Substanzen als Gerüst nachzuweisen sind.
Als Ursachen sind inzwischen gesichert:
1. Biographische (das Leben des Kranken betreffend) Ursachen
a. Genetische/Hereditäre Ursachen
- Cystinurie
[aufgrund einer genet. bedingten Stoffwechselerkrankung; autosomal-rezessiv vererbt[
- Hereditäre Hyperoxalurie
[angeborene Stoffwechselstörung; autosomalrezessiver Erbgang; kommt meist vor bei Kleinkindern]
- Lesch-Nyhan-Syndrom (Hyperurikämie-Syndrom)
[X-chromosomal-rezessiv vererbste Stoffwechselerkrankung aus dem
Rheumatischen Formenkreis]
- Mucoviszidose (Zystische Fibrose)
[genetische Erkrankung mit autosomal-dominantem Erbgang mit Lokalisation in verschiedenen Organen]
- Renale tubuläre Azidose (RTA)
[genetische Erkrankung mit autosomal-rezessivem Erbgang, die zu einem Defekt im Tubulussystem der Niere führt]
- Xanthinurie
[angeborene Stoffwechselstörung mit autosomal-rezessiven Erbgang]
b. Einzelniere
[anlage-bedingt oder nach Nephrektomie einer Niere]
c. Schwangerschaften
[größtes Risiko bei Frauen mit 3 und mehr Schwangerschaften]
c. Berufe
[Ärzte insbes. Operateure]
2. Verhaltens-bedingte Ursachen
a. Ernährung
[Exsikkose/Dehydrierung (Austrockung), mangelnde Flüssigkeits-Aufnahme, Fehl-Ernährung, hohe Zufuhr von tier. Eiweißen, fettreiche (bes. tier.) Ernährung, hohe Zufuhr auf lange Zeit von Oxalsäure-haltigen Lebensmitteln (Mangold, Spinat, Rhabarber, Kakao-Pulver – hohe Aufnahme von Calcium, hohe Aufnahme über lange Zeit von Purin-haltigen Nahrungsmitteln (u.a. Innereien, Hering, Makrele), hoher Kochsalz-Konsum (neben Salz z.B. Konserven, Fertiggerichte), Frucht-Zucker-haltige Getränke – Mangel an Mikronährstoffen (Mineralstoffe & Spuren-Elemente]
b. Genussmittel-Konsum
- Alkohol
(Frau: >20 g/Tag; Mann >30 g/Tag)
- Tabak (Rauchen usw.)
c. Körperliche Aktivität
- Immobilität bzw. Immobilisation
d. Übergewicht/Adipositas
e. Psycho-Soziale Situation
- chronischer Stress/Distress und Stress-Krankheit
3. Krankheits-bedingte Ursachen
a. Anorexia nervosa (Magersucht)
b. benigne (gutartige) Prostata-Vergrößerung
c. Gastro-Intestinale Funktionsstörungen
[chron. Bauchspeicheldrüsen-Entzündung (chron. Pankreatitis), Colitis ulcerosa (chron. Dickdarm-Entzündung/Autoimmunkrankheit), Z.n.Dünndarm-Resektion, M. Crohn (chron. Dickdarmentzündung/Au8toimmunkrankheit), Leberzirrhose, Zöliakie Gluten-Intoleranz)]
d. Harnabfluss-Störung und Harntransport-Störungen
e. chronische/rezidivierende Harnwegs-Infektionen
f. Überfunktion der Neben-/Bei-Schilddrüsen
g. Chronische Darmentzündung (CED)
h. bösartige (maligne) Tumorerkrankungen
i. Stoffwechsel-bedingte Übersäuerung (metabolische Azidose)
j. Tumor-Lyse-Syndrom
[lebensbedrohlich! – bedingt durch Zerfall von Tumoren unter Chemo-Therapie]
Als unabhängige Risiko-Faktoren gelten:
a. erniedrigtes HDL-Cholesterin
b. erhöhtes Serum-Calcium
c. erhöhte Calcium-Ausscheidung im Urin
d. zu hoher Serum-Oxalat-Spiegel
[v.a. zu finden bei Chron.-entzündlichen Darmerkrankungen/CED, Pankreas-Insuffizienz und bes. auch nach OP’s wegen Fettsucht und insbes. bei fortlaufender ‚Fehlernährung‘ mit einem Zuvie an Purin]
e. Hyperurikämie (zu hoher Harnsäure-Blutspiegel)
f. erhöhte Triglycerid-Werte im Blut
g. Medikamente
[lange und vielfältige Antibiotika-Therapie – Laxantien-Missbrauch – Intoxikation mit Vit. D]
i. Operationen
[urologische Eingriffe/OPs]
Fakt:
Die Entstehung von Nieren-Steinen bzw. zuvor von Nieren-Griess/-Konkrementen ist von vielen Faktoren abhängig, die je nach Ausprägung zu verschieden zusammengesetzten Konkrementen führen.
Viele Stoffwechselabläufe sind in diesem Zusammenhang noch ungeklärt.
Einteilung
Nierenstein ist nicht gleich Nierenstein!
Die Nieren-Steine/-Konkremente unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Form, ihrer chemischen Zusammensetzung und auch hinsichtlich unterschiedlicher „Mi8schformen“.
1. Einteilung nach der Form
a. Ventil-Steine
b. Hirschgeweih-Steine
c. Korallen-Steine
d. Ausguss-Steine
2. Einteilung nach chemischer Zusammensetzung
a. Calcium-Oxalat-Steine (65% Häufigkeit)
b. Urat-Steine (Harnsäure-Steine, 15% Häufigkeit)
c. Magnesium-Ammonium-Phosphat-Streine (sogen. Stovit-Steine oder Infekt-Steine, 11% Häufigkeit)
d. Calciumphosphat.Steine (ca. 9% Häufigkeit)
e. Cystin-Steine (ca. 1% Häufigkeit)
f. Xanthin-Steine (ca. 1% Häufigkeit)
3. Mischformen
Hinsichtlich Kombination verschiedener Formen und bes. verschiedener chemischer Zusammensetzung
Lokalisation
Hier gemeint das Vorkommen von Steinen in der Niere.
In den Nieren können Nieren-Konkremente/-Steine vorkommen in:
1. Nierenbucht(Sinus renalis)
[d.i. ein von Nierenparenchym umschlossener anatomischer Raum, der teilweise mit Bindegewebe und Fettgewebe ausgefüllt ist und der das Nierenbecken umschließt]
2. Nierenbecken (Pelvis renalis)
[d.i. der ‚Auffangraum‘ der Nieren für den aus den Nierenpapillen/Papillengängen (Ductus papillares) tropfenden Harn. Im Verlauf verjüngt sich das Nierenbecken hin zum Harnleiter (Ureter), der Verbindung zwischen Niere und Harnblase (Vesica urinaria)]
3. Nierenkelch(e) (Calix renalis)
[Die Nierenkelche sind ein System aus Hohlräumen im Inneren der Nieren, die den Harn aus den Sammelrohren bzw. den Ductus papillares in das Nierenbecken(Pyelon) weiterleiten. Sie sind der erste Abschnitt der ableitenden Harnwege – Die Nierenkelche formen in ihrer Gesamtheit wiederum das Nierenbecken (Pelvis renalis)]
4. Nierenmark(Medulla renalis)
[Als Nierenmark wird der innere Anteil des Nierenparenchym bezeichnet. Es liegt zwischen Nierenrinde und Nierenbecken und besteht aus 10-12 kegelförmige Gewebestrukturen, den sogen. Nierenpyramiden]
5. Nierenrinde (Cortex renalis)
[Die Nierenrinde ist der zwischen der Nierenkapsel und dem Nierenmark gelegene Teil der Niere. Die Nierenrinde liegt wie ein Mantel zwischen den Basisabschnitten der Nierenpyramiden und der Nierenkapsel]
6. Nierenpyramiden (Columnae renales)
[die Form des Nierenmarks eines jeden Lobus (Nierenlappen) erinnert an einen Kegel oder eine Pyramide, daher auch der Name „Nierenpyramide/Markpyramide“. Die Spitze der Pyramide ragt als ‚Nierenpapille‘ (Papilla renalis) in die Nierenkelche hinein]
Zusammanmerkung:
Neben dem Vorkommen in den Nieren lokalisieren sich Konkremente/Griess/Steine im ableitenden Harnsystem noch an:
a) Kreuzung der Harnleiter(Ureter)
[Auf seinem Weg unterkreuzt er auf dem Musculus psoas major (Großer Ledenmuskel) die Hoden- bzw. Eierstockgefäße (Arterien wie Venen), weiter kaudal (nach unten) in seinem Verlauf überkreuzt er die Arteria iliaca communis (Beckenschlagader) oder Arteria iliaca externa (äußere Beckenarterie) und im kleinen Becken unterkreuzt er kurz vor seinem Eintritt in die Wand der Harnblase den Samenleiter oder die Arteria uterina (Gebärmutter-Arterie)]
b) Harnleiter-Engen
[Die drei Harnleiter/Ureter-Engen finden sich:
1. am Ausgang aus dem Nierenbecken
2. an der Überquerung der Beckenschlagader bzw. äußeren Beckenarterie und
3. am Eintritt des harnleiters in die Harnblase]
Symptome
„Symptome durch Nierensteine müssen nicht immer und in jedem Fall auftreten!“
Das ist vielmals dann der Fall, wenn dier Nierenstein „ruhig und fest“ an den Prädilektionsstellen in der Niere liegt. –
Nebenbei:
Solche ‚ruhigen Nierensteine‘ werden als Zufallsbefunde entdeckt, wenn z.B. eine Sonographie des Abdomens (Ultraschalluntersuchung des Bauchraums) aus sonstigem Anlass vorgenommen wird.
Leit-Symptom Nr. 1 Schmerzen
Von leichtgradig und nicht ständig bestehend bis hin zu einem subjektiv empfundenen höchstgradigen und schier nicht mehr zu ertragendem Dauerschmerz bzw. anhaltender Kolik; plötzlich einschießend, stechend und auch wellenförmig (ondulierend), welche je nach Lage des Nierensteins in den Rücken, den seitlichen Unter-Bauch, die Leisten oder in die Genital-Region ausstahlen (können).
Diese Koliken können nur wenikge Minuten anhalten, aber auch mehr als 1-2 Stunden!
Übrigens:
Schmerzen/Koliken sind Indiz dafür, dass sich ein Nierenstein aus seiner bisherigen ruhigen Position gelöst hat und auf seiner „Wanderung“ irgendwo „steckengeblieben“ ist.
Leit-Sympton Nr. 2 Übelkeit-Brechreiz-Erbrechen
Weitere potentielle Symptome
1. Kreislauf-Probleme
[Blutdruckabfall bis hin zu Kreislauf-Kollaps, Kaltschweißigkeit]
2. Pollakissurie (häufiges Wasserlassen kleiner/kleinster Harnmengen)
mit nicht zu unterdrückendem Harndrang
3. Gefahr reflektorischer Damrverschluss (Ileus)
4. oft Haematurie (Blut im Urin) (aufgrund Schleimhautverletzungen durch
scharfkantige Steine)
5. motorische Unruhe
Kommt es zusätzlich zu einer Harnwegs-Infektion, dann außerdem:
6. Fieber, Schüttelfrost, Schmerzen beim Wasserlassen
Komplikationen
Immer dann, wenn ein Nierenstein vom Zeitpunkt seiner „Loslösung aus der bisherigen Verankerung“ und es auf seinem Weg in der Niere selbst in die ableitenden harnwege zu einem neuerlichen „Stau“ durch ein Festsetzen – in der Niere im Nierenbecken und der obersten (proximalen) Hernleiterenge (Ausgang Nierenbecken in die Harnleitermündung) –, dann kann durch dieses Passage-Hindernis der Urin nicht mehr abfließen; es kommt zum „Harnstau“.
Harnstau in der Niere bedeutet, dass sich der gebildete Urin in der Niere sammelt und mit und in diesem die aus dem Blut in der Niere heraus-gefilterten Giftstoffe (Toxine). Bleibt das Abflusshindernis über eine längere Zeit bestehen, dann schädigen diese Toxine das Nierengewebe.
Und bei längerem bestehen solcher Passagehindernisse in der Niere kommt es zu Nierenfunktions-Störungen.
Eine weitere Gefahr bei einem länger bestehenden Harnstau in der Niere – und generell in den ableitenden Harnwegen – besteht darin, dass sich Bakterien (z.B. Escherichia Coli) leicht regelrecht ‚einnisten‘ können und so zu Entzündungen/Infektionen in der Niere kommt/ kommen kann.
Die Kombination aus Harnstau und Infektion begünstigt das Übertreten von Bakterien aus den Harnwegen und dem z.B. Nierenbecken in den Blutkreislauf.
In der schwerwiegendsten Folge kann es dadurch zu einer Urosepsis respektive einer Nephrosepsis(„Nieren-Vergiftung“)kommen, also einer Blutvergiftung durch Bakterien, die vom Urogenitaltrakt (Nieren-Harn- und Geschlechtstrakt) in die Blutbahn gelangt sind. In vielen Fällen kommt es dann – auch nach Behebung des Nierenstein-Problems – wegen eines erhöhten Blut-Titers dieser Bakterien immer wieder zu Infekten im Urogenitalsystem.
Diagnostik
In vielen Fällen gibt bereits die Anamnese des Kranken mehr als erste Hinweise auf Nierensteine.
In/durch der/die ärztlichen Untersuchung erhärtet sich zumeist die
Erkrankung.
Gesichert wird die Diagnose letztlich durch eine sich anschließende Labor-Untersuchung und durch Bildgebende Verfahren.
Anmerkung:
Mit diesen Untersuchungen gilt es außerdem, die Erkrankung an Nierensteinen abzugrenzen gegenüber sonstigen Erkrankungen, die z.B. eine Harnstauung oder Schmerzen hervorrufen können, so u.a. Entzündung der Niere durch Bakterien und Viren (Glomerulo- oder Pyelonephritis, Nephritis) oder ein Nieren-Tumor.
Ich gehe (und dies empfehle ich) in 2 Schritten vor:
A. Obligate Basis-Diagnostik
1. Labor
a. Blut
- Großes Differential-Blutbild
- BSG/BKS (Blutsenkung)
b. Urin
- Urin-pH und spezif. Gewicht
- Urin-Sediment
- Urin-Status
Anmerkung:
Finden sich im Urin-Status „pathogene Keime“, dann sollte unbedingt anschließend
eine Urin-Kultur („Uri-Kult“) angelegt werden mit einem „Antibiogramm“.
TIPP:
Bei Verdacht auf Nieren-Konkrement/Nierenstein sollte beim Urinieren zur Gewinnung des Urin für die Diuagnostik der Harn durch ein Sieb gefiltert werden, um so evtl. im Harn vorhandene Konkremente für die spätere „Stein-/ Konkrement-Diagnostik“ sichern zu können!
2. Doppler-Duplex-Sonographie, farb-codiert, Abdomen
Speziell des gesamten Urogenital-Trakts
B. Weiterführende fakultative Diagnostik
1. Röntgen
[Nieren – Harnleiter – Blase]
2. Ausscheidungs-Urographie
[von Nieren und ableitenden Harnwegen mit Kontrastmittel]
!Vorsicht!
Gggfls. vorher auf „Konntrastmittel-Allergie“ prüfen und ebenso auf eine vorliegende Nierenfunktionsstörung
Um diese Untersuchungen umgehen zu können, empfiehlt sich
3. Spiral-Computer-Tomographie (Spiral-CT)
[von Nieren und dem Urogenital-System – dazu wird kein Kontratmittel benötigt]
4. Zystoskopie
[endoskopische Spiegelung der Harnblase]
5. Labor-Diagnostik
a. Blut
- Serum-Elektrolyte (Natrium, Kalium, Calcium, Phosphor/anorgan. Phosphat
- Nieren-Retentionswerte (Kreatinin, Harnstoff, Harnstoff-Stickstoff (Harnstoff-N), Harnsäure, Glomeruläre Filtrations-Rate/GFR – Screening auf Nieren-Carcinom mittels Tumor-Marker – Nieren-Belastung mit/durch Schwermetallen (insbes. Cadmium, Blei, Quecksilber)
b. 24-Std.-Sammelurin
mit u.a. Elektrolyte im Urin (Natrium, Kalium, Calcium, Phosphor/anorgan. Phosphat), Kreatinin, Albumin
6. Konkrement-/Stein-Untersuchung
[Eine Untersuchung der Ablagerungen im Labor kann Aufschluss über die genaue Ursache der Stein-/Konkrementbildung geben. Dann lassen sich die Nierensteine gezielt behandeln, beziehungsweise man kann der Entstehung weiterer Steine gezielt vorbeugen]
Therapie
Nierenstein-Behandlung bedeuted immer „zweigleisig“ zu verfahren und vorzugehen:
Einmal die „Akut-Therapie“ und dann die „Sekundär-Prävention“.
I. Akut-Therapie bei Nierenstein
Hier stehen wiederum 2 Behandlungs-Wege offen, in Abhängigkeit von der Größe und der Lage des Steins in der Niere und von der Intensität der durch den Stein verursachten Beschwerden: einmal eine „konservative bzw. indirekte“ Therapie – respektive ein Versuch, die Beschwerden zu beherrschen – und dann eine „aktive bzw. direkte“.
A. Konservative bzw. indirekte Therapie
Die Behandlungsmaßnahmen zielen darauf, den Nierenstein auf natürlichem Weg zum Ausscheiden zu bringen. Sie umfassen insbesondere:
1. Eigenmaßnahmen des Patienten
a. Reichlich Flüssigkeitsaufnahme
[etwa 3 L/Tag – kein koffeinhaltiger Kaffee und Schwarztee, keine zucker-haltigen Limonaden, keine Colagetränke. – Hinweis: Flüssigkeitsmenge unter Berücksichtigung sonstiger bestehender Krankheiten mit einer Beschränkung der Flüssigkeitszufuhr (u.a. Herzinsuffizienz)]
b. Wärme-Anwendungen
[z.B. Heizkissen, warme bis kurzdauernde heiße Sitzbäder]
c. Viel körperliche Bewegung
[Treppen rauf-und-runter, 2 Stufen auf einmal nehmen, Kniebeugen, Laufen/ Joggen und Tanzen]
d. Auf Ernährung achten
[wenig, besser keine purin-haltige Lebensmittel (z.B. Spinat/Mangold, Makrelen, Heringe, Innereien) essen – generell Fleish-Konsum deutlich einschränken – Salz-Konsum einschränken – viel Frischgemüse/Obst/Salate essen – auf ausreichende Zufuhr an Calcium aus Nahrung achten (z.B. Milch und Milchprodukte]
Der nachfolgende Punkt ist bereits gedacht zur Vorbeugung weiterer Nierensteine
e. Übergewicht kontinuierlich abbauen
[d.h. ca. 10-12% der aktuellen Körpergewichts/Jahr reduzieren!, aber keine Crash-Diäten!]
2. Arzneiliche Therapie
[d.h. Maßnahmen zur Behandlung der Schmerzen/Koliken]
a. Schulmedizinische Therapie
[Verordnung von
!Vorsicht!
Nierenfunktion kontrollieren!
- Novaminsulfon/Metamizol
- Tramadol oder Tilidin (= Semi-Opinoide)
auch in Kombinationen]
b. Biologisch-naturheilkundliche Therapie
[bei nur leichtergradigen Schmerzen als Monotherapie, sonst komplementär/additiv zur schulmedizin. Therapie:
- Traumeel® (HEEL)
- Spascupreel® (HEEL)
Hinweis:
Bd. Arzneimittel optimalerweise in Kombination
Unabdingbar bei einer konservativen Therapie ist die permanente Kontrolle durch den behandelnden Arzt – optimalerweise ein Urologe! –; die Wirkung, sprich das Ansprechen der Therapie, sollte regelmäßig überwacht werden mit:
a) Sonographie der Nieren
[um zu sehen, ob der Nierenstein noch festsitzt oder ob er weitergewandert ist und evtl. an einer weiteren Enge festsitzt]
b) Labor-Kontrollen
Meine persönliche Meinung:
Ich halte die „konservativ-inaktive Therapie bei einem Nierenstein“ nur für praktikabel und gerechtfertigt, wenn
a. der Patient ansonsten gesund ist und nicht an einer massiveren
gesundheitlichen Störung leidet (z.B. einer chron. Herzinsuffizienz/CHI, bekannter Einschränkung der Nierenfunktion),
b. die Beschwerden durch den Nierenstein sich für den Patienten im
c. der Nierenstein spätestens binnen 2-3 Tage spontan „abgeht“.
d. Spätenstens dann halte ich eine aktive Therapie für zwingend geboten, insbesondere um sonst evtl. drohende Komplikationen – Harnstau, Infektionen – zu vermeiden!
B. Direkte bzw. aktive konservative Therapie
Immer dann, wenn die konservativ-inaktive Therapie nicht erfolgreich war innerhalb des gesteckten Zeitfensters – z.B. weil der Stein entweder feststeckt oder im Lumen zu groß ist (>7mm) oder weil unter der Therapie mit Schmerzmitteln die Gefahr besteht, dass die Nierenfunktion geschädigt wird und besonders, weil die Schmerzn bzw. Koliken zunehmen – ist eine „direkte bzw. aktive Therapie“ dringend geboten.
Etliche Optionen stehen zur Verfügung. Der behandelnde Arzt sollte mit dem Patienten abklären, welche Optionen bestehen und welche er aufgrund des Nierensteins (Größe, Lage usw.) er präferiert. So z.B.:
a. Litholye oder Chemolyse
[d.i. die medikamentöse Auflösung von z.B. Nierensteinen]
b. Extrakorporale Stoßwellen-Lithotrypsie (ESWL)
[d.i. die nicht-invasive (unblutige) mechanische Zertrümmerung von Steinen durch zielgerichtete Stoßwellen]
c. Percutane Nephrolithopraxie (PCNL)
[d.i. ein invasives (blutiges) Verfahren zur Entfernung von Nierensteinen; es handelt sich um einen endoskopischen Eingriff; percutan bedeutet, dass es sich nicht um einen offenen chirurg. Eingriff handelt, sondern über die Punktion der Haut]
d. Ureterorenoskopie (URS)
[d.i. eine Nierenstein-OP bei Nierensteinen, die in den Harnleiter gerutscht sind und dort festsitzen; von der Harnröhre wird das Instrument (ähnlich einem Endoskop) über die Blase in die Harnleiter geschoben und der Stein entfernt]
e. Schlingentisch-Extraktion
[d.h. es wird eine Schlinge über den Harnleiter eingeführt und versucht, mit der Schlinge den Stein herauszuziehen –
!Vorsicht!
wegen hoher Verletzungsgefahr heute nur noch sehr selten in Anwendung!]
f. offene Operation
[eine „offene OP“ zur Steinentfernung ist heute extrem selten; i.d.R. nur dann, wenn der Nierenstein sehr groß ist und das Nieren-Hohlsystem vollständig ausfüllt]
g. Laparoskopie bzw. laparoskopische Chrirgie
Und:
In jedem Falle ist eine „Nach- und Weiterbehandlung“ zum erneuten Stein-Vorkommen – also zur „Sekundär-Prophylaxe“ – unbedingt ratsam und dem Patienten anzuemepfehlen!
II. „Sekundär-Prophylaxe“
Etwas flapsig das Motto:
„Lieber Stein-arm, als stein-reich!“
Wenngleich die erneute Bildung von Nierensteinen und Steinen im gesamten Urogenital-System nicht gänzlich zu vermeiden ist, kann aber – das ist wissenschaftlich eindeutig belegt – durch eine „Sekundär-Prophylaxe“ ein wirkungsvoller ‚Stein-Schutz‘ erreicht werden.
Und diese Vorbeugung ist besonders wichtig für Menschen, die bereits an einem Konkrement/Stein im Urogenital-System erkrankt waren.
Fakt:
„Wer bereits einmal an einem Stein im Urogenital-System erkrankt war, der muss immer damit rechnen, dass sich erneut Konkremente bzw. Steine bilden!“
Das heißt, dass hier der Mensch seinerseits gefordert ist.
Es ist inzwischen wissenschaftlich in groß-angelegten internationalen Studien belegt und bewiesen, dass eine „umfassende Umstellung der bisherigen Ernährung“ wirkungsvoll ist.
In Kurzform:
a. viel trinken (über den Tag verteilt)
b. Oxalat-reiche Lebensmittel weitgehend meiden (Spinat/Mangold,
Petersilie, Rhabarber, Walnüsse, Schokolade, Kakao)
c. auf eine ausreichende Versorgung mit Calcium achten (Vorsicht ist
geboten für Niereninsuffizienz-Kranke! – hier die Zufuhr mit dem Arzt abstimmen)
d. Konsum an tierischem Eiweiß deutlich einschränken
e. Konsum an Kochsalz deutlich einschränken
Ich ergänze:
Unerläßlich ist, dass sich der ehemalige Nierenstein-Patient regelmäßig durch einen Arzt untersuchen und kontrollieren läßt – u.a. Urin- und Blut-Untersuchung, Sonographie –.
Bedarfsweise muss eine bestehende Hyperurikämie (Erhöhung der Harnsäure im Blut) medikamentös behandelt werden.
Zur Vorbeugung von Steinen kann der Urin angesäuert werden – dies sollte mit dem behandelnden Arzt besprochen werden –.
Auch sollte der Patient sich mit dem Arzt besprechen, ob bei ihm die Einnahme von Magnesium – Magnesium bindet im Urin Oxalat und soll so die Bildung von Kalzium-Oxalat-Steinen hemmen – sinnvoll ist.
Zuletzt noch sollte mit dem behandelnten Arzt (Urologe) geklärt werden, ob es zur Sekundär-Prophylaxe von Nierensteinen sinnvoll und empfehlenswert ist, das eine oder andere Arzneimittel – wie es in der Literatur empfohlen wird – einzunehmen, so:
a. Kalziumcitrat
[in Studien konnte ein wirksamer Nierenstein-Schutz nachgewiesn werden]
b. Thiazid-Diuretika
[nachgewiesen ist in Studien, dass sie das Risiko für Nierensteine senken – d.s. „harn-treibende Wirkstoffe“ (Diurektika), welche über eine Hemmung der Aufnahme von Natrium und Chlorid (Kochsalz) in der Niere wirken – zu beachten ist allerdings die „Blutdruck-Situation“]
Als nächste Erkrankung soll der „Harnverhalt“ besprochen werden; im eigentlichen Sinn keine Erkrankung der Nieren, doch aufgrund seiner potentiell bestehenden negativen Einflussnahme auf die Nierenfunktion, soll der Harnverhalt hier besprochen werden.
(akuter) Harnverhalt
Komplikationen
! Achtung !
Bei der akuten Harnverhaltung besteht eine große Gefahr, dass die übervolle Harnblase rupturiert (einreißt).
Man unterscheidet drei Formen der Blasenruptur:
1. Extraperitoneale Ruptur
Diese Form macht ungefähr siebzig Prozent aller Blasenrupturen aus. Sie tritt vor allem im Rahmen von Beckenringfrakturen auf.
2. Intraperitoneale Ruptur:
Jede vierte Blasenruptur ist eine intraperitoneale Ruptur. Sie wird durch eine plötzliche Druckerhöhung oder durch eine Dezeleration verursacht. Die intraperitoneale Fraktur betrifft vor allem das Blasendach.
3. Spontane Ruptur:
Diese Form macht ungefähr fünf Prozent aller Blasenrupturen aus. Spontane Rupturen werden in der Regel bei Blasen mit Vorschädigung beobachtet.
Merke:
Als Komplikation der Blasenruptur kann es zu einer akuten Peritonitis(Bauchfellentzündung) - mit weiteren Risiken wie Bauchhöhlen-Entzündung, Durchbruch, Minderung der Blutversorgung in den Organen des Bauchraums mit insbes. Sauerstoff-Unterversorgung und der Gefahr einer Sepsis – und/oder zu einer Urosepsis(d.i. eine systemische Entzündungs-Reaktion des gesamten Organismus infolge einer von den Harnwegen ausgehenden bakteriellen Infektion. Mit einer Inzidenz von 3 von 1000 führt eine Urosepsis zu einer schweren septischen Erkrankung, die mit einer Mortalität von 50 bis 70 Prozent im höchsten Maße lebensbedrohlich ist) kommen.
Weiterhin ist ein paralytischer Ileus(d.i. eine Darmlähmung, die zu einer Aufhebung der Darmpassage führt. Ein Ileus ist lebensbedrohlich und bedarf als medizinischer Notfall einer sofortigen Intensiv-Therapie bzw. einer operativern Intervention) möglich.
Merke:
Eine akute Harnverhaltung immer ein medizinischer Notfall!
Besteht die Harnabfluss-Behinderung über eine längere Zeit – wie z.B. bei der chronischen Harnverhaltung –, kann es zu folgenden Komplikationen kommen:
a. Aufsteigende (aszendierende) Stauung des Harns
b. Auf- und absteigende Harnwegsinfekte
c. Pyelonephritis (Nierenbeckenentzündung)
d. Urosepsis (s.o)septischer SchockKreislauf- und Multi-Organ-
Versagen(Lunge, Niere, Leber mit Blutungen)
e. Chronische Niereninsuffizienz (CNI)(chron. Nierenversagen) (s.v.)
Die mit größte Komplikation ist die
f. Urämie
(= die Kontamination (Vergiftung/Intoxikation) des Blutes mit harnpflichtigen Substanzen. Eine Urämie kann als Folge einer terminalen Niereninsuffizienz oder eines akuten Nierenversagens auftreten. Die Nieren sind in beiden Fällen nicht mehr in der Lage, harnpflichtige Substanzen in ausreichender Menge mit dem Harn auszuscheiden)
Besteht ein Harnverhalt über eine längere Zeitspanne hinweg, so kann es zu einer Funktionsbeeinträchtigung des Blasenschließ-Muskels kommen; eine solche Funktionsbeeinträchtigung zeigt sich beispielsweise in einem Harnträufeln, das willentlich nicht zu beeinflussen ist.
Definition
Ein Harnverhalt– oder Harnverhaltung bzw. Harnretention oder Ischurie – bezeichnet die Unfähigkeit zur willentlichen Blasen-Entleerung(Miktion) mit einem dadurch bedingten Harn(auf- oder rück-)stau bis hinauf in die Nieren.
Die Harnverhaltung wird den „Blasenentleerungs-Störungen“ zugerechnet.
Verlaufsformen
Beim Harnverhalt gilt es zu unterscheiden – entsprechend dem vorliegenden beschwerdebild und dem Verlauf – zwischen:
1. Akute Verlaufsform
2. Chronische Verlaufsform
Der „akute Harnverhalt“ betrifft vielmals ältere Männer; aber auch Männer im mittleren Lebensalter können betroffen sein.
Infolge einer gutartigen (benignen) Prostata-Vergrößerung (Prostata-Hyperplasie) kann es plötzlich zur Einengung der Harnröhre kommen.
Die Blase füllt sich stetig, aber durch die Einklemmung kann kein Urin mehr abgegeben werden. Das Ergebnis sind bis stärkste Schmerzen und ein unangenehmes Druckgefühl im Unterbauch. Andere mögliche Ursachen sind die Blockade der ableitenden Harnwege durch Nierensteine oder Blasensteine, Tumoren oder Störungen der Nerven, etwa durch einen Bandscheibenvorfall.
Der akute Harnverhalt ist ein medizinischer Notfall!
Es droht ein Reißen der Harnblase.
Hier ist umgehender medizinischer Handlungsbedarf geboten!
Der „chronische Harnverhalt“ verursacht meist keine Schmerzen, dafür aber andere Beschwerden.
Dazu zählen:
1. Häufiger Harndrang, ohne wirklich viel Wasser lassen zu können.
2. Nach dem Wasserlassen besteht immer noch ein Harndrang.
3. Häufiges Wasserlassen
4. Harn-Inkontinenz.
Ursachen (Ätiologie)
Eine akute wie chronische Ischurie kann entstehen aufgrund zahlreicher und unterschiedlicher Ursachen.
Mögliche Ursachen sind:
A. Entzündungen des Harntraktes
oder der Prostata
(Prostatitis)
B. Medikamenten-Nebenwirkungen
(z.B. Anticholinergika/Parasympatholytika wie u.a. Atropin und Scopolamin)
C. Abfluss-Stauungen im Bereich von Harnblase oder Harnröhreinfolge von:
a. Steinverlegung
b. Prostataerkrankungen
c. Harnröhrenstriktur
(= Verengung der Harnröhre)
d. Harnröhrenklappen
e. Harnblasenkarzinom
D. Gebärmuttersenkung
E. Neurogene Blasenentleerungsstörungen infolge von:
a. diabetischer Polyneuropathie
b. Wirbelsäulentumore oder -Metastasen
c. (anlage-bedingte) Fehlbildungen an der Wirbelsäule
(Myelo-Meningozele, Spina bifida occulta)
d. Hirndurchblutungsstörungen
(insbes. Zustand nach ausgedehntem Hirninfarkt)
e. Hirnareal-Läsion
(z.B. Hirnblutung, schwerem Schädel-Hirn-Trauma)
f. Multiple Sklerose
(MS – Encephalomyelitis disseminata/ED)
g. Querschnitts-Syndrom
(Verletzung des sakralen Rückenmarks) oder
h. als Folge einer Epidural- bzw. Spinalanästhesie
(post-operative Harnverhaltung)
F. psychisch bedingter Harnverhalt
Symptomatologie
Leitsymptome eines akuten Harnverhalts sind bis zu heftigsten Unterbauch-Dauerschmerzen(auf der Visuellen Analog-Skala vielmals mit einem subjektiven Wert von 10 angegeben), dazu sogen. psycho-somatische/psychovegetative Beschwerden – wie Kaltschweißigkein, Herzrasen (Tachykardie) und Blutdruckanstieg –.
Beim chronischen Harnverhalt liegt vielmals eine (weitgehende) Beschwerdefreiheit vor.
Ansonsten Symptome wie bei der akuten Verlaufsform, insbesondere Harnträufeln bei Überlaufblase.
Diagnostik
Die akuten Beschwerden und die Angaben des Betroffenen zum „Verlauf“ mit schlußendlicher Harnverhaltung weisen den Weg zur Diagnose.
Dazu geben anamnestische Angaben– diese sind insbesondere bei der chronischen Harnverhaltung von besonderer Wichtigkeit – zu bestehenden Erkrankungen wie z.B. Diabetes mellitus mit evtl. zusätzlich diabetischer Polyneuropathie oder zu ausgeprägten Hirn-Durchblutungsstörungen (auch Zustand nach Hirnschlag) oder Zustand nach kürzlich erlittenem Schädel-Hirn-Trauma oder einer Hirnblutung oder einer massiven Harnblasen- und/oder Prostata-Entzündung und bei Männern, ob eine Prostata-Vergößerung bekannt ist bzw. bei Frauen, ob eine Senkung (Deszensus) der Gebärmutter (Uterus) mit Schwäche der Beckenmuskulatur bekannt ist und auch noch Frage, ob ein „Steinleiden“ (Niere, Harnleiter, Blase) bekannt ist und nicht zuletzt auch gezielte Fragen nach der psychischen Verfassung wegweisende Hinweise über die Ursache der Harnverhaltung.
Auch Angaben zu zurzeit eingenommenen Arzneimitteln sind von Wichtigkkeit.
Als nächster Schritt die körperliche Untersuchung.
D.h. insbesondere die Palpation der Bauchdecke und im Bereich der Nierenlager und der Harnblase; dazu Auskultation auf Darm-Geräusche bzw. deren Qualität. Eine Selbstverständlichkeit sind Temperatur- und Blutdruck- mit Herzfrequenz-Messung.
Im 3. Schritt folgen simultan Labor- und apparative bildgebende Diagnostik.
Diese ist insbesondere bei der chronischen Verlaufsform unumgänglich.
Gehen wir getrennt vor für die akute und die chronische Verlaufsform.
A) akute Harnverhaltung
1. Labor
Hier genügen …
a. Urin-Untersuchung
[Urinstatus und Sediment, pH, spez. Gewicht]
{Hinweis: sollten sich im Urinstreifentest Hinweise für das Vorliegen von pathogenen Keimen finden lassen – Bakterien, Pilze –, dann sollte umgehend eine Urin-Kultur angelegt werden mit Antibiogramm! – wichtig: Blut im Urin?]
b. Blut-Untersuchung
[Großes Differentialblutbild, Chrom-Reaktives Protein (CRP) – auch als CRP-Schnelltest – ggfls. noch BSG/BKS]
2. Bildgebende Diagnostik
a. Sonographie der Nieren, Harnleiter, Harnblase
Merke:
Ein akuter Harnverhalt ist ein urologischer Notfall und erfordert eine rasche Diagnose und schnellstmögliche Therapie.
B) chronische Harnverhaltung
Hinweis:
Unverändert bleibt, dass die Diagnostik möglichst rasch durchgeführt wird, um schnellstmöglich eine Therapie zur Beseitigung der Harnverhaltung und dann eine ggfls. erforderliche weitergehende Ursachen-Therapie zu ermöglichen.
1. Labor
a. Urin-Untersuchung
[wie bei akuter Harnverhaltung beschrieben]
b. Blut-Untersuchung
[wie bei akuter Harnverhaltung beschrieben – dazu bedarfsweise: Blutzucker, Nierenretentionswerte (Kreatinin, Harnstoff, Harnstoff-Stickstoff/BUN, Harnsäure GFR (Glomerukläre Filtrationsrate), Eisen, Serum-Elektrophorese, PSA (Prostata-Spezifisches Antigen) und bei entsprechendem Verdacht: Tumor-Marker-Screening und auch Schwermetalle]
2. Bildgebende Diagnostik
a. Sonographie der Nieren, Harnleiter, Harnblase
[bei der Harnblase insbes. „Füllungszustand“]
b. Diaphanoskopie
[= die Durchleuchtung von Körperteilen durch eine aufgesetzte Lichtquelle. In der Urologie kann eine Durchleuchtung des Skrotums zur Diagnostik von Varikozelen genutzt werden]
c. Endoskopische Untersuchungen
a) Urethroskopie (Harnröhren-Spiegelung)
b) Zystoskopie (Harnblasen-Spiegelung)
[bei beiden Verfahren Möglichkeit von Gewebeproben-Entnahmen (Biopsien) zur nachgehenden histologischen Untersuchung – ferner Entfernung von Steinen, Abtragung von Verenungen usw.]
d. Urographie
[d.i. eine kontrastmittelgestützteröntgenologische Darstellung des Harn-ableitenden Systems. Die entsprechenden Aufnahmen nennt man Urogramm bzw. Pyelogramm]
e. Computertomographie (CT) / Kernspintomographie (MRT)
ggfls. mit Kontrastmittel
[wichtig zur Abklärung bzw. Tumoren – Wirbelsäule, Becken, Nieren & ableitende Harnwege, Prostata bzw. Uterus und Eierstöcke -]
Wichtiger Hinweis:
Vor Röntgenaufnahmen mit Kontrastmittel sollte das Serum-Kreatinin bzw. die GFR überprüft werden!
Bei entsprechenden Vorbefunden bzw. in der orientierenden Untersuchung ermittelten Befunden zusätzlich:
3. orientierende neurologische Untersuchung
[bei Befund-Auffälligkeiten nach der Akut-Intervention wegen Harnverhaltung Zuweisung zu einem Facharzt für Neurologie]
4. orientierende psychosomatische/psychische Exploration
[bei Befund-Auffälligkeiten nach der Akut-Intervention wegen Harnverhaltung Zuweisung zu einem Facharzt für Psychosomatische Medizin bzw. für Psychiatrie]
Therapie
Der akute Harnverhalt und bedingt auch die chronische Verlaufsform bedürfen einer umgehenden kontrollierten Entlastung, sprich einer „Entleerung“, der Harnblase.
Entweder durch einen trans-urethralen oder durch einen suprapubischen Blasenkatheter. Oder auch durch eine entlastende Blasen-Punktion. Dabei wird der Urin nach und nach in kleineren Portionen abgelassen. Das lindert mögliche Schmerzen im Unterleib, die infolge der prall gefüllten Harnblase bei einem Harnverhalt entstehen (können).
Das langsame Ablassen beugt zudem Komplikationen, etwa Blutungen der Blasenwand, vor.
Der Harnröhrenkatheter kann – je nach Ursache des Harnverhalts –kurzzeitig oder dauerhaft in der Harnröhre verbleiben.
Beim Harnverhalt – zumal beim chronischen – hängt die weitere Therapie immer von der bzw. den jeweiligen Ursache/-n ab.
1) Liegt z.B. eine durch Bakterien oder Plize verursachte Entzündung in den ableitenden Harnwegen und/oder der Niere vor, dann ist eine gezielte spezielle Behandlung mit Antibiotika und/oder Antimykotika erforderlich, einschließlich entsprechender Befund-Kontrollen.
2) Sind Blasen- oder Harnleiter-Steine die Ursache, so werden diese überwiegend bereits nach der diagnostischen Endoskopie entfernt. Bei größeren Steinen müssen diese vor der Entfernung mittels Ultraschall zertrümmert werden.
In einigen Fällen ist aber ein operativer Eingriff erforderlich.
3) Sonstige Befunde in der Harnblase und/oder in Harnröhre oder
Harnleiter – wie z.B. Harnleiterklpapen, Strikturen – bedürfen in der Regel einer – auch minimal-invasiven – Operation.
4) Ist der Harnverhalt – zumal der chronische – Folge einer
bestehenden „Grunderkrankung“ wie z.B. einer neurologischen Erkrankung (u.a. Multiple Sklerose, diabetische Polyneuropahthie) oder eines Tumors (gutartig wie bösartig im Bereich des sakralen Anteils der Wirbelsäule oder einer Prostatahyperplasie oder einer Gebärmutter-Senkung oder einer Schwäche der Beckenbodenmuskulatur) u.a.m., dann muss diese bestmöglich behandelt bzw. eingestellt werden, um so die Beschwerden eines Harnverhalts entweder gänzlich zu beheben bzw. zumindest zu verringern.
5) Findet sich in der Abklärung, dass ein eingenommenes
Arzneimittel (bzw. dessen Wirkstoff/-e) die Ursache für den Harnverhalt ist, dann muss dieses Mittel sofort abgesetzt werden.
6) Tritt der Harnverhalt infolge einer psychischen Belastungssituation oder einer psychosomatischen bzw. psychischen Störung und Erkrankung auf, sollte eine fachärztliche Diagnostik und nachfolgend eine befund-adaptierte Behandlung (u.a. Gesprächstherapie, zeitweise Psychopharmaka) erfolgen.
Zystennieren
Definition
Bei Zystennieren– Synonym: Polyzystische Nierenerkrankung(PKD - Polycystic Kidney Disease) – handelt es sich um eine genetisch bedingte Erkrankung, bei der es zur Bildung vopn Flüssigkeits-gefüllten Zysten () überall in der Niere kommt.
Bei längerem Bestehen bzw. bei vermehrter Zystenbildung kommt es zur Nieren-Insuffizienz (s. Kapitel später) und final zum chronischen Nierenversagen (s. Kap. später).
Ätiologie / Pathogenese / Formen
Die Zysten bestehen aus ausgeweiteten Nephronen (= morphologisch-funktionelle Niereneinheit aus Glomerulus, BOWMAN-Kapsel & Harnkanälchen) und Sammelrohren.
Oft ist eine Differenzierung des Zystennieren-Ursprungs nicht möglich.
Die Hauptgruppen (Formen) sind:
1. Polyzystische Degeneration
[erwachsener und kindlicher Typ)
2. Renale Dysplasie
[multizystisch, fokal und segmental, familiär, Folge einer Obstruktion des unteren Harntrakts]
3. Kortikale Zysten
[einzeln und multipel, diffus glomerär und mikrozystisch]
4. Medulläre zystische Erkrankungen
Mark-Schwammniere]
5. Zysten bei hereditären (erblichen) Erkrankungen
6. Unterschiedliche Arten
Zu unterscheiden sind folgende „genetischen Ursachen“:
1. Autosomal-rezessive polyzystische Nierenerkrankung
[Diese Form der Erkrankung tritt viel seltener auf, äußert sich jedoch meist schon im Kindesalter mit zusätzlichen Symptomen (z.B. Störungen bei der Atmung). Der Krankheitsverlauf ist schwerer und führt oft schon früh zum Tod.
Hierbei liegt die Mutation in dem Gen PKDH1 (Polycystic kidney and hepatic disease 1), welches für das ProteinFibrocystin codiert. Seine Funktion ist noch nicht abschliessend geklärt.
Es wird vermutet, dass durch Mutation der PKD-Gene ein Stoppsignal inaktiviert wird, welches normalerweise die Lumenbildung in der Niere beendet. Fehlt nun dieses Signal wächst das Lumen der Nierentubuli (Harnkanälchen) immer weiter, es wird immer größer und Zysten bilden sich. Anscheinend müssen beide Anlagen (Allele) für das betreffende Gen inaktiviert sein, damit die Krankheit ausbricht.]
2. Autosomal-dominante polyzystische Nierenerkrankung
[Sie tritt mit einer Prävalenz von 1:1000 auf, wird jedoch oft erst im zweiten oder dritten Lebensjahrzehnt entdeckt. Meist geschieht dies durch Zufall, zum Beispiel bei anderweitig durchgeführten Ultraschalluntersuchungen. 10% aller Dialyse-Patienten sind von der polyzystischen Nierenerkrankung betroffen.
Ursache für diese Form der Erkrankung ist eine Mutation in den Genen PKD1 (85% der Fälle) oder PKD2 (15% der Fälle), daraus folgt eine Fehlfunktion ihrer Produkte Polycystin-1 und Polycystin-2. Deren Funktion ist momentan noch nicht genau bekannt, jedoch scheint die Interaktion zwischen Polycystin-1 und Polycystin-2 wichtig für die Erhaltung der Nierenstruktur zu sein.]
Fakten
Fakt 1
Zystennieren sind die viert-häufigste Ursache für Nierenversagen.
Fakt 2
Fakt 3
Zystennieren sind eine der häufigsten Erberkrankungen, die 50.000 Menschen in Deutschland und 12,5 Millionen weltweit betreffen. Eltern geben die Erkrankung zu 50% an ihre Kinder weiter.