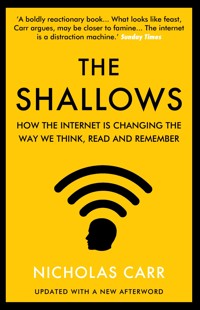4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Aus Barack Obamas Leseliste 2019:
Heute schon gegoogelt? Im Durchschnitt sind die Deutschen etwa zweieinhalb Stunden täglich online. Neuesten Studien zufolge, so zeigt Bestsellerautor und IT-Experte Nicholas Carr, bewirkt bereits eine Onlinestunde am Tag erstaunliche neurologische Prägungen in unserem Gehirn.
Wer das Internet nach Informationen, sozialen Kontakten oder Unterhaltung durchforstet, verwendet, anders als beim Buch- oder Zeitunglesen, einen Großteil seiner geistigen Energie auf die Beherrschung des Mediums selbst. Und macht sich um die Inhalte, buchstäblich, keinen Kopf. Die Folge: Im Internetzeitalter lesen wir oberflächlicher, lernen wir schlechter, erinnern wir uns schwächer denn je. Von den Anpassungsleistungen unseres Gehirns profitieren nicht wir, sondern die Konzerne, die mit Klickzahlen Kasse machen.
In seinem neuen Buch verbindet Carr, zwanzig Jahre nach Entstehung des World Wide Web, seine medienkritische Bilanz mit einer erhellenden Zeitreise durch Philosophie-, Technologie- und Wissenschaftsgeschichte – von Sokrates’ Skepsis gegenüber der Schrift, dem Menschen als Uhrwerk und Nietzsches Schreibmaschine bis zum User als Gegenstand aktueller Debatten und Studien. Und er vermittelt – jenseits von vagem Kulturpessimismus – anhand greifbarer Untersuchungen und Experimente, wie das Internet unser Denken verändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Für meine Mutterund im Gedenken an meinen Vater
»Und in der Mitte dieser weiten Stille Baut dir ein rosiges Heiligtum mein Wille Mit allem, was ein inbrünstiges Hirn ersinnt …«
JOHN KEATS, Ode an Psyche
VORWORT
Die digitale Revolution verändert das Denken und den Denkapparat. An diesem Befund kann kein Zweifel mehr bestehen, und die Widerrede dagegen, sofern sie nicht ausschließlich von Geschäftsinteressen gespeist ist, hat Züge des Ewiggestrigen. Das neunzehnte Jahrhundert hat die Industrialisierung dessen erlebt, was menschliche Hände machen können. Das zwanzigste Jahrhundert hat die Industrialisierung der menschlichen Fortbewegungsorgane vollzogen. Jetzt erleben wir die Industrialisierung des Gehirns.
Mühsam und unter enormen Opfern musste der Mensch die Kommunikation mit den Maschinen des Industriezeitalters lernen. Er musste seine Muskeln, seine Ernährung, seine Ausbildung an die neuen Gegebenheiten anpassen, Familienstrukturen und soziale Milieus wurden von den neuen Arbeitsplätzen verändert, Zeit- und Raumempfinden revolutionierte sich innerhalb einer einzigen Generation und jahrhundertealte Erfahrungskontinente versanken, weil man sie nicht mehr benötigte. Was geschieht nun, da es um unser Hirn geht, und welche kognitiven und psychologischen Folgen hat die Kommunikation mit intelligenten Maschinen?
Es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet diejenigen, die sich an der Spitze des digitalen Fortschritts wähnen, sich gar nicht vorstellen können, dass auch wir einen Preis zahlen werden, und vielleicht eines Tages gar nicht mehr wissen, dass wir ihn gezahlt haben. Das ist nicht Kulturpessimismus oder Technikfeindlichkeit, sondern eine der erregendsten Fragen für jeden, der gerne Herr im eigenen Haus, nämlich in seinem Kopf, bleiben möchte.
Es war Nicholas Carr, der mit seinem denkwürdigen Essay »Is Google making us stupid?« als erster diese Frage gestellt hat. Und er legt jetzt eine grundlegende Recherche vor: Was bedeutet die Industrialisierung menschlichen Denkens für den Menschen? Was geschieht, wenn Entscheidungsprozesse nicht nur an Computer abgegeben werden, sondern auch alle soziale Kontakte über Algorithmen, also mathematische Modelle, verwaltet und selektiert werden? Die Folgen sind womöglich nicht so sichtbar wie in der ersten industriellen Revolution, denn die digitale Revolution kennt keine Bilder von Fließbandarbeitern, Massenproduktion, von arbeitslosen Webern oder von geisttötenden Routinen nach dem Gesetz der Stechuhr. Aber nur weil wir es nicht sehen, bedeutet es nicht, dass nicht das Gleiche geschieht. Längst haben sich beispielsweise die Arbeitszeiten des modernen Menschen verschoben. Er liest seine E-Mails zu Hause, nutzt das iPhone im Urlaub und weiß, dass jede Minute irgendetwas geschehen könnte, das von ihm eine Reaktion verlangen könnte. Die Vernetzung der Computer hat einen neuen, faszinierenden Raum der Kommunikation und des Wissens geschaffen. Gleichzeitig aber ist das Internet wie auch der digitale Arbeitsplatz ein Ort fast frühkapitalistischer Konflikte, in der Millionen von Menschen die Grenzen zwischen gerechtem Lohn und ungerechter Selbstausbeutung nicht mehr erkennen können.
Das Gleiche gilt für den Multitasker, zu dem wir alle gezwungenermaßen geworden sind. Gewiss, auch in der Vergangenheit mussten Menschen oft mehrere Dinge gleichzeitig tun. Aber das Problem ist – und Nicholas Carr weist darauf hin –, dass der moderne Netzbewohner gezwungen ist, ausschließlich zu multitasken. Multitasking zerstört Nachdenklichkeit, Reflexion, deformiert Denken überhaupt. Gesetzt – wogegen alle wissenschaftliche Erkenntnisse sprechen – wir könnten es lernen; welchen Preis müssten wir bezahlen? Was würden wir verlieren?
Nichts ist mehr von gestern als die Debatte über digital immigrants oder digital natives. Die Unterscheidung war triftig für den kurzen Moment des Übergangs zwischen 1995 und 2005. Die Beschleunigungskräfte sind enorm, und das hat mit der kinderleichten Bedienbarkeit der modernen Technologien zu tun. Täuschen die Zeichen nicht, so ist die Zeit der Berater und Experten glücklicherweise vorbei. Die Menschen wissen, was das Netz ist. Aber wissen sie auch, dass das Netz nur die Oberfläche einer allumfassenden Kommunikation mit Computern ist? – einer Kommunikation, die vom Kühlschrank bis zum Freundschaftsnetzwerk und der Beurteilung durch den Arbeitgeber, den Rastern der Sicherheitsbehörden oder der Finanzbehörden reicht? Längst leben wir in einer Zeit, wo Journalisten nicht mehr für Menschen, sondern für Google schreiben, nämlich Überschriften und Teaser so formulieren, dass die Suchmaschine sie erkennt und bevorzugt. Nicht ohne Ironie muss man feststellen, dass ausgerechnet die Journalisten, deren Arbeitswelt als erste (aber keineswegs als letzte) sich revolutionierte, noch immer so tun, als handele es sich lediglich um ein Anpassungsproblem. Auch das hat die Carr-Rezeption gezeigt: Gegen Carr zu sein bringt gute Google-Suchergebnisse.
Nicholas Carrs Buch ist ein Buch der Aufklärung. Es widerlegt jene Ideologen des digitalen Zeitalters, hinter denen sich oft nicht mehr als Glücksritter verbergen, wie jene, die einst den Eisenbahnbau im Wilden Westen begleiteten. Es wäre wünschenswert, wenn Carrs Intervention dazu beitragen würde, das banale Dafür und Dagegen zu beenden. Niemand ist gegen das Netz. Und niemand ist gegen Computer. Auch Carr nicht. Er ist auch nicht »gegen« Google. Es geht gar nicht darum, dagegen oder dafür zu sein – man kann auch nicht gegen das Wetter oder die Farbe des Himmels sein. Die digitale Revolution ist irreversibel, und altertümlich ist an der Debatte nur der zwanghafte Versuch der Ideologen, die Analyse mit Formaten des neunzehnten Jahrhunderts zu beantworten, also Technikfeindlichkeit dort zu wittern, wo es in Wahrheit um den Umgang mit den neuen Techniken geht.
Nicholas Carr geht vom eigenen Befund aus, einen, den ich teile: An den Schwierigkeiten konzentriert zu lesen, merkt der denkende Mensch als erstes, dass etwas mit seinem Denken geschieht. Das geht weit über pädagogische Fragen hinaus. Es kennzeichnet einen wirklichen Übergang. Vermutlich wird Lektüre in der künftigen Gesellschaft fast zur therapeutischen Operation. Auch im frühen zwanzigsten Jahrhundert hat sich niemand vorstellen können, dass Menschen freiwillig atemlos über Straßen, über Felder und Wälder laufen, weil sie die Deformationen therapieren müssen, die ihnen eine Technik beibrachte, die sie doch gerade von Atemlosigkeit und vom Laufen befreien sollte. Welche Maßnahmen müssen und werden wir uns einfallen lassen? Soviel lässt sich heute schon sagen: Das Selbstverständliche des Denkens und Lesens wird verschwinden, und an seine Stelle wird das Unselbstverständliche treten. Wir werden in Schulen und an Arbeitsplätzen Kontemplation so fördern müssen, wie wir vor hundert Jahren gelernt haben, den Sport zur Pflicht zu machen. Zu den uralten meditativen Praktiken zählt, auf das eigene Atmen zu hören – das Selbstverständlichste von der Welt sich bewusst zu machen. Zu den Praktiken der Zukunft wird als erste gehören, wieder auf das eigene Denken zu hören.
Frank Schirrmacher
PROLOG:
DER WACHHUND UND DER DIEB
Im Jahre 1964, als die Beatles sich gerade anschickten, den amerikanischen Äther im Sturm zu erobern, veröffentlichte Marshall McLuhan Die magischen Kanäle. Durch dieses Buch wurde der kauzige Akademiker über Nacht zum Star. Es war orakelhaft, geheimnisvoll und bewusstseinsverändernd, also durch und durch ein Produkt der Sechziger, jenem inzwischen fernen Jahrzehnt der Drogentrips, Mondraketen und inneren wie äußeren Reisen.
Die magischen Kanäle war im Grunde eine Prophezeiung, in der die Auflösung des linearen Denkens vorhergesagt wurde. McLuhan erklärte, die »elektrischen Medien« des 20. Jahrhunderts – Telefon, Radio, Kino, Fernsehen – bedeuteten das Ende einer Diktatur des Textes über unsere Sinne und Gedanken. Unser isoliertes, bruchstückhaftes Selbst, durch die Lektüre bedruckter Seiten jahrhundertelang in sich gefangen, werde nun geheilt und verschmelze mit dem globalen Äquivalent eines Stammesdorfes. Wenn der kreative Prozess des Wissens zum kollektiven und allgemein zugänglichen Gut der gesamten Menschheit werde, näherten wir uns einer »technischen Simulation des Bewusstseins«.1
Doch selbst auf dem Höhepunkt seiner Popularität war Die magischen Kanäle ein Buch, über das man mehr sprach, als dass es gelesen wurde. Heute ist es ein kulturelles Relikt, das nur noch in Medienseminaren an Universitäten diskutiert wird. McLuhan war jedoch nicht nur ein kluger Kopf, sondern auch ein großer Showman und ein Meister des Schlagworts. Einer seiner Sätze aus dem Buch hat sich verselbstständigt und führt heute ein Eigenleben als beliebtes Sprichwort: »Das Medium ist die Botschaft.«
Was wir gerne vergessen, wenn wir diesen rätselhaften Aphorismus zitieren, ist, dass McLuhan die ungeheure Macht der neuen Kommunikationstechnik nicht nur anerkannte und guthieß. Er warnte auch vor der Gefahr, die eine solche Macht darstellte – und vor dem Risiko, diese Bedrohung zu übersehen: Die »elektrische Technik« sei längst nicht mehr wegzudenken. Doch die Menschheit verschließe Augen und Ohren davor, was alles passieren könne, wenn sie auf die Technik Gutenbergs treffe, auf welcher der gesamte »American Way of Life« aufgebaut sei.2
Wann immer ein neues Medium aufkommt, konzentrieren sich die Menschen – McLuhan zufolge – zunächst auf die von ihm transportierten Informationen. Sie interessieren sich für die Nachrichten in der Zeitung, die Sendungen im Fernsehen, die Worte, die eine Person am anderen Ende der Telefonleitung sagt. Die Technologie des Mediums jedoch, so erstaunlich sie auch sein mag, verschwindet dabei hinter seinem Inhalt – hinter den Fakten, der Unterhaltung, den Anweisungen, der Konversation.
Wenn die Leute zu diskutieren beginnen (was sie immer tun), ob die Auswirkungen eines Mediums nun gut oder schlecht sind, dann streiten sie sich regelmäßig nur über den Inhalt. Enthusiasten sind begeistert; Skeptiker machen alles schlecht. Der Streit ist bei jedem neuen Informationsmedium mehr oder weniger derselbe und mindestens so alt wie die ersten Bücher, die in Gutenbergs Presse entstanden.
Nicht ohne Grund preisen die Enthusiasten die Flut neuer Inhalte, die durch die jeweilige Technik ausgelöst wird, als Zeichen für eine »Demokratisierung« der Kultur. Ebenso begründet ist die Kritik der Skeptiker, die in den ungeschönten Inhalten ein Anzeichen für den Niedergang der Kultur sehen. Was dem einen ein großer Garten Eden, ist dem anderen ein riesiges Ödland.
Das Internet ist das jüngste Medium, das diese Debatte anheizt. Der Kampf zwischen Netz-Enthusiasten und Netz-Skeptikern ist so polarisierend wie eh und je. Während der letzten zwei Jahrzehnte wurde er in Dutzenden von Büchern und Artikeln sowie in Tausenden von Blog-Posts, Videoclips und Podcasts geführt. Die Befürworter verkünden ein neues Goldenes Zeitalter der allgemeinen Informationszugänglichkeit, wohingegen die Zweifler über ein dunkles Zeitalter der Mittelmäßigkeit und des Narzissmus klagen. Die Debatte war zwar wichtig, denn Inhalte sind zweifelsohne von Bedeutung, doch da sie auf Basis von persönlichen Ansichten und Neigungen geführt wurde, endete sie unweigerlich in einer Sackgasse. »Technikfeind«, zischt der Enthusiast, »alte Unke!« Und der Skeptiker kontert: »Kulturbanause! Unverbesserlicher Optimist!«
Was beide übersehen, ist McLuhans Beobachtung, dass hinsichtlich unseres Denkens und Handelns der Inhalt eines Mediums langfristig weniger wichtig ist als das Medium selbst. Was wir sehen und wie wir es sehen, verschmelzen in einem Massenmedium miteinander. Es ist für uns Fenster zur Welt und zu uns selbst zugleich. Wenn wir es oft genug nutzen, verändert es schließlich unser Wesen, sowohl als Individuen als auch als Gesellschaft. Die Auswirkungen der Technologie zeigten sich nicht auf einer Ebene von Meinungen oder Konzepten, schrieb McLuhan. »Stattdessen verändern sie ständig und ohne jeden Widerstand unsere Wahrnehmungsmuster. «3 Damit übertreibt der Showman vielleicht ein wenig, hat aber trotzdem recht. Ob Technikwunder oder Teufelszeug – die Magie der Medien wirkt jedenfalls direkt auf unser Nervensystem.
Wenn wir uns allein auf den Medieninhalt konzentrieren, kann es passieren, dass uns solche unterschwelligen Wirkungen völlig entgehen. Wir sind von der Informationsfülle viel zu verwirrt oder verstört, um zu bemerken, was in unseren Köpfen vor sich geht. Schließlich reden wir uns ein, dass die Technik selbst keine Rolle spielt. Wir gaukeln uns vor, es käme allein auf die Art ihrer Nutzung an, und wiegen uns in der trügerischen Sicherheit, wir hätten alles unter Kontrolle. Die Technik ist in unseren Augen ein Werkzeug, das erst in unserer Hand zum Leben erwacht und das wir nach Gebrauch wieder beiseitelegen.
McLuhan zitierte den Medienmogul David Sarnoff, der sowohl bei RCA-Radio als auch beim Fernsehsender NBC Pionierarbeit geleistet hatte. In einer Rede an der Universität von Notre Dame im Jahre 1955 wies Sarnoff die Kritik an den Massenmedien zurück, auf denen er sein Imperium und sein Vermögen aufgebaut hatte. Er bestritt, dass die Technik selbst negative Auswirkungen habe, und schob stattdessen den Hörern und Zuschauern den Schwarzen Peter zu: Man sei viel zu sehr darauf aus, das Instrument der Technik zum Sündenbock zu machen, anstatt die Nutzer ins Visier zu nehmen. Die Produkte der modernen Wissenschaft seien weder gut noch böse. Vielmehr bestimme die Art ihrer Nutzung ihren Wert. McLuhan entrüstete sich über diesen Gedanken und verspottete Sarnoff, er rede daher wie einer jener Schlafwandler, die augenblicklich überall zu finden seien.4
Jedes neue Medium, so stellte McLuhan fest, verändert uns. Unsere eingeübte Reaktion auf die Medien, insbesondere, dass in erster Linie die Art ihres Gebrauchs zähle, sei die Haltung eines »technologischen Idioten«. Medieninhalte seien lediglich das »saftige Stück Fleisch«, das ein Einbrecher bei sich habe, um den vor dem menschlichen Geist postierten Wachhund abzulenken.5
Nicht einmal McLuhan hätte vorhersehen können, welches Festmahl das Internet für uns bereitet hat: Ein Gang folgt auf den anderen, jeder saftiger als der vorangegangene, sodass uns zwischen den Bissen kaum Zeit zum Atmen bleibt. Seitdem Netzwerkcomputer auf die Größe von iPhones und BlackBerrys geschrumpft sind, ist das Festmahl transportabel geworden, überall und jederzeit verfügbar.
Es findet in unserem Zuhause statt, im Büro, im Auto, im Klassenzimmer, in unserem Geldbeutel, in unserer Tasche. Sogar Leute, die den zunehmenden Einfluss des Internets auf unser Leben misstrauisch beäugen, lassen sich durch ihre Besorgnis kaum die Freude und den Nutzen verderben, die der Technikgebrauch ihnen bietet. Der Filmkritiker David Thomson stellte einmal fest, dass »angesichts der Gewissheit des Mediums« jeglicher Zweifel als Schwäche ausgelegt werden könne.6
Er meinte damit das Kino und wie es Gefühle und Sinneseindrücke nicht nur auf die Leinwand projiziert, sondern auch auf uns, das stille, willfährige Publikum. Noch besser trifft seine Feststellung auf das Internet zu: Der Computerbildschirm walzt mit seinen Segnungen und Annehmlichkeiten sämtliche Zweifel wie ein Bulldozer nieder. Der Computer ist so sehr unser Diener, dass es fast schon kleinlich erschiene zu bemerken, dass er gleichzeitig auch unser Herr ist.
ERSTES KAPITEL:
HAL UND ICH
»Bitte, Dave. Hör auf. Ich bitte dich. Hör auf, Dave. Bitte. Lass es sein«, fleht der Supercomputer HAL den unerbittlichen Astronauten Dave Bowman in einer berühmten und seltsam ergreifenden Szene gegen Ende von Stanley Kubricks Film 2001 – Odyssee im Weltraum an. Bowman, den die fehlerhaft funktionierende Maschine beinahe ins Weltall und damit in den Tod geschickt hätte, deaktiviert ruhig und ungerührt die Speicherelemente des Gedächtnismoduls. »Mein Gedächtnis«, sagt HAL verloren. »Mein Gedächtnis schwindet. Ich spüre es. Ich spüre es.«
Ich spüre es ebenfalls. Während der letzten paar Jahre beschlich mich immer wieder das unangenehme Gefühl, dass irgendjemand oder irgendetwas an meinem Gehirn herumgepfuscht, die neuronalen Schaltkreise neu vernetzt und mein Gedächtnis umprogrammiert hatte. Mein Gedächtnis schwindet nicht – zumindest, soweit ich das beurteilen kann. Aber es verändert sich. Ich denke nicht auf dieselbe Weise wie früher. Am meisten fällt mir das beim Lesen auf. Einst fiel es mir leicht, mich in ein Buch oder einen langen Artikel zu vertiefen. Mein Geist biss sich in die Wendungen einer Geschichte oder die unterschiedlichen Positionen eines Textes fest, und ich konnte mich stundenlang mit Prosa beschäftigen. Heute ist das nur noch selten der Fall. Nach einer oder zwei Seiten schweifen meine Gedanken ab. Ich werde unruhig, verliere den Faden und suche nach einer anderen Beschäftigung. Es kommt mir immer vor, als müsste ich mein eigensinniges Gehirn zum Text zurückzerren. Das konzentrierte Lesen, das einmal etwas ganz Natürliches war, ist zu einem Kampf mit mir selbst geworden.
Ich glaube, ich weiß jetzt, was los ist. Seit mittlerweile über einem Jahrzehnt habe ich regelmäßig viel Zeit online verbracht, habe im Netz gesurft, herumgesucht und manchmal auch einen kleinen Beitrag zu den unermesslich großen Datenbanken geleistet. Für mich als Schriftsteller ist das Internet wie ein Geschenk Gottes. Recherchen, für die man sich manchmal tagelang durch die Zeitschriftenstapel oder -abteilungen der Bibliotheken wühlen musste, können heute innerhalb weniger Minuten erledigt werden. Ein bisschen gegoogelt, ein paar schnelle Klicks auf Hyperlinks, und schon habe ich die harten Fakten oder das kernige Zitat, wonach ich gesucht habe.
Ich kann nicht einmal schätzen, wie viele Stunden oder wie viele Liter Benzin ich durch das Internet gespart habe. Ich erledige die meisten Bankgeschäfte und einen Großteil meiner Einkäufe online. Ich benutze meine Browser, um Rechnungen zu bezahlen, Verabredungen zu treffen, Flüge und Hotelzimmer zu buchen, meine Fahrerlaubnis zu erneuern, Einladungen und Grußkarten zu versenden. Selbst wenn ich nicht arbeite, stöbere ich im Datendickicht des Netzes herum – lese und schreibe E-Mails, überfliege Überschriften und Blog-Posts, verfolge Facebook-Updates, sehe mir Video-Streams an, lade Musik herunter oder hüpfe einfach nur federleicht von einem Link zum nächsten.
Das Netz ist zu meinem Allzweckmedium geworden, dem Kanal für die meisten Informationen, die an meine Augen, Ohren und meinen Geist gelangen. Die Vorteile des direkten Zugangs zu einer solch unglaublich großen und leicht zu durchsuchenden Datenmenge sind vielfältig; man hat sie ausführlich beschrieben und gebührend gewürdigt. Google sei ein gewaltiger »Segen für die Menschheit«, sagt Heather Pringle, eine Autorin der Zeitschrift Archaeology. »Dort werden Informationen und Gedanken gesammelt und gebündelt, die zuvor so weit über die ganze Welt verstreut waren, dass kaum jemand davon profitieren konnte.«1 Clive Thompson von Wired indes bemerkt: »Wenn man sämtliche Speichermedien wieder abschaffen würde, wäre das ein gewaltiger Segen für unser Denken. «2
Die Segnungen gibt es tatsächlich. Aber sie haben ihren Preis. Wie McLuhan feststellte, sind Medien nicht einfach nur Informationskanäle. Sie liefern den Stoff für neue Gedanken, aber sie formen auch den Prozess des Denkens. Eine Auswirkung des Internets scheint es zu sein, dass es mir zunehmend schwerfällt, mich zu konzentrieren und intensiv nachzudenken. Ob ich nun online bin oder nicht, mein Gehirn erwartet, dass man ihm Informationen so füttert, wie es das Internet tut: in einer schnell dahinfließenden Partikelflut. Einst war ich ein Sporttaucher im Meer der Worte. Heute rase ich über die Oberfläche wie ein Typ auf einem Jet-Ski.
Vielleicht bin ich ja ein Einzelfall, eine Ausnahme. Das scheint jedoch nicht so zu sein. Wenn ich Freunden von meinen Leseschwierigkeiten erzähle, sagen viele, dass sie selbst ganz ähnliche Probleme haben. Je mehr sie das Internet nutzen, desto schwerer fällt es ihnen, bei längeren Texten die Konzentration zu behalten. Ein paar sorgen sich sogar, sie könnten langfristig zu zerstreuten Schusseln werden. Einige der Blogger, die ich verfolge, haben das Phänomen ebenfalls angesprochen.
Scott Karp, der früher für eine Zeitschrift gearbeitet hat und heute einen Blog über Online-Medien schreibt, gesteht, dass er überhaupt keine Bücher mehr liest. »Am College habe ich Literatur im Hauptfach belegt und immer sehr viel gelesen«, schreibt er. »Was ist geschehen?« Er gibt sich selbst die Antwort, indem er spekuliert: »Was wäre, wenn ich nicht deshalb nur noch im Netz lesen würde, weil sich meine Art zu lesen verändert hat oder weil es bequemer ist, sondern, weil sich meine Art zu DENKEN verändert hat?«3
Bruce Friedman, der einen Blog über Computer in der Medizin betreibt, hat ebenfalls beschrieben, wie das Internet seine geistigen Gewohnheiten verändert. »Ich habe inzwischen vollkommen die Fähigkeit verloren, einen längeren Artikel zu lesen und zu begreifen, ob nun im Internet oder in gedruckter Form«, sagt er.4 Friedman, ein Pathologe an der University of Michigan Medical School, erläuterte mir diese Aussage eingehend in einem Telefongespräch. Sein Denken, sagte er, lasse sich als »Stakkato« beschreiben und spiegele somit wider, wie er im Internet kurze Textpassagen aus vielen verschiedenen Quellen verarbeite. »Ich könnte Krieg und Frieden heute nicht mehr lesen«, gab er zu. »Ich habe die Fähigkeit verloren, das zu tun. Selbst ein Blog-Post von mehr als drei oder vier Absätzen ist mir zu viel. Ich überfliege ihn nur.«
Philip Davis, ein Doktorand im Fach Kommunikationswissenschaften in Cornell, der regelmäßig für den Blog der Society for Scholarly Publishing schreibt, erinnert sich daran, dass er in den Neunzigern einmal einer Freundin zeigte, wie man mit einem Webbrowser umgeht. Er sagt, er sei »erstaunt« und sogar »irritiert« gewesen, dass die Frau innehielt, um den Text auf den Seiten zu lesen, über die sie stolperte. »Du sollst die Webseiten nicht lesen, sondern einfach auf die Hyperlinks klicken«, wies er sie zurecht. Heute, so schreibt Davis, »lese ich viel – zumindest sollte ich viel lesen, nur dass ich es nicht tue. Ich überfliege. Ich scrolle. Ich habe kaum noch die Geduld für lange, detaillierte und nuancierte Ausführungen, obwohl ich andere bezichtige, dass sie die Welt zu simpel darstellen.«5
Karp, Friedman und Davis – allesamt gebildete Männer, die sich gerne schriftlich mitteilen – bedauern offenbar den schleichenden Verlust ihrer Fähigkeiten, zu lesen und sich zu konzentrieren. Unterm Strich, so sagen sie, mache der Nutzen des Internets – der schnelle Zugriff auf eine Fülle von Informationen, gute Such- und Filtertools sowie die Möglichkeit, einem kleinen, aber interessierten Publikum die eigene Meinung mitzuteilen – den Verlust der Fähigkeit, stillzusitzen und die Seiten eines Buchs oder einer Zeitschrift umzublättern, aber wieder wett. Friedman teilte mir per E-Mail mit, er sei »noch nie so kreativ gewesen« wie in jüngster Zeit. Dies schreibt er seinem Blog zu sowie »der Möglichkeit, im Web ›Tonnen‹ von Informationen einsehen zu können«. Karp glaubt inzwischen, dass er seinen Horizont durch die Lektüre vieler kurzer, verlinkter Schnipsel im Netz besser erweitern kann als durch »250-seitige Bücher«. Allerdings könnten wir »die Überlegenheit dieses vernetzten Denkens noch nicht erkennen, weil wir sie an unseren alten, linearen Denkprozessen messen«.6 Davis meint hierzu: »Das Internet mag mich zu einem ungeduldigeren Leser gemacht haben, doch ich glaube, dass es mich in vielerlei Hinsicht auch schlauer gemacht hat. Ein erweiterter Zugang zu Dokumenten, Artefakten und Menschen bedeutet mehr äußere Einflüsse auf mein Denken und damit auch auf mein Schreiben. «7 Alle drei wissen, dass sie dafür etwas Wichtiges geopfert haben, doch würden sie diesen Schritt nicht wieder rückgängig machen wollen.
Manchen Menschen erscheint bereits der Gedanke, ein Buch zu lesen, altmodisch und vielleicht sogar ein bisschen dumm – als ob man seine Hemden selbst nähte oder sein Fleisch selbst schlachtete. »Ich lese keine Bücher«, sagt Joe O’Shea, ehemaliger Präsident der Studentenschaft an der Florida State University und seit 2008 Rhodes-Stipendiat. »Ich gehe zu Google, wo ich alle relevanten Informationen sehr schnell finde.« O’Shea, der im Hauptfach Philosophie belegt, sieht keinen Grund dazu, sich durch die Kapitel eines Buches zu wühlen, wenn er sich die gewünschten Textpassagen per Google Book Search in knapp einer Minute zusammensuchen kann. »Sich hinzusetzen und ein Buch von vorn bis hinten durchzuarbeiten, hat doch überhaupt keinen Sinn«, sagt er. »Da verschwende ich nur meine Zeit, wo ich doch alle Informationen, die ich brauche, über das Web viel schneller bekomme.« Sobald man gelernt habe, ein geschickter »Online-Jäger« zu sein, würden Bücher überflüssig, sagt er.8
O’Shea scheint eher die Regel als eine Ausnahme zu sein. Im Jahre 2008 veröffentlichte eine Forschungs- und Beratungseinrichtung namens nGenera eine Studie darüber, welche Auswirkungen das Internet auf die Jugend hat. Die Firma interviewte 6000 Mitglieder der von ihr so bezeichneten »Generation Net« – Jugendliche, die mit dem Internet aufgewachsen sind. »Durch den Einfluss der digitalen Technik hat sich bei ihnen sogar die Informationsaufnahme selbst verändert«, schrieb der leitende Forscher. »Sie lesen eine Seite nicht unbedingt von links nach rechts und von oben nach unten. Stattdessen überfliegen sie das Ganze nur und suchen dabei gezielt nach Informationen, die sie wirklich interessieren. «9 Katherine Hayles, Professorin an der Duke University, gestand erst kürzlich in einem Gespräch bei einem Phi-Beta-Kappa-Treffen: »Ich kann meine Studenten nicht mehr dazu bewegen, Bücher ganz zu lesen.«10 Hayles unterrichtet Englisch. Die Studenten, von denen sie spricht, sind Literaturstudenten.
Die Menschen nutzen das Internet in jeder erdenklichen Weise. Manche sind eifrige, wenn nicht zwanghafte Verfechter der jeweils neuesten Technologie. Sie haben bei einem Dutzend oder mehr Online-Diensten einen Account und beziehen regelmäßig Informationen aus allen möglichen Quellen. Sie bloggen und taggen, texten und twittern. Andere wiederum müssen technisch nicht unbedingt auf dem allerneuesten Stand sein, sind aber trotzdem die meiste Zeit über online und tippen auf ihrem PC, ihrem Laptop oder ihrem Handy herum. Das Netz ist zu einem festen Bestandteil ihrer Arbeit, ihrer Schulausbildung und ihres gesellschaftlichen Lebens geworden, oft in allen drei Bereichen. Wieder andere loggen sich nur ein paar Mal täglich ein – um ihre E-Mails zu checken, eine Story in den Nachrichten zu verfolgen, ein interessantes Thema zu recherchieren oder ein bisschen einzukaufen. Freilich gibt es auch viele Menschen, die das Internet überhaupt nicht nutzen, weil sie es sich entweder nicht leisten können, oder weil sie es nicht wollen. Klar ist jedoch auch, dass in den gerade einmal 20 Jahren, seit der Softwareprogrammierer Tim Berners-Lee den Code für das World Wide Web schrieb, das Internet für die Gesamtgesellschaft zum Medium Nummer eins geworden ist. Das Ausmaß seiner Nutzung ist beispiellos, selbst im Vergleich zu den Massenmedien des 20. Jahrhunderts. Das Ausmaß seines Einflusses ist ebenso gewaltig. Freiwillig oder gezwungenermaßen haben wir uns an den Schnellfeuermodus gewöhnt, mit dem im Internet Informationen gesammelt und verbreitet werden.
Wie McLuhan vorhersagte, scheinen wir in unserer Geistes- und Kulturgeschichte an einem wichtigen Scheideweg angelangt zu sein, einem Moment des Übergangs von einer Denkweise zur nächsten. Nur ein Miesepeter würde sich vor den mannigfaltigen neuen Möglichkeiten verschließen. Was wir jedoch gegen die Segnungen des Netzes eintauschen, nennt Karp »unsere alte, lineare Denkweise«. Still und leise, gezielt und ungehindert wird der lineare Geist von einem neuen Geist verdrängt, der Informationen in kurzen, zusammenhanglosen und oft überlappenden Stößen serviert bekommen möchte und muss – je schneller, desto besser. Der ehemalige Zeitschriftenredakteur und Journalismusprofessor John Battelle, der heute eine Online-Beratungsfirma betreibt, hat den intellektuellen Schauder, der ihn beim Surfen im Web überkommt, folgendermaßen beschrieben: »Wenn ich stundenlang in Echtzeit im Netz herumbastele, habe ich das Gefühl, geistig erhellt zu werden, als ob ich tatsächlich ein bisschen schlauer würde.«11 Die meisten von uns haben online bereits ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Solche Gefühle sind wie süffiges Gift – so sehr, dass sie uns für die tieferen kognitiven Auswirkungen des Internets blind machen.
In den letzten fünf Jahrhunderten, seit es Gutenbergs Druckerpresse weiten Teilen der Bevölkerung ermöglichte, Bücher zu lesen, stand der lineare Geist im Zentrum von Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft. Ebenso flexibel wie subtil, war dies der fantasievolle Geist der Renaissance, der rationale Geist der Aufklärung, der innovative Geist der industriellen Revolution, ja, selbst der subversive Geist der Moderne. Bald schon könnte es der Geist von gestern sein.
Der Computer HAL 9000 wurde am 12. Januar 1991 in einer fiktiven Computerfirma in Urbana im Bundesstaat Illinois geboren – oder, wie HAL sich bescheidener ausdrücken würde, betriebsbereit gemacht. Ich kam beinahe auf den Tag 35 Jahre früher zur Welt, im Januar 1959, in einer anderen Stadt im Mittelwesten, nämlich in Cincinnati, Ohio. Mein Leben gestaltete sich – wie das der meisten Babyboomer – als Schauspiel in zwei Akten. Es begann mit der analogen Jugend und ging dann nach einem kurzen, aber heftigen Kulissenwechsel in das digitale Erwachsenendasein über.
Wenn ich mir Bilder aus meiner Kindheit ins Gedächtnis rufe, erscheinen sie zugleich tröstlich und fremd, wie Szenen aus einem jugendfreien Film von David Lynch. Ich sehe das klobige, senffarbene Telefon an der Wand in unserer Küche hängen, mit seiner Wählscheibe und seiner langen, gewundenen Strippe. Ich sehe, wie mein Vater an der Zimmerantenne auf dem Fernsehgerät herumfummelt und vergeblich versucht, für das Spiel der Reds ein Bild ohne Schneetreiben auf der Mattscheibe zu bekommen. Ich sehe die aufgerollte, vom Tau feuchte Zeitung in unserer geschotterten Einfahrt liegen.
Ich erinnere mich an die Hi-Fi-Anlage im Wohnzimmer. Darum verstreut liegen ein paar Plattencover und Staubhüllen (einige davon von den Beatles-Alben meiner älteren Geschwister) auf dem Teppich. Unten, in dem im Souterrain gelegenen, muffigen Familienzimmer, stehen Bücher in den Regalen – viele Bücher. Ihre bunten Rücken tragen alle einen Titel und den Namen eines Autors.
Im Jahre 1977, dem Jahr, als Star Wars in die Kinos kam und der Computerriese Apple gegründet wurde, zog ich nach New Hampshire, um das dortige Dartmouth College zu besuchen. Als ich mich bewarb, wusste ich noch nichts davon, doch Dartmore war seit Langem ein Vorreiter in den Computerwissenschaften und spielte eine führende Rolle dabei, Studenten und Lehrkörper die ungeheuren Möglichkeiten datenverarbeitender Maschinen leichter zugänglich zu machen. Der Präsident des Colleges, John Kemeny, war ein anerkannter Computerwissenschaftler, der 1972 ein einflussreiches Buch mit dem Titel Man and the Computer geschrieben hatte. Zehn Jahre zuvor war er außerdem einer der Erfinder von BASIC gewesen, der ersten Programmiersprache, die allgemein gebräuchliche Worte und Syntax verwendet. Etwa in der Mitte des Collegegeländes, direkt hinter der neo-gregorianischen Baker Library mit ihrem hoch aufragenden Glockenturm, befand sich das einstöckige Kiewit Computation Center, ein grauer, vage futuristischer Bau, der die beiden General Electric GE-635 Computer beherbergte. Diese Großrechner betrieben das bahnbrechende Dartmouth Time-Sharing System, ein früher Typus eines Netzwerks, der es Dutzenden von Menschen gleichzeitig gestattete, die Computer zu benutzen. Dieses Timesharing war die erste Manifestation dessen, was wir heute als »personal computing« bezeichnen. Es ermöglichte, wie Kemeny in seinem Buch schrieb, »eine echte Symbiose zwischen Mensch und Computer«.12
Ich belegte Englisch im Hauptfach und gab mir alle Mühe, Mathe- und andere wissenschaftliche Seminare zu umgehen, doch das Kiewit lag strategisch günstig mitten auf dem Campus, auf halber Strecke zwischen meinem Wohnheim und den Studentenverbindungen. An Wochentagen verbrachte ich abends oft ein oder zwei Stunden an einem Terminal im öffentlichen Fernschreiberzimmer und vertrieb mir so die Zeit, bis die Bierpartys richtig in Gang kamen. Für gewöhnlich vertrieb ich mir die Zeit mit einem der noch unglaublich primitiven Multiplayer-Games, die von den studentischen Programmierern – den »Sysprogs«, wie sie sich nannten – zusammengehackt worden waren. Daneben schaffte ich es aber auch, mir beizubringen, wie man das umständliche Textverarbeitungsprogramm des Systems benutzte. Ich lernte sogar ein paar BASIC-Befehle.
Doch das war alles kaum mehr als digitale Spielerei. Für jede Stunde, die ich im Kiewit verbrachte, saß ich bestimmt zwei Dutzend nebenan in der Baker-Bibliothek. Auf Prüfungen paukte ich in dem riesigen Leseraum, schlug in den schweren Bänden auf den Referenzregalen Fakten nach und arbeitete halbtags an der Ausleihe, wo ich Bücher ausgab und entgegennahm. Die meiste Zeit in der Bibliothek verbrachte ich jedoch damit, durch die langen, engen Korridore zwischen den Regalen zu schlendern. Obwohl ich von zehntausenden Büchern umgeben war, kann ich mich nicht daran erinnern, dabei jenes erdrückende Gefühl verspürt zu haben, das für unsere heutige »Informationsüberflutung« symptomatisch ist. Es lag etwas Beruhigendes in der Zurückhaltung all dieser Bücher, ihrer Bereitschaft, jahrelang oder sogar jahrzehntelang zu warten, bis der richtige Leser kam und sie von ihrem Platz im Regal nahm. Lass dir Zeit, flüsterten mir die Bücher mit staubiger Stimme zu. Wir laufen dir nicht weg.
Erst 1986, fünf Jahre nachdem ich Dartmouth verlassen hatte, hielt der Computer vollends Einzug in mein Leben. Zum Missfallen meiner Frau gab ich fast unsere gesamten Ersparnisse, etwa 2000 Dollar, für einen der ersten Apple Macintosh aus – einen Mac Plus, ausgestattet mit einem einzigen MB RAM, einer 20-MB-Festplatte und einem winzigen Schwarzweißmonitor. Ich erinnere mich noch gut daran, wie aufgeregt ich war, als ich die kleine beige Maschine auspackte. Ich stellte sie auf meinen Schreibtisch, steckte die Tastatur und die Maus ein und drückte auf den Netzschalter. Das Ding leuchtete auf, spielte eine Begrüßungsmelodie und lächelte mir zu, während es die geheimnisvolle Routine durchlief, die es schließlich ganz zum Leben erweckte. Ich war hingerissen.
Ich nutzte den Plus sowohl geschäftlich als auch privat. Jeden Tag schleppte ich ihn ins Büro der Management-Beratungsfirma, wo ich als Redakteur arbeitete. Ich verwendete Microsoft Word, um Angebote, Berichte und Präsentationen zu redigieren. Manchmal startete ich auch Lotus 1-2-3, um Änderungen in die Tabelle eines Beraters einzugeben. Jeden Abend karrte ich den Computer wieder nach Hause. Dort benutzte ich ihn, um die Familienkasse zu verwalten, Briefe zu schreiben und Spiele zu spielen (diese waren immer noch unbeholfen, aber nicht mehr ganz so primitiv). Das Spannendste von allem aber war, mithilfe der genialen HyperCard-Anwendung, die es damals zu jedem Mac gab, simple Datenbanken zu erstellen. HyperCard war die Schöpfung von Bill Atkinson, einem von Apples erfindungsreichsten Programmierern, und umfasste ein Hypertext-System, welches das Erscheinungsbild und die Bedienung des World Wide Web vorwegnahm. Wo man im Web heute Links zu anderen Seiten anklickt, klickte man bei HyperCard Buttons auf Karten – doch die Idee dahinter und ihre verführerische Kraft waren dieselben.
Ich begann zu ahnen, dass der Computer mehr als nur ein einfaches Werkzeug war, das tat, was man ihm befahl. Er war eine Maschine, die auf sanfte, aber unmissverständliche Art und Weise einen Einfluss auf ihren Benutzer ausübte. Je mehr ich mit ihm arbeitete, desto mehr veränderte er meine Arbeitsweise. Anfangs hatte ich es als unmöglich empfunden, etwas am Bildschirm zu redigieren. Ich druckte das Dokument aus, korrigierte es mit einem Bleistift und tippte die Änderungen in die digitale Version ein. Dann druckte ich es abermals aus und ging noch einmal mit dem Bleistift darüber.
Manchmal wiederholte ich einen solchen Kreislauf ein Dutzend Mal am Tag. Doch eines Tages änderte sich meine Arbeitsweise plötzlich. Ich stellte fest, dass ich nicht länger auf Papier schreiben oder redigieren konnte. Ich fühlte mich verloren ohne die Löschtaste, die Scrollbar, die Ausschneiden- und Einfügen-Funktion oder den Rückgängig-Befehl. Ich musste nun meine gesamte Arbeit am Bildschirm verrichten. Durch die Benutzung der digitalen Textverarbeitung war ich selbst zu einer Art Textverarbeiter geworden.
Als ich mir um 1990 ein Modem zulegte, brachte das noch weit größere Veränderungen. Bis dahin war der Plus eine in sich geschlossene Maschine gewesen, deren Funktionen sich darauf beschränkten, welche Software ich auf seiner Festplatte installierte. Als ich ihn über das Modem mit anderen Computern verband, nahm er eine neue Identität und eine neue Rolle an. Er war nicht länger nur ein Hightech-Schweizer-Taschenmesser. Er war ein Kommunikationsmedium, ein Gerät, mit dem man Informationen finden, organisieren und übermitteln konnte. Ich probierte sämtliche Online-Dienste aus – CompuServe, Prodigy, sogar das kurzlebige iWorld von Apple – und blieb schließlich bei America Online hängen. Mein erster AOL-Vertrag beschränkte mich auf fünf Online-Stunden wöchentlich. Peinlich genau teilte ich mir die kostbaren Minuten ein, in denen ich mit einer Gruppe von Freunden, die ebenfalls AOL-Accounts hatten, E-Mails austauschte, die virtuellen Anschläge auf ein paar Schwarzen Brettern verfolgte und ins Netz gestellte Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften las. Irgendwann mochte ich sogar das Geräusch, das mein Modem von sich gab, wenn es sich über die Telefonleitung mit dem AOL-Server verband. Wenn man dem Piepen und Klirren lauschte, war es, als hörte man ein paar Robotern bei einer freundlichen Diskussion zu.
Mitte der Neunziger war ich in der »Upgrade-Spirale« gefangen, worüber ich gar nicht unglücklich war. Den alternden Plus entließ ich 1994 in den Ruhestand und ersetzte ihn durch einen Macintosh Performa 550 mit Farbmonitor, einem CD-ROM-Laufwerk, einer 500-Megabyte-Festplatte und einem für damalige Verhältnisse unglaublich schnellen 33-Megahertz-Prozessor. Der neue Computer erforderte neue Versionen der meisten Programme, die ich verwendete, und ließ mich alle möglichen neuen Anwendungen mit den neuesten Multimedia-Features installieren. Als die ganze neue Software endlich auf der Festplatte war, war der Speicher voll, und ich musste mir zusätzlich eine externe Festplatte kaufen. Später kaufte ich noch ein ZIP-Laufwerk und einen CD-Brenner. Nach wenigen Jahren kaufte ich wieder einen neuen Desktop-Computer, diesmal mit einem wesentlich größeren Monitor und einem viel schnelleren Chip, und dazu noch ein tragbares Modell, das ich auf Reisen verwenden konnte. Mein Arbeitgeber hatte in der Zwischenzeit die Macs zugunsten von Windows-PCs aus seiner Firma verbannt, sodass ich nun zwei verschiedene Systeme benutzte, eines bei der Arbeit und eines zu Hause.
Etwa zur selben Zeit hörte ich zum ersten Mal von diesem sogenannten Internet, einem geheimnisvollen »Netzwerk der Netzwerke«. Den Leuten zufolge, die sich damit auskannten, versprach es, »alles zu verändern«. Ein Artikel in Wired aus dem Jahre 1994 erklärte mein geliebtes AOL für »von heute auf morgen hinfällig«. Eine neue Erfindung, der »Webbrowser«, öffnete die Tür zu einer aufregenden digitalen Welt: »Indem man den Links folgt – ein Klick, und das verlinkte Dokument erscheint –, kann man durchs Netz reisen und sich dabei nur von seinen Launen und seiner Intuition leiten lassen.«13 Ich war zunächst nur interessiert, dann aber packte mich die neue Technologie. Ende 1995 hatte ich den neuen Netscape Browser auf meinem Rechner in der Firma installiert und durchstreifte damit die scheinbar endlosen Weiten des World Wide Web. Bald hatte ich auch zu Hause einen ISP-Account – und ein dazu passendes, viel schnelleres Modem. Ich meldete meinen AOL-Dienst ab.
Den Rest der Geschichte kennen Sie, weil es vermutlich auch Ihre eigene Geschichte ist. Immer schnellere Chips. Immer schnellere Modems. Yahoo und amazon und eBay. MP3s. Videostreams. Breitband. Napster und Google. BlackBerrys und iPods. Wi-Fi-Netzwerke. YouTube und Wikipedia. Bloggen und Mikrobloggen. Smartphones, USB-Sticks, Notebooks. Wer könnte da widerstehen? Ich bestimmt nicht.
Als um 2005 das Web 2.0 aufkam, ging ich auch diesen Schritt mit. Ich bewegte mich in sozialen Netzwerken und generierte Inhalte. Ich ließ eine eigene Domain namens roughtype.com eintragen und startete einen Blog. Es war äußerst spannend, zumindest die ersten paar Jahre lang. Seit Beginn des Jahrzehnts arbeitete ich als freier Autor und schrieb hauptsächlich über Technologie. Ich wusste, dass die Veröffentlichung eines Artikels oder eines Buches eine zähe, mühsame und oft frustrierende Angelegenheit war. Man arbeitete wie ein Sklave an einem Manuskript und schickte es dann an einen Verleger. Vorausgesetzt, man bekam es nicht mit einem Ablehnungsschreiben wieder zurück, musste man anschließend wieder und wieder am Text herumbasteln, Fakten nachprüfen und schließlich korrekturlesen.
Das fertige Produkt erschien erst mehrere Wochen oder Monate später. Handelte es sich um ein Buch, musste man oft über ein Jahr warten, bis man ein druckfrisches Exemplar in Händen hielt. Das Bloggen umging diesen schwerfälligen traditionellen Veröffentlichungsweg. Man tippte etwas in den Rechner, setzte ein paar Links, klickte auf »veröffentlichen«, und schon war das eigene Werk draußen, unmittelbar und weltweit zugänglich. Man erlebte sogar etwas, das beim förmlicheren Schreiben nur sehr selten vorkam: direkte Reaktionen von Lesern in Gestalt von Kommentaren oder Links – falls die Leser ihrerseits Blogs hatten. Das Ganze schien ebenso neu wie befreiend.
Auch online zu lesen erschien neu und befreiend. Hyperlinks und Suchmaschinen lieferten mir neben Bildern, Klängen und Videos eine endlose Masse an Worten auf den Bildschirm. Als die Verleger ihre Lizenzpolitik aufgaben, wurde aus der Flut freier Inhalte eine Flutwelle. Rund um die Uhr strömten Schlagzeilen durch meine Yahoo-Homepage und meinen RSS-Feedreader. Ein Klick auf einen Link führte zu einem Dutzend oder Hundert weiteren. Alle ein, zwei Minuten gingen neue E-Mails in meiner Mailbox ein. Ich eröffnete Accounts bei MySpace und Facebook, Digg und Twitter. Nach und nach bestellte ich meine Zeitschriften- und Zeitungsabonnements ab. Wer brauchte die denn noch? Wenn die Druckversion eintraf, nass vom Tau oder zerknittert, hatte ich stets das Gefühl, ich hätte sämtliche Storys bereits gesehen. Im Jahre 2007 jedoch schlich sich klammheimlich eine Schlange des Zweifels in mein Infoparadies.
Ich bemerkte, dass das Netz einen viel stärkeren und weiter reichenden Einfluss auf mich hatte, als dies bei meinem alten PC je der Fall gewesen war. Nicht nur, dass ich sehr viel Zeit damit verbrachte, auf einen Computermonitor zu starren. Nicht nur, dass sich viele meiner Gewohnheiten und routinemäßigen Abläufe veränderten, je mehr ich mich an die Webseiten und Webdienste gewöhnte und von ihnen abhängig wurde. Nein – die grundlegende Funktionsweise meines Gehirns schien sich zu verändern. Damals begann ich mir auch um meine Fähigkeit Sorgen zu machen, mich länger als ein paar Minuten auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren. Anfangs dachte ich, das Problem wäre ein altersbedingtes Symptom nachlassender Geisteskraft. Doch dann begriff ich, dass ich nicht nur geistig abschweifte.
Mein Gehirn war hungrig. Es verlangte, so gefüttert zu werden, wie das Netz es fütterte – und je mehr man es fütterte, desto hungriger wurde es. Selbst wenn ich nicht am Computer saß, sehnte ich mich danach, E-Mails zu checken, Links anzuklicken oder ein bisschen zu googeln. Ich wollte ständig mit der Welt verbunden sein. So, wie mich Microsoft zu einer Textverarbeitungsmaschine aus Fleisch und Blut gemacht hatte, so verwandelte mich das Internet nun offenbar in eine Art Hochgeschwindigkeits-Datenprozessor, einen menschlichen HAL.
Ich vermisste mein altes Gehirn.
Titel der Originalausgabe: The Shallows – What the Internet
Is Doing to Our Brains
Originalverlag: W.W. Norton & Company, New York
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Nicholas Carr Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 by Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kompanie Werbeagentur, München – Zürich
Layout und Herstellung: Ursula Maenner Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
eISBN 978-3-641-08068-6
www.blessing-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe