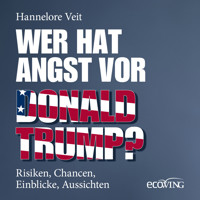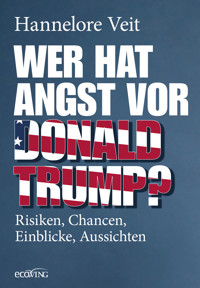
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Make America Great Again: Wer Donald Trump wählt – und warum Ungläubigkeit, Entsetzen, Fassungslosigkeit bei dem Gedanken, dass Donald Trump bei der Wahl 2024 ein zweites Mal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gekürt wurde. Europa schaut mit Verwunderung und Furcht über den Atlantik. Wie kann man diesen Mann an der Spitze der USA wollen? Doch was aus der Ferne so einfach scheint, ist es bei näherer Betrachtung nicht. Hannelore Veit, langjährige USA-Korrespondentin des ORF, ist während der Vorwahlen 2024 durch das Land gereist. Sie hat mit den Menschen gesprochen, die Trump wählen, und gibt eine Einschätzung ab, ob von ihm tatsächlich eine Gefahr für Europa ausgeht. - Mittendrin: in der Zuschauermenge bei einer Wahlveranstaltung der Republikaner - Präsidentschaftswahl in den USA: Wer wählt Trump? Was macht ihn für unterschiedliche Wählerschichten so attraktiv? - Raus aus der Europa-Bubble: Wie Politik in den USA funktioniert - Ist die Demokratie in Gefahr? Eine Einschätzung - Ein spannendes politisches Buch über das Phänomen Donald Trump Donald Trump: Beliebtheit, die unerklärlich scheint, und mögliche Erklärungen Warum ist Donald Trump auch bei Millionen gebildeter und kritisch denkender Amerikaner so beliebt? Was macht die Anziehungskraft eines Politikers aus, der genau das ist, was ihm so oft vorgeworfen wird: ein Narzisst, Lügner und Aufschneider? Hannelore Veit hat sich unter den MAGA-Anhängern umgehört. Ihr Buch über Trump und seine Wähler bietet Einblicke in eine politische Landschaft, die aus europäischer Sicht nur schwer zu verstehen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
WER HAT ANGST VOR DONALD TRUMP?
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung
ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren beziehungsweise Herausgeber
und des Verlages ist ausgeschlossen.
© 2024 ecoWing Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – Wien,
einer Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags,
der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung,
auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche
Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Palatino, Impact LT Standard
Lektorat: Barbara Köszegi
Umschlaggestaltung: www.b3K-design.de, Andrea Schneider, diceindustries
Autorenillustration: © Claudia Meitert/carolineseidler.com
Umschlagmotiv: © Philipp Horak
eISBN: 978-3-7110-5364-0
INHALT
Prolog
Undercover in der MAGA-Welt
Der Schock 2016
Die Person Donald Trump
Unterwegs in Florida
Warum Frauen Trump wählen
Beten für Donald Trump: Die Evangelikalen
Latinos und Schwarze: Neue Wählerpools für Donald Trump
Trump-Wähler der gebildeten Schichten
Trumps Dominanz bei den Republikanern
Wie gefährdet ist die Demokratie?
Trump und die Medien
Die Prozesse
Trumps Pläne für eine zweite Präsidentschaft
Epilog
Über die Autorin
Der US-Wahlkampf 2024 ist ein Wahlkampf der Überraschungen. Fast jede Woche dreht sich im Sommer 2024 das Bild. Alles ist im Fluss. Was bisher als gesetzt galt, ist es nicht mehr: ein Attentatsversuch, ein Kandidatenwechsel in letzter Minute, ein Donald Trump, der sich auf eine neue und wesentlich jüngere Mitbewerberin um das Präsidentenamt einstellen muss.
Mehrmals ist der Druck des Buches gestoppt worden, um letzte Ereignisse im Wahlkampf einzuarbeiten. Neue überraschende Wendungen sind zwischen der Drucklegung und dem Erscheinen dieses Buches nicht ausgeschlossen.
Das vorliegende Buch ist kein Buch über den Wahlkampf, es beschreibt den Hintergrund, vor dem diese Wahl stattfindet.
Wien, am 31. Juli 2024
PROLOG
An einem kalten Wintermorgen Anfang 2024 bin ich auf dem Weg zum Flughafen, um für eine Recherchereise nach Washington zu fliegen, in die Stadt, aus der ich acht Jahre lang als USA-Korrespondentin berichtet habe. »Wie kann es sein, dass dieser Trump wieder da ist? Das gibt’s nur in Amerika, dass so einer noch einmal Präsident werden kann. Wird er wirklich gewählt?«, fragt mich mein Taxifahrer. Ich wollte eigentlich nie zu den Journalisten gehören, die Taxifahrer als Stimme des Volkes zitieren, und tue es hier doch. Denn er spricht aus, was ich in Europa so oft höre: »Wie kann es sein?« Und immer schwingt der Satz mit: Sind die Amerikaner alle verrückt? Unser Amerika-Bild ist geprägt von den respektlosen Sätzen, die Donald Trump fast täglich geliefert hat, von seinen Provokationen, Drohungen und Beleidigungen, die wir, die Medien, mit großer Lust wiedergegeben haben.
Am 7. November 2020, als Joe Biden vier Tage nach der Wahl von den US-Networks zum Wahlsieger erklärt wurde, dachten wir: »Das war’s. Donald Trump ist endgültig weg, die, die Trump als Irrtum der Geschichte sahen, hatten recht.« Wie habe ich mich geirrt, wie haben wir alle uns geirrt. Eigentlich hätten wir es besser wissen müssen: Es ist gewagt, eine Vorhersage zu treffen, wenn es um Donald Trump geht.
Wer wählt Donald Trump? Das ist die zentrale Frage dieses Buches. Politologen haben Donald Trumps Kernwählerschicht sehr genau beschrieben: Seine Wähler sind männlich, ungebildet, weiß, getragen vom Gefühl, von der politischen Elite in Washington ausgegrenzt zu werden. Mag sein, dass sie Trump unreflektiert gewählt haben, sicher ist, dass sie ihn wieder wählen werden: weil sie ihn als einen der ihren empfinden, weil er auf das Establishment schimpft, weil er ihre schlichte Sprache spricht, weil er verspricht, sich um sie zu kümmern, weil sie hoffen, dass er als Businessman die Wirtschaft boomen lässt, weil sie mit Political Correctness nichts anfangen können und es ihnen egal ist, wer welche Klos benutzen darf, weil sie nicht verstehen, warum plötzlich alle über Trans People reden, weil das Schlagwort DEI (Diversity, Equity, Inclusion – Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion) in ihrem Leben keine Relevanz hat.
Doch diese Wählergruppe reicht nicht, um das Phänomen zu erklären, dass Trump bei der letzten Wahl 75 Millionen Menschen dazu gebracht hat, ihm ihre Stimme zu geben, dass er 2024 ohne erkennbare Mühe wieder Präsidentschaftskandidat der Republikaner geworden ist und dass er im aktuellen Wahlkampf beste Chancen hat. Unter denen, die ihn gewählt haben, sind sehr viele gebildete, erfolgreiche Männer und Frauen, die sich sehr wohl Gedanken machen, wenn sie zu den Urnen gehen. Das ist die Wählerschicht, die ich am interessantesten finde.
Trump ist alles, was ihm vorgeworfen wird: Er ist Narzisst, Lügner, Aufschneider, Angeber, Besserwisser. Er ist unberechenbar, überheblich, aggressiv, kränkend und selbst leicht kränkbar. Er kritisiert schonungslos und oft untergriffig und verträgt selbst keine Kritik – und doch hat er Qualitäten, die man auf den ersten Blick nicht unbedingt sieht. Vor allem dann nicht, wenn man jede seiner Aussagen wörtlich nimmt. Er ist ein brillanter Entertainer, er hat Charisma und weiß, wie man mit seinem Publikum spielt. Und das Publikum liebt ihn genau dafür. Außerdem: Er hat in seiner Amtszeit einiges erreicht.
»Es ist alles sehr kompliziert.« Diesen Satz kennen wir in Österreich gut. Ich bin, während ich dieses Buch schrieb, manchmal verzweifelt vor dem Computer gesessen und habe mich gefragt: Wie soll ich all diese diametral auseinandergehenden Einschätzungen des Status quo in einem Buch zusammenführen? Irgendwie hat eines immer mit dem anderen und sehr oft auch mit dem gegensätzlich anderen zu tun. Ich habe mich während meiner Reisen in die USA im Winter 2024 vor allem mit republikanisch eingestellten Wählern und Wählerinnen unterhalten. Wir, die Medien, hatten vor Trumps Wahlsieg 2016 in unserer Meinungsblase in Washington gelebt und nicht auf die Trump-Wähler gehört, wir hatten sie nicht ernst genommen, und das war unser großer Fehler.
Also bin ich Anfang des Jahres 2024 ein paar Wochen lang durch das Land gereist, habe mich bemüht, mit möglichst vielen ehemaligen und zukünftigen Trump-Wählern und -Wählerinnen ins Gespräch zu kommen, habe versucht auszuloten, ob und wie sich ihre Position geändert hat, ob sie sich relativiert oder verfestigt hat. Ich habe mich bei Trump-Wahlkampfveranstaltungen ins Publikum gemischt und aufgeschrieben, was die Trump-Anhänger und -Anhängerinnen an Gründen dafür angeben, warum sie Trump wählen. Manche äußerten sich differenzierter, viele – vor allem die Trump-Basis – undifferenziert.
Dies ist nicht ein Buch über Donald Trump, es ist keine politikwissenschaftliche Analyse, es ist ein Buch über seine Wähler und Wählerinnen. Ich habe mich auf die Suche nach den Gründen für die enorme Spaltung dieses Landes gemacht. Ich habe den Menschen zugehört, viele Aussagen unkommentiert stehen gelassen, so wie sie gefallen sind, habe sie aber, wo immer möglich, in den entsprechenden Kontext gesetzt. Ich habe versucht herauszuhören, warum ein Dialog nicht möglich ist, warum es keine Mitte gibt.
Joe Biden hat in seiner Inauguration Speech, seiner Antrittsrede am 20. Jänner 2021, sehr viel von Zusammengehörigkeit und Eintracht gesprochen. 2024 können wir mit Fug und Recht sagen, dass wir von Einigkeit genauso weit entfernt sind wie unter Präsident Trump. Die Polarisierung ist so omnipräsent, dass ein Schritt in Richtung Harmonie kaum möglich scheint. In unserer Zeit der aufgeheizten Debatten in den sozialen Medien scheint keiner die Argumente der anderen Seite hören, geschweige denn ernst nehmen zu wollen.
Unser österreichisches Amerika-Bild ist von unserem Standpunkt, von unserer Weltanschauung geprägt. Wir können aber nicht erwarten, dass Amerikaner die Welt so sehen, wie wir sie sehen. Sie sind nicht sozialisiert wie wir, die wir in einem kleinen Land mitten in Europa leben, das über ein gut entwickeltes Sozialnetz verfügt und sich die Neutralität auf die Fahnen geheftet hat.
Amerika tickt anders. Der Rest der Welt wächst nicht mit der Idee des »American Exceptionalism« auf, mit dem Stolz, sich selbst die älteste Demokratie der Welt nennen zu können, ohne viel darüber nachzudenken, was für eine Art von Demokratie es war und ist, wenn einige gleicher sind als andere. Es ist ein Land, das entstanden ist aus dem Gedanken, frei zu sein. Es ist ein Land, das aus Krisen, und seien es selbst verschuldete, schneller herauskommt als andere, das die Fehlerkultur schätzt, das Risikobereitschaft schätzt, das den Grundsatz hochhält: Ich arbeite hart, und wenn ich es zu Vermögen bringe, dann habe ich mir das verdient und bin stolz darauf. Es ist ein Land, in dem der Österreicher Arnold Schwarzenegger Weltruhm erlangt hat, was ihm in Österreich wohl nie gelungen wäre. Es ist ein Land, in dem die Krankenversicherung für alle nicht von allen geschätzt wird, wie Barack Obama in den acht Jahren seiner Präsidentschaft lernen musste. Es ist ein Einwanderungsland, das in der Selbstsicht der Republikaner und immer mehr auch der Demokraten an die Grenzen der Bereitschaft gestoßen ist, Zuwanderung zu tolerieren. Es ist ein Land, das Europa nicht als Vorbild sieht – vielleicht mit der Ausnahme der Kultur –, ein Land, das einen Krieg für Europa geführt hat, den Wiederaufbau in Europa gewährleistet hat und trotzdem mit Anti-Amerikanismus konfrontiert ist. Es ist ein Land, das schon seit Langem nicht mehr die Rolle des Weltpolizisten spielen will, nicht erst seit Donald Trump.
Auch die Person Donald Trump wird in Amerika ganz anders gesehen als in Europa. So wie wir Barack Obama undifferenziert positiv gesehen haben, sehen wir Donald Trump undifferenziert negativ. Wir haben Angst vor Donald Trump. Die Sorge, dass ihm Europa egal ist, ist nicht unberechtigt, wenn man sich mit seiner Persönlichkeit auseinandersetzt. Für ihn zählt nur eines: er selbst. Die Angst, dass Europa auf sich selbst gestellt sein könnte, ist ein durchaus realistisches Szenario. Priorität in der Außenpolitik hat China. Das pazifische Jahrhundert hat schon Obama, der auf der Pazifikinsel Hawaii geborene Präsident, ausgerufen.
Emotionen und Angst sind wichtige Faktoren im Wahlkampf 2024. »Wir haben Angst«, sagen demokratisch denkende Wähler, sagen die Europäer. »Wovor denn?«, fragen die republikanisch denkenden Amerikaner.
Während ich diese Zeilen schreibe, wird klar: Trumps Gegenkandidatin heißt Kamala Harris. Joe Biden hat trotz seiner katastrophalen Debatte Ende Juni gegen Donald Trump und trotz offensichtlicher altersbedingter Schwächen lange auf seiner Kandidatur beharrt, hat aber angesichts der Kritik aus den eigenen Reihen schließlich aufgegeben und seine Unterstützung der Vizepräsidentin zugesagt. Als Präsidentschaftskandidatin steht Kamala Harris einem Donald Trump gegenüber, der vor keinen Angriffen und Untergriffen zurückschreckt. Seine Wähler und Wählerinnen sind ihm sicher, umso mehr gilt das nach dem Attentatsversuch auf ihn am 13. Juli 2024. Wer die Wahl gewinnt, ist offen. Doch: Die Welt wird sich möglicherweise noch einmal an einen Präsidenten Trump gewöhnen müssen.
UNDERCOVERIN DER MAGA-WELT
»We just love Donald Trump.« Tara steht vor mir in der Schlange vor dem Coliseum Complex in Greensboro in North Carolina. Es ist neun Uhr früh an diesem Samstag Anfang März 2024, knapp vor dem Super Tuesday, die Menschenschlange ist jetzt schon lang, vom Ordnungspersonal eingewiesen und ordentlich in Serpentinen gereiht. Erst in zwei Stunden wird das Coliseum die Türen öffnen und die Trump-Fans einlassen. Fünf Stunden dauert es dann schließlich, bis Donald Trump tatsächlich die Bühne betritt. Geduld ist gefragt, Stehvermögen ebenso. Man kommt leicht ins Gespräch, verkürzt so die Wartezeit. Tara, um die 50 – nach ihrem genauen Alter frage ich nicht –, zieht sich, während sie ansteht, ein dunkelblaues T-Shirt über ihre Bluse: »Trump 2024« steht darauf. »Es ist meine erste Trump Rally, meine erste Großkundgebung mit Trump«, erzählt Tara. Im Wahlkampf 2016 kam Donald Trump zwar nach Greensboro, aber damals war sie verhindert. Tara lebt in Greensboro, doch ihre Verwandten, die sie irgendwo in der Menge weiß, sind weit aus dem Süden des Bundesstaates North Carolina angereist. Tausende sind es, die Trump hier live erleben wollen. Wer das stundenlange Anstellen nicht in Kauf nehmen will, wird sich mit Stehplätzen ganz hinten im Saal begnügen müssen.
Von Aggressivität ist an diesem Vormittag nichts zu spüren. Es ist eine friedliche Gruppe von MAGA-Anhängern (MAGA: Make America Great Again), die sich hier versammelt hat. Man ist schließlich unter sich, vereint in der Unterstützung und fast so etwas wie Verklärung für Donald Trump. Ich gehe davon aus, dass alle, die hierhergekommen sind, zur Trump-Kernwählerschaft gehören und ihm unverbrüchlich die Treue halten werden, egal, was bis zur Wahl noch passiert. Was nicht wirklich verwundert: Es sind fast nur Weiße in der Menge. Und das, obwohl fast jeder vierte Einwohner North Carolinas schwarz ist. Ganze drei Afroamerikaner zähle ich.
16 Bundesstaaten werden am Super Tuesday in ein paar Tagen ihre Vorwahlen abhalten und Donald Trump einen großen Schritt näher zur republikanischen Präsidentschaftskandidatur und möglicherweise zur Präsidentschaft bringen. North Carolina ist einer der Swing States, einer der Bundesstaaten, die bei den Wahlen am 5. November den Ausschlag geben könnten, weil in diesem Bundesstaat das Pendel sowohl in Richtung Republikaner als auch in Richtung Demokraten ausschlagen könnte. Donald Trump hat North Carolina 2020 mit einem Vorsprung von knappen 75 000 Stimmen gewonnen. Diesmal hoffen die Demokraten, den Bundesstaat wieder zurückholen zu können.
Ich habe mich für diese Rally knapp vor dem Super Tuesday unter die Trump-Anhänger und -Anhängerinnen gemischt, bin nicht wie sonst bei Wahlkampfveranstaltungen als Journalistin auf der Pressetribüne dabei, sondern quasi inkognito unter den Fans.
Viele in der Schlange tragen MAGA-Kappen, Pullover mit US-Flaggen sind überall zu sehen, einige haben amerikanische Flaggen um die Schultern drapiert, eine Frau hat sich eine blau-weiß-rot glitzernde Spange ins Haar gesteckt. Ein junger Mann schwingt eine riesige blaue Fahne: »Trump 2024 – Make America Great Again« lautet der Schriftzug darauf. »Ho, ho ho – Joe’s gotta go« skandiert ein anderer, die Menge stimmt ein. »Ho, ho, ho!« Mit Joe ist Joe Biden gemeint. Und immer wieder ist der Schlachtruf: »USA! USA! USA!« zu hören.
Die Atmosphäre erinnert ein bisschen an einen Jahrmarkt. Auf dem Parkplatz vor der Halle haben die Händler mit Trump-Fanartikeln ihre Stände aufgebaut, sie machen ein gutes Geschäft: 25 Dollar kosten die Kappen, wer mehrere kauft, kriegt sie billiger. »Trump Save America« heißt es auf T-Shirts, oder kurz und prägnant: »Trump 2024«. Der diabolisch anmutende »Mug Shot«, das Polizeifoto von Donald Trump, aufgenommen im Zuge eines der vielen Prozesse, die gegen Trump laufen, ist zum Markenzeichen geworden. Überall ist es auf T-Shirts zu sehen, »Never Surrender« oder »Trump Wanted … For President« steht darunter. Flaggen mit »Trump will be back« flattern im Wind, Trump-Teddybären, Trump-Spielzeug, alles findet sich an den Ständen. Ein Mann mit gelber Trump-Perücke freut sich über jedes Selfie, das mit ihm gemacht wird. Manche der Slogans auf den Stickern und T-Shirts sind witzig, andere angriffig, T-Shirts mit »#FJB« für »Fuck Joe Biden« ziehen viele Käufer an. Auch ein paar religiöse Motive finden sich: »Jesus is my Savior – Jesus ist mein Retter«, heißt es auf einem T-Shirt. Ein paar selbst ernannte Wanderprediger ziehen durch die Menge – dass sie mit ihrem missionarischen Eifer auch tatsächlich Menschen erreichen oder gar neue Anhänger finden, darf bezweifelt werden. Auffällig, aber nicht weiter überraschend: Auf vielen Trump-Merchandising-Artikeln wird das Second Amendment zitiert, der Zweite Verfassungszusatz, der das Recht festschreibt, Waffen zu tragen. Es gibt auch Banner mit »Gun Control means Using Both Hands – Waffen zu kontrollieren heißt, sie mit beiden Händen zu halten«. Überall werden Flaggen und Banner mit den Stars and Stripes, der Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika, und den ersten drei Wörtern der amerikanischen Verfassung, »We the People – Wir das Volk«, zum Kauf angeboten. Trump hat es verstanden, sich als Mann des Volkes zu positionieren, als Außenseiter, der gegen das Establishment angetreten ist, und als Mann, der treu zur Verfassung steht. Und seine Anhänger und Anhängerinnen nehmen es ihm voll und ganz ab.
Tara, die für ein Reisebüro arbeitet, ist mit ihrem Ehemann Bob gekommen. Zwei Stunden anstehen, um in den Saal eingelassen zu werden, das nimmt sie gerne in Kauf. Als ich sage, dass ich eigentlich Journalistin bin und eine Trump Rally im Publikum erleben möchte, merke ich ein gewisses Zögern. Aber dann meint Bob: »Ah, dann sind Sie eine von den guten Journalisten, gut, dass Sie herkommen und mit uns reden, statt über uns zu schreiben, ohne jemals dabei gewesen zu sein.« Das Eis ist gebrochen, bereitwillig erzählen sie mir, warum sie »ganz sicher« am 5. November Donald Trump wählen werden. »Ich mag Trump, weil er kein Politiker ist. Er ist ein Businessman, die Politmaschinerie in Washington interessiert ihn nicht. Er ist ein Mann, der anpackt – who fixes things – und Sachen in Ordnung bringt«, sagt Tara. »Ja, er wird manchmal ausfällig, aber er sagt, was er denkt. Wir wissen, wo er herkommt, er ist kein verlogener Politiker. Bei ihm gibt es kein verstecktes Motiv.« Bob gelingt es, ab und zu ein Wort einzuwerfen: »Wir haben einfach keine andere Wahl. In Washington ist ein Kartell an der Macht, die Biden-Regierung muss abgewählt werden.« – »Trump liebt Amerika, er steht für Freiheit und wir wollen unsere Freiheit«, mischt sich Amy, die vor uns in der Schlange steht, ins Gespräch. »Sie wollen unsere Freiheit einschränken«, sagt Bob, »die Wirtschaft war unter Trump besser, alles war besser, jetzt haben wir offene Grenzen, es ist ein Albtraum. Sie lügen, lügen, lügen in Washington!«, wird er laut und leidenschaftlich. »Ich weiß schon, das hört sich nach einer Verschwörungstheorie an«, sagt Tara, »aber das ist es nicht: Sie, die anderen, hassen Trump und tun alles gegen ihn. Er sieht die Dinge so, wie wir sie sehen, aber niemand hört uns zu.« Bob fügt hinzu: »Den Demokraten ist Amerika egal.« Auch Amy, zu der inzwischen ihre Kinder und Enkelkinder gestoßen sind, stimmt ein: »Die Politiker in Washington, Demokraten und Republikaner, alle sind sie korrupt. Trump wird den Sumpf in Washington trockenlegen.«
Es sind Sätze, wie man sie überall von Trump-Anhängern hören kann. Er ist »ihr« Mann, er spricht für sie. Er, der Millionär, der stolz darauf ist, »ganz klein«, mit einer Million Dollar seines Vaters, als Businessman begonnen zu haben, wie er immer wieder betont, hat sich zur Stimme der kleinen Leute erklärt und wird als einer der ihren akzeptiert.
Ein paar Stunden später wird Donald Trump auf der Bühne im Saal dieselben Argumente wie Tara, Bob und Amy verwenden. Seine Talking Points sind die Talking Points seiner Fans.
Die Show
Dass hier nicht bloß ein Präsidentschaftskandidat, sondern ein Ex-Präsident erwartet wird, wird spätestens beim Eintritt in die Veranstaltungshalle offensichtlich. »All guests will be screened by the United States Secret Service« hatte es im Info-Mail geheißen, das im Vorfeld an alle registrierten Teilnehmer geschickt wurde. Schwer bewaffnete Sicherheitskräfte in schusssicheren Westen checken Taschen beim Einlass gründlicher, als ich es je bei Events erlebt habe. Die Geheimdienst- und Polizeipräsenz ist enorm. Die Nervosität der Sicherheitskräfte ist spürbar, der Snackstand im Coliseum lässt nach einer halben Stunde die Rollbalken runter: Der Geheimdienst hat es angeordnet, heißt es.
Die Atmosphäre im Saal ist eine Mischung aus gespannter Erwartung, Enthusiasmus und auch ein bisschen Ungeduld. Die Menge muss bei Laune gehalten werden. Aus den Lautsprechern dröhnen patriotische Songs, gemischt mit ABBA-Klassikern, Ohrwürmern und Hits der 1990er-Jahre. Viele Künstler, darunter Bruce Springsteen oder die Rolling Stones, haben Trump inzwischen verboten, ihre Songs bei seinen Veranstaltungen zu benützen.
Meine Sitznachbarn im Saal – Tara und Bob habe ich im Gedränge aus den Augen verloren – erzählen mir, dass sie nicht nur gekommen sind, um den Präsidenten live zu erleben, sondern auch der Atmosphäre wegen.
Keine Rally ohne Treueschwur auf die Verfassung, ohne Gebet mit Danksagung für die »Freiheiten, die wir in Amerika genießen« und ohne die Bitte, »Donald Trump zu helfen, Amerika wieder zu alter Größe zurückzuführen«. Und keine Rally, bei der nicht die Nationalhymne, der »Star-Spangled Banner«, gesungen wird.
Lokalpolitiker aus North Carolina treten als Vorredner auf, werben um Stimmen, denn in den Vorwahlen geht es nicht nur um den republikanischen Präsidentschaftskandidaten, auch die Kandidaten der Republikaner auf Bundesstaatenebene werden gekürt. Jedes Mal, wenn Washington und der angebliche Sumpf an Korruption erwähnt wird, gibt es Buhrufe aus dem Publikum.
Die Menge ist elektrisiert, als Donald Trump zu den Klängen von Lee Greenwoods »God Bless the USA« mit dem patriotischen und ins Ohr gehenden Refrain »I’m proud to be an American« die Bühne betritt. Dunkelblauer Anzug, viel zu lange rote Krawatte, blonde, zur Tolle geföhnte Mähne – ganz so, wie wir ihn kennen, nimmt er die Huldigungen des Publikums entgegen. »Thank you Greensboro, thank you North Carolina«, ruft er unter aufbrausendem Jubel in die Menge.
Seine Rede ist alles zugleich: politische Show der Sonderklasse, Selbstinszenierung und Aneinanderreihung von Lügen und Halbwahrheiten. Er zeichnet ein dunkelgraues Bild der Gegenwart und verspricht, dass mit ihm alles besser werde, dass er alles richten werde. Er skizziert, wie eine zweite Trump-Amtszeit aussehen könnte: Er werde den Deep State, den Schattenstaat, der Amerika heute beherrsche, ausmerzen, er werde eine harte Linie gegen illegale Einwanderung und Kriminalität fahren, er werde massiv auf fossile Energie setzen. Die Rede folgt demselben Muster wie seit Tag eins im ersten Wahlkampf, seit dem Tag, als er im Juni 2015 auf der goldenen Rolltreppe im Trump Tower in New York seine Kandidatur verkündete. Damals hatten seine Wahlkampfmanager noch befürchtet, dass nicht genug Menschen kommen würden und hatten Claqueure in der Menge platziert, um sicherzugehen, dass die Menge auch für die TV-Kameras groß genug aussah. Das ist längst nicht mehr notwendig.
Angriffig ist Donald Trump, aber ich empfinde ihn als nicht mehr ganz so energiegeladen wie im Wahlkampf 2016 oder im Wahlkampf 2020. Selbst im Jahr der Pandemie, als Joe Biden vorwiegend aus dem Keller seines Hauses in Wilmington in Delaware wahlkämpfte, fuhr Trump durch das Land, um seine Fans zu motivieren und um in allen kritischen Bundesstaaten Rallies abzuhalten.
An ein Skript hält sich Donald Trump nur sehr lose, er weiß, was seine Fans hören wollen, und erfüllt ihre Erwartungen. Die aufgestellten Teleprompter sind grobe Hilfsmittel, immer wieder weicht er vom Text ab und geht auf sein Publikum ein. Darin ist er Meister. Er spielt mit der Menge, zeigt mit dem Finger auf einzelne Zuschauer. Die Menge liebt es.
Was man in den kurzen Redeausschnitten, den Soundbites, die anschließend in den TV-Nachrichten gezeigt werden, nicht sieht: Immer wieder blitzt Humor auf. Donald Trump ist manchmal wirklich witzig, macht sich nicht nur über andere, sondern auch über sich selbst lustig. Er wirft Stichwörter in die Menge, die dankbar aufgegriffen werden. Die Fans ganz vorne nennt er scherzhaft die »Front Row Joes – die Groupies in der ersten Reihe«. Sich selbst vergleicht er mit Al Capone, er selbst sei öfter angeklagt als der legendäre Mafiaboss. Nicht ganz korrekt, aber für Lacher und Entrüstung darüber, dass die Justiz eine Hexenjagd gegen ihn veranstalte, sorgt er damit allemal.
Auch diesmal bringt Trump seine größten Hits, enttäuscht das Publikum nicht. Stehsätze wie »Joe, you are fired« fallen, das Publikum grölt – es ist eine Anspielung auf Trumps TV-Show »The Apprentice«, in der er mit diesem Satz Kandidaten für einen Job rausbeförderte. Joe, gemeint ist Joe Biden, könne weder Reden halten noch einen Wahlkampf führen, gehen könne er auch nicht – damit spielt er auf Bidens Alter und dessen oft unkoordinierte Bewegungen an.
Den größten Applaus erhält er bei seinem Lieblingsthema, der angeblich gestohlenen Wahl. »Ich werde nicht zulassen, dass sie die Wahl 2024 fälschen! Einen Erdrutschsieg werden wir hinlegen, too big to rig, zu groß, um ihn uns wegzunehmen.« Wie auf Kommando werden überall im Saal blau-weiße »Too big to rig«-Schilder hochgehalten. Es wird gegrölt, es wird applaudiert. Ich gehe davon aus, dass so gut wie alle seine Fans, die nach Greensboro gekommen sind, tatsächlich glauben, dass Trump und nicht Biden die letzte Wahl gewonnen hat. Immer wieder skandieren sie: »USA! USA! USA!«
Eines der ganz großen Themen des Wahlkampfs 2024, die Einwanderung, ist auf Donald Trump zugeschnitten. An die Fakten hält er sich nicht: In seiner Rede im Trump Tower, als er 2015 seine Kandidatur ankündigte, sprach er von Kriminellen und Vergewaltigern, die Mexiko über die