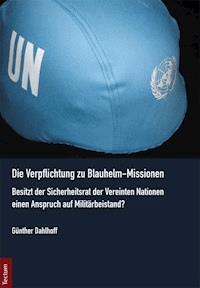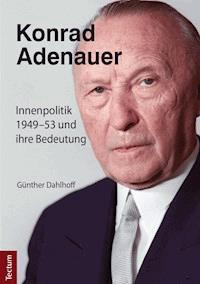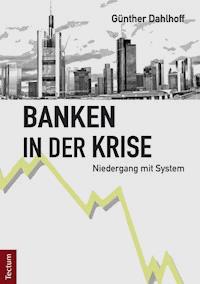19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Es kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage 'was ist deutsch' niemals ausstirbt" (Friedrich Nietzsche) Immer wieder kommt es in der Geschichte zu Ereignissen, die eine intensivere Beschäftigung mit sich selbst anstoßen. Dies gilt für einzelne Individuen ebenso wie für ganze Gruppen oder Nationen. Die Frage "Wer oder was ist deutsch?" rückt durch die derzeitige 'Flüchtlingskrise' wieder in den Mittelpunkt einer hitzigen Debatte - und zwingt uns geradezu zur Reflexion und Neuordnung der eigenen Werte. Die Aufgabe der gesellschaftlichen Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger verlangt von allen ein hohes Maß an Toleranz und Verständnis für die je andere Kultur. Aber verstehen die Deutschen sich eigentlich selbst? Wer sind wir und was macht uns zu Deutschen? Wird man deutsch, wenn man den deutschen Pass bekommt? Ergibt sich aus dem Charakter der Deutschen die zu ihnen passende Staatsform? Wie konnte Bundeskanzler Adenauer in nur 14 Jahren aus einem mitteleuropäischen Land ein westeuropäisches machen? Sind die Deutschen von heute dieselben wie vor 200 Jahren? Wie haben sie sich in diesen Jahren selbst gesehen? Und wie steht es mit dem Islam und seinem Verhältnis zu Deutschland? Mal ernst, mal unterhaltsam, beschäftigt sich der erfahrene Diplomat und viel gereiste Autor Günther Dahlhoff mit all dem, was so 'typisch deutsch' ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Günther Dahlhoff
Wer oder was ist deutsch?
Günther Dahlhoff
Wer oder was ist deutsch?
Die unbeantwortete Frage. Ein Essay
Tectum Verlag
Bei Fragen oder Anregungen, Kontakt zum Autor möglich unter
Günther Dahlhoff
Wer oder was ist deutsch? Die unbeantwortete Frage. Ein Essay
© Tectum Verlag Marburg, 2015
Umschlagabbildungen: Fotolia.com © JiSign
Umschlaggestaltung: Norman Rinkenberger | Tectum Verlag
ISBN: 978-3-8288-6339-2
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter
der ISBN 978-3-8288-3670-9 im Tectum Verlag erschienen.)
Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
INHALT
VORWORT
I. DIE FRAGE NACH DER FRAGE: WER ODER WAS IST DEUTSCH?
II. GRUNDLAGEN
A. Deutsche Sprache
1. Das Wort deutsch
2. Von Althochdeutsch zu Neuhochdeutsch
3. Charakter der deutschen Sprache
B. Die Deutschen
1. Deutsche Rassen und Stämme
2. Vom deutschen Kulturvolk zum deutschen Staatsvolk
3. Die Deutschen 1945
C. Land der Deutschen
III. PERIODEN DES DEUTSCHTUMS 1789/1945
A. Deutschtum 1789/1815
1. Germaine de Staël
2. Goethe und Schiller
3. Die Romantiker
B. Deutschtum 1815/71
1. Der deutsche Bund
2. Romantischer Patriotismus
3. Aufstieg des Bürgertums
4. Heinrich Heine und Ludwig Börne
5. Richard Wagner
C. Deutschtum 1871/1918
1. Noch einmal Richard Wagner und Friedrich Nietzsche
a) Wagner
b) Nietzsche
2. Deutschtum
a) Abendland
b) Protestantismus
c) Katholizismus
3. Thomas Mann
a) Über sich selbst
b) Über das Protestantische
c) Über den Westen, Kultur und Zivilisation
D. Deutschtum 1919/33
E. Deutschtum 1933/45
1. Sonderweg vollendet
2. Nochmal Heinrich Heine, sowie Martin Heidegger und Arnold Gehlen
3. Mythos und Masse
4. Antisemitismus
5. Typisch deutsch?
IV. DEUTSCHTUM 1945/2015
A. 1945/49
B. Staat
1. Grundgesetz
2. Ende von Preußen und Aufstieg des Westens
3. Literatur
C. Charakter der Bevölkerung
1. Gründlichkeit, Sachlichkeit, Ordnung
a) Gründlichkeit: Ernst/Tiefe/Weltanschauung
b) Sachlichkeit: Sachzwang/esprit/Form
c) Ordnung: Harmonie/Konsens/Disziplin
2. liberté, égalité, fraternité
a) Freiheit: Freiheiten/Individualismus/political correctness
b) Gleichheit: Gleichheiten/Sozialstaat/Ungleichheiten
c) Solidarität: Soziale Marktwirtschaft/Sozialpartnerschaft/Treue
3. Innerlichkeit, Gemütlichkeit, Gefühl
a) Innerlichkeit: Rückzug ins Private/Konvention/Karneval und Gartenzwerg
b) Gemütlichkeit: Gemütlichkeit I/Gemütlichkeit II/Romantik 1968
c) Gefühl: Nationalgefühl/Pflichtgefühl/Angst
V. DIE UNBEANTWORTETE FRAGE: WER ODER WAS IST DEUTSCH?
A. Patriotismus und Holocaust
B. Kulturnation und Staatsnation
C. Leitkultur
NACHWORT
ANMERKUNGEN
VORWORT
Diese Darstellung setzt ein in den Jahren unmittelbar nach der Französischen Revolution (1789). Sie bewirkte das Ende des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation durch Niederlegung der Reichskrone durch den österreichischen Kaiser Franz II.(1806) und den Beginn der Entwicklung zum deutschen Nationalstaat (1871). In den vergangenen beiden Jahrhunderten erhielt das moderne Deutschtum seine Prägung. Zur genauen Beschreibung der Deutschen der napoléonischen Zeit – etwa von der Gründung des Rheinbundes (1806) bis zum Wiener Kongress (1814/15) – schöpfe ich reichlich aus dem 1813 erschienenen Werk der Germaine de Staël De l'Allemagne. Für die Zeit vor 1945 berichte ich ferner, was über Deutsche und Deutschtum geschrieben wurde von Dichtern und Denkern wie etwa Goethe, Schiller, den Romantikern, Heine, Börne, Wagner, Nietzsche, Thomas Mann, Sombart, Heidegger oder Gehlen.
Seit mindestens zweihundert Jahren wurden und werden Meinungen veröffentlicht zur Frage,wer oder was deutsch sei.1 Bei der Lektüre gelangt man recht bald zu der Erkenntnis, dass der Charakter der deutschen Bevölkerung sich in den beiden Jahrhunderten zwar als in mancher Hinsicht veränderlich, aber als überwiegend stabil erwiesen hat, während die politische Verfassung Deutschlands in diesen beiden Jahrhunderten tiefgreifende Veränderungen erfahren hat. Dabei scheint mir, dass keine Form der politischen Verfassung der Deutschen seit 1789 – Monarchie bis 1918, Republik bis 1933, Nationalsozialismus bis 1945, Bundesrepublik (und DDR) seit 1949 – eine notwendige Folge ihres Charakters war bzw. ist, sondern dass der Charakter der Deutschen der jeweiligen staatlichen Verfassung ihr jeweils typisches deutsches Gepräge verliehen hat: bei jeweils geänderten Spielregeln lebte die Bevölkerung ihre jeweilige staatliche Verfassung nach ihrer Art: gründlich und ordentlich, nur in den 14 Jahren der Weimarer Republik gab es keine allgemein verbindlichen Spielregeln, nach denen sie hätte spielen können.
Wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs (1945) setzte eine neue Entwicklung ein, die es so in der zurückliegenden Zeit nicht gab, nämlich die Einwanderung nach Deutschland, die heute ein Fünftel der Einwohner des Landes ausmacht, insbesondere die islamische. Das hat Folgen für die Frage, wer oder was deutsch ist, mit der Folge, dass auch aus diesem Grunde die Frage nicht beantwortet ist.
I. DIE FRAGE NACH DER FRAGE: WER ODER WAS IST DEUTSCH?
Mit dem Geist einer großen Nation ist es jederzeit eine vielspältige Sache. Es gibt den Unterschied der Sphären: die großen Institutionen, Kirchen, Universitäten, Parteien; einzelne, welche zu den vielen sprechen und das Denken und Sein der vielen ausdrücken; einzelne, die nur zu wenigen sprechen, aber dennoch durch die Kraft ihrer eigenen Seelen so wirklich und zeitgültig sind wie die Erfolgsautoren. Es gibt den Unterschied der Generationen, welche, obgleich nebeneinander existierend, doch verschiedenen Zeiten angehören. Es gibt den Unterschied der persönlichen Meinungen, Haltungen, Charaktere (Golo Mann2).
Dies ist ein persönliches kleines Buch und im besten Falle ein Essay. Ich erschöpfe weder das Thema noch den Leser, ich will nicht belehren sondern erzählen. Ich halte es mit dem brillanten, aber in Fachkreisen nicht sehr geschätzten Egon Friedell, der jede Geschichtsschreibung für subjektiv und relativ hielt. Ich folge ihm auch darin, dass Geschichte nur auf künstlerische Weise dargestellt werden könne. Zwar soll es bei der Darstellung von Geschichte um den Versuch gehen, zu sagen wie es "wirklich war" (Ranke), während die Kunst so gut wie nie versucht hat, nur die Wirklichkeit darzustellen, sondern sie zu auch deuten. Vor allem die mit wissenschaftlichem Anspruch auftretende deutsche historische Literatur seit der Mitte des 19. Jahrhunderts erweckt in der Regel den Eindruck, sie verkünde eine Wahrheit statt einer Deutung. Bei der Deutung der Ereignisse der Geschichte stellen sich trotz des Abstands der Ereignisse dieselben Probleme ein wie bei der Deutung der Gegenwart. Vielleicht gibt es eine Wahrheit, aber niemand weiß, in wessen Besitz sie sich befindet oder wer ihr am nächsten kommt. Ich halte es mit John Locke (1632/1704):
it is evident that the extent of our knowledge comes not only short of the reality of things, but even of the extent of our own ideas.
es liegt auf der Hand, dass die Reichweite unserer Erkenntnis nicht nur hinter der Wirklichkeit der Dinge zurückbleibt sondern sogar hinter der Reichweite unserer eigenen Vorstellungen.
Die großen englischen Philosophen haben sich aber davon nicht entmutigen lassen, sondern nach Wegen gesucht, der Wahrheit, der adaequatio intellectus et rei [Übereinstimmung von Einsicht und Wirklichkeit] fortschreitend näher zu kommen. Die Historiker der Gegenwart bewegen sich weiterhin auf der ganzen Breite von marxistischer bis zu bürgerlich-konservativer Analyse und Deutung. Nur von den völkischen Deutern haben die meisten die Bühne verlassen. Für die einen ist der historische Agent die Gesellschaft, oder nicht einmal die ganze Gesellschaft sondern nur zwei Agenten, das Proletariat und die Besitzer des Kapitals (die bourgeosie). Für andere sind es immer noch die großen Persönlichkeiten, die die Geschichte bestimmen. Ich sehe die Agenten der Geschichte in den großen Persönlichkeiten als Kinder ihrer Zeit. Bismarck, Hitler oder Adenauer würden heute wahrscheinlich nicht die Bedeutung erlangen, die sie je in ihrer Zeit hatten. Auch religiöse Prägung des Autors ist wichtig. Man erkennt sie beim deutschen Historiker am einfachsten, wenn er sich mit dem Konflikt zwischen Martin Luther (protestantisch) und Kaiser Karl V. (katholisch) auseinandersetzt, versteckter, wenn er sich mit Romantik (eher protestantisch) oder Biedermeier (eher katholisch) befasst. Die wenigsten Autoren stellen sich jedoch vor. Ich bin bürgerlich, aber nicht großbürgerlich. Ich sehe mich weder links noch rechts. Ich sehe im Marxismus weder ein geeignetes Werkzeug der Analyse von Politik und Geschichte noch ein Leitbild der Politik, und ich denke weder kapitalistisch noch völkisch. Schließlich bin ich in einem rheinisch-katholischen Milieu aufgewachsen. Mein Blick ist mehr derjenige aus Köln als derjenige aus Berlin, obschon ich zurzeit in Berlin schreibe.
Die Frage, was am Deutschen so typisch sei, scheint mindestens seit 150 Jahren vorwiegend Linksintellektuelle – im Sinne von Opponenten zum vorherrschenden Zeitgeist – zu beschäftigen, im 19. Jahrhundert etwa Heinrich Heine, Richard Wagner und Friedrich Nietzsche, im 20. Jahrhundert etwa Werner Sombart, Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas oder Hermann Glaser. Aber es gab auch Intellektuelle rechts der Mitte, die vom bürgerlich-elitären Thomas Mann bis zu den völkischen Ideologen des Nationalsozialismus reichen, wie Martin Heidegger oder Arnold Gehlen. Alles, was man über das unerschöpfliche Thema lesen kann, und das ist nicht wenig, reicht von frivoler Philosophie (Friedrich Nietzsche), über ernste Wissenschaft (Werner Sombart) bis zum guten Feuilleton (Johannes Gross).
England und Frankreich sind im Vergleich zu Deutschland uralte Nationalstaaten. In der englischen Geschichte gab es nur drei große Wendepunkte. Ab 43 v. Chr. eroberten die Römer England (nicht Schottland und Wales), seit der Mitte des 5. Jh. übernahmen dort die aus dem deutschen Nordwesten und Dänemark stammenden Angelsachsen und Jüten nach und nach die Herrschaft, und 1066 folgte unter Wilhelm dem Eroberer die normannische Eroberung Englands. Danach hat keine fremde feindliche Macht mehr den Fuß auf die Insel gesetzt und die Entwicklung von außen gestört. Die direkte Geschichte Frankreichs reicht zurück bis 486, als der fränkische König Chlodwig (französisch Clovis) die noch römische Ile de France eroberte, zumindest jedoch bis zum Vertrag von Verdun (843), mit dem das von Karl dem Großen hinterlassene Reich in ein westliches, mittleres und östliches geteilt wurde. Für so alte Staaten wie England und Frankreich stellt sich die Frage der nationalen Identität nicht mehr.
Manche Autoren definierten Deutschtum so, als beruhe es auf Eigenschaften, die weit in die Vergangenheit zurückreichen und folglich weit in die Zukunft ragen. Vor wenigen Jahren ist Hermann Bausinger3jener Frage des deutschen Wesens als Volkskundler auf dem von Herder gewiesenen Wege nachgegangen und dabei wieder von dem traditionellen Gedanken einer Gesetzlichkeit ausgegangen, wonach das individuelle Dasein genau so bestimmt sei wie die überindividuelle Geschichte. Herder sei dabei abhängig von Vico (1668/1744) und Montesquieu (1689/1755), die beide in den Völkern eigentümliche Individualitäten, Entfaltungen des Allgemeingeists gesehen hätten. Wilhelm von Humboldt (1767/1835) meinte, dass die Nationen wie die Individuen durch keine Politik abzuändernde Richtungen hätten.4 Friedrich II von Preußen meinte, zunächst gelte es, den Geist der Völker, die man regieren soll, zu erfassen, damit man wisse, ob sie mild oder streng regiert werden müssen, ob sie rebellisch sind, ob sie zu Unruhen, Intrigen, zur Spottlust neigen, worin ihre Talente bestehen und zu welchen Ämtern sie sich am meisten eignen.5
Allein von der Zeit Goethes (1749/1832) und Schillers (1759/1805) bis heute hat das Deutschtum sich mehrfach gehäutet. Ich halte es mit dem sozialdemokratischen Werner Sombart (1863/1941), der 1935 fand:6
Wir finden heute noch Züge bei uns vorherrschend, die schon Tacitus als den Germanen eigentümlich hervorgehoben hat. Und insofern bleibt deutsch … durch den Wechsel der Jahrhunderte hindurch, wie etwa der furor teutonicus. Daraus zu schließen, dass hier rassenmäßig verankerte Züge vorliegen, die also dem Genotypus angehören, liegt nahe, bleibt aber natürlich unbeweisbar. Andererseits gibt es Züge am deutschen Volke, die unzweifelhaft wandelbar in der Zeit sind.
Dieser Stetigkeit und Wandelbarkeit gehe ich nach. Als Einstieg habe ich, ganz subjektiv, das Buch De l'Allemagne der Germaine de Staël (1766/1817) gewählt. Das hat drei Gründe:
(1) ihre jetzt wenig mehr als 200 Jahre alte Darstellung Deutschlands der Jahre 1803/08 verdient noch immer großes Interesse, wie man sehen wird.
(2) Das moderne nationale Gemeinschaftsgefühl der Deutschen begann seine Entwicklung in den Jahren nach der Französischen Revolution (1789), in denen sie ihre Deutschlandreisen unternommen hatte.
(3) Der Romanist Michael Nerlich schreibt zu Recht,7 dass die Deutschen ihre nationalstaatliche Identität nie unter Abstraktion von Frankreich haben denken können, und, wie ich ergänzen möchte, im Konflikt mit Frankreich: Selbstfindung der Deutschen durch Auflehnung gegen das "lange französische 19. Jahrhundert" (1789/1914).
Aus diesem Anlass wird der Leser auch immer wieder auf den folgenden Seiten Frankreich begegnen. Die Befreiungskriege gegen Napoléon (1813/15) setzten eine politische Entwicklung in Gang, zu der der deutsche Bund (1815/1866), der deutsch-französische Krieg (1870/71), die Reichsgründung (1871), und die beiden Weltkriege (1914/18, 1939/45) gehören. Auch über Napoléons Wirkung lag ein Fluch:
Das eben ist der Fluch der bösen Tat,
Dass sie, fortzeugend, immer Böses muss gebären
(Schiller, Wallenstein, Piccolomini).
Germaine de Staël, damals 38 Jahre alt, hatte 1803/05 u.a. Frankfurt am Main, Weimar und Berlin sowie 1807/08 Wien besucht. Da solche Reisen zu jener Zeit mit der Pferdekutsche durchzuführen waren, hatte sie reichlich Zeit und Gelegenheit, auch Eindrücke des bereisten Landes zu sammeln. Die Welt, die sich ihr eröffnete, löste in ihrem wachen, politisch wie literarisch höchst gebildeten Verstande teils Be-, teils Verwunderung aus:8
Cette frontière du Rhin est solennelle; on craint, en la passant, de s'entendre prononcer ce mot terrible: Vous êtes hors de la France.
Diese Rheingrenze ist feierlich; wenn man sie überquert, fürchtet man zu hören, wie man selbst dieses schreckliche Wort ausspricht: Manist nicht mehr in Frankreich.
Für die Reisen hatte sie sich eigens die deutsche Sprache angeeignet, obschon in den Schichten, in denen sie in Deutschland verkehrte, allgemein gutes Französisch gesprochen wurde. Über ihre Erkenntnisse veröffentlichte sie ein Werk in drei Bänden: De l'Allemagne. Zum Einen enthält es eine Fülle von Beobachtungen über Deutschland und die Deutschen, die seinerzeit berechtigt waren und zu der Frage einladen, was immer noch so ist wie damals vor 200 Jahren, und was sich geändert hat. Zum Anderen verfasste sie ihr Werk zu einer Zeit, in der in Deutschland noch kein Nationalstaat existierte, aber durch die Ideen der Französischen Revolution und Napoléon umstürzende Veränderungen stattfanden, die 1871 den deutschen Nationalstaat hervorbrachten. Das Gebiet des dem Untergang geweihten Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation befand sich im Übergang von einer Staatenwelt mit 1789 selbständigen Herrschaften (bis 1803) zu einem deutschen Bund mit nur noch 38 souveränen Staaten (1815/66) und zur Entfaltung eines neuen deutschen Nationalbewusstseins durch das Wirken von Dichtern und Denkern. Germaine de Staël war in den turbulenten 12 Jahren zwischen 1803/15 in Deutschland. Was 12 Jahre verändern können, zeigte die nächste Periode von 12 Jahren – 1933/45 – in der kein Stein auf dem anderen blieb. Im letzten dieser 12 Jahre begann die vorerst letzte Häutung des Deutschtums. Ihr wichtigster Agent war – nach den Besatzungsmächten (1945/49) – Bundeskanzler Konrad Adenauer (1876/1967), dem es in seiner Regierungszeit (1949/63) gelang, aus einem bis dato weithin als mitteleuropäisch angesehenen Teil Deutschlands einen westeuropäischen Staat zu machen.
Dem Patrioten ist es sehr geläufig, den Namen seines Volkes mit unbedingter Verehrung anzuführen; je mächtiger ein Volk ist, desto weniger scheint es jedoch darauf zu geben, seinen Namen mit dieser Ehrfurcht sich selbst zu nennen.
So schrieb Richard Wagner in seinen Notizen zur Frage Was ist deutsch? aus dem Jahre 1865, also sechs Jahre vor der Gründung des Deutschen Reichs, die er aber erst 1878 im ersten Jahrgang der „Bayreuther Blätter“ veröffentlicht hat; und er fährt fort:
Es kommt im öffentlichen Leben Englands und Frankreichs bei Weitem seltener vor, dass man von ,englischen’ und ,französischen Tugenden’ spreche; wogegen die Deutschen sich fortwährend auf ,deutsche Tiefe’, ,deutschen Ernst’, ,deutsche Treue’ u. dergl. m. zu berufen pflegen. Leider ist es in sehr vielen Fällen offenbar geworden, dass diese Berufung nicht vollständig begründet war.9
Kurz vor der Reichsgründung von 1871 hatte sich der liberale Publizist und Politiker Julius Fröbel über den inflationären Gebrauch der Identifikationsvokabel „deutsch“ mokiert:10
Welches Volk hat wie das deutsche das Beiwort immer im Munde, welches seinen eigenen Charakter bezeichnet? ,Deutsche Kraft’, ,deutsche Treue’, ,deutsche Liebe’, ,deutscher Ernst’, ,deutscher Gesang’, ,deutscher Wein’, ,deutsche Tiefe’, ,deutsche Gründlichkeit’, ,deutscher Fleiß’, ,deutsche Frauen’, ,deutsche Jungfrauen’, ,deutsche Männer’ – welches Volk braucht solche Bezeichnungen außer das deutsche? … Der Deutsche verlangt von sich ganz extra, dass er deutsch sein soll, als ob ihm freistünde, aus der Haut zu fahren ... Der deutsche Geist steht gewissermaßen immer vor dem Spiegel und betrachtet sich selbst, und hat er sich hundertmal besehen und von seinen Vollkommenheiten überzeugt, so treibt ihn ein geheimer Zweifel, in welchem das innerste Geheimnis der Eitelkeit beruht, abermals davor. – Was ist dies alles anders als die Selbstquälerei eines Hypochonders, dem es an Bewegung fehlt, und dem nur durch Bewegung zu helfen ist?
Im Frühjahr 1873 meinte Nietzsche:11
Ich habe schon jetzt kaum den Mut, irgend eine Eigenschaft als eine speziell deutsche zu reklamieren … In dieser Not halte ich mich an die deutsche Sprache, die wahrhaftig bis jetzt allein sich durchgerettet hat, durch all die Mischung von Nationalitäten und Wechsel der Zeiten und Sitten, und meine, dass ein metaphysischer Zauber, Einheiten aus Vielheiten, Einartiges aus Vielartigem zu gebären, in der Sprache liegen müsse.
15 Jahre nach der Reichsgründung fand Nietzsche:12
Die deutsche Seele ist vor allem vielfach, verschiedenen Ursprungs, mehr zusammen- und übereinandergesetzt als wirklich gebaut: das liegt an ihrer Herkunft. Ein Deutscher, der sich erdreisten wollte, zu behaupten "zwei Seelen wohnen, ach!, in meiner Brust", würde sich an der Wahrheit arg vergreifen, richtiger, hinter der Wahrheit um viele Seelen zurückbleiben. Als ein Volk der ungeheuerlichsten Mischung und Zusammenführung von Rassen, vielleicht sogar mit einem Übergewicht des vor-arischen Elements, als "Volk der Mitte" in jedem Verstande, sind die Deutschen unfassbarer, umfänglicher, widerspruchsvoller, unbekannter, unberechenbarer, überraschender, selbst erschrecklicher, als andere Völker sich selber sind – sie entschlüpfen der Definition und sind damit schon die Verzweiflung der Franzosen. Es kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage "was ist deutsch" niemals ausstirbt.
Natürlich ging die Suche nach dem, was Deutschsein ausmache, nach dem Zusammenbruch von 1945 weiter. Das Bild, das Germaine de Staël von den Deutschen gezeichnet hatte und das Deutschland durch Hitler sich selbst und der Welt geboten hatte, konnten gegensätzlicher nicht sein. Dolf Sternberger schrieb 1949 nach der Gründung der Bundesrepublik:13
Wir wissen nicht wer wir sind. Das ist die deutsche Frage. Es gibt nahezu nichts, kein Ziel, keine Form des gemeinsamen Lebens, die hier mit ganzem Herzen ergriffen und ausgebildet werden könnte. Auf jeder möglichen Gestalt deutschen Daseins liegt ein Schatten.
Das war nicht nur für 1949 typische Ratlosigkeit, sondern auch noch für ein bis zwei Generationen danach. Auch Theodor Ludwig Wiesengrund, genannt Theodor W. Adorno14, war ratlos. Er antwortete auf die Frage, was deutsch sei, vermöge er zumindest nicht unmittelbar zu antworten, zuvor sei über die Frage selbst zu reflektieren. Ungewiss sei, ob es etwas wie den Deutschen, oder das Deutsche, oder irgend ein Ähnliches in anderen Nationen, überhaupt gebe. Es sei darum vielleicht besser, wenn er die Frage nach dem, was deutsch sei, ein wenig reduziere und bescheidener fasse: was ihn bewogen habe, als [jüdischer] Emigrant, als mit Schimpf und Schande Vertriebener, und nach dem, was von Deutschen an Millionen Unschuldiger verübt worden sei, doch aus Amerika nach Deutschland zurück zu kommen. Adorno wollte einfach wieder dorthin, wo er seine Kindheit verbracht hatte, wodurch sein Spezifisches bis ins Innerste vermittelt gewesen sei. Neben Heimweh habe sich auch Objektives geltend gemacht, nämlich die Sprache mit ihrer besonderen Wahlverwandtschaft zur Philosophie, und zwar zu deren spekulativem Element. Er schließt mit den Worten:
In der Treue zur Idee, dass, wie es ist, nicht das letzte sein solle – nicht in hoffnungslosen Versuchen, festzustellen, was das Deutsche nun einmal sei, ist der Sinn zu vermuten, den dieser Begriff noch behaupten mag: im Übergang zur Menschheit.
Im Übergang zur Menschheit? Auf die Frage komme ich im Nachwort zurück. Deutschtum also auf dem Wege dahin, aber noch nicht dort angekommen?
II. GRUNDLAGEN
A.Deutsche Sprache
Die deutsche Sprache stammt ab von den untereinander verwandten aber doch verschiedenen Sprachen der deutschen Stämme, die die Römer Germanen nannten, und deren gebildete Vertreter sich untereinander eher in lateinischer Sprache als in ihren jeweiligen Stammessprachen verständigen konnten. Die Sachsen [heute Niedersachsen und Westfalen] und Friesen im Norden konnten sich in ihren Stammessprachen eher mit den Bewohnern Englands als mit den Franken, Baiern und Alemannen in ihren gebirgigen Siedlungsgebieten verständigen. Da es für diese Sprachen zum einen keine Schrift gab, außer der Runenschrift, die aber keine Gnade fand, zum anderen durch die katholische Kirche und vor allem die katholischen Mönche aber die lateinische Schrift wie selbstverständlich verwendet wurde, machten sich die Mönche daran, die germanischen Laute mit den lateinischen Buchstaben wiederzugeben. Das war indessen schwierig.15 Zu den lateinischen Buchstaben x, c und v gab es keine germanischen Laute. Für den Laut w wurde nicht das lateinische v genommen, sondern es wurden zwei u nebeneinander gestellt: uu, woraus später das w wurde. Das führte dazu, dass der Laut wu zu uuu wurde. Auch für Laute wie sch oder ch hatte die lateinische Sprache keine Buchstaben. Umlaute gab es im Lateinischen nur scheinbar, etwa in Worten wie Caesar, poena (Strafe) oder puer (Knabe). In Rom wurde Caesar wie Ka-eh-sar ausgesprochen, sodass daraus der Kaiser wurde, in Byzanz dagegen Za-eh-sar, sodass daraus der Zar wurde; poena wurde po-eh-na gesprochen, puer wie puh-er. Nun kommt das Aber. Das ae, wie in caelum (Himmel) und oe, wie in poena lieferten die Vorlage für die Schreibweise der Umlaute. Vielleicht ist dem Leser aufgefallen, dass im Telefonbuch oder in Wörterbüchern "Franz Schüler"" vor "Franz Schuler" oder "schön" vor "schon" steht. Hier ist der Grund: die Mönche schrieben die Umlaute zunächst ae, oe und ue. Später setzten sie das e in verkleinerter Form auf das a, o und u. Und schließlich wurde aus dem kleinen hochgestellten e ein Trema: ä, ö und ü.
1. Das Wort deutsch
Das Adjektiv deutsch geht auf das germanische Substantiv thiot (Volk) zurück. Das Reich der Franken hatte sich um 600 über das heutige Frankreich (ohne Bretagne, Aquitanien und Septimanien16), den Westen des heutigen Deutschland (beiderseits des Rheins, Hessen, Thüringen, Bayern), die heutige Schweiz und Tirol erstreckt. Die Bedeutung der Romanen im heutigen Frankreich war im 7. Jahrhundert gewachsen. Die herrschenden Merowinger (5. Jh./751) und dann Karolinger (ab 751) hatten die überlegene Kultur des römisch geprägten Landes zusammen mit der lateinisch geprägten Sprache und dem katholischen Ritus für sich übernommen. Dies hatte eine stärkere Betonung der Eigenart der fränkisch-germanischen Bevölkerung im östlichen Frankenreich zur Folge, die linksrheinisch bereits katholisch und rechtsrheinisch noch zu bekehren war. oder wurde im fränkischen Osten nun als dem eigenen Stamm zugehörig verstanden im Unterschied zu , woraus sich das Wort "welsch" für Franzosen und Italiener entwickelte. Die Welsch-Schweizer sind heute die Schweizer französischer Sprache. Unter Karl dem Großen wurde 768 das Wort belegt. Die war die fränkische Volkssprache im Unterschied zur , der in Frankreich gesprochenen Volkssprache lateinischer Herkunft. Mit dem Zerfall des Fränkischen Reiches nach dem Tode Karls prägte sich der Unterschied zwischen der und der stärker aus. Im ostfränkischen Raum wurde aus , was zur Sammelbezeichnung der Stammessprachen im ostfränkischen Reich wurde. Schon die Straßburger Eide (842) der Enkel Karls des Großen (Ludwig der Deutsche, Karl der Kahle) hatten die Trennung der deutschen und der romanischen Sprache beurkundet. Aus wurde später das Wort "deutsch". Die Träger dieser Sprache sollen erstmals im Annolied, einem frühmittelhochdeutschen Gedicht, im Jahr 1180, als Deutsche bezeichnet worden sein. Im Sachsenspiegel von 1369, einem Rechtsbuch des deutschen Mittelalters, heißt es "" [jedes deutsche Land hat seinen Pfalzgrafen: Sachsen, Baiern, Franken und Schwaben]. Die Ersetzung des "i" durch das "y" im Namen der Bayern fand im 19. Jahrhundert statt. Auf eine Merkwürdigkeit weist Göttert hin:
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!