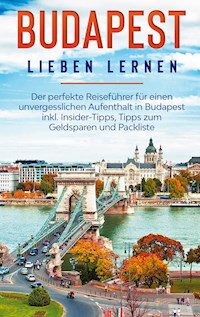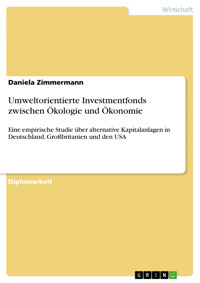Wer sind wir? Ein philosophisches Lesebuch. Die abendländische Philosophie von Aristoteles bis Wittgenstein E-Book
Daniela Zimmermann
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer eintauchen möchte in den Kosmos der abendländischen Philosophie, steht vor den immer gleichen Fragen: Was soll ich lesen? Welche Autoren und Werke sind wichtig? Dieses Lesebuch präsentiert die einflussreichsten Denker und ihre bedeutendsten Texte in einer Auswahl, die ein getreues Bild von der Kraft des menschlichen Geistes zeichnet: von den Vorsokratikern über die Denker des Mittelalters bis hin zu den philosophischen Theorien des 20. Jahrhunderts. Ein einleitender Überblick und ausführliche Porträts zu allen 30 Philosophen schaffen zusätzlich Orientierung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1225
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Wer sind wir?
Ein philosophischesLesebuch
Die abendländische Philosophie vonAristoteles bis Wittgenstein
Herausgegeben vonDaniela Zimmermann
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthälttechnische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernungdieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung,Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung,insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- undzivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmenwir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen,sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind
im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2022 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen
der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: Antonio Canova, »The muse Urania and Thales«
© Iberfoto / Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bad Honnef
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-29758-9V001
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Einleitung
I. Die Anfänge der abendländischen Philosophie
Parmenides – Die Wahrheit des Seins
Das Lehrgedicht
Heraklit – Alles fließt
Fragmente
II. Die klassische Philosophie Athens
Platon – Erkenntnis als Dialog
Phaidon
›Das Höhlengleichnis‹
Aristoteles – Umfassendes Denken: Gott, Seele, Natur
Metaphysik
Über die Seele
III. Philosophie im Zeitalter des Hellenismus
Epikur – Die Lust im Garten des Lebens
Brief an Herodot
Brief an Menoikeus
Seneca – Wissen, worauf es ankommt
Moralische Briefe an Lucilius
Plotin – Gesuchtes Zentrum: Das Eine
Die Enneaden
Boethius – Irdisches Glück ist nicht das höchste Gut
Trost der Philosophie
IV. Die Philosophie des Mittelalters
Augustinus– Schau ins Innere
Die Bekenntnisse
Averroes– Im Einklang von Glauben und Wissen
Harmonie der Religion und Philosophie
Thomas von Aquin – Über die Sinne hinaus zu Gott
Die katholische Wahrheit oderdie theologische Summa
V. Die Philosophie der Neuzeit
Francesco Petrarca – Der Mensch ist das Maß
Von seiner und vieler Leute Unwissenheit
Die Besteigung des Mont Ventoux
Niccolò Machiavelli – Die Philosophie der politischen Macht
Der Fürst
Michel Montaigne – Die Wahrheit des Essays
Philosophieren heißt sterben lernen
Über die Freundschaft
Über den Ruhm
Francis Bacon– »Wissen ist Macht«
Neues Organon
Essays
René Descartes – Die Gewißheit des Denkens
Prinzipien der Philosophie
Gottfried Wilhelm Leibniz – Die beste aller möglichen Welten
Die Monadologie
Thomas Hobbes – Das Recht der Natur und der Staat
Der Leviathan
David Hume – Erkenntnis aus der Erfahrung
Eine Untersuchung überden menschlichen Verstand
Jean-Jacques Rousseau – Der Mensch ist frei geboren
Der Gesellschaftsvertrag
Bekenntnisse
Immanuel Kant – Die gewagten Abenteuer der Vernunft
Kritik der reinen Vernunft
Georg Wilhelm Friedrich Hegel – »Der Weg des Geistes ist der Umweg«
Phänomenologie des Geistes
VI. Umbruch der Systeme
Karl Marx – Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen
Das kommunistische Manifest
Arthur Schopenhauer – Alles Leben ist Leid
Die Welt als Wille und Vorstellung
Sören Kierkegaard – Existenz aus Leidenschaft
Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift
Friedrich Nietzsche – Die Umwertung aller Werte
Über Wahrheit und Lüge imaußermoralischen Sinn
Menschliches, Allzumenschliches
Also sprach Zarathustra
VII. Philosophie der Gegenwart
Ludwig Wittgenstein – The linguistic turn (Die Wendung zur Sprache)
Philosophische Untersuchungen
Ein Brief-Fragment
Hannah Arendt – Philosophie und Politik im Licht der Menschlichkeit
Der Bürgerkrieg zwischen Denkenund gemeinem Verstand
Wo sind wir, wenn wir denken ?
Michel Foucault – Was ist Wissen ?
Was ist ein Philosoph ?
Die Sprache der Abwesenheit
Die Ordnung der Dinge
Thomas Nagel – »Das letzte Wort«
Der Tod
Der Sinn des Lebens
Anhang
Quellenverzeichnis
Bibliographie allgemeiner Werke zur Geschichte der Philosophie
Einleitung
»Denn dies ist in erster Linie die Leidenschaft des Philosophen, sich zu wundern. Es gibt keinen anderen Anfang und Grundsatz der Philosophie als diesen.«
Mit diesen wenigen Worten hat Platon in seinem Dialog Theaitetos seinen Lehrer Sokrates definieren lassen, was einen Philosophen ausmacht: Er ist jemand, der noch Staunen kann.
Jeder große Philosoph zeichnet sich dadurch aus, daß er seine eigene Sicht auf die Welt hat und an ihr etwas Unvermutetes, noch nie Gesehenes entdeckt.
Dieses Lesebuch stellt 30 Philosophen vor, die einen ganz neuen Aspekt in die Geschichte des abendländischen Denkens gebracht und deren Verlauf entscheidend beeinflußt haben.
Es richtet sich an einen interessierten Leserkreis, der einen Zugang zur Philosophie finden möchte. Dazu gehört nicht nur, jeden Philosophen durch eine kurze Beschreibung seines Lebens, seines Werks und seiner Stellung innerhalb der Philosophiegeschichte einzuführen, sondern vor allem, ihn selbst zu Wort kommen zu lassen.
Die Texte, die für diese Sammlung ausgewählt wurden, repräsentieren Denken und Werk des jeweiligen Philosophen und nehmen eine Schlüsselstellung in der Philosophiegeschichte ein. Sie sollen eine persönliche Begegnung zwischen ihm und dem Leser herstellen und zeigen, daß vieles, was die Philosophen in der Vergangenheit zu sagen hatten, nicht nur für die Geisteswissenschaft, sondern auch für unser heutiges Leben von Bedeutung ist.
Die hierfür ausgesuchten Beispiele sollen den Leser durch die reiche philosophische Landschaft des Abendlandes führen. Ziel ist, nicht nur die einzelnen Philosophen vorzustellen, sondern auch Verbindungen zwischen den Denkern und deren Ideen sichtbar zu machen. Denn kein Philosoph steht in seinem Denken für sich allein, sondern er ist Teil einer Entwicklung, in der er Bezug auf Vorausgegangenes nimmt und gleichzeitig nach vorne weist.
Es besteht ein ständiger Dialog zwischen dem Neugedachten und dem Vorhergedachten, oft auch zwischen den philosophischen Persönlichkeiten selbst. Es entstehen Sympathien und Antipathien, man beobachtet das Weiterentwickeln von Ideen, aber auch deren Ablehnung. So war Platon z. B. ein bewundernder Schüler von Sokrates und hat dessen Philosophie in die seine aufgenommen. Aristoteles wiederum studierte bei Platon, lehnte aber zentrale Aspekte seiner Lehre ab. Seine Philosophie wurde im Mittelalter für viele christliche Philosophen wichtig. Die Denker der beginnenden Neuzeit hingegen versuchten, sich ganz von seinem Einfluß zu befreien, und entdeckten andere antike Schriftsteller und Philosophen für sich. Für Petrarca symbolisierten die Schriften des Augustinus den Anbruch eines neuen Zeitalters, Augustinus selbst hatte sein Denken auch an Cicero und Plotin geschult. Im 19. Jahrhundert berief sich Marx auf Hegel, während sich Hegel in seinen zentralen Gedanken an den Vorsokratiker Heraklit anlehnte. Diesen hatte auch Nietzsche neben der klassischen Antike für sein Werk fruchtbar gemacht und neu interpretiert. Letzterer war stark von Schopenhauer beeinflußt, der wiederum Wesentliches von Kant übernahm, aber Hegel verachtete. Kant las Hume, dieser war mit Rousseau befreundet. In unserer Gegenwart wurde Nietzsche für Foucault zur Offenbarung. Und so weiter und so fort.
Die Geschichte der Philosophie ist auch eine Geschichte der Vernetzungen und Verflechtungen und gleicht einem sich bis heute unaufhaltsam weiterspinnenden Gewebe von Gedanken und Ideen. Dennoch treten einzelne Philosophen mit ihrem Denken hervor, weil sie in eine neue Richtung weisen. Mit einigen von ihnen beginnt sogar eine neue Epoche, weil ihre Philosophie Ausdruck tiefgreifender geschichtlicher und gesellschaftlicher Wandlungen ist. Ihnen ist es gelungen, diesen Veränderungen durch ihr Denken Gestalt zu geben und mit ihrer Sprache das in Worte zu fassen, was bisher noch nicht formuliert werden konnte.
Oft stellen die Schriften großer Philosophen auch im literarischen Sinne Kunstwerke dar, die dem Neuen, das aus ihnen spricht, eine besondere Sprache und Form geben. Deswegen ist es lohnend, die Werke der Philosophen selbst zu lesen und es nicht allein bei Einführungen oder Zusammenfassungen zu belassen.
Dieses Buch nimmt eine Einteilung der Philosophiegeschichte in sieben Epochen vor. Innerhalb dieser wurden die Philosophen so ausgewählt, daß sie ein breites Spektrum an Fragestellungen und Aspekten repräsentieren. Trotz der Verschiedenartigkeit der philosophischen Perspektiven kann ein roter Faden, eine übergeordnete Tendenz innerhalb der einzelnen Epochen verfolgt werden.
Die Anfänge der abendländischen Philosophie, für die beispielhaft Parmenides und Heraklit ausgewählt wurden, sind dadurch charakterisiert, daß die sogenannten Vorsokratiker die Frage nach dem Sein zum ersten Mal mit dem Blick auf ein Ganzes stellen. Obwohl ihre Denkweisen sehr unterschiedlich sind, formulierten sie ein Grundthema, das wesentlich für die gesamte westliche Philosophiegeschichte geworden ist.
Die klassische Philosophie Athens, die ihre Höhepunkte in Platon und Aristoteles findet, zeichnet sich dadurch aus, daß aus ihr erstmals große philosophische Systeme hervorgehen. Beide Denker hinterließen umfangreiche Werke, die zu den gedanklichen Säulen des Gebäudes der westlichen Philosophie wurden. Sie schufen die Begrifflichkeiten, mit denen die Philosophie seither operiert. Im Zentrum stehen die elementaren Fragen nach der Wahrheit und dem menschlichen Wissen.
Die Philosophie im Zeitalter des Hellenismus beschäftigt sich tendenziell mit den konkreten Fragen der Lebensführung. Nun rückt der Einzelne in das Blickfeld philosophischer Betrachtungen. Die diese Epoche repräsentierenden Denker Epikur, Seneca, Plotin und Boethius beantworten sie in unterschiedlicher Weise. Für Epikur ist es die sinnliche Lust, die ein erfüllendes Leben verspricht, Seneca verweist auf die Tugenden der Moral und der Pflichterfüllung, Plotin sucht das Heil in der Hinwendung zum Geistigen, und Boethius findet es in der Philosophie selbst.
Die Philosophie des Mittelalters ist durchweg von der Thematik des Glaubens geprägt. Der erste große Denker des Christentums, Augustinus, sucht auf ergreifende Weise in seinem tiefsten Inneren danach. Averroes, der bedeutende islamische Denker, will den Glauben mit der Philosophie in Einklang bringen. Und Thomas von Aquin errichtet dem Glauben auf dem Höhepunkt des christlichen Mittelalters eine großartige und kunstvolle Denkkathedrale.
Die Philosophie der Neuzeit stellt den umfassendsten Abschnitt dieses Buches dar. Er vereint so unterschiedliche Denker wie Petrarca, Machiavelli, Montaigne, Bacon, Descartes, Leibniz, Hobbes, Hume, Rousseau, Kant und Hegel. Einige dieser Philosophen stehen mit ihrem Denken an der Grenze zur Literatur (Petrarca, Montaigne), andere richten es auf die Politik (Machiavelli, Hobbes), wieder andere verbinden es mit der strengen Wissenschaft (Descartes, Leibniz) oder leiten es aus der Erfahrung ab (Bacon, Hume), mancher macht es für die Verbesserung der Gesellschaft fruchtbar (Rousseau) oder verfolgt die Entwicklung des Denkens in der Geschichte (Hegel). Die Philosophie der Neuzeit ist breit gefächert. Und doch zeichnet sie sich durch ein besonderes, alle philosophischen Facetten vereinigendes Charakteristikum aus: Im Zentrum des Interesses steht das selbstbestimmte Individuum. Daraus ergibt sich auch die maßgebliche Fragestellung der neuzeitlichen Philosophie: der nach den Möglichkeiten und Grenzen menschlicher Erkenntnis. Hier läuft alles im Denken Kants zusammen, er hat in bezug auf diese Frage das vorläufige Schlußwort gesprochen.
Ein fundamentaler Umbruch der Systeme setzt in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein. Tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen und das endgültige Verschwinden des großen Schutzmantels der Religion führte auch die Philosophie dazu, ehemals vertretene Werte radikal über Bord zu werfen. Das Denken wendete sich der menschlichen Existenz zu, die nun ohne metaphysische Hilfskonstruktionen auskommen mußte. Marx wehrte sich und rief zum Kampf für eine neue Gesellschaft auf, Kierkegaard analysierte das existentielle Grundempfinden des modernen Menschen, Schopenhauer vertrat einen tiefen Pessimismus gegenüber dem gesamten Menschengeschlecht, und Nietzsche brachte auf den Punkt, was als große Leerstelle bis heute klafft: der Tod Gottes.
Einzig Die Philosophie der Gegenwart muß ohne roten Faden auskommen. Sie strebt in verschiedene Richtungen. Für dieses Buch wurden beispielhaft vier Philosophen herausgegriffen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch wichtige Strömungen der Gegenwartsphilosophie vertreten. Wittgenstein wendet sich der Sprache als einzig möglichem philosophischen Thema zu; Arendt entwickelt philosophisch-politische Prämissen angesichts einer neuen Herausforderung des 20. Jahrhunderts, der des Entstehens von totalitärer Herrschaft; Foucault sucht nach unsichtbaren Strukturen in der Gesellschaft, die unser Wissen und unsere Vernunft bestimmen, und Nagel geht vor dem Hintergrund der naturwissenschaftlichen Entwicklungen unserer Zeit den alten philosophischen Fragen nach dem menschlichen Bewußtsein, dem Sinn des Lebens und dem Tod nach.
›Philosophie‹ heißt in der ursprünglichen, griechischen Wortbedeutung nichts anderes als ›Liebe zur Weisheit‹. Liebe strebt in ihrem wahren Wesen bekanntlich nicht nach Nutzen und Gewinn. Sie besteht nur um ihrer selbst willen. Ähnlich verhält es sich mit dem Denken an sich. Es ist, wie das Staunen als dem Beginn der Philosophie, ein unvoreingenommener und freier Akt. Dieses freie Denken muß jeder Philosophie vorausgehen.
Martin Heidegger beschrieb diesen Prozeß mit folgenden Worten:
Das Denken führt zu keinem Wissen wie die Wissenschaften
Das Denken bringt keine nutzbare Lebensweisheit
Das Denken löst keine Welträtsel
Das Denken verleiht keine unmittelbaren Kräfte zum Handeln
Das Zitat stammt aus dem Aufsatz Was heißt Denken ?, den wir aufgrund von Restriktionen der Erben dieses Philosophen leider nicht abdrucken konnten, aber in seiner wesentlichen Aussage dieser Textsammlung voranstellen wollen.
Die Geschichte der Philosophie ist eine Geschichte der sich wandelnden Sichtweisen auf die Welt. Sie wird sich ändern und immer wieder neue Richtungen einschlagen, solange es Menschen gibt. Die Grundfragen aber werden bleiben. Die Philosophie stellt sie uns immer wieder neu.
I. Die Anfänge der abendländischen Philosophie
Parmenides
(um 540 v. Chr. – um 450 v. Chr.)
Die Wahrheit des Seins
Die Anfänge der westlichen Philosophie werden oft als ›dunkel‹ bezeichnet. Damit meint man nicht nur die Ferne der Zeit, sondern auch die ersten Philosophen und ihr Denken selbst. Diese Philosophen werden üblicherweise ›Vorsokratiker‹ genannt, weil sie in der Zeit vor Sokrates (469 bis 399 v. Chr.) lebten. Man weiß nicht viel von ihrem Leben, und keines ihrer Werke ist vollständig erhalten geblieben. Ihre Gedankenwelten scheinen mysteriös und fremd.
Man mußte die Spuren ihres Denkens entweder in den Schriften späterer Schriftsteller suchen oder hat nur Fragmente ihrer Texte aufgefunden. Selbst diese sind oft Zitate aus zweiter Hand, von nachfolgenden Philosophen aus dem Gedächtnis aufgezeichnet oder aus anderen Quellen übertragen.
Trotzdem sind diese frühen Philosophen von immenser Wichtigkeit für die abendländische Kulturgeschichte. Sie sind die ersten Repräsentanten eines ganz neuen Denktypus: dem des philosophisch-wissenschaftlich reflektierenden Individuums.
Die ersten Philosophen waren gleichzeitig Wissenschaftler, ›Naturdenker‹, sie fragten nach der Beschaffenheit der Erde und des Universums und leiteten sowohl aus ihren konkreten Beobachtungen, aber auch aus ihren mathematischen und astronomischen Kenntnissen Prinzipien über die Welt und das Dasein ab.
Sie untersuchten die Elemente Wasser und Luft als möglichen Urgrund des Lebens, sie berechneten die Wirkung von Kräften und stellten zum ersten Mal die Frage nach den Ursachen allen Seins. Damit eröffneten sie einen für das abendländische Denken neuen Raum: den der Erkenntnis, die über die Materie hinausgeht und zu Prinzipien gelangt, die von allgemeiner Bedeutung sind. Mit den ersten Philosophen beginnt eine neue Sichtweise auf die Welt, und zwar mit der Frage nach dem, was hinter – meta – allem Physischen liegt: die Metaphysik.
Obwohl der Begriff der Metaphysik erst mehrere hundert Jahre später in Zusammenhang mit dem Denken des Aristoteles gebraucht wird, ist er dennoch schon auf wesentliche Denkstrukturen zu Beginn der Philosophie anwendbar. Abendländische Philosophie ist für zwei Jahrtausende, bis fast in das 19. Jahrhundert hinein, in ihrem Wesen Metaphysik, die Lehre von dem, was hinter oder jenseits der Dinge liegt.
Der erste Metaphysiker ist wohl Parmenides. Er war einer der bedeutendsten der vorsokratischen Denker. Viel ist nicht von seinem Leben überliefert, doch galt er bereits im Altertum als wichtiger Philosoph und war als Begründer der sogenannten ›Eleatischen Schule‹ bekannt.
Geboren wurde er in Unteritalien, in der Stadt Elea, einer Kolonie phokaischer Griechen. Man sagt, daß auch heute noch die dort lebenden Menschen Parmenides besonders leicht verstehen und ihn gerne zitieren. Er soll in sehr hohem Alter in seiner Vaterstadt gestorben sein. Man weiß, daß er aus vornehmem Elternhaus kam, doch weitere Informationen über seinen Lebenswandel sind spärlich. Eine antike Quelle berichtet, er sei mit einem sehr armen, aber vortrefflichen Mann befreundet gewesen sein. Parmenides war auch als Gesetzgeber oder Politiker tätig. Es ist überliefert, daß seine Gesetze auch nach seinem Tod noch alljährlich beschworen wurden, was darauf schließen läßt, daß er in Elea sehr angesehen war.
Wahrscheinlich hat er einmal Athen besucht. Platon erzählt, Parmenides sei dort ungefähr im Alter von 65 Jahren und in Begleitung Zenons, einem Schüler, Freund und ebenfalls wichtigen vorsokratischen Philosophen, eingetroffen und habe mit dem jungen Sokrates diskutiert. Platon nannte ihn den »Großen« und einen Denker von einer »ganz und gar ursprünglichen Tiefe«.
Parmenides ist einer der wenigen Vorsokratiker, von dem wir tatsächlich noch Selbstverfaßtes lesen können. Längere Passagen seines sogenannten Lehrgedichtes sind erhalten.
Dieser Text zählt zu dem Bedeutsamsten, was von den frühen Philosophen verfaßt wurde. Zum ersten Mal wurde hier der für die abendländische Philosophie wesentliche Denkhorizont eröffnet: das Sein und das Nichts.
Anscheinend hat Parmenides klar erkannt, daß seine Lehre den Durchbruch in neue Regionen des Denkens bedeutete. Dieses Ereignis schildert er in poetischer Form und auf bildhafte und mitreißende Weise. Es wird zwar deutlich, daß der Verfasser kein Dichter war und seine Sprache etwas Ungelenkes und Schweres hat, doch ist zu erkennen, daß er die Gesamtheit dieses so mühsam zu fassenden Gegenstandes wirklich vor Augen gehabt hat. Das gibt dem Text die ungewöhnliche Charakteristik des Ringens und des Begreifen-Wollens eines Themas, welches so vorher noch nie in Worte gefaßt wurde.
Parmenides läßt sein Lehrgedicht mit der folgenden Szene beginnen:
Auf einer rasanten Fahrt mit einem Pferdegespann wird der ›wissende Mann‹ (der Philosoph) mit glühenden Rädern von Stadt zu Stadt zu einem Tor hin getragen. Die Fahrt führt aus dem Dunkel der Nacht in taghelles Licht. Der Symbolgehalt der Szene wird sofort deutlich: Nacht steht für Nichtwissen und Licht für Wissen. Am Tor angekommen, trifft er auf Dike, die Göttin der Gerechtigkeit. Sie schiebt den schweren Riegel beiseite und läßt den Philosophen aus der Sphäre des Dunkels, aus der er kommt, in das Reich des Lichtes eintreten; er geht über eine Schwelle, er steigt hinüber in eine andere, höhere Welt, die er nach einem langen Weg erreicht hat. Nicht nur das Bild des Weges, das für die Philosophie immer wieder von Bedeutung ist, wird bereits aufgezeigt, sondern auch ein weiterer Vorgang: Das Hinübersteigen zu einem Ort, der nicht der sinnlichen Erfahrungswelt zugehört, sondern allein dem Denken. Erst viel später wird ein philosophischer Begriff für diesen Akt gefunden: Transzendenz (abgeleitet von dem lateinischen Wort trans-cendere, hinübergehen).
Es ist, als ob mit dieser grandiosen Eröffnungsszene die Philosophie die Weltbühne betreten habe und Parmenides sich des Eintrittsmomentes in einen neuen Abschnitt der menschlichen Denkgeschichte bewußt gewesen sei.
Das Lehrgedicht ist, wie die mythischen Dichtungen Homers, in Hexametern verfaßt, dem klassischen Sechser-Versmaß der antiken Poesie. Die dargestellte Feierlichkeit läßt den Text wie eine göttliche Offenbarung wirken.
Trotz des mythologischen Charakters, der den dramatischen Effekt des Inhalts betont, verfolgt Parmenides eine rein logische Argumentationslinie. Diese führt aus der Wandelbarkeit der sinnlichen Wahrnehmungsweise zu einer Erkenntnis von Welt, die sich rein dem Denken erschließt.
Für Parmenides ist Denken und Sein eines. Dieser Gedanke stellt das Zentrum seiner Lehre dar. Hieraus ergibt sich auch die zweite, wesentliche Aussage des Lehrgedichtes: Nichts kann nicht sein, weil es sich nicht denken läßt. Denken schließt Nichts aus, denn Denken hat immer einen Gegenstand – das, was ist.
Parmenides geht nicht von verschiedenem, einzelnem Seienden aus, sondern er entdeckt eine Allgemeinheit von Sein, der er eine Sprache verleihen will.
Er fragt sich, was geschieht, wenn wir denken, aber auch, wenn wir sprechen und sagen: es ist. Nicht nur das Denken, sondern auch die Sprache selbst, wird von Parmenides in seine Überlegungen einbezogen. Die Erkenntnis, daß es einen Zusammenhang von Denken, Sprechen und Sein gibt, ist ein ganz neuer Gedanke und von großer Bedeutsamkeit für die Geschichte des Denkens.
Parmenides entdeckt ein Denken, das von selbst, ohne das Mittel der Sinne zum Sein vorstoßen kann, und er erkennt, daß es die Sprache ist, die diesen Vorgang vollzieht.
Mit der Vorstellung, daß sich die Wahrheit des Seins allein aus der denkenden Erkenntnis erschließt, legt Parmenides den Ausgangspunkt des Weges, den die abendländische Philosophie im Wesentlichen beschreiten wird: den des Logos – der vernünftigen Rede –, der aus den Niederungen, Wandelbarkeiten und Trugbildern des Sinnenscheins nach oben führt zum Licht des unwandelbaren, ewigen Seins.
Das Sein selbst stellt sich Parmenides als immer gleichbleibend vor, unveränderlich und ausgewogen, wie eine ›wohlgerundete Kugel‹.
Wir sehen also, wie im Lehrgedicht Grundkonzepte angelegt sind, die ausschlaggebend für die Errichtung des philosophischen Denkgebäudes des Abendlandes sind:
Das Hinausgehen über die Welt der sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen (Transzendenz), um zu höheren Wahrheiten zu gelangen (Metaphysik), und die Erschließung dieser Wahrheiten durch das Denken und die Vernunft (Logos).
Parmenides’ Absicht ist es, die Unwandelbarkeit und Ewigkeit des Seins zu denken. Das radikal Neue dabei ist die Vorstellung des Bezugs von Denken und Sein. Dieser ist zugleich Quell und Grenze der westlichen Philosophie.
Das Lehrgedicht
1. Die Rosse, die mich dahintragen, zogen mich weiter davon, soweit die Lust mich trieb, als mich auf den vielberühmten Weg, der von Stadt zu Stadt den wissenden Mann trägt, die Göttinnen gebracht hatten. Auf diesem zogen mich die Vieles verstehenden Rosse, und die Mädchen wiesen den Weg. Die Achse in den Naben entsandte Pfeiftöne und erhitze sich glühend. Die Sonnenmädchen, die das Haus der Nacht verlassen hatten, schlugen mit den Händen die Schleier von ihren Häuptern zurück und lenkten zum Lichte die Fahrt.
Dort steht das Tor der Bahnen von Nacht und Tag – es umfaßt einen Türsturz und eine steinerne Schwelle; das lichte Tor selbst ist von großen Türflügeln verschlossen; davon verwaltet die vielesrächende Dike die verschiedenen Schlüssel.
Ihr nun sprachen die Mädchen mit sanften Worten zu und überredeten sie, daß sie ihnen den vorgeschobenen Riegel schnell vom Tor wegstieße. Da öffnete sich weit der Schlund des Tores, wobei sich die reich mit Erz beschlagenen Pfosten in ihren Pfannen drehten; gerade hindurch lenkten die Mädchen Wagen und Pferde.
Die Göttin empfing mich, ergriff meine rechte Hand mit der ihren, erhob das Wort und sprach: Jüngling, der du von göttlichen Wagenlenkern geleitet, mit den Rossen, die dich tragen, zu unserem Haus gelangst, Freude dir ! Kein schlechtes Geschick, sondern Gesetz und Recht sandte dich, diesen Weg zu kommen. Nun sollst du alles erfahren, sowohl der Wahrheit unerschütterliches Herz, als auch der Sterblichen Schein-Meinungen, die ohne wahre Gewißheit sind. Denn du sollst auch dieses kennenlernen und zwar so, wie dieser Schein sich Geltung verschafft, indem er alles ganz und gar durchdringt.
2. Wohlan, so will ich denn sagen (vernehme und trage das Wort weiter, das du hörtest), welche Wege des Suchens und Fragens allein zu denken sind:
der eine Weg, daß ISTist und daß Nichtsein nicht ist, das ist der Weg der Überzeugung (denn diese folgt der Wahrheit). Der andere aber, daß NICHTISTist und daß Nichtsein erforderlich ist, dieser Weg ist, so sage ich dir, gänzlich unerkundbar: denn weder erkennen könntest du das Nichtseiende (das ist ja unausführbar) noch aussprechen;
3. denn dasselbe ist Denken und Sein.
4. Schaue doch mit dem Geist, wie durch den Geist das Abwesende anwesend ist mit Sicherheit; denn er wird das Seiende von seinem Zusammenhang mit dem Seienden nicht abtrennen, und zwar weder als solches, das sich nach dem Lauf der Dinge überall hin zerstreut, noch als solches, das sich zusammenballt.
5. Ein Gemeinsam-Zusammenhängendes ist es für mich, von wo ich beginne; dorthin werde ich auch zurückkehren.
6. Nötig ist zu sagen und zu denken, daß nur das Seiende ist; denn Sein ist, ein Nichts dagegen ist nicht; das heiße ich dich zu beherzigen. Zunächst warne ich dich daher vor jenem Weg des Suchens. Dann aber auch vor jenem, auf dem die nichts wissenden Sterblichen einher straucheln, Doppelköpfe. Denn Ratlosigkeit steuert in ihrer Brust den hin und her schwankenden Sinn. Sie treiben dahin, stumm und blind zugleich, die Verblödeten, unentschiedene Haufen, für die das Sein und das Nichtsein dasselbe gilt und dann wieder nicht dasselbe und für die es bei allem einen gegenteiligen Weg gibt.
7./8. Denn es ist unmöglich, zu beweisen, daß Nichtseiendes sei; vielmehr halte du von diesem Weg des Suchens den Gedanken fern, laß dich auch nicht von der Gewohnheit auf diesen Weg zwingen, das blicklose Auge und das dröhnende Gehör und die Zunge walten zu lassen, sondern entscheide mit dem Denken die vielumstrittene Frage, die von mir genannt wurde.
Aber nur noch eine Weg-Kunde bleibt dann, nämlich daß ISTist. Auf diesem Weg stehen viele Zeichen: Sein ist ungeboren und unvergänglich, denn es ist ganz und heil und unerschütterlich sowie ohne Ziel und es war nie und wird nie sein, weil es im Jetzt zusammen vorhanden ist als Ganzes, Eines, Zusammenhängendes. Denn was für einen Ursprung willst du für das Sein ausfindig machen ? Wie, woher soll es herangewachsen sein ? Auch nicht sein Entstehen aus dem Nichtseienden werde ich dir gestatten auszusprechen und zu denken.
Denn unaussprechbar und undenkbar ist, daß NICHTISTist. Welche Notwenigkeit hätte es denn auch antreiben sollen, später oder früher mit dem Nichts beginnend zu entstehen ? So muß es also entweder ganz und gar sein oder überhaupt nicht. Auch wird die Kraft der Überzeugung niemals erlauben, aus Nichtseiendem könnte irgend etwas anderes als eben dieses hervorgehen. Daher hat auch Dike das Sein weder zum Werden noch zum Vergehen freigegeben, indem sie die Fesseln lockerte, nein, sie hält es fest. Die Entscheidung hierüber liegt in folgendem: IST oder NICHTIST ! Entschieden ist nun aber, wie es notwendig war, den einen Weg als undenkbar, unsagbar beiseite zu lassen, den anderen aber als vorhanden und wirklich-wahr zu betrachten. Wie aber könnte dann Seiendes zugrunde gehen, wie könnte es entstehen ? Denn entstand es, so ist es nicht und ebensowenig, wenn es erst in Zukunft einmal sein sollte. So ist Entstehen verlöscht und Vergehen verschollen.
Sein ist auch nicht teilbar, weil es ganz gleichartig ist. Und es gibt nicht etwa hier oder da ein stärkeres Sein, das seinen Zusammenhang hindern könnte, noch ein geringeres; es ist vielmehr ganz von Seiendem erfüllt. Darum ist es ganz zusammenhängend; denn Seiendes stößt dicht an Seiendes.
Aber unbeweglich-unveränderlich liegt es in den Grenzen gewaltiger Bande ohne Ursprung, ohne Aufhören; denn Entstehen und Vergehen wurden weit in die Ferne verschlagen; es verstieß sie die wahre Überzeugung; und als Dasselbe und in Demselben verharrend ruht es in sich und so verbleibt es standhaft an Ort und Stelle.
Denn die machtvolle Notwendigkeit hält es in den Banden der Grenze, die es rings umschränkt, weil das Seiende nicht ohne Abschluß sein darf; denn es ist unbedürftig, fehlte ihm aber etwas, so würde es der Ganzheit bedürfen.
Dasselbe ist Denken und der Gedanke, daß ISTist; denn nicht ohne das Seiende, in dem es als Ausgesprochenes ist, kannst du das Denken antreffen. Es ist nichts und wird nichts anderes sein außerhalb des Seienden, da es ja die Moira daran gebunden hat, ein Ganzes und unbeweglich zu sein. Darum ist alles, was die Sterblichen in ihrer Sprache gesetzt haben bloßer Name, überzeugt es sei wahr: Werden sowohl als Vergehen, Sein sowohl als Nichtsein, Wandel des Ortes und Wechsel der leuchtenden Farben.
Aber da eine letzte Grenze vorhanden ist, so ist es von allen Seiten vollendet, der Masse einer wohlgerundeten Kugel vergleichbar, von der Mitte her überall gleichgewichtig. Es darf ja nicht dort etwas größer oder etwas schwächer sein. Denn es ist weder Nichtseiendes, das es hindern könnte zum Gleichmäßigen zu gelangen, noch könnte Seiendes irgendwie hier mehr, dort weniger vorhanden sein als Seiendes, da es ganz unversehrt ist. Sich selbst nämlich ist es von allen Seiten her gleich, gleichmäßig fügt es sich in seine Grenzen.
Damit beende ich für dich mein verläßliches Reden und Denken über die Wahrheit. Aber von hier ab lerne die menschlichen Schein-Meinungen kennen, indem du meiner Worte trügerische Ordnung hörst.
Sie haben nämlich ihre Ansichten dahin festgelegt, zwei Formen zu benennen (von denen man eine nicht festlegen sollte, darin haben sie sich geirrt). Sie unterschieden die Gestalt in ihren Gegensätzen und sonderten ihre Merkzeichen voneinander ab: hier das ätherische Flammenfeuer, das milde, das ja leicht ist und mit sich selbst überall identisch. Aber auch jenes setzten sie für sich, das ganze Gegenteil des anderen: die lichtlose Nacht, ein dichtes und schweres Gebilde. Diese Weltordnung will ich dir verkünden, in der ganzen Glaubhaftigkeit ihres Scheins, so daß keine Meinung eines Sterblichen dich je überholen wird.
9. Aber nachdem alle Dinge Licht und Nacht benannt war und das, was ihnen jeweils ihren Kräften gemäß als Name zugeteilt wurde, ist alles zugleich voll von Licht und unsichtbarer Nacht, die beide gleichgewichtig sind, denn es ist unmöglich, daß etwas unter keinem von beiden steht.
10. Erfahren sollst du das Äther-Wesen und alle Sternbilder im Äther und der reinen klaren Sonnenfackel versengendes Wirken, und woher sie entstanden sind, und das umwandernde Wirken und Wesen des rundäugigen Mondes wirst du erkunden. Du wirst aber auch vom ringsumfassenden Himmel erfahren, wie er entsproß und wie ihn die Notwendigkeit zwang, das Gefüge der Sterne zu halten.
11. Ich will jetzt erzählen, wie die Erde und die Sonne sowie der Mond, auch der all-gemeinsame Äther und auch die himmlische Milchstraße und der äußerste Olympos sowie der Sterne warme Kraft danach strebten zu entstehen.
12. Denn die engeren Ringe wurden mit ungemischtem Feuer angefüllt, auf diese folgen Ringe mit Nacht, dazwischen ergießt sich der Anteil der Flamme. Und inmitten von allem ist die Göttin, die alles lenkt. Denn überall regt sie grausige Geburt und Paarung an, indem sie dem Männlichen das Weibliche zur Paarung schickt und umgekehrt, das Männliche dem Weiblichen.
13. Zuerst ersann sie von allen Göttern den Eros.
14. Der Mond ein nachleuchtendes, um die Erde irrendes Licht.
15. Der Mond stets schauend nach den Strahlen der Sonne.
15 a. Die Erde im Wasser verwurzelt.
16. Denn je nachdem wie jeder die Mischung der vielfach irrenden Glieder besitzt, so steht der Geist den Menschen zur Seite. Denn es ist immer dasselbe, was denkt in den Menschen, ebenso wie die innere Beschaffenheit ihrer Glieder, bei allen und jedem: der Gedanke ist nichts als ein Mehr.
17. Zur Rechten die Knaben, zur Linken die Mädchen.
18. Wenn Frau und Mann die Keime der Liebe mischen, formt die Kraft, die sie in den Adern aus verschiedenem Blute bildet, aber nur wenn sie die gleichmäßige Mischung erhält, wohlgebaute Körper. Wenn aber verschiedene Kräfte in den vermischten Samen miteinander streiten und diese in dem gemischten Körper keine Einheit bilden, so werden sie grauenvoll das keimende Leben durch Doppelgeschlechtigkeit heimsuchen.
19. So also entstand dies nach dem Schein und ist noch jetzt und wird von nun an in Zukunft wachsen und dann sein Ende nehmen. Und für all dieses haben die Menschen Namen festgelegt, einen bezeichnenden für jedes.
Heraklit
(um 540 v. Chr. – um 475 v. Chr.)
Alles fließt
Heraklit, der zweite vorsokratische Philosoph, der nun vorgestellt werden soll, scheint auf den ersten Blick eine ganz gegensätzliche Denkweise zu verfolgen wie Parmenides.
Er lehrt, daß alles einem stetigen Wandel unterworfen ist und aus Kampf und Gegensatz entsteht.
Heraklit war ein Zeitgenosse des Parmenides und lebte, räumlich auf das Weiteste getrennt, in Ephesus, damals eine der wohlhabendsten Städte der Mittelmeergegend. Er stammte aus einer Adelsfamilie und war ein Einzelgänger, der die Demokratie als pöbelhafte Gleichmacherei verachtete. Aufgrund der hochgestellten gesellschaftlichen Position seiner Familie hatte er ein politisches Amt geerbt, das er allerdings an seinen jüngeren Bruder abtrat, da er selbst die Politik haßte. Eine Anekdote erzählt, wie er eines Tages im Tempel der Artemis mit den Kindern Würfel gespielt habe. Als sich eine erstaunte Menschenmenge um ihn versammelte, sagte er: »Was wundert ihr euch ? Ist das nicht besser, als Politik mit euch zu treiben ?«
Im hohen Alter soll er als Einsiedler und sich nur von Pflanzen ernährend in den Bergen gelebt haben. Einige antike Biographien schildern sein Ende folgendermaßen: Er habe an Wassersucht gelitten und konnte von den Ärzten nicht geheilt werden. So entwickelte er seine eigene Heilmethode: Er bestrich sich mit Kuhmist, setzte sich der Sonne aus und hoffte, das Wasser würde auf diese Weise dem Körper entzogen werden. Leider war der Erfolg negativ und kostete ihn das Leben. Hunde hatten ihn während der ›Behandlung‹ angefallen und zerrissen.
Von der Nachwelt wurde er auch ›der Dunkle‹ genannt.
Heraklit verfaßte eine Schrift, der wahrscheinlich erst später der Name Über die Natur gegeben wurde, denn zu jener Zeit hatten Texte noch keine Titel. Es heißt, er habe sie selbst feierlich im Tempel der Artemis in Ephesus niedergelegt. Diese Schrift, von der etwa 130 Fragmente erhalten sind, besteht aus knapp formulierten, eigenwilligen Sprüchen in einem an Bildern und Vergleichen reichen Stil. Ihr Ton ist fast beschwörerisch, und sie gehören zum Tiefsten und zugleich Rätselhaftesten, was uns von den frühen Philosophen übermittelt wurde. Heute weiß man nicht mehr, ob diese Fragmente einmal Teil eines Gesamttextes gewesen sind oder eine Sammlung von Lebensweisheiten und Aphorismen. Auch die Ordnung der Fragmente ist nicht mehr nachvollziehbar, jetzt stellt man sie meist in thematischen Gruppen zusammen.
Schon im Altertum empfand man Heraklits Sprüche als nur schwer zugänglich und sagte, er habe sie aus Absicht ›dunkel‹ formuliert, um nur für Wenige verständlich zu sein. Der breiten Masse sollten sie verschlossen bleiben. Wahrscheinlich ist, daß eine neue Denkform aus ihnen spricht, die sich tatsächlich nicht an die Vielen richtet, sondern ganz für sich steht. Dabei verfährt sie monologisch und entwickelt eine sehr eigene, exklusive Weise der Vermittlung, die sich auch vor Unzugänglichkeiten der Gedanken und Ausdrucksweise nicht scheut.
Zum ersten Mal haben wir es mit einem Philosophen zu tun, der ein Bewußtsein für das Abseitige entwickelte, weil er selbst ein Außenseiterdasein führte, fernab von den Geschäftigkeiten der Polis, der Stadtgemeinschaft, in der er lebte. So tritt auch sein Denken aus den gewöhnlichen Kommunikationsformen heraus und sucht die Konfrontation mit dem, was sich nicht einfach offenbart. Der Philosoph als der Einzelne, der die Autorität von Gesellschaft und hergebrachten Ausdrucks- und Denkformen durchbricht, ist bis heute charakteristisch für das Selbstverständnis jedes Philosophen. Es findet seinen ersten Repräsentanten in Heraklit.
Einer der bekanntesten Aussprüche von Heraklit lautet: »Man kann nicht zweimal in denselben Fluß steigen.« Als panta rhei – »alles fließt« – wurde das Prinzip, daß alles in Bewegung sei und das Dasein einem ewigen Wandel unterliege, später auf diese berühmte Formel gebracht, die sich allerdings so bei Heraklit nicht findet. Oft werden die Vorstellung des stetigen Fließens und die Idee, daß sich alles aus der Konfrontation gegensätzlicher Kräfte entwickelt, als das Gegenteil der parmenideischen Lehre von der Ausgewogenheit und Unwandelbarkeit des Seins ausgelegt. »Der Krieg ist der Vater aller Dinge«, sagt zwar Heraklit, aber er wird mißverstanden, wenn man glaubt, er sehe die Welt allein als opponierende, sich ständig verändernde und bewegende Kräfte. Vielmehr erkennt er Einheitliches jenseits der Vielheit und nimmt eine Ordnung im Kosmos wahr, die das Einswerden der Gegensätze bewirkt. Nur der Mensch, so Heraklit, hat das noch nicht begriffen: »Sie verstehen nicht, wie es auseinandergetragen mit sich selbst im Sinn zusammengeht: gegenstrebige Vereinigung wie die des Bogens und der Leier«, heißt es in einem seiner Sätze.
Die Ordnung, die das Gegensätzliche eint, nennt Heraklit den Logos.
Heraklit ist der erste griechische Philosoph, der diesen Begriff im philosophischen Sinne benutzt. Logos heißt im griechischen Sprachgebrauch eigentlich die Rede, die Abfolge von Worten oder auch das Sammeln und Lesen. Heraklit erweitert diese Bedeutung zu einer Denkform, um die Welt zu erklären. Mag alles noch so fließend sein – alle Vorgänge vollziehen sich nach innewohnenden Regeln, die im Veränderlichen als Bleibendes erscheinen. So ist der Logos die durchwirkende Vernunft, er ist das Umgreifende, die ›Weltordnung‹. »Alles geschieht nach dem Logos«, schreibt Heraklit. Und obwohl sich das gesamte Weltgeschehen nach ihm richtet, hat der Mensch keinerlei Erfahrung von ihm: »Für dieses Wort aber, obwohl es ewig ist, haben die Menschen kein Verständnis […]. Alles geschieht nach diesem Wort, und doch gebärden sie sich wie die Unerfahrenen.« Die Menschen sind blind und taub dem Logos gegenüber und wissen noch nicht einmal, »was sie im Wachen tun, wie sie ja vergessen, was sie im Schlaf tun«. Sie sind Unwissende und verbringen ihr Leben unbewußt, wie im Traum. Ihr Leben ist ein Schein im Vergleich zum wahren Sein des Logos.
Mit diesem Gedanken beginnt die für die abendländische Philosophie so charakteristische Hinwendung zur Vernunft, die über dem Leben steht und die für fast zwei Jahrtausende Vorbedingung des Denkens sein sollte.
Die Größe im Denken Heraklits liegt in der Erkenntnis, daß hinter dem unaufhörlichen Fluß der Dinge, hinter allem Gegensätzlichen ein einheitliches, verbindendes Gesetz steht. Werden und Vergehen sind eine Einheit.
Diese Vorstellung führt weg von der zu jener Zeit herrschenden mythischen Göttervielfalt. So denkt Heraklit den bahnbrechenden Gedanken eines einzigen Gottes, in dem alle Gegensätze aufgehoben sind: »Gott ist Tag und Nacht, Winter und Sommer, Krieg und Frieden, Überfluß und Hunger.«
Die Philosophie nachfolgender Jahrhunderte ist in außerordentlichem Maße vom Denken Heraklits geprägt.
Seine Idee einer allgegenwärtigen göttlichen Weltvernunft – des Logos – wurde später in der christlichen Theologie zum ›göttlichen Wort‹.
Mit der Lehre der Einheit des Gegensätzlichen schuf er ein erstes Modell einer Dialektik, die mehr als zweitausend Jahre später bei Friedrich Hegel, der von Heraklit zutiefst beeinflußt war, zum philosophischen Instrument der Erkenntnis wurde. Hegel schrieb: »Es ist kein Satz des Heraklit, den ich nicht in meiner Logik aufgenommen habe.«
Auch die Marxisten entwickelten wesentliche Ideen aus der Dialektik, der Gegenüberstellung von Gegensätzlichem, zum Erreichen einer gemeinsamen Aussage.
Der Gedanke vom Kampf als Vater aller Dinge findet sich dann auch bei Nietzsche wieder.
Fragmente
Für dieses Wort aber, ob es gleich ewig ist, haben die Menschen kein Verständnis, weder ehe sie es vernommen, noch sobald sie es vernommen. Alles geschieht nach diesem Wort, und doch gebärden sie sich wie die Unerfahrenen, so oft sie es versuchen in solchen Worten und Werken, wie ich sie künde, ein jegliches nach seiner Natur auslegend und deutend, wie sich’s damit verhält. Die anderen Menschen wissen freilich nicht, was sie im Wachen tun, wie sie ja auch vergessen, was sie im Schlafe tun. (1)
Sie verstehen es nicht, auch wenn sie es vernommen. So sind sie wie die Tauben. Das Sprichwort bezeugt’s ihnen: ›Anwesend sind sie abwesend‹. (34)
Sie wissen weder zu hören noch zu reden. (19)
Darum ist es Pflicht dem Gemeinsamen zu folgen. Aber obwohl das Wort allen gemein ist, leben die meisten so, als ob sie eine eigene Einsicht hätten. (2)
Die Wachenden haben eine gemeinsame Welt, doch jeder Schlafende wendet sich nur an seine eigene. (89)
Die Schlafenden sind Arbeiter und Mitwirkende an den Weltereignissen. (75)
Man soll nicht handeln und reden wie Schlafende. Denn im Schlaf bilden wir uns nur ein zu handeln und zu reden. (73)
Von dem, womit sie doch am meisten und beständig zu tun haben, nämlich dem Sinn des Ganzen, entzweien sie sich, und die Dinge auf die sie täglich stoßen, sind ihnen fremd. (72)
Keineswegs denken die meisten über das nach, was ihnen begegnet, noch verstehen sie, was sie erfahren: aber sie bilden es sich ein. (17)
Gemeinsam ist allen das Denken. (113)
Allen Menschen ist es gegeben, sich selbst zu erkennen und klug zu sein. (116)
Gar vieler Dinge kundig müssen weisheitsliebende Menschen sein. (35)
Seinen Unverstand zu verbergen ist besser: nur ist es schwer beim Ausgelassensein und beim Wein. (95)
Alles, was man sehen, hören, lernen kann, das ziehe ich vor. (55)
Schlechte Zeugen sind dem Menschen Augen und Ohren, wenn sie Barbarenseelen haben. (107)
Die Menschen lassen sich über die Kenntnis der sichtbaren Dinge ähnlich täuschen wie Homer, der doch weiser war als die Hellenen allesamt. Ihn foppten nämlich Jungen, die Läuse erjagt hatten, indem sie ihm zuriefen: alles was wir gesehen und gefangen haben, das lassen wir da; was wir aber nicht gesehen und nicht gefangen haben, das bringen wir mit. (56)
Man soll es nicht tun wie Kinder der Eltern, deren Art es einfach ist, ›wie wir es gelernt haben‹. (74)
Hunde bellen jeden an, den sie nicht kennen. (97)
Ein hohler Mensch pflegt bei jedem Wort starr dazustehen. (87)
Über die wichtigsten Dinge soll man nicht vorschnell urteilen. (47)
Das Denken ist der größte Vorzug, und die Weisheit besteht darin, die Wahrheit zu sagen und nach der Natur zu handeln, auf sie hinhörend. (112)
Eins, das allein Weise, will nicht und will doch auch wieder mit dem Namen Zeus benannt werden. (32)
Reinigung von Blutschuld suchen sie vergeblich, indem sie sich mit Blut besudeln, wie wenn einer, der in Kot getreten, sich mit Kot abwaschen wollte. Für wahnsinnig würde ihn doch halten, wer von den Leuten ihn bei solchem Treiben bemerkte. Und sie beten auch zu diesen Götterbildern, wie wenn einer mit Gebäuden Zwiesprache halten wollte. Sie kennen eben die Götter und Heroen nicht nach ihrem wahren Wesen. (5)
Nachtschwärmer, Magier, Bakchen, Mänaden und Eingeweihte. In unheiliger Weise findet die Einführung in die Weihen statt, wie sie bei den Leuten gebräuchlich sind. (14)
Wenn es nicht Dionysos wäre, dem sie die Prozession veranstalten und das Phalloslied singen, wäre es ein ganz schändliches Tun. Ist doch Hades eins mit Dionysos, für den sie da toben und Fastnacht feiern. (15)
Der Herrscher, dem das Orakel in Delphi gehört, spricht nichts und verbirgt nichts, sondern er deutet an. (93)
Die Sibylle, die mit rasendem Mund Ungelachtes und Ungeschminktes und Ungesalbtes redet, reicht mit ihrer Stimme durch tausend Jahre. Denn der Gott treibt sie. (92)
Überheblichkeit soll man noch eher löschen als eine Feuersbrunst. (43)
Das Volk soll kämpfen um sein Gesetz wie um seine Mauer. (44)
Wenn ihr nicht mich, sondern das Wort vernehmt, ist es weise zuzugestehen, daß alles eins ist. (50)
Will man mit Geist reden, muß man sich auf den Geist des Ganzen stützen, wie eine Stadt auf das Gesetz und noch stärker. Nähren sich doch alle menschlichen Gesetze aus dem einen göttlichen. Das nämlich herrscht soweit es nur will und genügt allem und siegt über alles. (114)
Gäbe es keine Sonne, trotz der übrigen Gestirne, wäre es Nacht. (99)
Die Sonne wird nicht ihre Maße überschreiten; wenn aber doch, werden die Erinnyen, der Dike Schergen, sie dabei ertappen. (94)
Die Horen sind es, die alles bringen. (100)
Diese Weltordnung, dieselbige für alle Wesen, hat kein Gott und kein Mensch geschaffen, sondern sie war immerdar und ist und wird sein lebendiges Feuer; sein Erglimmen und Verlöschen sind ihre Maße. (30)
Feuers Wandlungen: erstens Meer, die Hälfte davon Erde, die andere Glutwind. Es zerfließt das Meer und erhält sein Maß nach demselben Wort, das galt, ehe es denn Erde ward. (31)
Umsatz findet wechselweise statt, des Alls gegen das Feuer und des Feuers gegen das All, wie des Goldes gegen Waren und der Waren gegen Gold. (90)
Feuer lebt der Luft Tod und Luft des Feuers Tod; Wasser lebt der Erde Tod und Erde den des Wassers. (76)
Das Kalte wird warm, Warmes kalt, Nasses trocken, Dürres feucht. (126)
Auch der Gerstentrank zersetzt sich, wenn man ihn nicht umrührt. (125)
Die schönste Weltordnung ist wie ein aufs Geradewohl hingeschütteter Kehrichthaufen. (124)
Das Weltall aber steuert der Blitz. (64)
Denn alles wird das Feuer, das heranrücken wird, richten und verdammen. (66)
Gott ist Tag und Nacht, Winter und Sommer, Krieg und Frieden, Überfluß und Hunger. Er wandelt sich aber wie das Feuer, das, wenn es mit Räucherwerk vermengt wird, nach eines jeglichen Wohlgefallen so oder so benannt wird. (67)
Mangel und Überfluß. (65)
Man kann nicht zweimal in denselben Fluß steigen … Er zerstreut und sammelt sich und naht und entfernt sich. (91)
Wer in dieselben Fluten hinabsteigt, dem strömt stets anderes Wasser zu. Auch die Seelen dünsten aus dem Feuchten hervor. (12)
Für die Seelen ist es Tod, zu Wasser zu werden, für das Wasser Tod, zur Erde zu werden. Aus der Erde wird Wasser, aus Wasser Seele. (36)
Für die Seelen ist es Lust, Tod oder naß zu sein. Wir leben den Tod jener, und jene leben unseren Tod. (77)
Die Sonne ist neu an jedem Tag. (6)
Ein Tag ist wie der andere. (106)
Es ist immer ein und dasselbe, was in uns wohnt: Lebendes und Totes und das Wache und das Schlafende und Jung und Alt. Wenn es umschlägt, ist dieses jenes und jenes wiederum, wenn es umschlägt, dieses. (88)
Sich wandelnd ruht er aus. (84 a)
Es ist ermattend, denselben Herren zu frohnen und zu dienen. (84 b)
Der Schraube Weg, gerade und krumm, ist ein und derselbe. (59)
Der Weg auf und ab ist ein und derselbe. (60)
Unsterbliche sterblich, Sterbliche sterblich: sie leben gegenseitig ihren Tod und sterben ihr Leben. (62)
Des Bogens Name ist Leben (bios), sein Werk Tod. (48)
Der Mensch zündet sich in der Nacht ein Licht an, wenn er gestorben, erloschen ist; im Leben berührt er den Toten im Schlaf, wenn sein Augenlicht erloschen ist; im Wachen berührt er den Schlafenden. (26)
Tod ist alles, was wir im Wachen sehen, und Schlaf, was im Schlummer. (21)
Krankheit macht die Gesundheit angenehm, Übel das Gute, Hunger den Überfluß, Mühe die Ruhe. (111)
Bei Gott ist alles schön und gerecht; die Menschen aber halten einiges für gerecht, anderes für ungerecht. (102)
Gäbe es jenes nicht, so kennten sie der Dike Namen nicht. (23)
Die Weisheit ist nur eines, nämlich die Vernunft zu erkennen, die alles und jedes zu lenken weiß. (41)
Vielwisserei lehrt nicht Verstand haben. Sonst hätte Hesiod es gelernt, und Pythargoras, ferner auch Xenophanes und Hekataios. (40)
Keiner von allen, deren Worte ich vernommen, gelangt dazu, zu erkennen, daß die Weisheit etwas von allem abgesondertes ist. (108)
Seinen Unverstand zu verbergen ist besser, als ihn zur Schau zu stellen. (109)
Trockene Seele die weiseste und beste. (118)
Hat sich ein Mann betrunken, wird er von einem jungen Knaben geführt. Er taumelt und merkt nicht, wohin er geht; denn seine Seele ist feucht. (117)
… vergißt wohin der Weg führt. (71)
Ich habe mich selbst erforscht. (101)
Der Seele ist das Wort eigen, das sich selbst mehrt. (115)
Der Seele Grenzen kannst du nicht finden, auch wenn du jegliche Straße abschrittest; so tiefen Grund hat sie. (45)
Mit dem Herzen zu kämpfen ist hart. Denn jeden seiner Wünsche erkauft man um seine Seele. (85)
Es ist nicht gut, wenn den Menschen alle ihre Wünsche erfüllt werden. (110)
Eigendünkel ist eine fallende Sucht. (46)
Dem Menschen ist sein Sinn sein Gott. (119)
Denn des Menschen Sinn kennt keine Zwecke, wohl aber göttliche. (78)
Die Natur liebt es, sich zu verstecken. (123)
Meerwasser ist das reinste und scheußlichste: für Fische trinkbar und lebenserhaltend, für Menschen untrinkbar und tödlich. (61)
Säue baden in Kot, Geflügel in Staub oder Asche. (37)
Am Dreck sich ergötzen. (13)
Esel würden Spreu dem Gold vorziehen. (9)
Bestände das Glück in körperlichen Lustgefühlen, so müßte man die Ochsen glücklich schätzen, wenn sie Erbsen zu fressen finden. (4)
Der schönste Affe ist häßlich mit dem Menschengeschlecht verglichen. (82)
Der weiseste Mensch wird gegen Gott gehalten wie ein Affe erscheinen in Weisheit, Schönheit und allem anderen. (83)
Kind heißt der Mann vor der Gottheit wie der Knabe vor dem Mann. (79) Kinderspiele … (70)
Würden alle Dinge zu Rauch, könnte man sie nur mit der Nase unterscheiden. (7)
Krieg ist aller Dinge Vater, aller Dinge König. Die einen macht er zu Göttern, die andern zu Menschen, die einen zu Sklaven, die andern zu Freien. (53)
Man soll aber wissen, daß der Krieg das Gemeinsame ist und das Recht der Streit und daß alles durch Streit und Notwendigkeit zum Leben kommt. (80)
Das Auseinanderstrebende vereinigt sich, und aus den Gegensätzen entsteht die schönste Vereinigung, und alles entsteht durch den Streit. (8)
Verbindungen sind: Ganzes und Nichtganzes, Eintracht und Zwietracht, Einklang und Mißklang und aus allem eins und aus einem alles. (10)
Verborgene Vereinigung ist besser als offene. (54)
Sie verstehen nicht, wie das Auseinanderstrebende ineinander geht: gegenstrebige Vereinigung wie beim Bogen der Leier. (51)
Denn beim Kreisumfang ist Anfang und Ende gemeinsam. (103)
Denn alles, was da kreucht, wird mit Gottes Geißel zur Weide getrieben. (11)
Wie kann einer verborgen bleiben, vor dem, was nimmer untergeht ! (16) Die Goldgräber schaufeln viel Erde und finden wenig. (22)
Denn was ist ihr Sinn oder Verstand ? Straßensängern glauben sie und zum Lehrer haben sie Pöbel. Denn sie wissen nicht, daß die meisten schlecht und nur wenige gut sind. (104)
Wenn sie geboren sind, schicken sie sich an zu leben und den Tod zu erleiden oder vielmehr auszuruhen, und sie hinterlassen Kinder, daß auch sie den Tod erleiden. (20)
Der Menschen wartet nach dem Tod, was sie nicht erwarten oder wähnen. (27)
Denn Leichname sollte man eher wegwerfen als Mist. (96)
Eins gibt es, was die Besten allem anderen vorziehen: den ewigen Ruhm den vergänglichen Dingen. Die Meisten freilich liegen da, vollgefressen wie das liebe Vieh. (29)
Im Krieg Gefallene ehren Götter und Menschen. (24)
Größerer Tod empfängt größere Belohnung. (25)
Denn was der Glaubwürdigste erkennt und festhält, ist nur Glaubenssache. Aber freilich, die Lügenschmiede und ihre Eideshelfer wird doch Dike zu fassen wissen. (28)
Einer gilt mir zehntausend, falls er der Beste ist. (49)
Gesetz heißt auch dem Willen eines einzigen folgen. (33)
Wenn er es nicht erhofft, wird er das Unverhoffte nicht finden. Denn unerforschlich ist es und unzugänglich. (18)
Die Kenntnis des Göttlichen entzieht sich größtenteils dem Verständnis, weil man nicht daran glaubt. (86)
II. Die klassische Philosophie Athens
Platon
(427 – 347 v. Chr.)
Erkenntnis als Dialog
Platon ist der erste Denker der westlichen Philosophiegeschichte, von dem ein umfangreiches Werk erhalten ist.
Platon hat keine Lehrschriften verfaßt, sondern Dialogdichtungen, in denen fiktive Gesprächspartner, meist unter der Führung seines geliebten Lehrers Sokrates, nach Kategorien wie dem Schönen, der Liebe, dem Wissen, der Gerechtigkeit und dem Guten fragen. Charakteristisch ist der lebendige Austausch, der in den kunstvoll aufgebauten Gesprächen entwickelt wird.
Mit Platon beginnt eine neue Form der dialogischen Auseinandersetzung um die Wahrheit. Man kann sagen, daß Platon der Wegbereiter der das Abendland seither prägenden Kultur der Wahrheitssuche ist.
Platon lebte und wirkte in Athen. Er wurde als Sohn einer der vornehmsten athenischen Familien geboren, die bis auf Solon zurückreichte, den berühmten Gesetzgeber und einen der ›sieben Weisen‹ Griechenlands. Aufgrund seiner privilegierten gesellschaftlichen Stellung war ihm die Laufbahn eines führenden Politikers vorbestimmt, und er genoß eine für die Aristokratie dieser Zeit übliche Erziehung: Unterricht in Mathematik und Malerei und die Beschäftigung mit der Dichtung.
Doch zwei Ereignisse brachten ihn dazu, der Politik den Rücken zu kehren und sich ganz der Philosophie zuzuwenden: die persönliche Begegnung mit Sokrates und die politische Krisensituation in seiner Heimatstadt. Beides hing miteinander zusammen.
Platon hatte Sokrates wahrscheinlich schon im Alter von 12 Jahren kennengelernt, wurde aber erst von seinem 20. Lebensjahr an dessen Schüler. Das Athen, in dem Platon als junger Mann lebte, befand sich bereits in einem kulturellen Niedergang.
Durch den Prozeß der Demokratisierung und die Niederschlagung der Perser war die Stadt bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. zu ihrer vollen Blüte gelangt. Nun, einhundert Jahre später, hatte der Peloponnesische Krieg Athen ausgeblutet, und die nachfolgende Schreckensherrschaft der dreißig Tyrannen führte mit dem Umsturz der bestehenden Verfassung zu einer politischen Krise.
Vor diesem Hintergrund ereignete sich ein tragisches, für die Philosophiegeschichte folgenreiches Geschehen: Sokrates, der ›freundlichste und gerechteste aller Männer‹, wurde im Jahr 399 v. Chr. hingerichtet. Die Anklage lautete Gottlosigkeit.
Den damals etwa 28jährigen Platon stürzte der gewaltsame und unverschuldete Tod seines Lehrers in eine tiefe Krise. Er sah dessen Hinrichtung als Ausdruck der Korruptheit und Verderbtheit seiner Zeit an. Platon beschloß, das philosophische Erbe Sokrates’, der selbst nichts Schriftliches hinterlassen hatte, in seinen Dialogen unsterblich zu machen.
Nach der Erschütterung, die Sokrates’ Tod verursachte, verließ Platon Athen und reiste für längere Zeit durch Unteritalien und Sizilien. Er schrieb seine ersten Dialoge, knüpfte Verbindungen zu den dort wirkenden Pythagoreern und beschäftigte sich mit deren mathematischen Errungenschaften. In den griechischen Siedlungsgebieten des südlichen Italiens traf er auch auf die Philosophie des Parmenides, die für die Entwicklung seiner Denkweise von größtem Einfluß war.
Und: Er denkt vor dem Hintergrund der Ungerechtigkeiten, die er in seiner Heimatstadt hatte beobachten müssen, über Modelle eines gerechten Staates nach.
Wenn Platon auch selbst nicht mehr politisch aktiv sein wollte, so hatte er doch die Vorstellung entwickelt, mit den Mitteln der Philosophie eine bessere Gesellschaft zu begründen. Drei Mal, zuerst etwa 389/388, dann um 367/366 v. Chr. und schließlich 361/360 v. Chr., hielt er sich am Hof des sizilianischen Tyrannen Dionysios I. bzw. seines Sohnes Dionysios II. auf und versuchte Einfluß auf deren Politik zu nehmen. Hier suchte er seine philosophisch-politischen Ideen in die Tat umzusetzen: Der Staat sollte nach der Idee des Guten und den Maßstäben der Philosophie geführt werden, der Herrscher müsse selbst ein Philosoph sein. Beides sollte zusammenfallen, Staatsgewalt und Philosophie. Platon entwickelte die erste Staatsutopie in der westlichen Kulturgeschichte – und scheiterte. Wieder bestätigte sich die Unberechenbarkeit der Politik, jeder der drei Aufenthalte endete entweder in Verstimmungen oder Intrigen.
Nach seiner ersten Sizilienreise, um das Jahr 387 n. Chr., gründete Platon in der Nähe von Athen seine Schule, die berühmte Akademie. Sie wurde nach dem Halbgott Akademos benannt, weil sie in einem diesem Gott geweihten Hain lag. Die Akademie war weit mehr als eine Lehranstalt, wie wir sie heute kennen, sie stellte eine Art Lebensgemeinschaft dar. Zwar ist über den Alltagsablauf wenig bekannt, doch weiß man, daß hier neben Philosophie auch Mathematik, Geometrie, Astronomie, Politik, Zoologie und Botanik unterrichtet wurden. Tägliche gymnastische Übungen waren Teil des Lehrplanes. Die besten Mathematiker der Zeit gingen aus ihr hervor. Ihr berühmtester Schüler war Aristoteles.
Die Akademie bestand mehr als 900 Jahre, bis sie im Zuge des Untergangs des römischen Reiches und der einsetzenden Christianisierung von Kaiser Justinian im Jahr 529 n. Chr. geschlossen wurde.
Platon unterrichtete hier von seinem vierzigsten Lebensjahr bis zu seinem Tod im Jahr 347 v. Chr. Bis zum Schluß war er bei voller Gesundheit, arbeitete und schrieb.
Für diese Textsammlung wurden Abschnitte aus zwei Dialogen von Platon ausgewählt:
Zum einen ein Auszug aus dem Dialog Phaidon und zum anderen das berühmte ›Höhlengleichnis‹, das dem Buch Politeia (Der Staat) entnommen wurde.
Beide Textpassagen eignen sich besonders dazu, wesentliche Aspekte von Platons sogenannter Ideenlehre – einer der Grundpfeiler der abendländischen Kultur- und Ideengeschichte – zu verdeutlichen.
Die Ideenlehre geht von der Vorstellung aus, daß sich echte Erkenntnis nur jenseits der sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungsformen gewinnen lasse. Im Griechischen bedeutet das Wort ›Idee‹ ursprünglich ›Bild‹ oder ›Gestalt‹. Wer das wahre Sein der irdischen, wandelbaren Dinge erkennen will, muß in den Bereich der Ideen oder Urbilder vordringen. Hier kann er in rein geistiger Schau das eigentliche, bleibende Wesen der Dinge erkennen, das, was hinter dem liegt, was wir sehen, riechen, hören oder ertasten können. In dieser rein geistig erfaßbaren Welt, läßt sich die Idee des Guten, Wahren und Schönen mit Hilfe der Vernunft erkennen. Für Platon ist die Sinneserfahrung ein unvollkommenes Erkennen. Das eigentliche Erkennen ist die Einsicht in die Ideen. Die konkreten Dinge selbst sind in ihrer Vergänglichkeit immer nur ein Abbild der ewig bleibenden Ideen. Alles, was wir zum Beispiel als schön wahrnehmen, hat Teil an dem Urschönen, das jenseits dieser Welt existiert und das immer und unwandelbar ist.
Obwohl Platons Philosophie durch das reine Denken zur Erkenntnis führen will, stellt sie nicht nur eine rein theoretische Beschäftigung dar, sondern bedeutet ein den Menschen in seinem ganzen Dasein ergreifendes Streben nach dem Schönen, Wahren und Guten.
Von welch existentieller Dimension für Platon die Prinzipien der Ideenlehre sind, zeigt der Dialog Phaidon.
Das Gespräch, das hier zwischen Sokrates und seinen Freunden geführt wird, findet in der Todeszelle des Sokrates statt und endet mit dessen Hinrichtung durch den Giftbecher. Die Darstellung dieser Szene berührt seit Jahrhunderten ihre Leser. Der Diskurs zwischen den Anwesenden geht den wesentlichen Fragen des menschlichen Daseins auf tief ergreifende Weise nach. Platon führt anschaulich vor, wie die Ideenlehre Antwort auf eine der wesentlichen menschlichen Grundfragen geben kann. Gefragt wird: Ist die Seele unsterblich ? Wie steht der Körper im Verhältnis zur Seele ?
Sokrates, der dem Tod Geweihte, verteidigt die Unsterblichkeit der Seele mit den Argumenten der Ideenlehre. Der Körper sei die wandelbare, vergängliche Hülle, und die Befreiung der immateriellen Seele aus ihrem Gefängnis bedeute ihr Aufsteigen in das ihrem Wesen entsprechende Reich – das der Ideen, des reinen Wissens und der wahren Erkenntnis. Hier verbleibt sie, solange sie eine gute, das heißt, philosophische Seele ist, für immer. Mit dieser Zuversicht wird Sokrates, der für Platon der einzig wahre Philosoph ist, unsterblich und tröstet über seinen Verlust hinweg.
Das Bild des Aufstiegs vom niederen, irdischen Dasein in das Reich des Lichts und der Vernunft, wird im sogenannten ›Höhlengleichnis‹ besonders plastisch dargestellt. Es ist das zentrale Moment der Ideenlehre. Im ›Höhlengleichnis‹ wird die Sonne als Innbegriff des Guten zur höchsten aller Ideen. Die meisten Menschen leben, so Platon, gefesselt an das trügerische Reich der Sinne und nehmen vom wahren Licht der Erkenntnis nichts wahr als Schatten, die sich an die Wände der düsteren, unterirdischen Höhle werfen, in der sie leben. Der Mensch, der in dieser dunklen Welt stumpfsinnig hin und her läuft, muß gezwungen werden, nach oben zu steigen und den Quell des Lichts und der Erkenntnis – die Sonne – zu schauen und so das Gute wahrzunehmen. Ohne das Wissen um das Gute kann nichts erkannt und auch niemals richtig gehandelt werden.
Der, der das gleißende Licht der Sonne ertragen kann und sich nicht scheut, in das Helle zu sehen, ist der Philosoph. Im offenen Blick in die Sonne offenbart sich ihm das richtige Handeln, und er weiß deswegen auch, was wahre Gerechtigkeit bedeutet.
Platon entwickelt aus seiner Ideenlehre auch ethische und politische Motive. Das Höhlengleichnis zeigt, wie aus der Erkenntnis der Idee des Guten die Utopie eines gerechten Staates hervorgeht. Bedingung ist das Zusammenwirken von Philosophie und Herrschaft.
Sein Fazit: Nur der Philosoph kann ein guter Herrscher sein. Er hat die Sonne gesehen und das Gute erkannt !
Phaidon
(Auszug)
O Guter, sprach Sokrates, nur nicht großsprechen, damit uns nicht ein Zauber das, was gesagt werden soll, verrufe und verdrehe. Doch das soll bei Gott stehen, wir aber wollen nun auf gut homerisch näher tretend hieran versuchen, ob du wohl etwas sagst. Was du aber suchst, scheint mir der Hauptsache nach zu sein, du verlangst, es soll gezeigt werden, daß unsere Seele unvergänglich und unsterblich ist, wenn doch ein philosophischer Mann, der, im Begriff zu sterben, gutes Mutes ist und der Meinung, daß er nach seinem Tode sich dort vorzüglich wohl befinden werde, mehr als wenn er einer andern Lebensweise folgend gestorben wäre, wenn ein solcher nicht ganz unverständig und töricht sein soll bei seinem guten Mut. Zu zeigen aber, daß die Seele etwas Starkes und Göttliches ist, und daß sie war ehe wir geboren wurden, dies alles, behauptest du, könne gar füglich auch keine Unsterblichkeit andeuten, sondern daß die Seele zwar etwas lange Beharrendes ist und wer weiß wie lange Zeit vorher irgendwo gewesen ist und vielerlei gewußt und getan hat, aber deshalb doch noch nicht unsterblich wäre, sondern eben dieses, daß sie in menschlichen Leib gekommen, könne schon der Anfang ihres Unterganges gewesen sein, gleichsam als eine Krankheit, und so könne sie in Jammer und Not dieses Leben leben und am Ende desselben in dem, was man Tod nennt, untergehen. Und ob sie einmal in den Leib kommt oder oft, dies behauptest du, könne keinen Unterschied darin machen, daß doch jeder von uns müsse besorgt sein. Denn es gehöre sich gar wohl, daß jeder, wer nicht unverständig sein wolle, sich fürchte, der nicht wisse und keine Rechenschaft davon geben könne, daß sie unsterblich ist. Dies ist es ungefähr, glaube ich, o Kebes, was du meinst, und absichtlich wiederhole ich es öfter, damit uns nichts davon entgeht und auch du, wenn du willst, etwas hinzusetzen und davontun kannst. – Darauf sagte Kebes: Für jetzt habe ich wohl nichts davonzutun oder hinzuzusetzen; sondern dies ist es, was ich sagen will.