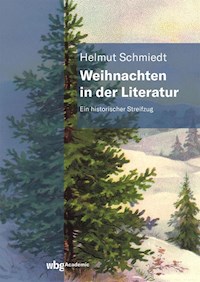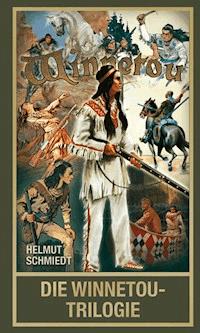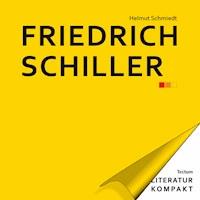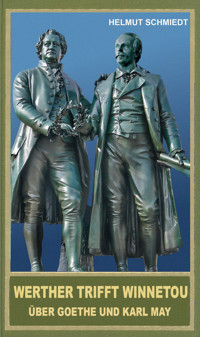
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Karl-May-Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Es gibt mehrere gute Gründe, vergleichende Blicke auf die Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) und Karl May (1842 – 1912) zu werfen. 1. die Qualität ihres literarischen Werks: Goethe ist der größte deutsche Dichter schlechthin bzw., nach neuerem Urteil, einer der größten, und May reiht sich auf seinem speziellen Gebiet des Erzählens ebenfalls in den Kreis der Besten ein 2. die enorme Breite und Vielfalt ihrer Aktivitäten, nicht nur im literarischen Bereich, sondern auch im Leben: Es tun sich jeweils Welten auf, von denen schwer vorstellbar ist, wie ein Einzelner sie alle hat durchmessen können 3. der hohe und einzigartige Bekanntheitsgrad ihrer herausragenden Figuren: Winnetou ist neben Faust wohl die berühmteste Figur der deutschen Literatur. Eine solche Konstellation schreit geradezu nach einer Untersuchung, die Leben, Werk und Wirkung Goethes und Mays gemeinsam inspiziert. Was bisher fehlte, ist der Versuch, die verschiedenen Mosaiksteine zusammenzusetzen und umsichtig zu ergänzen, sodass ein größeres Ganzes entsteht. Hier soll er unternommen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WERTHER TRIFFTWINNETOU
ÜBER GOETHEUND KARL MAY
VON
HELMUT SCHMIEDT
Herausgegeben von Bernhard Schmid© 2024 Karl-May-Verlag, BambergAlle Urheber- und Verlagsrechte vorbehaltenDeckelbild: pinta Gestaltung & Kommunikation
ISBN 978-3-7802-1637-3
KARL-MAY-VERLAGBAMBERG . RADEBEUL
INHALT
Vorbemerkungen
Einleitung
ERSTER TEIL: Koryphäen der Literaturgeschichte
Leben- und Werkchronik
Wirkung und Rezeption
Wissensdurst
Interpretationswut
Verehrung und Kommerz
Künstlerische Rezeption
Politik
Differenzen
Lebensläufe
Dichtung und Wahrheit und Leben und Streben
Zweierlei Leben
Karriereschritte
Reisen
Frauen
Bilanz
Arbeitsverfahren
Spuren des Lebens
Arbeit mit Quellen
Literarische Vielfalt
Textrevisionen
Treue zum Personal
Selbstreflexion
Karl Mays Umgang mit Goethe
Goethe als Bildungsgut
Goethe als Argumentationshelfer
Goethe in Mays Bibliothek
Literaturhistorische Zusammenhänge
ZWEITER TEIL: Romanwelten
Erste Sätze
Unterwegs
Individuelle Entwicklungen
Miteinander umgehen
Alltagsleben
Erotik
Umgang mit der Natur
Umgang mit Bildung
Bauformen des Erzählens
Varianten der Komik
Letzte Sätze
Fazit
Literaturverzeichnis
Namensregister
Vorbemerkungen
„Goethe, Joh. Wolfgang v., größter dtsch. Dichter“
(Knaurs Lexikon A – Z. München 1950, S. 554)
„Karl May ist einer der besten deutschen Erzähler, und er wäre vielleicht der beste schlechthin, wäre er kein armer, verwirrter Prolet gewesen.“
(Ernst Bloch: Die Silberbüchse Winnetous (Neufassung). In: Erbschaft dieser Zeit. Frankfurt a. M. 1962, S. 170)
„Da gibt es Liebe und Freundschaft und Haß und Reisen und Feste und Krieg und Nächstenliebe; da gibt es Goethe den Höfling, den Abenteurer, den Wissenschaftler (Physiker, Mineraloge, Botaniker, Meteorologe, Anatom und Biologe), den Lehrer, den Liebhaber, den Ehemann, den Vater, den Verwalter, den Diplomaten, den Direktor der Theater und Museen, den Maler und Zeichner, den Zeremonienmeister, den Philosophen und den Politiker – und ich habe noch nicht einmal den Dichter und Dramatiker erwähnt, den Romancier, den Übersetzer, den Briefeschreiber und den Kritiker.“
(Kurt R. Eissler: Goethe. Eine psychoanalytische Studie 1775–1786. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Peter Fischer. Bd. 1. Basel/Frankfurt a. M. 1983, S. 36)
„Trickbetrüger, Sträfling, Indianer-Erfinder, Angeber, Schreibtisch-Schwerarbeiter, Prediger, Aufklärer und Wissenschafts-popularisierer, Gedankenlyriker, Großmystiker, Völkerversteher, Goethe-Epigone, Nietzsche-Antagonist, Tausendsassa.“
(Florian Schleburg: Karl May war ein Plural. Eine Chancefür das Museum der Zukunft. In: Magazin des Karl-May-Museums. Nr. 2. 2021, S. 10)
„... ich kann nichts groß, gewaltig und schön genug bekommen und habe doch kein ausgebildetes Kunstverständnis für das Schöne. Goethe würde ganz anders sehen, denken und empfinden als ich. Das ist nun leider hier im Leben nicht mehr nachzuholen.“
(Eintrag Karl Mays in sein Reisetagebuch anlässlich einer Besichtigung der Ruinen von Baalbek am 6.4.1900. In: Dieter Sudhoff/Hans-Dieter Steinmetz: Karl-May-Chronik. Bd. II: 1897–1901. Bamberg/Radebeul 2005, S. 351)
„Winnetou – neben Faust wohl die berühmteste Figur der deutschen Literatur“
(Otto Brunken: Der rote Edelmensch. Karl Mays ‚Winnetou‘. In: Hurrelmann, Bettina (Hrsg.): Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Frankfurt a.M. 1995, S. 293)
„Goethe ist Gott; aber ein fehlbarer und in einer Welt der Vielgötterei.“
(Michael Maar: Die Schlange im Wolfspelz. Das Geheimnis großer Literatur. Hamburg 2020, S. 171)
Einleitung
Wenn man die Formulierungen, mit denen dieses Buch beginnt, so ernst nimmt, wie sie gemeint sind, gibt es mehrere gute Gründe, vergleichende Blicke auf die Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) und Karl May (1842–1912) zu werfen. Erstens zeichnen sie sich durch eine überragende Qualität ihres literarischen Werks aus: Goethe ist der größte deutsche Dichter schlechthin bzw., nach neuerem Urteil, einer der größten, und May reiht sich auf dem speziellen Gebiet des Erzählens ebenfalls in den Kreis der Besten ein und verpasst vielleicht nur aufgrund seiner Herkunft eine noch positivere Einstufung. Zweitens imponieren beide durch die enorme Breite und Vielfalt ihrer Aktivitäten, und das betrifft neben der literarischen Tätigkeit auch ihr sonstiges Leben: Der „Anatom“ und der „Übersetzer“, der „Höfling“ und der „Kritiker“ hier, der „Völkerversteher“, „Angeber“ und „Nietzsche-Antagonist“ da – es tun sich jeweils Welten auf, von denen schwer vorstellbar ist, wie ein Einzelner sie alle hat durchmessen können. Drittens schließlich ist der Bekanntheitsgrad ihrer herausragenden Figuren einzigartig.
Eine solche Konstellation schreit geradezu nach einer Untersuchung, die Leben, Werk und Wirkung Goethes und Mays gemeinsam inspiziert. Tatsächlich liegt dazu schon eine Reihe von Arbeiten vor, die allerdings klein sind und stets nur Detailaspekten gelten. Der Verfasser dieses Buches hat selbst einiges dazu beigetragen; nähere Informationen finden sich am Ende der Einleitung. Ferner hat – um nur ein paar weitere Beispiele zu nennen – Hermann Wohlgschaft, Autor der umfangreichsten aller May-Biografien, bei einem Gedicht Mays intensiv „an Goethes Hymnendichtungen“1 gedacht und Mays Lebensweg mit demjenigen Fausts verglichen.2 In einer kühnen Anwendung moderner Literaturtheorie hat ein anderer Autor Goethes Italienische Reise als „antizipierendes Plagiat“3 von Mays großem Orientroman – Durch die Wüste und so weiter – identifiziert und damit, wie schon der Untertitel seines Beitrags mitteilt, das Problem Goethe/May für endgültig gelöst erklärt; an dieser Stelle möge sich der geneigte Leser, in Übereinstimmung mit jenem Verfasser, ein Smiley vorstellen. Was bisher fehlt, ist der Versuch, die verschiedenen Mosaiksteine zusammenzusetzen und umsichtig zu ergänzen, sodass ein größeres Ganzes entsteht. Hier soll er unternommen werden.
Wer sich auf seine literarischen Kenntnisse etwas zugutehält und ein wenig genauer über die Herren Goethe und May informiert ist, mag allerdings spontan Anlass zu Misstrauen verspüren: Ist es wirklich sinnvoll und mehr als Effekthascherei, sie in einen solchen Zusammenhang zu bringen? Käme das nicht dem sprichwörtlichen Versuch nahe, Äpfel mit Birnen zu vergleichen? Sind die Ähnlichkeiten, die von den oben wiedergegebenen Zitaten suggeriert werden, nicht bloß oberflächlicher Natur? Dass Schriftsteller schillernde Persönlichkeiten und fleißig sind, lässt sich schließlich über eine Vielzahl von ihnen sagen, und die unterstellte exponierte Position dieser beiden ergibt sich nach weit verbreitetem Urteil offenbar doch auf höchst unterschiedliche Weise: Bei Goethe ist es die einzigartige künstlerische und intellektuelle Qualität seiner Arbeit, die ihm eine Ausnahmestellung einräumt, während Ernst Blochs Einschätzung der epischen Qualitäten von Mays Werk nicht gerade zum Allgemeingut der Literaturexperten gehört und Mays besonderer Rang eher daraus resultiert, dass er zu den kommerziell erfolgreichsten Schriftstellern der deutschen Literaturgeschichte zählt oder da vielleicht gar den Spitzenplatz einnimmt.
Auch Gesichtspunkte, die mit Werturteilen nichts zu tun haben, nähren die Skepsis. Es ist grundsätzlich immer schwer, Personen zu vergleichen, die verschiedenen historischen Epochen angehören. Was die literarische Arbeit betrifft, so hat Goethe sich auf allen nur denkbaren Gebieten exponiert, als Epiker, Dramatiker und Lyriker, während Mays Ruhm sich weitestgehend auf seine erzählenden Schriften stützt und die übrigen – auch wenn da einiges vorhanden ist – kaum Beachtung fanden. Führt man also nicht gewaltsam völlig Unterschiedliches zusammen, wenn man das Projekt einer umfassenden Gegenüberstellung Goethes und Mays verfolgt?
An dieser Stelle ist es notwendig, ein wenig über den Sinn des Vergleichens nachzudenken. Da in ‚Vergleich‘ das Wort ‚gleich‘ steckt, liegt der Gedanke nahe, dass man nur Dinge nebeneinander betrachten sollte, die viel Gemeinsames oder zumindest viele Ähnlichkeiten aufweisen, also im engeren Sinne irgendwie ‚gleich‘ sind. Das aber ist keineswegs eine zwingende Überlegung. Es kann durchaus sinnvoll sein, in einem einzigen Arbeitsgang Personen, Sachverhalte und Gegenstände anzuschauen, die sich auf den ersten Blick erheblich voneinander unterscheiden, denn gerade bei einer solchen Konfrontation lassen sich unter Umständen spezifische Charakteristika umso genauer erkennen und gewichten. Es geht dann nicht primär um die Feststellung, dass die Dinge Gemeinsamkeiten aufweisen und worin sie bestehen, sondern um die Frage, ob sie es überhaupt tun und welche Einsichten sich gewinnen lassen, wenn die Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten gering ausfallen oder fast gar nicht vorhanden sind; es geht um Abgrenzung auf einer Basis, die Abgrenzung sinnvoll erscheinen lässt. Natürlich lohnt sich ein solches Unternehmen nur, wenn es am Ende zu buchenswerten Erkenntnissen führt – aber da sollte man in seinen Erwartungen nicht schon vorab zu kleinmütig sein, denn unter Umständen kann selbst die Feststellung, dass eine Sache mit einer anderen beinahe gar nichts zu tun hat, insofern zu Einsichten verhelfen, als die Beleuchtung der Differenzen verschiedenen Gegenständen genauere Konturen verleiht. Nur wenn sich herausstellt, dass ein Vergleich zum Verständnis weder des einen noch des anderen Objekts etwas beiträgt und auch nichts über Relationen irgendwelcher Art besagt, ist er gänzlich überflüssig. Grundsätzlich aber gilt: Man kann durchaus Äpfel mit Birnen vergleichen, genauso übrigens die Mücke mit dem Elefanten.
Die Kunstsparte Literatur mit ihrer unüberschaubaren Zahl von Autoren und Autorinnen, die unendlich viele Texte geschrieben haben, lässt sich denken als ein extrem differenziert gestaltetes Haus von überwältigender Größe: mit zahllosen Wohnungen unterschiedlichster Art, was ihre Position, ihre Größe, ihre Aufteilung und Ausstattung, ihre Erreichbarkeit und die Möglichkeiten zur Wahrnehmung der Außenwelt betrifft. In diesem Gebäude befinden sich die muffige kleine Kellerwohnung, von der man kaum nach draußen sehen kann, und die Luxusresidenz in einem oberen Stockwerk, von der aus man durch riesige Fenster weit in die Umgebung schaut, die biedere, vor allem nach praktischen Gesichtspunkten eingerichtete Wohnung und das avantgardistisch gestaltete Domizil direkt unterm Dach, das dem einen wie der Gipfel des architektonischen Fortschritts erscheint und dem anderen wie eine Ansammlung von Räumlichkeiten, bei denen man wegen der vielen schrägen Stellen vor allem darauf achten muss, sich nicht den Kopf zu stoßen. Vor Überraschungen ist man nie gefeit: Wenn man in einer Etage drei Wohnungen desselben Typs betrachtet hat, kann man bei der vierten auf eine stoßen, mit der man nie und nimmer gerechnet hätte. Einige Hausbewohner pflegen eine solide oder gar herzliche Gemeinschaft, aber viele haben nichts miteinander zu tun, kennen die Nachbarn nicht oder kaum und legen – was ihr gutes Recht ist – auch keinen Wert darauf, an diesem Zustand etwas zu ändern. Aber alle Wohnungen und damit auch die Bewohner stehen, von übergreifender Warte aus betrachtet, in einem Zusammenhang miteinander und sind durch zahllose Wände, Treppen, Aufzüge, Gänge, Türen, Decken, Leitungen und andere sichtbare wie unsichtbare Dinge miteinander verbunden. Es kann also durchaus reizvoll sein, die Besonderheiten der einen Wohnung durch den Vergleich mit einer anderen zu erläutern, auch wenn man da oft mehr von Differenzen zu reden hat als von Gemeinsamkeiten. Die Erläuterungen können mit Feststellungen zu Defiziten arbeiten – die eine Wohnung enthält dies und jenes nicht, das sich in der anderen findet –, aber es reicht bei Weitem nicht aus, ausschließlich damit zu argumentieren: Jede Wohnung, erscheine sie noch so klein und dürftig ausgestattet, verfügt aufgrund des Einflusses ihrer Nutzer über spezifische Eigenheiten und Besonderheiten.
So betrachtet, ist der Vergleich zwischen verschiedenen Schriftstellern und ihren Arbeiten – den verschiedenen Bewohnern und Wohnungen des Hauses Literatur – im Grundsätzlichen immer möglich, und das gilt im Fall von Goethe und May erst recht, wenn man an die obigen Zitate denkt. Am Ende müssen die Ergebnisse zeigen, wie sehr er sich lohnt.
Zu einem sinnvollen Vorgehen gehört es jedoch, sich vorab die Grenzen der möglichen Argumentation bewusst zu machen. Die Lebenszeiten Goethes und Mays schließen aus, ihre Tätigkeit konzentriert im Hinblick auf eine einzige historische Epoche zu deuten. Diese Sperre setzt, jenseits aller sonstigen Differenzen, einen ganz anderen Rahmen, als er sich etwa in dem eindrucksvollen Buch von Herfried Münkler über Karl Marx, Richard Wagner und Friedrich Nietzsche ergibt,4 jene drei Koryphäen des 19. Jahrhunderts, die bei aller Unterschiedlichkeit gemeinsam als wichtigste Revolutionäre der sogenannten bürgerlichen Epoche Deutschlands firmieren: Der älteste von ihnen, Wagner, ist 1813 geboren, der jüngste, Nietzsche, 1900, gestorben, sodass ihre Lebenszeiten insgesamt weit weniger als ein Jahrhundert umspannen und zum erheblichen Teil parallel verlaufen. Dagegen starb Goethe zehn Jahre vor Mays Geburt, und zwischen seinem Geburtstag und Mays Todestag liegen mehr als anderthalb Jahrhunderte. Freilich eröffnet sich in unserem Fall die Möglichkeit, historische Abläufe und Abhängigkeiten in den Blick zu nehmen, sodass aus dem Manko fehlender zeitlicher Nähe der Vorzug einer Personifikation geschichtlicher Entwicklungen wird.
Weitere Vorüberlegungen ergeben sich aus dem genaueren Blick auf die oben wiedergegebenen Zitate. Bei näherer Prüfung verweisen sie bereits, auch wenn wir sie bisher als Anstifter zu einem vergleichenden Blick gesehen haben, auf deutliche Unterschiede zwischen dem Weimarer Olympier und dem weithin der Kategorie Jugend- und Unterhaltungsliteratur zugerechneten Erfolgsschriftsteller. Bei Goethe geben Begriffe wie „Direktor“ und „Diplomat“ zu erkennen, dass er durchweg auf der Sonnenseite des gesellschaftlichen Lebens stand, während der „Trickbetrüger“ und „Sträfling“ im Falle Mays signalisieren, dass er zumindest vorübergehend eine radikal entgegengesetzte soziale Position einnahm. Goethe zugeordnete Wörter, wie „Liebe und Freundschaft“, „Ehemann“, „Vater“, heben auf Alltagserfahrungen ab, die das Genie auch in konventionelle Erfahrungswelten einordnen, wohingegen der „Angeber“ und „Schwerarbeiter“ May in diesem Zusammenhang gleich wieder mit besonderen Akzentuierungen ins Auge gefasst wird. Goethes Charakterisierung verzichtet vollständig darauf, ihn mit anderen Namen in Verbindung zu bringen, während dies bei May zweimal passiert, mit wiederum gegensätzlicher Tendenz: Ein „Epigone“ wirkt nicht unbedingt souverän, ein „Antagonist“ muss kulturgeschichtlich ernst genommen werden. Der Autor Eissler beendet seine Kurzbeschreibung nach dem Gedankenstrich mit Hinweisen auf das, was wir heute in erster Linie mit Goethe verbinden, auf das vielfältige literarische Werk, während der Autor Schleburg nicht einmal den „Romancier“ explizit benennt, als der May doch berühmt geworden ist, und seine Darlegungen in einen Begriff mit ironischem Beiklang münden lässt: „Tausendsassa“; ein Pendant dazu wäre wohl weniger der gelegentlich auf Goethe angewendete Begriff ‚Universalgenie‘ als vielmehr ‚Hansdampf in allen Gassen‘. So resultiert aus diesen Formulierungen, ihren Parallelen zum Trotz, in der Summe eine gewisse Hierarchisierung, und es trifft sich gut, dass der jüngere der beiden Autoren diese selbst durch seinen Tagebucheintrag bestätigt: In Anbetracht einer kulturgeschichtlichen Sehenswürdigkeit fällt Karl May zwar spontan ein, sich mit Goethe zu vergleichen, aber er markiert dabei eine unaufhebbare substanzielle Differenz, bei der er schlechter abschneidet – wie in dem Zitat, in dem er eben als „Goethe-Epigone“ figuriert.
Aus all dem resultieren, grob betrachtet, zwei zentrale Aufgaben für eine vergleichende Untersuchung. Zum einen sollte es darum gehen, zwei herausragende Schriftsteller und ihr Werk im Hinblick auf historische Zusammenhänge zu betrachten: Welche Befunde ergeben sich in Verbindung mit ihrer Zugehörigkeit zu verschiedenen – kulturellen, literarischen, aber auch politischen und gesellschaftlichen – Epochen? Zum anderen erscheint es reizvoll, die erkennbaren Differenzen zwischen zwei Schriftstellern, die für die gewaltige Breite und Vielfalt des Phänomens Literatur stehen, in den Fokus zu rücken: Es gilt, in Anlehnung an das Bild vom riesigen und vielgestaltigen Gebäude, höchst unterschiedliche Wohnungen zu besichtigen und damit Erkenntnisse zu sammeln über die im Einzelnen weit auseinanderklaffenden Verfahrensweisen, deren man sich unter dem gemeinsamen Dach der Literatur bedienen kann. Beide Aufgaben stehen in einem, nun ja, dialektischen Verhältnis zueinander: Plausible Einsichten zu historischer Kontinuität und historischen Brüchen lassen sich nur gewinnen unter Berücksichtigung der immensen Ausdehnung des von Goethe und May beackerten literarischen Feldes, während dieses seine Umrisse und Merkmale auch dank historisch veränderter Dispositionen gewinnt. Einfacher gesagt: Der jüngere Schriftsteller steht, irgendwie, in der Nachfolge des älteren, aber zugleich sind beide unendlich weit voneinander entfernt und auf den verschiedensten Ebenen, irgendwie, Antipoden.
Im Ersten Teil des folgenden Textes wird Grundlegendes über Goethe und May gesagt; danach werden einzelne Elemente ihrer Werke miteinander verglichen. Natürlich geht es primär stets um die Dinge, die einen Vergleich lohnend erscheinen lassen. Daraus ergibt sich, dass etliche Problemkomplexe weitgehend unbeachtet bleiben, die bei dem einen Autor der Erörterung würdig wären, zu denen es aber bei dem anderen weder eine Entsprechung noch einen im konstruktiven Sinne signifikanten Kontrast gibt; das gilt im Falle Goethes etwa in Bezug auf die von einem Teil der neueren Forschung postulierten dunklen Seiten seiner Tätigkeit als Staatsmann und Politiker, bei May für Details seiner Jahre als krimineller Vagabund und Häftling. In den Textvergleichen des Zweiten Teils konzentriert sich dann die Aufmerksamkeit bei Goethe ganz überwiegend auf die vier Romane Die Leiden des jungen Werther, Wilhelm Meisters Lehrjahre, Die Wahlverwandtschaften und Wilhelm Meisters Wanderjahre, bei May auf die ‚klassischen‘ Abenteuerromane um Old Shatterhand alias Kara Ben Nemsi und die ihm in anderen Texten, wie Die Sklavenkarawane, annähernd gleichgestellten Heldenfiguren; das geschieht unabhängig davon, ob es ein erzählendes Ich gibt, wie in der Winnetou-Trilogie, oder ein außenstehender Erzähler agiert, wie in Der Schatz im Silbersee und Sklavenkarawane. Texte mit anderer Gattungszugehörigkeit werden berücksichtigt, sofern sich dadurch ertragreich weitere Einsichten gewinnen lassen, wie etwa beim Thema Erotik.
Das vorliegende Buch ist in der Konzeption, in der Struktur und in maßgeblichen Befunden etwas Neues, stützt sich aber auch, wie schon angedeutet, auf eine Reihe von Vorarbeiten des Verfassers. Insofern zieht es zugleich die Summe einer sich über Jahrzehnte erstreckenden Beschäftigung mit den beiden Autoren, und so werden diese Vorarbeiten teils sinngemäß, teils – auch mit längeren Passagen – wörtlich einbezogen, ohne dass dies im Einzelnen ausgewiesen würde. Es handelt sich um folgende Publikationen:
Bücher:
–Karl May. Leben, Werk und Wirkung. Frankfurt a.M. 31992.
–Liebe, Ehe, Ehebruch. Ein Spannungsfeld in deutscher Prosa von Christian Fürchtegott Gellert bis Elfriede Jelinek. Opladen 1993.
–Der Schriftsteller Karl May. Beiträge zu Werk und Wirkung. Hrsg. v. Helga Arend. Husum 2000 (Sammlung von Aufsätzen).
–Friedrich Schiller. Marburg 2013.
–Karl May oder die Macht der Phantasie. Eine Biographie. München 22017.
–Die Winnetou-Trilogie. Über Karl Mays berühmtesten Roman. Bamberg/Radebeul 22019.
Aufsätze:
–Woran scheitert Werther? In: Schmiedt, Helmut (Hrsg.): „Wie froh bin ich, daß ich weg bin!“. Goethes Roman ‚Die Leiden des jungen Werther‘ in literaturpsychologischer Sicht. Würzburg 1989, S. 147–172.
–Zweierlei Schicksale. Zur Bearbeitung von Sturm-und-Drang-Texten durch ihre Autoren. In: Lenz-Jahrbuch. Sturm-und-Drang-Studien. Bd. 4, 1994, S. 113–122.
–Von Trauerrändern, Kamelexkrementen und Verwesungsgeruch. Karl Mays Umgang mit einer anderen Seite des abenteuerlichen Lebens. In: Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 2004, S. 105–119.
–Mays Umgang mit den Weimarer Klassikern. In: Pyta, Wolfram (Hrsg.): Karl May:Brückenbauer zwischen den Kulturen. Berlin 2010, S. 61–72.
–Karl May ist Christus. Wie ein berühmter Schriftsteller seine Helden und sich selbst inszeniert. In: Wiener Karl May Brief, 2014, Heft 3–4, S. 9–16.
–Komik extrem. In: Diekmannshenke, Hajo/Neuhaus, Stefan/Schaffers, Uta (Hrsg.): Das Komische in der Kultur. Marburg 2015, S. 69–83.
–„Die Liebe kommt dann schon von selbst.“. Karl Mays Dorfgeschichte ‚Der Giftheiner‘. In: Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 2015, S. 123–140.
–Mal hü, mal hott. Karl May und seine Publikationsorgane. In: Rudloff, Michael/Schäfer, Karl/Götz von Olenhusen, Albrecht (Hrsg.): „Ich? Ja, ich!“. Wie Karl May sich erfunden hat. Vorträge eines Symposiums der Akademie für Weiterbildung in Freiburg-Littenweiler. Sonderheft der Karl-May-Gesellschaft 156, 2016, S. 36–46.
–„... und laß das Büchlein deinen Freund sein“. Was der Leser Werther die ‚Werther‘-Leser lehrt. In: Merten, Stephan/Scherer, Gabriela/Hayer, Björn/Heintz, Kathrin (Hrsg.): Fakten und Vorbehalte. Festschrift für Lothar Bluhm zum 60. Geburtstag. Trier 2018, S. 27–38.
–Noch einmal: Goethe und Karl May. In: Mitteilungen der Karl-May-Gesellschaft 202, 51. Jg., 2019, S. 63–70.
–Der Verlust der einfachen Wahrheiten. Anmerkungen zu Leerstellen germanistischer Diskurse. In: Wirkendes Wort. Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 72. Jg., 2022, Heft 1, S. 121–135.
–Winnetou und Old Shatterhand – eine Freundschaft? In: Brenne, Andreas (Hrsg.): Blutsbrüder. Der Mythos Karl May in Dioramen. Bamberg/Radebeul 2022, S. 171–184.
Hinweise auf Arbeiten des Verfassers, die in diesem Rahmen weniger wichtig sind, finden sich in den entsprechenden Fußnoten.
Die Fußnoten weisen Literaturhinweise und Zitate mit Angabe von Autorennamen und Kurztiteln aus. Bei den Ausgaben der Werke Goethes und Mays werden Siglen verwendet. Nähere Angaben finden sich im Literaturverzeichnis am Ende des Buches.
Siglen:
Ich danke Florian Schleburg und Roderich Haug für die sorgfältige Lektüre des Textes und zahlreiche Verbesserungsvorschläge sowie Bernhard Schmid für die Aufnahme des Buches in die Grüne Reihe.
1Hermann Wohlgschaft:Karl May. Leben und Werk. Biographie. Bd. 3. Historisch-kritische Ausgabe (künftig: HKA). Abteilung IX. Band 1.3, S. 1543.
2Vgl. ebd. Bd. 2. HKA IX.1.2, S. 913f.
3Lowsky,OldShatterhand, S. 193.
4Vgl. Münkler,Marx.
ERSTER TEIL:Koryphäen der Literaturgeschichte
Lebens- und Werkchronik
Goethe
1749 Geburt als Sohn wohlhabender Eltern in Frankfurt a.M., 28. August.
1750 Geburt der Schwester Cornelia.
1765–68 Studium in Leipzig. Beziehung zu Anna Katharina Schönkopf (Kätchen). Lieder über Annette; Die Laune des Verliebten. Im Juli 1768 schwere Erkrankung mit Blutsturz.
1768–70 Frankfurt. Vorübergehend Annäherung an pietistische Kreise.
1770–71 Studium in Straßburg. Bekanntschaft mit Johann Gottfried Herder und Jakob Michael Reinhold Lenz. Beziehung zu Friederike Brion im benachbarten Sesenheim.
1771 Rückkehr nach Frankfurt. Tätigkeit als Anwalt. Intensivierung der literarischen Projekte. Zum Schäkespears Tag.
1772 Mitarbeit bei den von Johann Heinrich Merck herausgegebenen Frankfurter Gelehrten Anzeigen, einem für die Ästhetik des Sturm und Drang zentralen Publikationsorgan. Von Mai bis September am Reichskammergericht in Wetzlar. Enge Freundschaft mit Charlotte Buff und ihrem Verlobten Christian Kestner. Auf dem Rückweg nach Frankfurt Besuch bei Sophie von La Roche, in deren Tochter Maximiliane Goethe sich verliebt.
1773–74 Frankfurt. Literarische Tätigkeit in den verschiedensten Gattungen. Prometheus (1773); Götz von Berlichingen (1773). Problematische Wiederbegegnung mit der inzwischen verheirateten Maximiliane. Die Leiden des jungen Werthers (1774); der Roman macht Goethe international zu einem berühmten Autor.
1775 Beziehung zu Anna Elisabeth Schönemann (Lili), vorübergehend Verlobung. Reise mit Freunden in die Schweiz. Im Herbst lädt Karl August, Herzog von Weimar, Goethe dorthin ein, und Goethe folgt der Einladung; Weimar wird fortan sein Lebensmittelpunkt. Bekanntschaft mit Charlotte von Stein.
1776 Goethe wird zum Mitglied des Geheimen Consiliums in Weimar ernannt und erhält ein festes Gehalt. In der ersten Zeit seines Aufenthalts pflegt er gemeinsam mit dem jungen Herzog einen an jugendliche Freiheits- und Ungebundenheitsideale erinnernden Lebensstil: Unterwegssein, Trinken, Tanzen, Flirten. Besuch von Freunden aus der Sturm-und-Drang-Zeit.
1777–86 Während die literarische Arbeit weitgehend stagniert, übernimmt Goethe zahlreiche bürokratische und politische Aufgaben. 1782 Adelsdiplom. Verschiedene Reisen, darunter eine weitere in die Schweiz. Goethe wendet sich naturwissenschaftlichen und medizinischen Problemen zu und findet 1784 den Zwischenkieferknochen beim Menschen.
1786–88 Unter konspirativen Umständen angetretene Reise nach Italien mit längeren Aufenthalten in Rom, wo Goethe eine sexuelle Beziehung mit einer Einheimischen unterhält. Ausgeprägte Pflege kultureller und naturwissenschaftlicher Interessen. Wiederbelebung der literarischen Arbeit. Kurz nach der Rückkehr 1788 lernt Goethe in Weimar Christiane Vulpius kennen, sie wird seine Geliebte. Die politischen Aufgaben werden reduziert.
1789 Im Dezember Geburt des Sohns August.
1790 Abschluss einer achtbändigen Werkausgabe mit einem Faust-Fragment sowie Tasso, Iphigenie und Egmont. Reise nach Venedig.
1791–93 Fortsetzung der politisch-organisatorischen Arbeit in kleinerem Rahmen sowie der literarischen Tätigkeit. 1792 mit dem Herzog auf dem Feldzug gegen Frankreich.
1794 Beginn der Freundschaft mit Friedrich Schiller und ihrer Kooperation auf literarischem und literaturpolitischem Gebiet; wechselseitig Ratschläge und Urteile zu neu entstehenden Werken.
1795–98 Weitere Reisen. 1796 schließt Goethe seinen zweiten Roman ab, Wilhelm Meisters Lehrjahre.
1799–1805 Schiller zieht 1799 nach Weimar um und arbeitet bis zu seinem Tod (1805) weiter mit Goethe zusammen. Erkrankungen Goethes 1801 und 1805.
1806 Besetzung Weimars durch französische Truppen. Eheschließung mit Christiane, nachdem sie in der heiklen Situation erheblich souveräner reagiert hat als Goethe.
1807 Goethe verliebt sich in die deutlich jüngere Minna Herzlieb. Arbeit an verschiedenen Projekten, darunter die Farbenlehre.
1808 Faust I. Begegnung mit Napoleon Bonaparte in Erfurt.
1809 Die Wahlverwandtschaften. Beginn der Arbeit an Dichtung und Wahrheit.
1810–12 Weitere Begegnungen mit prominenten Persönlichkeiten, darunter Kaiserin Maria Ludovica von Österreich und Ludwig van Beethoven. 1812 ist Weimar wiederum intensiv von den Kriegsereignissen betroffen.
1813–15 Beschäftigung mit Gedichten von Hafis, die Goethe zu eigener Lyrik inspirieren. Beziehung zu Marianne von Willemer und Kooperation mit ihr. 1815 letzter Besuch in Frankfurt.
1816 Tod Christianes.
1817–18 Goethe wird als Theaterleiter in Weimar entlassen. Fortsetzung der naturwissenschaftlichen Arbeit. 1818 in Karlsbad ein weiterer der mittlerweile zur Regel gewordenen Kuraufenthalte.
1819 West-östlicher Divan.
1820–24 Weitere Kuraufenthalte. Wilhelm Meisters Wanderjahre, erste Fassung (1821). 1823 lebensgefährliche Herzerkrankung. Johann Peter Eckermann kommt nach Weimar und wird zum wichtigen Gesprächspartner. Während seiner Aufenthalte in Marienbad verliebt sich Goethe in Ulrike von Levetzow, die seinen Heiratsantrag jedoch ablehnt. Marienbader Elegie.
1825 Goethe lebt seit fünfzig Jahren in Weimar.
1826–27 Vereinbarung mit Cotta über eine umfangreiche Ausgabe letzter Hand. Lektüre von Werken neuerer fremdsprachiger Autoren wie James Fenimore Cooper, Victor Hugo und Walter Scott, während Goethe von der deutschen Gegenwartsliteratur dieser Zeit nichts hält.
1828 Tod des Herzogs Karl August.
1829 Wilhelm Meisters Wanderjahre, zweite Fassung.
1830 Goethes Sohn August stirbt in Rom.
1831 Testament. Ende der Arbeit an Faust II und dem vierten Teil von Dichtung und Wahrheit.
1832 Neuerliche Erkrankung. Goethe stirbt am 22. März in Weimar.
May
1842 Geburt in einer Weberfamilie in Ernstthal, 25. Februar.
1856–60 Ausbildung am Lehrerseminar in Waldenburg, die May wegen verschiedener kleiner Vergehen nicht abschließen darf.
1861 Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung am Lehrerseminar in Plauen.
1861–62 Kurze Tätigkeit als Lehrer. Der Mitbewohner seiner Unterkunft bezichtigt May eines Diebstahls, und May wird zu einer sechswöchigen Gefängnisstrafe verurteilt.
1863 Nach der damit verbundenen Streichung aus der Liste der Schulamtskandidaten hält sich May wieder in seiner Vaterstadt auf, erteilt Privatunterricht und führt musikalisch-deklamatorische Abendveranstaltungen durch.
1864–65 May als krimineller Vagabund, der Diebstähle, Betrügereien und Hochstapeleien begeht.
1865–68 Vierjährige Haftstrafe, die May im Arbeitshaus Schloss Osterstein in Zwickau verbüßt. Vorzeitige Entlassung im November 1868 wegen guter Führung.
1869–70 Fortsetzung der kriminellen Karriere mit ähnlichen Delikten wie zuvor. Insbesondere reüssiert May als Gauner, wenn er sich vor seinen Opfern als eine höhergestellte Persönlichkeit ausgibt.
1870–74 May wird zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, die er im Zuchthaus Waldheim absitzt. Im September 1872 erscheinen in einem Kalender als Mays vermutlich erste literarische Veröffentlichungen drei kleine Gedichte.
1875–77 Tätigkeit als Redakteur und Autor im Verlag von Heinrich Gotthold Münchmeyer, Dresden. May betätigt sich in verschiedenen Genres, von Sachtexten über Dorfgeschichten und Humoresken bis zu Abenteuer-erzählungen.
1877–78 Redakteur und Autor für eine Zeitschrift des Verlegers Bruno Radelli, Dresden. May siedelt seine Erzählungen zunehmend auf exotisch-abenteuerlichen Schauplätzen an.
1879 Nachdem May als vorgeblich höhere Amtsperson zu einem mysteriösen Todesfall in seiner Bekanntschaft recherchiert hat, wird er zu seiner letzten, dreiwöchigen Gefängnisstrafe verurteilt, die er in seinem Heimatort absitzt. Erste Veröffentlichung einer Abenteuererzählung in der katholischen Zeitschrift Deutscher Hausschatz, deren Mitarbeiter May über Jahrzehnte hinweg bleiben wird.
1880 Eheschließung mit Emma Pollmer.
1881 Beginn der Veröffentlichung jenes umfangreichen Romans im ›Hausschatz‹, der ein Jahrzehnt später unter Buchtiteln von Durch die Wüste (zunächst: Durch Wüste und Harem) bis Der Schut die Reihe seiner Gesammelten Reiseromane eröffnen wird.
1882–86 Nach einer Wiederbegegnung mit Münchmeyer schreibt May für ihn, beginnend mit Das Waldröschen, fünf in Fortsetzungen veröffentlichte Romane, wegen der Vertriebsform auch Kolportageromane genannt, die sich in ihrem sensationellen Gestus deutlich von den seriöser wirkenden Abenteuererzählungen unterscheiden.
1887–91 Neben der Fortsetzung der Arbeiten für den Hausschatz verfasst May einige seiner bekanntesten Romane für die Knabenzeitschrift Der Gute Kamerad, darunter Der Schatz im Silbersee.
1892 Im Verlag von Friedrich Ernst Fehsenfeld, Freiburg, beginnen Carl May’s gesammelte Reiseromane zu erscheinen.
1893 Winnetou, der Rote Gentleman.
1894–98 Der Erfolg der Fehsenfeld-Bände beschert May ein hohes Einkommen und ermöglicht den Erwerb und Bezug der ‚Villa Shatterhand‘ in Radebeul. May tritt immer wieder mit der Behauptung hervor, er sei im buchstäblichen Sinne identisch mit seinem Ich-Helden Old Shatterhand alias Kara Ben Nemsi und schildere im Wesentlichen persönliche Erlebnisse.
1899–1900 Orientreise, die von Kairo über Orte wie Jerusalem, Beirut und Damaskus bis nach Sumatra führt, zunächst allein und dann in Begleitung Emmas und des befreundeten Ehepaars Plöhn. Beginn publizistischer und später auch juristischer Auseinandersetzungen um Person und Werk.
1901–02 Eine literarische Neuorientierung wird mit Titeln wie Himmelsgedanken, einer Sammlung von Gedichten und Aphorismen, und Et in terra pax unübersehbar.
1903 Scheidung von Emma, Eheschließung mit Klara Plöhn, deren Mann 1901 verstorben ist.
1904–07 Deutlicher Rückgang der Verkaufszahlen, Fortsetzung der öffentlichen Querelen. In seinem letzten Jahrzehnt wird May mehrfach von schweren Erkrankungen heimgesucht. Frau Pollmer, eine psychologische Studie (1907).
1908 Kurze Amerikareise mit Klara.
1909–11 Der Streit mit dem Journalisten Rudolf Lebius, der – z.T. verfälschend – Mays Vorstrafen öffentlich bekannt macht, kulminiert in der auch vor Gericht verhandelten Frage, ob man May einen „geborenen Verbrecher“ nennen darf. Mein Leben und Streben (1910).
1912 Vortrag Empor ins Reich der Edelmenschen im Wiener Sophiensaal; im Publikum befindet sich die Friedens-nobelpreisträgerin Bertha von Suttner. May stirbt am 30. März in Radebeul
Wirkung und Rezeption
Wissensdurst
Die in den Vorbemerkungen wiedergegebenen Zitate lassen sich verstehen als Anregungen zu einer vorsichtigen, sachlich begründbaren Gegenüberstellung von Goethe und May. Zugleich sind sie, streng genommen, Dokumente der außerordentlichen Wirkungsgeschichte dieser beiden Schriftsteller, der enormen Resonanz, die sie und ihr Werk beim Publikum, bei der Kritik und in der für sie zuständigen Fachwissenschaft gefunden haben. Wir wollen zunächst dieser Spur weiter folgen: Gibt es, über die pauschale Feststellung vielfältiger Tätigkeiten und herausragender Leistungen hinaus, auf dem Gebiet der Rezeption etwas, das einen engeren Zusammenhang stiftet? Unterstützt der intensive Umgang, den Literaturfreunde und professionelle Experten mit diesen Heroen der Kulturgeschichte getrieben haben, auch in Details den Gedanken, sie gemeinsam in den Blick zu nehmen? Wir nähern uns Goethe und May also zunächst gewissermaßen von außen, um zu erkunden, in welchem Umfang sich dort etwas von den Übereinstimmungen und Unterschieden spiegelt, die wir einleitend unterstellt haben.
Die erste, nicht gerade überraschende Erkenntnis, die sich beim Studium der zahllosen Rezeptionsdokumente gewinnen lässt, lautet: Eine große Gemeinsamkeit besteht darin, dass man grenzenlos neugierig ist und alles über die beiden wissen und festhalten will, was sich überhaupt nur dingfest machen lässt; die systematische, mit ausuferndem Elan betriebene Rekonstruktion möglichst aller greifbaren Elemente in Leben und Werk ist ein allgegenwärtiges Anliegen. Bücher wie Goethes Leben von Tag zu Tag. Eine dokumentarische Chronik in acht Bänden (1982ff.) und eine Karl-May-Chronik (2005f.) in fünf Bänden vollziehen einen ebenso langwierigen wie präzisen Weg durch die Vita, der eng den vielen überlieferten Quellen folgt und auch nebensächlichste Details erfasst. Man findet zudem diverse Nachschlagewerke mit Titeln wie Goethe-Handbuch, Goethe-Lexikon, Goethes Weimar. Das Lexikon der Personen und Schauplätze und Who’s who bei Goethe sowie Das große Karl May Figurenlexikon, Geografisches Lexikon zu Karl May, Das neue Lexikon rund um Karl May und sogar Das Karl-May-Tierlexikon; auch in diesen Fällen handelt es sich teilweise um mehrbändige Projekte, bei beiden Autoren. Immer neue Biografien beleuchten unter wechselnden Vorzeichen und mit unterschiedlicher Ausführlichkeit die Lebensläufe oder Teile davon. Immer neue Detailstudien fördern immer neue Einzelheiten zu wesentlichen oder peripheren Ereignissen zutage: Goethes zweimaliger Kuraufenthalt in Wiesbaden zog eine dreibändige Dokumentation im Gesamtumfang von 1.392 Seiten nach sich, Karl Mays Bekanntschaft mit einer ansonsten völlig unbekannten Verehrerin eine 460 Seiten umfassende.5
Das letztgenannte Beispiel lehrt, dass auch Personen der Umgebung beharrliche Aufmerksamkeit gilt: Wem wären heute noch Ulrike von Levetzow oder der ‚Kunschtmeyer‘ (Heinrich Meyer), Lu Fritsch oder Friedrich Ernst Fehsenfeld bekannt, gäbe es nicht die Beziehung zu denen, die allen bekannt sind? Dass sich derart weit ausgreifende Erkenntnisse häufig dem Engagement von Forschern und Liebhabern verdanken, die mit einigem Fanatismus auf dieses eine große Objekt fixiert sind, liegt auf der Hand; der Eckermann zum Goethe ist ja beinahe sprichwörtlich geworden. Ebenso liegt auf der Hand, dass es fortlaufend umfangreicher bibliografischer Erfassungsmaßnahmen bedarf, den Wust an Publikationen halbwegs überschaubar zu halten. Das Goethe-Jahrbuch weist regelmäßig einen umfangreichen Teil mit Rezensionen auf – der z.B. im Jahrgang 2014 fünfundzwanzig Bücher vorstellt –, das Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft einen Literaturbericht.
Die andere, dunkle Seite des unersättlichen Drangs zum Sammeln und Vermessen bilden Mythen und Legenden um Momente der Lebensgeschichte, die nach wie vor geheimnisvoll erscheinen. Hat Goethe tatsächlich auf der Italienreise erstmals mit einer Frau geschlafen, und aus welchem Grund musste sein früherer Freund Jakob Michael Reinhold Lenz Weimar plötzlich verlassen? Was ist mit May im Verlauf seiner Orientreise 1899/1900 geschehen, dass er als ein psychisch weitgehend veränderter Mensch zurückkehrte, und stimmt das Gerücht, dass er Vater eines unehelichen Kindes oder gar mehrerer war? Ebenso wirken manchmal die Beziehungen zwischen biografischer Realität und literarischer Fiktion höchst rätselhaft. Wie kann es sein, dass Goethe 1783 in Weimar der Hinrichtung einer Frau zustimmte, die als ‚Kindsmörderin‘ verurteilt worden war, obwohl er vorher in der ersten Fassung der Gretchen-Tragödie das Schicksal einer genauso handelnden jungen Mutter mit viel Verständnis gezeichnet hatte? Wieso war May in der Lage, im Jahr 1907 neben dem utopischen, eine friedlich-harmonische Zukunft der Menschheit herbeibeschwörenden Roman Ardistan und Dschinnistan einen langen Text über seine erste Ehefrau zu verfassen, Frau Pollmer, eine psychologische Studie, der von Hass und Abscheu nur so strotzt? Zu Fragen dieser Art gibt es oft keine hinreichend belegbaren Antworten, und so kommt es, dem umfangreichen Wissen über die Autoren zum Trotz, immer wieder zu neuen Spekulationen.
Einiges in diesem Bereich streift ans Skandalöse, und an gierig aufgenommenen Skandalen um Leben und Werk hat es bei unseren Autoren auch ansonsten nicht gefehlt. Goethes Beziehung zu Christiane Vulpius erschien der vornehmen Weimarer Gesellschaft als eine ganz und gar unziemliche Angelegenheit und wurde hämisch mit Klatsch und Tratsch bedacht, zumal sie erst nach Jahren eine Legalisierung durch Heirat erfuhr; etliche seiner Publikationen galten unter den Vorzeichen von Sitte und Moral als höchst bedenklich. May erlebte einen tiefen Sturz in der Gunst des Publikums, als sich um 1900 herausstellte, dass er in der Vergangenheit kriminell gewesen war und mehrere Jahre in Haftanstalten verbracht hatte; auch wurde zu dieser Zeit bekannt, dass er einst unter Pseudonym Romane veröffentlicht hatte, die nach den damaligen Geschmacksvorstellungen nahezu pornografische Züge enthielten.
Zu den Besonderheiten der biografischen Beschäftigung mit beiden Autoren gehört ferner, dass gelegentlich Aufsehen erregende Theorien verbreitet werden, nach denen es um wesentliche Elemente ihres Lebens und Arbeitens in Wahrheit ganz anders bestellt war, als bisher weithin vermutet wurde. Im Jahr 2003 erschien ein Buch von Ettore Ghibellino, J.W. Goethe und Anna Amalia – eine verbotene Liebe, demzufolge es in Weimar eine bis ins Intime reichende Liebesbeziehung zwischen dem jungen Goethe und der Herzogin Anna Amalia gegeben hat; die bekannte Korrespondenz zwischen Goethe und Charlotte von Stein sei in Wirklichkeit eine zwischen Goethe und der Herzogin gewesen, und die Hofdame habe lediglich als weiblicher Strohmann gedient, um das vor der Öffentlichkeit nicht zu rechtfertigende Verhältnis zu kaschieren. Während diese These in der allgemeinen Goethe-Forschung – um es diplomatisch zu formulieren – wenig Anklang gefunden hat, zog gleichzeitig im anderen Fall die spektakuläre Revision eines zentralen biografischen Komplexes zwar einige Kritik auf sich, erntete am Ende aber ganz überwiegend Zustimmung. Lange Zeit hatte man auf die in Mays Selbstbiografie formulierte Information vertraut, er sei kurz nach seiner Geburt vollständig erblindet und erst nach einigen Jahren dank ärztlicher Kunst genesen; daraus ließen sich weitreichende Folgerungen zu seiner psychischen Entwicklung und den Besonderheiten der späteren Fantasieprodukte ziehen. An der Wende zum 21. Jahrhundert jedoch wurde diese Episode in einer medizinischen Dissertation zu einer „ophthalmologische[n] Unmöglichkeit“ erklärt und interpretiert „als nachträgliche Heroisierung oder gar Allegorisierung“6 eines vom Schicksal schwer getroffenen Menschen.
Wenn man sich die genannten mehrbändigen Werke zur Chronologie der Lebensgeschichten etwas genauer anschaut, stößt man bei aller Übereinstimmung auch wieder auf eine Differenz. Verständlich ist, dass sich die für solche Projekte notwendigen Quellen häufen, je älter und berühmter die betreffenden Personen werden: Die Verbindungen, in denen sie stehen, nehmen tendenziell zu; die Aufmerksamkeit, die sich auf sie konzentriert, wird immer größer, und so gibt es die Dokumente, auf die spätere Forschungen zur Lebensgeschichte zurückgreifen müssen, in kontinuierlich wachsendem Maße. In Goethes Leben von Tag zu Tag zeigt sich dies darin, dass der erste Band das gesamte erste Vierteljahrhundert in Goethes Leben behandelt (1749–75), ein mittlerer dagegen acht Jahre (Bd. 4: 1799–1806) und der letzte gar nur fünf (Bd. 8: 1828–32). Diese Diskrepanz findet sich auch bei May, aber hier fällt sie noch extremer aus: Band 1 der Karl-May-Chronik deckt mit dem Zeitraum 1842–1896 nicht weniger als 54 Jahre ab, und die vier Folgebände gelten dann den verbleibenden sechzehn, wobei der letzte, Band 5, sich auf nicht mehr als drei konzentriert.
Verantwortlich für diese zwar im Grundsätzlichen gleichen, dann aber doch noch sehr unterschiedlichen Proportionen sind in erster Linie zwei Dinge: die jeweilige Herkunft und der Zeitpunkt des Karrierebeginns. Goethe entstammte einer vermögenden, prominenten, einflussreichen und dem Schreiben zugeneigten Familie der Reichsstadt Frankfurt; May kam im proletarischen Milieu des erzgebirgischen Provinzorts Ernstthal zur Welt. Goethes Karriere nahm Fahrt auf, kaum dass er das zwanzigste Lebensjahr erreicht hatte, und bereits mit dem 1774 veröffentlichten Roman Die Leiden des jungen Werther wurde er zu einem europaweit bekannten Starschriftsteller; Karl May schlug sich in dem Lebensalter, da Goethe reüssierte, als Kleinkrimineller durch, wurde inhaftiert, publizierte erst ab Mitte der 1870er-Jahre regelmäßig – also in seinen dreißiger Jahren – und brauchte noch einmal ca. anderthalb Jahrzehnte, um berühmt und reich zu werden. Es leuchtet ein, dass man unter diesen Umständen über die ersten Jahre und Jahrzehnte Goethes erheblich mehr aussagekräftige Materialien findet als über den gleichen Zeitraum im Leben Mays. Deren exzessive Fülle in späten Jahren hängt im Übrigen auch damit zusammen, dass May hier – nach der Aufdeckung seiner dubiosen Vergangenheit – zu einer skandalumwitterten Person wurde, mit der sich die entsprechend interessierte Presse ausgiebig beschäftigte.
Interpretationswut
Auch über die Arbeit an Daten und Fakten hinaus ist das Interesse gewaltig. Goethes Werk wurde, was Kommentare, Analysen und Interpretationen betrifft, von der deutschen Literaturwissenschaft vermutlich häufiger und intensiver besprochen als das jedes anderen Schriftstellers; in gut ausgestatteten Fachbibliotheken füllt die Goethe-Literatur viele Regale, und Recherchen zu Goethes Internet-Präsenz bestätigen die anhaltende Aufmerksamkeit. Das große Interesse setzte schon zu seinen Lebzeiten ein und hat sich, mit kleinen zwischenzeitlichen Schwankungen, bis heute erhalten. So spiegelt sich in der Goethe-Forschung zwangsläufig die gesamte Geschichte der Germanistik. Der Positivismus ihrer Frühzeit zeigt sich von seiner umtriebigsten Seite, und die geistesgeschichtliche Orientierung der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts lässt sich ebenso ertragreich an Goethe-Arbeiten studieren wie alle späteren methodischen und modischen Verfahrensweisen. Der Verfasser des vorliegenden Buches hat daher den Versuch unternehmen können, die Geschichte einer speziellen analytischen Tradition anhand eines einzigen Goethe-Romans umfassend zu dokumentieren.7
Von einer seriösen May-Forschung ist demgegenüber erst seit den späten 1960er-Jahren zu reden, denn der Ruf dieses Schriftstellers entsprach lange Zeit nicht den Anforderungen, die eine auf kulturelle Höchstleistungen fixierte Fachwissenschaft an ihre Objekte stellte. Dann aber profitierte May von der „Veränderung oder Erweiterung des Literaturbegriffs“, einem Vorgang, mit dem die Germanistik nun „auch das bisher als trivial Verrufene, das lange Zeit Ignorierte und Verfemte“8 unter ihre Fittiche nahm. Mit der May-Forschung ging es rasch aufwärts, und im Zuge dieser Entwicklung wurde manches von dem nachgeholt, was bei Goethe über viele Jahrzehnte hinweg gediehen war: Auch in diesem Fall traten – z.T. mit unvermeidlicher Verspätung – die allermeisten Verfahrensweisen der germanistischen Literaturwissenschaft markant hervor, und so stellt sich nun auch die May-Forschung, freilich in weitaus bescheidenerem Maße, als ein Spiegel der Geschichte des Faches dar bzw. als ein Kompendium, in dem deren Stationen in besonders dichter Zusammenballung hervortreten.
Festzuhalten ist allerdings, dass an ihr in auffällig großer Zahl Experten beteiligt waren, die keineswegs dem akademischen Fach Germanistik angehörten. So bringt man den Aufschwung der May-Forschung zu Recht in engste Verbindung mit der Gründung der Karl-May-Gesellschaft (1969); deren Vorsitzender war Jahrzehnte lang kein Philologe, sondern der Jurist Claus Roxin, und zu ihren Mitgliedern zählten stets mit weit höherem Anteil als in anderen literarischen Gesellschaften Menschen ohne jeglichen beruflichen Bezug zur Literaturwissenschaft. Die Goethe-Forschung hat zwar ebenfalls von der Tätigkeit nicht professionell an sie gebundener Laien und Liebhaber erheblich profitiert; die May-Forschung aber ist zum erheblichen Teil eine von kompetenten Laien und Liebhabern.
Nicht nur das Gesamtbild der schriftlichen Rezeption bietet Übereinstimmungen. Auch in vielen einzelnen Bestandteilen lassen sich Parallelen entdecken, und sie beginnen bereits bei dem elementarsten Problem: der Bereitstellung der künstlerischen Erzeugnisse. Bei beiden Schriftstellern gibt es die unterschiedlichsten Bemühungen, das Werk editorisch zu betreuen bzw. – nüchterner betrachtet – zu vermarkten, und das hat zu einer kaum überschaubaren Fülle von Gesamt-, Teil- und Einzelausgaben geführt. Im Falle Mays beruhen diese Editionen in vielen Fällen auf postumen Bearbeitungen: Nicht die zu Mays Lebzeiten veröffentlichten Texte wurden wiedergegeben, sondern sprachlich gravierend veränderte und inhaltlich abgewandelte, gekürzte oder erweiterte Versionen, von denen man größtmögliche Verkäuflichkeit erwartete. So kann man sagen, dass ein großer Teil der Leserschaft Mays Werk anhand von Texten kennengelernt hat, die man bei streng philologischer Betrachtung gar nicht als von May verfasst betrachten kann; bei Goethe existiert diese Tradition nur in bescheidenem Umfang.
Auch die künstlerischen Nebentätigkeiten sind gründlich dokumentiert: Goethe ist als Zeichner dem Interessierten ebenso leicht zugänglich wie May als Komponist. Man kann sich z.B. Goethes Zeichnung von Schloss Kochberg in einer großformatigen Reproduktion an die Wand hängen und Mays Lied ‚Ave Maria‘ – das laut Band III der Winnetou-Trilogie von deutschen Siedlern gesungen wird, als Winnetou im Sterben liegt – in einer Aufnahme des Dresdner Kreuzchors zu Gemüte führen.
Nicht alle Schöpfungen der beiden riefen bei ihren Verehrern uneingeschränktes Wohlwollen hervor, und auch darauf hat die Editionsgeschichte reagiert. Viele Goethe-Herausgeber scheuten sich, den Lesern das Tagebuch zuzumuten, jenes heikle Gedicht, dessen Protagonist in einer delikaten Situation sexuell versagt – ein höchst anrüchiges Thema. Analog dazu dauerte es länger als ein halbes Jahrhundert, bis der Karl-May-Verlag die Schrift Frau Pollmer, eine psychologische Studie publizierte,9 die schon erwähnte derbe, Verweise auf Intimes nicht scheuende Polemik Mays gegen seine erste Ehefrau. Ferner gibt es sowohl bei Goethe als auch bei May ein paar Texte, bei denen ihre Autorschaft bzw. der Grad ihrer Beteiligung an der Entstehung nicht über jeden Zweifel erhaben ist, und entsprechend schwer tun sich damit die Herausgeber.
Vielfalt und Dissonanzen ergeben sich aber nicht nur bei editorischen Bemühungen und den divergierenden methodischen Verfahrensansätzen, sondern erst recht in den konkreten Ergebnissen des interpretierenden und analysierenden Umgangs mit den Werken; es scheint, als habe auch da der Weimarer dem ‚anderen‘ Klassiker, als den Gert Ueding May bezeichnete,10 nur in quantitativer Hinsicht einiges voraus. Vergleicht man beispielsweise eine marxistische Werther-Interpretation, die in den 1950er- oder 60er-Jahren in der DDR publiziert wurde, mit einer werkimmanent ausgerichteten, die zur gleichen Zeit in der Bundesrepublik erschien, sowie mit einer vom Geist Jacques Lacans geprägten aus späterer Zeit und einer Pierre Bourdieu verpflichteten aus noch jüngerer Vergangenheit, so wird man oft nur mit einiger Anstrengung davon überzeugt bleiben, dass sie sich mit demselben Roman befassen – zu unterschiedlich sind die gedanklichen Ausgangspunkte, Bewegungen und Befunde. Während liberal eingestellte Kommentatoren angesichts dieser Situation die Überzeugung vertreten, man könne literarische Werke generell unter den verschiedensten Perspektiven betrachten und müsse sich nicht auf die Priorität dieses oder jenes Ansatzes und einer daraus resultierenden Erkenntnis festlegen, betonen andere den notwendigen Vorrang einer einzigen, für elementaren wissenschaftlichen Fortschritt stehenden Orientierung. Auch die May-Forschung kennt seit Langem diese zugespitzte Konfrontation, den Streit um den wenn nicht allein ‚richtigen‘, so doch unbedingt zu bevorzugenden Umgang mit ihrem Objekt. Als ein Rezensent des Jahrbuchs der Karl-May-Gesellschaft die ausschließliche Konzentration auf die Person May rügte und „Abhandlungen über Pauperismus, Militarismus, Kolonialismus oder über Schulwesen, Arbeiterbildung, Kolportagehandel und Informationsmarkt“11 anmahnte, antwortete der Jahrbuch-Herausgeber Hans Wollschläger nicht weniger streng, „mit Abhandlungen über Ismen wäre es nichts.“12 Jahrzehnte später tadelte ein Autor, der selbst auf ein historisch eingebundenes Verständnis der Texte Mays setzte, die „pseudopsychologischen Deutungen“,13 die zeitweise in der Forschung eine große Rolle spielten.
Aber auch da, wo man sich über die methodischen Ansätze und zentralen Erkenntnisinteressen weitgehend einig ist, kommt es zu divergierenden Ergebnissen. Diejenigen, die Goethe primär unter politisch-ideologiekritischen Prämissen lesen, streiten darüber, ob es sich um einen reaktionären ‚Fürstenknecht‘ – schließlich diente er einem absolutistischen Herrscher als kulturelles Aushängeschild – oder einen progressiv-bürgerlichen Humanisten handelt; in Entsprechung dazu gilt May den einen als Rassist und Wegbereiter des Nationalsozialismus – angeblich war er ein Lieblingsschriftsteller Adolf Hitlers – und den anderen als Vertreter einer utopisch auf Freiheit und Selbstbestimmung gerichteten Literatur. Die einschlägigen Auseinandersetzungen mögen für außenstehende Betrachter manchmal die Grenze des Kuriosen streifen, zumal Einigkeit nicht einmal in Bezug auf ein einzelnes Werk festzustellen ist. In der Abteilung Psychologische Annäherungen eines Sammelbandes zum Winnetou-Mythos finden sich mehrere biografisch-tiefenpsychologisch ausgerichtete Abhandlungen, in denen die Figur des Indianerhäuptlings nacheinander als Objekt homosexueller Begierden, als Mutter-Imago und als Stellvertreter der Ehefrau Karl Mays gedeutet wird.14 Das Pendant dazu entstammt der Bilanz eines Werther-Sammelbandes zum psychologischen Verständnis der Titelfigur: „Diagnostiziert der eine Kommentator einen ‚nervösen Charakter‘, so setzt der andere auf die Karte einer zu schwach ausgeprägten Ich-Abwehr gegenüber dem Sog des unbewussten Selbst, während der dritte mit einer narzißtischen Regression argumentiert und der vierte die Besonderheiten eines bestimmten psychologischen Typs ins Zentrum rückt.“15
Wer bei seinen Untersuchungsobjekten Eigenarten findet, die unerfreulich und peinlich wirken, kann auf einen großen Fundus exkulpierender Erklärungen zurückgreifen; das gilt bei Goethe etwa für die erwähnte These vom ‚Fürstenknecht‘ oder für den Umgang mit Frauen, dessen fragwürdige Seiten der Psychoanalytiker Kurt R. Eissler auf eine arg belastende Bindung an die Schwester Cornelia zurückführt.16 Bei May ist solch ein kritischer Punkt die unübersehbare Vorliebe für nationale, rassische und kulturelle Klischees, die gerade im Lichte anderslautender Äußerungen desselben Autors besonders auffallen. Man relativiert sie teils mit der Einschätzung, im Vergleich zu vielen Zeitgenossen erschienen Mays Stereotypen moderat, teils mit der Betonung der poetischen Lizenz, die einem Schriftsteller im Umgang mit der Realität zuzugestehen sei, und teils mit dem Hinweis auf ähnlich gestimmte historische Quellen, die May als verlässlich ansah und deshalb gewissenhaft reproduzierte.
Eine weitere Parallele findet sich in der unterschiedlichen Wertschätzung verschiedener Phasen der literarischen Entwicklung. Goethe wie May folgen im Alter ganz anderen künstlerischen Vorstellungen als in früheren Jahren, und dementsprechend gibt es beträchtliche Diskrepanzen in der Konzeption ihrer jeweiligen Texte, auch wenn sie durch gleich bleibende Gattungsbezeichnungen miteinander verbunden sind. Besonders fällt dies dann auf, wenn die späten Werke sich als unmittelbare Fortsetzung der früheren darstellen und man als Leser dennoch den Eindruck gewinnt, mit ihnen eine andere Welt zu betreten: Faust II und Wilhelm Meisters Wanderjahre setzen den ersten Faust und Wilhelm Meisters Lehrjahre ebenso im Abstand von Jahrzehnten fort wie Winnetou IV – heute eher bekannt als Winnetous Erben – den dreibändigen Roman Winnetou I–III, aber bei ihrer Lektüre könnte man fast vermuten, es mit verschiedenen Autoren zu tun zu haben. Dabei scheint die Art der Veränderung hier und da ganz ähnlicher Natur zu sein: Das in den frühen Werken vermittelte Geschehen verfügt jeweils über klarere Konturen und wirkt relativ handfest und gut nachvollziehbar, während es später um weniger leicht zu erfassende Geschehnisse geht und auch die formale Gestaltung von ganz anderer, unkonventionell anmutender Art ist. In der Goethe- wie in der May-Rezeption finden sich einige pointierte Äußerungen, die diese Entwicklung mit nahezu identischer Tendenz kommentieren: Es gehe „der Gedankengehalt in der dichterischen Form nicht mehr auf, das Interesse an den Personen des Romans und ihren Schicksalen hat ein Ende, und wir finden uns […] mehr und mehr in eine symbolische Schemenwelt versetzt“,17 notierte David Friedrich Strauß 1872 über Goethes Wanderjahre, und ein knappes Jahrhundert später, 1966, schrieb Otto Forst-Battaglia über die letzten Romane Karl Mays, sie seien „langweilig, inkohärent; die Symbolik erstickt den sichtbaren Ablauf der berichteten Ereignisse.“18 Man könnte die Formulierungen fast austauschen.
Charakteristisch an diesen Zitaten ist gerade auch ihre streng wertende Implikation: Es geht nicht bloß darum, Unterschiede zwischen frühen und späten Texten zu fixieren, sondern um Abqualifizierungen des einen gegenüber dem anderen. Die sind nun ein verbreitetes Merkmal in der Rezeption Goethes wie Mays: Bei beiden gibt es zahlreiche Leser, die sehr entschieden entweder die frühen oder die späten Arbeiten eindeutig bevorzugen. Loben die einen Goethe-Freunde den aufsässigen Impetus und die befreiende Ungebärdigkeit von Götz, Prometheus und Werther, so setzen die anderen auf die strukturell sorgfältig reflektierte Altersweisheit, mit der der Verfasser des zweiten Faust und der Wanderjahre aufwartet. Bei May halten viele Leser Romane vom Schlag des Schatz im Silbersee, der ersten drei Winnetou-Bände und des sechsbändigen Orientromans für seine bedeutendsten Leistungen, während andere das nach 1900 entstandene Spätwerk zu seinem künstlerischen Gipfelpunkt erklären. Historisch betrachtet, gibt es in der Verteilung der Wertschätzung gelegentlich konjunkturelle Schwankungen. So haben etwa während der kulturell wildbewegten 1970er-Jahre deutsche Theaterregisseure bevorzugt Goethes frühe Dramen auf die Bühne gebracht und die anderen vernachlässigt, eine Schwerpunktbildung, die sich später wieder änderte. Nachdem 1969 die Karl-May-Gesellschaft gegründet worden war, sah sie es einige Jahre lang vor allem als ihre Aufgabe an, für eine Anerkennung des in der Öffentlichkeit missachteten Spätwerks zu sorgen; bald danach war von dieser Akzentuierung nicht mehr viel zu bemerken.
Verehrung und Kommerz
Es ist eine Binsenweisheit: Ohne latente oder offene Werturteile kommt die wissenschaftliche Beschäftigung mit literarischen Werken nicht aus. Ausgeprägt emotionale Aspekte zeigen sich erst recht, wenn man in andere Bereiche der Rezeptionsgeschichte blickt und schier überschwängliche Begeisterung entdeckt. Bei Goethe gilt das insbesondere wiederum für den Helden seines ersten Romans, während der Enthusiasmus gegenüber anderen Figuren sich meistens in eher sublimierter Form darstellt. Manche Werther-Freunde bekundeten eine geradezu nach Ineinssetzung strebende Annäherung: Er habe, schreibt einer, sich intensiv bemüht, so zu sein wie Werther, müsse aber einräumen, dass er dessen Größe und Singularität nicht erreiche: „im demüthigenden Bewußtsein, daß ich nicht so dächte, nicht so sein könne, als dieser da.“19 Eine kollektive Begleiterscheinung zu dieser Schwärmerei – die einer Figur gilt, deren Leben bekanntlich im Suizid endet! – waren Fan-Veranstaltungen am Grabe jenes Karl Wilhelm Jerusalem, dessen trauriges Schicksal Goethe für den zweiten Teil seines Romans ausgewertet hat. Die Werther-Verehrer führten in Wetzlar eine „Procession nach dem Grabe des armen Jerusalem [durch]“; man kleidete sich wie Werther, es wurde gesungen, aus Goethes Roman vorgelesen und eine Rede zur Legitimität des Selbstmords aus Liebeskummer gehalten, und an dieser Veranstaltung nahmen nicht etwa nur „junge Laffen, verschossene Hasen und andere Firlefanze“ teil, wie ein erstaunter Berichterstatter mitteilt, sondern auch „Männer von hoher Würde, Kammerassessoren und Damen von Stande“.20
Bei May richtete sich solche Zuneigung erst einmal auf mehrere seiner global aktiven heroischen Figuren, aber es ist unübersehbar, dass zunehmend der Apachenhäuptling21 Winnetou in den Mittelpunkt der Begeisterung rückte, eine Figur, die mittlerweile Eingang in den Duden gefunden hat. Allerdings dürfte die Verehrung in diesem Fall ganz überwiegend eine Sache von Kindern und Jugendlichen gewesen sein, die sich bei ihren Indianerspielen ebenso in den Dress des Idols hüllten wie die erwachsenen Werther-Freunde. Ein besonderes, immer wieder zitiertes Beispiel für die Verehrung Mays auch in älteren Generationen bildet der Umstand, dass der Schriftsteller Carl Zuckmayer einem Kind den Namen Winnetou gab – und zwar einer Tochter.
Es fällt auf, dass die Neigung zu einer derart identifikatorischen Lektüre in den fraglichen Romanen selbst vorweggenommen wird. Werther liest nur Literatur, mit der er sich emotional eng verbunden fühlen kann, und neigt dazu, das eigene Leben einschließlich aller Veränderungen in literarischen Werken gespiegelt zu finden; so spricht er zunächst von „meinem Homer“ und später davon, Ossian habe „in meinem Herzen den Homer verdrängt“.22 May arbeitete über Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Texten mit einem Indianer, den er Winnetou nannte, und nachdem der sich zu einer immer edleren, menschenfreundlichen, im umfassenden Sinne vorbildlichen Gestalt entwickelt hat, wird er in Mays letztem Roman, Winnetou IV alias Winnetous Erben, postum zum Namenspatron eines neuen Clans, einer kontinuierlich wachsenden Gemeinschaft von Personen, die sich verpflichten, im Sinne eines Schutzengels über das Wohlergehen bestimmter Mitmenschen zu wachen. Das ist etwas anderes als das aus der Abenteuerlust geborene Indianerspiel von Kindern, aber der Grad der Verehrung Winnetous erscheint ähnlich intensiv.
Generell gilt allerdings für Goethe wie für May, dass man über diese Form von Enthusiasmus heute in der Vergangenheitsform reden muss. In Bezug auf Werther erlosch sie bereits nach kurzer Zeit mit dem Ende jener literaturhistorischen Epoche, die unter Begriffen wie Empfindsamkeit oder Sturm und Drang rubriziert wird. Die Begeisterung für Mays Abenteuerromane und ihre Helden gedieh Jahrzehnte lang, ist aber unter jungen Lesern seit mindestens einer Generation stark rückläufig, genauso wie das Interesse an Indianern und den Verhältnissen des sogenannten Wilden Westens überhaupt; Fantasy- und Science-Fiction-Welten sind an seine Stelle getreten.
Während der Hoch-Zeit der Verehrung hat es nicht an heftiger Besorgnis ob ihrer möglicherweise schädlichen Folgen gefehlt. Man hielt dem Autor des Werther vor, der Suizid der von vielen verehrten Titelfigur könne sensible Leser auf schlimme Abwege treiben, und es sei ohnehin völlig unakzeptabel, einen Selbstmörder derart sympathisch zu zeichnen. Auch andere Werke Goethes stießen auf heftige Ablehnung: Das Schauspiel Stella etwa endet in seiner ersten Version mit einer Art Ehe zu dritt, ein Ausgang, der als Propaganda für Hurerei und Vielweiberei angeprangert wurde. Karl Mays Fantastereien gerieten in Verdacht, junge Leser von der für ihren Reifungsprozess unbedingt notwendigen Konzentration aufs Hier und Jetzt abzulenken. Und es blieb nicht bei theoretisierenden Bedenken: Man will tatsächlich Selbsttötungen registriert haben, die wesentlich auf die Lektüre des Werther zurückzuführen gewesen seien, und bei May ist bekannt, dass sich junge Straftäter zu ihrer Entschuldigung auf die verführerische Kraft seiner abenteuerlichen, die Regularien des Alltagslebens ständig überschreitenden Erzählungen berufen haben. Handfeste Konsequenzen blieben ebenfalls nicht aus: Der Verkauf von Goethes Roman war im Raum Leipzig eine Zeit lang verboten, und Mays Bücher wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus den Bibliotheken bayerischer Mittelschulen entfernt.
Da man mit Popularität und Prominenz Geld verdienen kann, wurden beide Personen und ihre Werke zum Gegenstand intensiver kommerzieller Auswertung. Stehen hier das Goethe-Bild oder gemalte Szenen aus Goethes Werken zur Verfügung, um gutbürgerliche Wohnungen als Statussymbol zu schmücken, so finden sich dort eine Winnetou-Büste für die geschmackvolle Raumausstattung – „Alabastergips, bunt bemalt, 30 cm hoch“, wie es in der Werbung des Karl-May-Verlags hieß – und diverse Ingredienzien einer jugendlichen Subkultur, vom Bleistiftanspitzer mit Indianerbild bis zu Postern mit den Hauptdarstellern der erfolgreichen Karl-May-Filme aus den 1960er-Jahren. „Karl May ist eine Industrie“,23 schrieb ein Autor, der Jahrzehnte zuvor die erste Dissertation über Karl May verfasst hatte, und auch Goethes erster Roman wurde begleitet „von einer Industrie modischer Artikel […]: blauer Frack und gelbe Weste, der breitkrempige runde Hut, Sammeltassen, Fächer, Bonbonnieren, Tapeten und Stickereien mit Werther-Motiven“.24
Kunst und Kommerz gehen oft eine untrennbare Verbindung ein: Bei den May-Filmen handelt es sich zweifellos um eine Form künstlerischer Rezeption, aber zu ihr gehörte auch von Anfang an das ökonomische Kalkül. Filme sind, wie kitschige Devotionalien, immer auch eine Ware, und Entsprechendes gilt natürlich für mehr oder weniger alles, das man in Zusammenhang mit Dichtern und ihren Werken kaufen kann, von Büchern bis zu den kuriosesten Fan-Utensilien.
Künstlerische Rezeption
Profilierte Schriftsteller ernten, Stichwort Intertextualität, häufig eine beträchtliche Resonanz in den Werken anderer Autoren. Die Leiden des jungen Werther haben geradezu ein eigenes Genre begründet, die ‚Wertheriaden‘, und noch im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts avancierte einer dieser Texte, Ulrich Plenzdorfs Die neuen Leiden des jungen W. (1973), zu einem veritablen Bestseller; im 21. Jahrhundert setzt unter anderem der Roman eines bekannten Literaturkritikers, Die freie Liebe von Volker Hage (2015), diese Tradition fort, indem er z.B. die Chronologie des Plots derjenigen des Werther im Abstand von zweihundert Jahren exakt folgen lässt und Sätze aus dem alten Roman als unmittelbare Vorlage für eigene Formulierungen verwendet. Kaum eine Literaturgeschichte verzichtet auf den Hinweis, dass ohne den Wilhelm Meister die Gattung des deutschen Bildungsromans eine ganz andere Entwicklung genommen hätte oder vielleicht gar nicht existierte, und ebenfalls unumstritten ist, dass das maßgeblich durch Götz von Berlichingen vertretene Drama des Sturm und Drang mit seiner rabiaten Inanspruchnahme individueller künstlerischer Freiheit gegenüber der vorher geltenden Regelpoetik die Zukunft deutscher Theaterstücke in neue Bahnen lenkte. Überhaupt stellt sich die literarische Wirkung Goethes als ein beinahe unüberschaubares Territorium dar.
Im Falle Mays hat man zahlreiche Spuren in den Werken späterer Autoren gefunden, von Joachim Ringelnatz bis Ernst Jünger, von Carl Zuckmayer bis Arno Schmidt, von Michael Ende bis Guntram Vesper, dessen Roman Frohburg (2016) genaue Kenntnisse der Geschichte Karl Mays und seiner Wirkung ebenso verrät wie unzählige Passagen im Gesamtwerk Schmidts. Bei einigen renommierten Autoren tauchen direkte Bezüge auf May schon im Titel auf, etwa in Wie Karl May Adolf Hitler traf und andere wahre Geschichten von Hans Christoph Buch (2003) und Winnetou, Abel und ich von Josef Winkler (2014). May hat natürlich auch die jüngere Geschichte des deutschen Abenteuerromans und benachbarter Genres maßgeblich beeinflusst. Selbst sein Umgang mit von ihm nur selten traktierten Schauplätzen war folgenreich, sodass ein Literaturwissenschaftler, der sich mit Afrika-Romanen der deutschen Literatur befasst, Mays wenigen einschlägigen Texten eine „repräsentative Aussagekraft“25 zuerkennt.
Eine eigene Gruppe innerhalb der literarischen Wirkungsgeschichte bilden Werke, die mit literarischen Ambitionen und meistens ohne große Rücksicht auf empirische Daten und Fakten das Leben der Autoren oder Teile daraus thematisieren. Im Jahr 1816 unternahm die Hofrätin Kestner, die ein halbes Jahrhundert zuvor das reale Vorbild für die Lotte im Werther gebildet hatte, eine Reise zu Verwandten nach Weimar und traf bei dieser Gelegenheit auch Goethe noch einmal; zwar ist fast nichts über die realen Abläufe des Ereignisses bekannt, aber Thomas Mann entwickelte daraus einen ganzen Roman, Lotte in Weimar (1939). Von anderem Zuschnitt sind Romane wie Marianne. Goethe-Roman von Hans Franck (1953) und Das Erlkönig-Manöver von Robert Löhr (2007), eine wildbewegte Geschichte, in der sich Goethe, Schiller, Achim von Arnim, Bettine von Arnim, Heinrich von Kleist und Alexander von Humboldt zu einer abenteuerlichen Reise treffen, um gemeinsam einen großen Gegner zu bekämpfen: Napoleon Bonaparte. Zu May existiert desgleichen eine beachtliche Zahl von romanhaften Biografien, etwa Swallow, mein wackerer Mustang von Erich Loest (1980). Klaus Funke erzählt in dem Roman Die Geistesbrüder (2013) über die reale Freundschaft und künstlerische Zusammenarbeit zwischen May und dem Maler Sascha Schneider, Philipp Schwenke in Das Flimmern der Wahrheit über der Wüste (2018) über Mays reale Orientreise, Peter Henisch in Vom Wunsch, Indianer zu werden