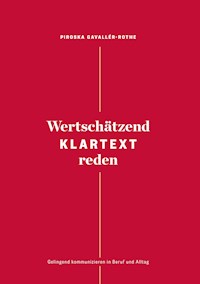
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Ich habe es dir doch schon 1000 Mal gesagt!" Häufig ist ein solches Intro der Auslöser für unerquickliche Auseinandersetzungen. Hier erfahren Sie, wie Sie auch kritische Themen sowohl klar als auch wertschätzend in einen konstruktiven Austausch bringen können. Praxisnahe Beispiele helfen, die Inhalte in den Alltag zu übertragen. Zahlreiche Exkurse geben Impulse zur persönlichen Entwicklung und beleuchten Aspekte aus Partnerschaft, Erziehung und Beruf, ebenso wie z. B. die Entstehung häuslicher Gewalt oder die Wirksamkeit therapeutischer Interventionen. So eröffnen sich neue Perspektiven, um auch herausfordernde Situationen nachhaltiger und stimmiger zu lösen. Kurzweilig und nachvollziehbar zeigt das Buch auf, wie bekannte (kommunikations-)psychologische Modelle wie z. B. Schulz von Thuns Vier-Seiten-Modell, die Transaktionsanalyse oder die Arbeit mit dem Inneren Kind durch die Integration grundlegender Konzepte der Gewaltfreien Kommunikation sinnvoll erweitert und wirksam vertieft werden können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Ob im Privaten oder im beruflichen Kontext: Was genau macht es aus, ob wir eine Kommunikation als gelingend erleben oder aber nicht?
Dieser Frage gehe ich seit vielen Jahren nach, indem ich meine Kommunikationsseminare oftmals mit genau dieser Frage beginne. Anhand eigener Erfahrungen können die Teilnehmenden dabei Qualitäten positiv erlebter Kommunikation sammeln, die später in der Großgruppe präsentiert werden. Das Erstaunliche an dieser Arbeit ist: Unabhängig davon, ob Führungskräfte oder Mitarbeitende, Lehrende oder Lernende, Eltern oder deren Kinder diese Fragen beantworten – die Qualitäten positiv erlebter Kommunikation sind durchgängig die gleichen. Zu den ganz besonders häufig genannten Qualitäten zählen dabei: Respektvoller Umgang, gegenseitiges Verständnis und gegenseitige Akzeptanz, Offenheit der GesprächspartnerInnen, Empathie für das Gegenüber, Klarheit hinsichtlich dessen, worum es geht sowie innere als auch äußere Ruhe.
Wollen wir unsere Kommunikation und unsere Beziehungen und somit letztlich auch die Welt, in der wir leben, positiver gestalten, so müssen wir sowohl im Innen als auch im Außen arbeiten: Im Innen geht es dabei vor allem um die Entwicklung einer inneren Haltung, die es uns ermöglicht, uns selbst und unserem Gegenüber einfühlsam und wertschätzend begegnen zu können. Darüber hinaus ist es aber ebenso wichtig, die Entwicklung einer klaren und eindeutigen Denk- und Sprechweise zu fördern. Sie soll uns dabei unterstützen, mehr und mehr Klarheit dabei zu entwickeln, worum es uns wirklich geht. Aus der Synthese dieser beiden Pole können wir dann in einen sowohl wertschätzenden als auch klar gestalteten Dialog mit unserem Gegenüber treten.
Sowohl bei der Entwicklung einer einfühlsamen und wertschätzenden Haltung als auch bei der Entwicklung einer klaren und eindeutigen Sprache werden wir durch alte und häufig dysfunktional wirkende Denk- und Sprachmuster behindert. Aus meiner vieljährigen Erfahrung bei der Entwicklung wertschätzender und klarer Kommunikationskulturen in Unternehmen, Organisationen und Schulen weiß ich allerdings: Eine tief greifende und wahrhaftige Transformation unserer Kommunikations- und (damit auch) Beziehungsgestaltung ist nicht möglich, ohne Bewusstheit für unsere oftmals unbewusst verwendeten Denk- und Sprachmuster zu entwickeln. Diese Bewusstheit reicht jedoch allein nicht aus. Zusätzlich müssen wir alternative Kommunikationsmuster erlernen, die unser Denken und unser Sprechen in neue, beziehungsförderliche Bahnen lenken. Um es von Anfang an klar zu haben: Mit Kommunikationsmustern meine ich nicht, dass wir vorgefertigte Formulierungen erlernen, die wir nach hinreichendem Training wie einstudiert abspulen können. Wenn ich von Kommunikationsmustern spreche, dann meine ich vielmehr ein Denk- und Sprachraster, welches uns dabei hilft, unser Denken und Sprechen neu auszurichten und das, was uns bewegt sowohl situativ angemessen (im Sinne von wertschätzend) als auch klar und authentisch (im Sinne von unserem wahren Selbst entsprechend) in Worte fassen und in Beziehung bringen zu können.
Haltung und Technik sind also zentral, wenn wir die Fähigkeit zu „Wertschätzend Klartext reden“ entwickeln wollen. Wie sich bei der Lektüre dieses Buches aber noch zeigen wird, kommt für „Wertschätzend Klartext reden“ ein weiterer bedeutsamer Aspekt hinzu: Die allermeisten Menschen fallen schnell aus ihren Ressourcen, wenn ihre ganz persönlichen „roten Knöpfe“ gedrückt werden. In einem solchen Fall können dann sogar „Kommunikationsprofis“ schnell in reaktive Verhaltensweisen verfallen und sich weit weg von „Wertschätzend Klartext reden“ bewegen. Für „Wertschätzend Klartext reden“ ist demnach auch bedeutsam, inwieweit Menschen bereit und fähig sind, ihre „roten Knöpfe“ so zu bearbeiten, dass sie auch in persönlich herausfordernden Situationen angemessen handlungsfähig bleiben. Daher werde ich auch ausführlich beschreiben, wie die Bearbeitung tief greifender persönlicher Verletzungen (die mit der Zeit zu den persönlichen „roten Knöpfen“ werden) gelingen kann. Im besten Fall können auf diese Weise alte Verletzungen zu persönlichen Kraftquellen werden.
Grundlage von „Wertschätzend Klartext reden“ bildet bei alledem die Gewaltfreie Kommunikation (GFK). Sie wird uns deshalb über das ganze Buch hinweg implizit (Kapitel 1 – 10) und explizit (ab Kapitel 11) begleiten. Gleichwohl handelt es sich bei „Wertschätzend Klartext reden“ um kein typisches „GFK-Lehrbuch“, in dem primär die Grundlagen der GFK vermittelt werden. Stattdessen wird die GFK – ebenso wie andere bekannte und anerkannte (kommunikations-)psychologische Ansätze – in eine weit gefasste und ganzheitliche Sichtweise auf die Mechanismen zwischenmenschlicher Kommunikations- und Beziehungsgestaltung integriert.
Ein Ziel dieses Buches ist es, die häufig unverbundenen (kommunikations-) psychologischen Ansätze in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen und dadurch ein ganzheitliches Verständnis der Wirkungsweisen gewohnter Kommunikationsmuster zu fördern. Hierbei möchte ich insbesondere aufzeigen, wie Schulz von Thuns Vier-Seiten-Modell der Kommunikation, die Transaktionsanalyse oder die Arbeit mit dem Inneren Kind durch die Integration der Grundlagen von „Wertschätzend Klartext reden“ sinnvolle Erweiterung und wirksame Vertiefung erfahren können.
Gleichzeitig soll das Buch aber auch einen umsetzungsfähigen Mehrwert generieren. Mit dem Sprachgerüst der GFK soll aufgezeigt werden, wie konkret „Wertschätzend Klartext reden“ machbar und damit sowohl im Beruf als auch im Alltag praktisch umsetzbar wird.
Und letztlich ist das Buch doch auch ein GFK-Buch. Allerdings eines, das einen erweiterten Zugang zur GFK ermöglicht. Leitfrage ist nämlich nicht „Was ist die GFK und wie funktioniert sie?“, sondern „Wie kann ich wertschätzend sein und zugleich Klartext reden?"
„Wertschätzend Klartext reden“ habe ich nicht für die „schnelle Lektüre“ zwischendurch geschrieben. Statt zu konsumieren, lade ich Sie ein, sich Zeit zu nehmen, um mitzudenken, nachzudenken und neu zu denken. In diesem Fall wird das Buch zu einer reichhaltigen Erkenntnis- und Inspirationsquelle – nicht nur für Kommunikationsprofis in beratenden und begleitenden Berufen. Insbesondere ist das Buch auch wegweisend für Menschen, die konkrete Impulse suchen für eine gelingende Kommunikation in Familie, Beruf und Alltag sowie auch für tief greifende persönliche Entwicklung und Entfaltung.
WICHTIGE ANMERKUNGEN ZUR LEKTÜRE DIESES BUCHES
Wie bereits dargelegt, ist es mir beim Verfassen dieses Buches ein besonderes Anliegen gewesen, sämtliche Inhalte, und ganz besonders den Ansatz der GFK, in einem ganzheitlichen Kontext zu setzen sowie die unterschiedlichsten (kommunikations-)psychologischen Ansätze miteinander in Verbindung zu bringen. Aus diesem Grund kommt speziell den Exkursen eine besondere Bedeutung zu.
Gleichzeitig ist mir bewusst, dass jeder Exkurs für sich einen neuen Gedankengang eröffnet und sich damit außerhalb der Stringenz der eigentlichen Thematik bewegt.
Damit Ihnen eine leichte Orientierung innerhalb des Textes möglich ist und Ihre Gedanken einem nachvollziehbaren „roten Faden“ folgen können, empfehle ich folgendes Vorgehen beim Lesen dieses Buches:
Lesen Sie das Buch – oder die einzelnen Kapitel – erst einmal ohne Exkurse und am besten von vorne nach hinten. So kann Ihr Fokus beim eigentlichen Thema bleiben und sich der grundsätzliche Gedankengang ohne Ablenkung durch die Exkurse entfalten. Die Exkurse lesen Sie am besten nach der Lektüre des jeweiligen Kapitels gesondert als kleine „Inspirationsschmankerl“ zwischendurch. Bei einer wiederholten Lektüre des Kapitels oder des Buches können Sie die Exkurse dann als „kleine Umwege zu besonderen Aussichtspunkten“ in Ihren Lesefluss integrieren.
Natürlich steht es Ihnen frei, selbst zu entscheiden, ob Sie sich an die von mir empfohlene Leseweise halten mögen und selbstverständlich können Sie das Buch auch ganz anders lesen. Damit Sie sich allerdings mit Leichtigkeit im Text orientieren können, haben alle Exkurse ein einheitliches Layout mit Rahmen und Spaltensatz erhalten. So wird auf einen Blick ersichtlich, an welcher Stelle ich in meinen Ausführungen das eigentliche Thema verlasse und auf einen anderen gedanklichen Pfad wechsle.
Außerdem werden Sie im Text verschiedene Verweise finden. Zitiere ich eine Autorin oder einen Autor, so finden Sie den dazugehörigen Verweis in den Anmerkungen, ebenso wie weitergehende Gedanken oder Anmerkungen, die ich nicht in den Haupttext aufnehmen wollte. Buchinterne Verweise habe ich im Fließtext verortet.
Einige Beispiele in diesem Buch habe ich aus meiner Begleitungstätigkeit entliehen. Hierbei war es mir außerordentlich wichtig, achtsam mit den von mir begleiteten Menschen zu sein. Die Echtfälle habe ich deshalb ausschließlich als Inspirationsquelle genutzt und diese hinsichtlich entscheidender Parameter soweit abgeändert, dass weder die von mir begleiteten Personen individuell erkennbar sind, noch ihre tatsächlichen Lebenssituationen.
ZUR FRAGE DES GENDERNS
Bei der Arbeit an „Wertschätzend Klartext reden“ habe ich mich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit ich in diesem Buch gendern möchte. Der einfache Weg wäre es gewesen, auf das Gendern zu verzichten und die traditionelle (und damit männliche) Schreibweise zu wählen. Gendersensibilität hätte ich damit zeigen können, dass ich darauf hinweise, dass selbstverständlich auch all diejenigen Menschen in meine Aussagen inkludiert sind, die sich nicht in der männlichen Form wiederfinden. Da es bei „Wertschätzend Klartext reden“ allerdings um grundlegende Paradigmenwechsel und die tief greifende Veränderung von althergebrachten Denk- und Sprechweisen geht, war es mir wichtig, auch bei der Frage des Genderns stimmig damit zu sein, was ich in die Welt tragen möchte. Deshalb habe ich beschlossen, die Herausforderung des Genderns anzunehmen.
Was anfangs äußerst sperrig zu werden schien, hat sich schlussendlich an vielen Stellen als gar nicht so schwerfällig herausgestellt. Dies liegt insbesondere daran, dass ich festgestellt habe, dass es für mich viel einfacher ist, vom Gegenüber, der sendenden Person oder dem empfangenden Menschen zu schreiben, als mich mit dem oder der Sprecher*in, dem oder der Zuhörer*in oder dem oder der Leser*in durch den Text zu quälen. Insofern habe ich, wo es irgend ging, eine der zuvor genannten Bezeichnungen gewählt. Dabei fiel mir mit der Zeit auf, dass ich diese Formulierungen sehr zu schätzen beginne, da sie so umfassend sind, dass alle Menschen – gleich welcher inneren oder äußeren geschlechtlichen Zugehörigkeit – unter diese Begriffe subsumiert werden können. Zudem habe ich auch bemerkt, wie sich so der trennende Unterschied zwischen den Geschlechtern mehr und mehr aufhebt und der Mensch als solcher verstärkt sichtbar wird.
An Stellen, wo mir die Verwendung von „das Gegenüber“, „die Person“ oder „der Mensch“ stilistisch nicht passend erschienen, habe ich versucht, neutrale Bezeichnungen zu wählen (z.B. Studierende). Wo auch dies nicht möglich war, habe ich mir erlaubt, mit den restlichen Bezeichnungen flexibel und undogmatisch umzugehen. Deshalb finden Sie stellenweise Bezeichnungen in ihrer männlichen als auch weiblichen Form (zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, jedoch in abwechselnder Reihung, denn wenn man sich schon auf die Gleichwertigkeit der Geschlechter beruft, dann frage ich mich schon, weshalb immer die weibliche Anrede zuerst kommen soll) oder um ein bloßes -In (zum Beispiel ZuhörerIn) ergänzt. In diesem Fall habe ich allerdings der Lesbarkeit halber auf das Gender-Sternchen verzichtet. All die Menschen, die das konsequente und achtsame Gendern an genau diesem Sternchen festmachen, bitte ich diese meine punktuelle „Strategie der Leichtigkeit“ nachzusehen. Gleichzeitig hoffe ich, dass mein guter Wille und die Ernsthaftigkeit, mit welcher ich – wo irgend möglich – achtsame Sprachgestaltung ins Leben zu tragen versuche, unabhängig von diesen sporadischen Ausnahmen gesehen und gewürdigt wird.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß, erhellende Erkenntnisse und viel Inspiration bei der Lektüre meines Buches.
Herzlich,
Piroska Gavallér-Rothe
September 2019
Inhalt
KAPITEL 01
Wertschätzend Klartext reden, ja geht denn das?
Exkurs 01
– Verbindung zum Werte- und Entwicklungsquadrat
Exkurs 02
– Die Idee von Yin und Yang
KAPITEL 02
Ein bisschen Theorie muss sein
Der Kommunikationsprozess und seine Tücken – Codierung, Decodierung und der Weg der Nachricht
Ich sehe was, was du nicht siehst – Der (Für-)Wahrnehmungsprozess
Exkurs 03
– Die Kunst der Führung
Exkurs 04
– Wie sprichst denn du?
Exkurs 05
– Kann man sich Kommunikationstechniken sparen?
KAPITEL 03
Qualitäten gelingender Kommunikation
Praktische Bedeutung
Exkurs 06
– Die Gestaltungskraft der Verhaltensvariabilität
Exkurs 07
– Verletzlichkeit ist nicht Verletzbarkeit
Exkurs 08
– Freundliches Unterbrechen
KAPITEL 04
Wie ich denke, all-so bin ich
KAPITEL 05
Ich bin schuld, ich bin falsch
Exkurs 09
– Was macht das mit dir?
Exkurs 10
– Seit wann bist du falsch? Erziehungsimpulse als Schlüsselmoment
KAPITEL 06
Du bist schuld, du bist falsch
Der Mensch in Alarmbereitschaft
Aggression und Depression – Zwei Seiten einer Medaille
Exkurs 11
– Häusliche Gewalt: Allgegenwärtiger Ausdruck dysfunktionaler Beziehungsgestaltung
Exkurs 12
– Kein Weg zurück?
Exkurs 13
– Die Macht des Inneren Kindes
Exkurs 14
– Abspaltung und Verdrängung
KAPITEL 07
Ich bin ok
Der Prozess der Selbstbewusstwerdung
Selbstgewahrsamkeit
Selbstklärung
Selbsteinfühlung
Selbstverbindung
Selbstbefriedung und Selbsterstarkung
Selbstgestaltung
Exkurs 15
– Vom Ich zum Selbst
Exkurs 16
– Den Stress wegatmen
Exkurs 17
– Hilfreiches Gefühleraten
Exkurs 18
– Die heilsame Kraft des Schmerzes
Exkurs 19
– „Der Kunde ist König“
Exkurs 20
– Schluss mit der Lösungsfokussierung!
Exkurs 21
– Keine Einheitslösung
Exkurs 22
– Tröstungsversuche sind kontraproduktiv
Exkurs 23
– Das Drama der Bedürftigkeit
KAPITEL 08
Du bist ok
Zuhören ist nicht gleich zuhören
Die Kunst des Spiegelns
Begriffsverwirrung
Der Empathiebegriff von Rosenberg
Mitgefühl und Mitleid
Einfühlung, Empathie und einfühlsames Verstehen
Exkurs 24
– Muss man sich wirklich alles gefallen lassen?
Exkurs 25
– Ich-Vergessenheit versus Ich-Überwindung
Exkurs 26
– Der Preis der Ungeduld
Exkurs 27
– Die Bedeutung unseres Resonanzkörpers
Exkurs 28
– Mitleid: Eine fragwürdige menschliche Regung
Exkurs 29
– Professionelle Distanz
Exkurs 30
– Achtsamkeit mit dem eigenen Seelenraum
Exkurs 31
– „Empathie blendet uns“?
KAPITEL 09
Grundlegender Paradigmenwechsel
Unbewusste Reaktion versus bewusste Antwort
Vom „entweder – oder“ zum „sowohl – als auch“
Bewusster Austauschprozess
Exkurs 32
– Skepsis gelassen begegnen
Exkurs 33
– Der Mittelfinger als Kompass
Exkurs 34
– Diskussion als Leidenschaft
Exkurs 35
– Die fiese kleine Schwester des Neins
Exkurs 36
– Gipfelerlebnisse
Exkurs 37
– Wo bin ich und wo bist du?
KAPITEL 10
Dysfunktionale Denk- und Sprachmuster
Urteile, Vorwürfe und kritische Bewertungen
Vergleiche
Verantwortung leugnen
Erwartungen, Forderungen und Drohungen
Konklusion
Exkurs 38
– Kritik und Lob in der Dynamik der Transaktionsanalyse
Exkurs 39
– Die Dysfunktionalität des Lobens
Exkurs 40
– Die Verantwortung als Coach bzw. BegleiterIn
Exkurs 41
– Auf Superlative getrimmt
Exkurs 42
– Mea culpa, mea maxima culpa und ich bin doch nicht schuld!
Exkurs 43
– Ich will, darf nicht, bin frei
Exkurs 44
– Die Illusion der Abhängigkeit
KAPITEL 11
Die GFK als Erweiterungs- und Vertiefungsoption
Das Vier-Seiten-Modell der Kommunikation in seiner Erweiterung durch die GFK
Das Kommunikationsmodell der Transaktionsanalyse in seiner Erweiterung durch die GFK
Exkurs 45
– Die Relevanz der Haltung
Exkurs 46
– Ohne Haltung ist alles nichts, doch Haltung allein bringt’s auch noch nicht
Exkurs 47
– Gut gemeinte „Zwangsbeglückung“
Exkurs 48
– Die „Beseelung“ des Erwachsenen-Ichs
Exkurs 49
– Die Emotionalität der Emotionslosigkeit
Exkurs 50
– Es halten und aushalten können
KAPITEL 12
Wertschätzend Klartext reden mit GFK
Beobachtung – Einstieg in einen wertfreien Austausch
Gefühle –Ausdruck dessen, dass etwas (nicht) stimmt
Pseudo-Gefühle
Sonderfall Ärger, Wut und Zorn
Pseudo-Gefühle in Therapie und persönlicher Begleitung
Bedürfnisse – Worum es mir im Grunde geht
Mit unseren Bedürfnissen sind wir alle gleich
(
Un)erfüllte Bedürfnisse: Die Ursache der eigenen Gefühle
Bedürfnisbewusstsein und Eigenverantwortung stärken
Die Dynamik und Vielfalt unserer Bedürfnisse
Die formbare Abstraktheit von Bedürfnissen
Bitten – Die Brücke von mir zu dir
Vorab-Reflexion
Abkehr von der Lösungsorientierung
Bitte versus Forderung
Die vier Schritte zusammen
Exkurs 51
– Wenn Verantwortung zu Schuld mutiert
Exkurs 52
– „Unterstellungen in der Gefühlsverpackung“
Exkurs 53
– Bedürfnisorientierte Interventionen als Vertiefungsmöglichkeit für verhaltenstherapeutische bzw. verhaltensorientierte Arbeit
Exkurs 54
– Abwehr und Abgrenzung im Gegensatz zu einem achtsamen und selbstbestimmten Umgang mit dem eigenen inneren Raum
Exkurs 55
– Verdrängung von Bedürfnissen
Exkurs 56
– Unglücklich durch Erwartungshaltungen?
Exkurs 57
– Selbstfürsorge oder Egoismus?
Exkurs 58
– Soziale Dressur versus soziales Lernen
Exkurs 59
– Konstruktiver Umgang mit einem „Nein“
KAPITEL 13
Zusammenfassung und Ausblick
ANHANG
Vertiefendes und Weiterführendes
Vier-Seiten-Modell der Kommunikation
Werte- und Entwicklungsquadrat
Transaktionsanalyse
Neurolinguistisches Programmieren
Gewaltfreie Kommunikation
Leitfragen für Beobachtung
Gefühlsliste
Bedürfnisliste
Die Bitten im Überblick
Checklisten und Arbeitsmaterialien
Überblick der vier Lebens- und Kommunikationshaltungen, repräsentiert durch die „Vier Stühle“
All meine Farben
Vorwort
Anmerkungen
Literaturliste
Danke!
KAPITEL 01
Wertschätzend Klartext reden, ja geht denn das?
Ding der Unmöglichkeit? Wenn Menschen mich fragen, was ich beruflich mache, dann erzähle ich gerne, dass ich mich mit dem Thema „Wertschätzend Klartext reden“ beschäftige. Sehr häufig geschieht hierbei folgendes: Einem ersten Impuls folgend sind meine GesprächspartnerInnen höchst angetan von der Idee, Kommunikation so gestalten zu können, dass sie sowohl klar als auch wertschätzend erlebt werden kann. Dann aber beginnen sie nachzudenken. Und in dem Maße, wie sie nachdenken, beginnen sie skeptisch zu werden. Ihren aufkeimenden Bedenken folgend höre ich dann häufig sehr ähnlich klingende Einwände. „Wertschätzend Klartext reden“ sei dem Grunde nach zwar sicherlich sehr wichtig und auf jeden Fall auch äußerst erstrebenswert, praktisch aber doch ein Ding der Unmöglichkeit. Als Referenz wird dabei häufig die eigene Lebenserfahrung herangezogen. Hiernach könne man entweder Klartext reden oder „nett und freundlich“ und ergo wertschätzend sein. Beides zur gleichen Zeit – das scheint die Quadratur des Kreises und damit (bei aller Sympathie für die Idee) faktisch nicht umsetzbar zu sein.
Entweder – oder. Je mehr ich mich mit bewusster Kommunikations- und Beziehungsgestaltung beschäftige, umso klarer wird für mich: Die Skepsis hat ihre Berechtigung. Denn in der Welt, in der die meisten von uns sprachlich sozialisiert wurden, leben wir in einem Spannungsverhältnis, das – salopp gesagt – zwischen „Zaunpfahl und Weichspüler“ angesiedelt ist. Spätestens wenn es unstimmig wird und die Situation einer Klärung bedarf, müssen wir uns entscheiden, wie wir dieses Spannungsverhältnis für uns lösen wollen. Häufig entscheidet das „persönliche Temperament“ oder die Fähigkeit, sich zurückhalten zu können. Im Ergebnis stehen wir daher entweder klar und deutlich für uns ein, grenzen das, was uns wichtig ist, unmissverständlich ab und weisen unser Gegenüber mehr oder minder freundlich in seine Schranken. Oder wir nehmen uns des lieben Friedens willen zurück, kommunizieren freundlich „durch die Blume“, reden „um den heißen Brei“ – all das, um bloß nicht anzuecken und unser Gegenüber zu verärgern.
Sowohl – als auch. Für „Wertschätzend Klartext reden“ braucht es etwas anderes als das, was wir für gewöhnlich gelernt haben. Konkret braucht es für „Wertschätzend Klartext reden“ integrative und synergetische Fähigkeiten. Erst wenn nämlich die Verbindung, der Ausgleich und die Synthese des (scheinbar) Gegensätzlichem gelingt, kann aus „Wertschätzend Klartext reden“ eine realistisch umsetzbare Option werden.
Nichts für die Trickkiste. Die Idee von „Wertschätzend Klartext reden“ ist es dabei nicht, sich auf die Schnelle ein paar erfolgversprechende Kommunikationstricks und -tools anzueignen. Es geht vielmehr darum, eine wahrhaft wertschätzende und einfühlsame Grundhaltung zu entwickeln. Erst eine solche Haltung ermöglicht es, auch in Stresssituationen sowohl mit sich selbst als auch mit seinem Gegenüber empathisch und verbindend zu sein und zu bleiben. Zum anderen geht es aber auch darum, so viel innere Klarheit und Stärke zu entwickeln, dass wir uns mutig, klar und authentisch mit dem zeigen und einbringen, was uns wichtig und wertvoll ist. Erst wenn wir beide Qualitäten gleichzeitig und gleichwertig in Beziehung bringen und aufrechterhalten können, wird es nach meiner Erfahrung möglich, Kommunikation so zu gestalten, dass sie von allen Beteiligten als wahrlich gelingend und bereichernd erlebt wird.
Gelingende Kommunikation trägt ganz wesentlich dazu bei, zwischenmenschliche Verbindung sowie gegenseitiges Verständnis und Vertrauen zu fördern. Verbindung, Verständnis und Vertrauen wiederum helfen ganz maßgeblich dabei, die Qualität der eigenen Beziehungen über alle Lebensbereiche hinweg spürbar erfüllender und freudvoller werden zu lassen.
1Exkurs
Verbindung zum Werte- und Entwicklungsquadrat
Stets, wenn ich die Grundprinzipien beschreibe, die der Idee von „Wertschätzend Klartext reden“ zugrunde liegen, erwähne ich auch das Werte- und Entwicklungsquadrat von Schulz von Thun1 (vgl. Anhang, S. →). Auch Schulz von Thun geht – in meinen Worten – davon aus, dass es für eine lebensdienliche und beziehungsförderliche Kommunikations- und Interaktionsgestaltung eine Balance zwischen zwei gegensätzlich wirkenden Werten bzw. Polen bedarf . Bestünde diese Balance nicht, so „verkomme“ ein grundsätzlich positiver Wert zu seiner „entwertenden Übertreibung“, da ihm der qualitative Ausgleich durch den positiven Gegenwert fehle.2 Diese Dynamik zeigt sich auch bei „Wertschätzend Klartext reden“: Fehlt es beim Klartext reden an verbindender Wertschätzung, dann kommunizieren wir leicht wie die „Axt im Walde“. Fehlt uns bei einer wertschätzend gestalteten Kommunikation die eigene Klarheit hinsichtlich dessen, worum es uns im Grunde geht, dann werden wir schnell „wachsweich“ und verlieren in unserer Kommunikationsgestaltung an Aussagekraft und wohltuender Eindeutigkeit.
2Exkurs
Die Idee von Yin und Yang
In meinen Seminaren ist mir stets auch das Yin-Yang-Symbol einen weiteren, kurzen Exkurs wert.3 Dieses Symbol versinnbildlicht für mich in einer sehr anschlussfähigen Weise den integrativen und synergetischen Gedanken, der „Wertschätzend Klartext reden“ zugrunde liegt: Kommunikation gelingt, wenn sowohl aus der Energie des Yin als auch aus der Energie des Yang ausgewogen geschöpft werden kann und sich somit die beiden Energien ergänzen. Die Yang-Energie befähigt das Individuum, klar und selbstbewusst einzustehen für sich und das, was einen bewegt. Verbindend und wertschätzend kann dies allerdings nur geschehen, wenn das Individuum ebenso fähig ist, sich mit der Yin-Energie zu verbinden und damit das, was den anderen bewegt, offen und vorurteilsfrei aufzunehmen und es (im wahrsten Sinne des Wortes) gelten zu lassen.
Ein bisschen Theorie muss sein
Wie bereits im Vorwort eingehend dargelegt, wendet sich „Wertschätzend Klartext reden“ an jene Leserschaft, die ein grundsätzliches Interesse an kommunikationspsychologischen Phänomenen und gelingender zwischenmenschlicher Beziehungsgestaltung hat. Gleichzeitig hat es den Anspruch, ein Sachbuch zu sein, das auch (kommunikations-)psychologisch vorgebildeten Leserinnen und Lesern aus begleitenden, beratenden, pädagogischen und therapeutischen Berufen einen erkenntnisreichen und vertiefenden Mehrwert bietet.
Sofern Sie zur Gruppe der fachlich versierten Leserschaft gehören, werden Sie sich womöglich fragen, inwiefern die Lektüre der nachfolgenden Seiten wirklich notwendig ist für Sie, wo Sie in kommunikationspsychologischer Hinsicht doch selbst gut bewandert sind und viele der hier vorgestellten Konzepte bereits bestens kennen.
Beim Verfassen von „Wertschätzend Klartext reden“ war es mir außerordentlich wichtig, die hier vermittelten Inhalte in einen ganzheitlichen Kontext einzubetten. Dadurch soll nach und nach und Schritt für Schritt ersichtlich werden, weshalb das, was „Wertschätzend Klartext reden“ ausmacht, auf den ersten Blick vielleicht ungewohnt erscheint, aber letztlich durchaus sehr viel Sinn macht. Zudem ist es mir wichtig, bekannte und anerkannte (kommunikations-)psychologische Ansätze in eine weitgefasste und ganzheitliche Sicht auf die Mechanismen zwischenmenschlicher Kommunikations- und Beziehungsgestaltung zu integrieren. Laut meinen SeminarteilnehmerInnen besteht der Mehrwert meiner „Wertschätzend Klartext reden“-Seminare insbesondere darin, dass die häufig unverbundenen (kommunikations-) psychologischen Ansätze in einen sinnvollen Gesamtzusammenhang gesetzt werden und durch ihre Verknüpfung mit den Prinzipien der Gewaltfreien Kommunikation einen sowohl erkenntnisreichen als auch umsetzungsorientierten Mehrwert generieren.
DER KOMMUNIKATIONSPROZESS UND SEINE TÜCKEN – CODIERUNG, DECODIERUNG UND DER WEG DER NACHRICHT
Verständnisfalle. In der zwischenmenschlichen Kommunikation entspricht das, was verstanden wird, selten dem, was tatsächlich gemeint war. Diese Erkenntnis ist weder revolutionär noch neu und deshalb auch fast allen meiner SeminarteilnehmerInnen rein theoretisch durchaus bekannt. Gleichzeitig bin ich Tag für Tag äußerst verwundert, wenn ich in den unterschiedlichsten Kontexten erlebe, wie viele Menschen sich in ihrer konkreten Kommunikationsgestaltung offensichtlich dennoch der Illusion hingeben, dass gehört auch gleich verstanden sei. Dieses Phänomen illusionärer Einbildungsfähigkeit bringt Johann Wolfgang von Goethe mit einem seiner Aphorismen sehr treffend auf den Punkt:
„Es gibt viele Menschen, die sich einbilden, was sie erfahren, das verstünden sie auch.4“
Johann Wolfgang von Goethe
So erlebe ich – übrigens auch im professionellen Kontext – überraschend selten, dass das Gehörte und Verstandene durch gezieltes Nachfragen oder bewusstes Spiegeln auf ihre Übereinstimmung mit dem tatsächlich Gemeinten konsequent überprüft werden.
BEISPIEL
Profis verstehen sich per se!?
Ein nahezu schulbuchmäßiges Beispiel, wie Theorie und tatsächlich gelebte Kommunikationsgestaltung auseinanderklaffen können, findet sich im Ablauf eines Klärungsgesprächs mit einem meiner Freunde, der im therapeutischen Kontext tätig ist. Dieses Gespräch hatten wir nach einer persönlichen Auseinandersetzung vereinbart, die uns beiden ziemlich zugesetzt hatte. Unser Ziel war es, in einem zweiten Austauschversuch Verständnis füreinander zu entwickeln, damit wir wieder unbelastet in Beziehung sein können. Als der Freund in diesem Klärungsgespräch nochmals darlegte, worum es ihm gehe, wollte ich das Verstandene kurz spiegeln. Daraufhin entgegnete er mir: „Hey, wir sind doch beide Profis, da kannst du dir das Spiegeln sparen.“ Ich war perplex. Perplex, weil mein Verständnis von „Profi“ diesbezüglich zu einem ganz anderen Ergebnis führt: Ja, wir sind Profis und gerade deshalb sind wir uns bewusst, dass gehört noch lange nicht verstanden ist. Und genau deshalb verlangsamen wir gezielt unsere Kommunikation und prüfen immer wieder achtsam, ob wir noch im Gleichklang des gegenseitig Verstandenen sind. DAS bedeutet für mich professionelle Gesprächsführung – ganz grundsätzlich und ganz besonders dann, wenn das Ziel des Austausches Beziehungsklärung und die Entwicklung gegenseitigen Verständnisses ist.
Sie halten meine Ausführungen womöglich für überzeichnet? Dann machen Sie doch einfach mal einen kleinen Feldversuch. Setzen Sie sich dazu bspw. in ein Café, in die Kantine oder in ein Meeting und hören Sie aufmerksam zu, wie die Kommunikation zwischen den Beteiligten abläuft. Wie häufig überprüfen Menschen bewusst das anscheinend Verstandene, bevor sie hierauf antworten? Oder achten Sie im Selbstversuch mindestens einen Tag darauf, wie oft Sie bereits am Erwidern sind, bevor Sie durch bewusstes Spiegeln sichergestellt haben, Ihr Gegenüber tatsächlich in seinem Sinne verstanden zu haben.
Mit etwa zwanzig Kaffeebohnen können Sie ganz gezielt Ihre Aufmerksamkeit schulen. Legen Sie die Kaffeebohnen z.B. während einer Telefonkonferenz an einen Platz auf Ihrem Schreibtisch. Immer, wenn Sie eine Erwiderung ohne vorhergehende Spiegelung hören, lassen Sie eine Kaffeebohne an einen anderen Platz auf Ihrem Schreibtisch wandern. Beobachten Sie, in welcher Geschwindigkeit die Kaffeebohnen von der einen Seite zur anderen wandern. Wenn alle Kaffeebohnen auf der anderen Seite sind, dann setzen Sie Ihr Praxis-Experiment in die entgegengesetzte Richtung fort.
Damit Menschen nicht aneinander vorbeireden, sind tatsächliches Verstehen und wahrhaftiges Verständnis für eine gelingende Kommunikation unabdingbar. Deshalb möchte ich an dieser Stelle nochmals den Codierungs- und Decodierungsprozess sowie den Weg der Nachricht näher beleuchten:
Unklar in der Tiefe. Unser Denken und Sprechen ist mit unterschiedlichsten individuellen Erfahrungen und Assoziationen verknüpft und hat damit einen umfassenden Bedeutungsgehalt. Das Neurolinguistische Programmieren (in seiner Kurzform auch NLP genannt; vgl. Anhang, S. →) spricht hier von der „Tiefenstruktur“ der Sprache.5 Wollen wir mit jemandem in Kommunikation treten, ist es annähernd unmöglich, all das, was uns bezüglich einer berührten Thematik bewegt, vollständig in ihrer Tiefenstruktur abzubilden und zu vermitteln. Zum einen würde dieses Unterfangen in aller Regel bei weitem den Rahmen dessen, was unser Gegenüber aufnehmen kann, sprengen. Zum anderen sind wir uns während unserer – meist spontanen – Äußerungen für gewöhnlich nicht vollumfänglich dessen bewusst, was uns auf der Tiefenstruktur bezüglich der Thematik alles bewegt.
Gerne möchte ich das Konzept der Tiefenstruktur anhand des folgenden Beispiels näher illustrieren:
BEISPIEL
„Ich finde Hunde einfach nur furchtbar!“
Ich höre in der Kneipe am Nebentisch eine Frau mit großer Begeisterung erzählen, dass in ihre Nachbarwohnung jemand mit Hund eingezogen ist und sie diesen Hund „entzückend“ findet. Ihr Gesprächspartner hört zu und erwidert brummig:
„Ich finde Hunde einfach nur furchtbar.“Was wir hören ist das, was sich auf der Oberflächenstruktur offenbart: Der Gesprächspartner findet Hunde furchtbar. Weshalb das allerdings so ist, wird aus dieser Äußerung nicht ersichtlich. Hierzu bräuchte es einen ergänzenden Austausch, der die Tiefenstruktur des Gesagten sichtbar macht. So könnten bspw. in der Tiefenstruktur folgende Aspekte entweder einzeln oder gar zusammen eine Rolle spielen:
„Ich finde Hunde ekelig – sie stinken, sabbern und haaren.“„Ich finde das ganze Getue rund um den Hund furchtbar.“Und ganz im unbewusst Verborgenen könnte vielleicht auch ein tiefenpsychologischer Aspekt eine Rolle spielen, wie z.B.:
„Die Anhänglichkeit von Hunden berührt mich und erinnert mich ganz unbewusst an einen kindlichen Teil von mir, der auch anhänglich ist. Allerdings habe ich als Kind viel schmerzhafte Ablehnung erfahren, mit der ich nicht umgehen konnte. Daher habe ich diese Anhänglichkeit in mir abgespalten. Und damit ich mit meinem abgespaltenen Anteil auf keinen Fall in Kontakt komme, lehne und werte ich alles ab, was mich auch nur im Entferntesten daran erinnern könnte.“Vernetztes Denken, lineares Sprechen. Zusätzlich sehen wir uns bei der Vermittlung dessen, was uns gerade bewegt, mit einer weiteren Herausforderung konfrontiert. Äußerst vereinfacht und auf das für meine Ausführungen Wesentliche reduziert geht es hierbei um den grundlegenden Unterschied zwischen dem, wie wir denken und dem, wie wir sprechen: Eine weit verbreitete Annahme ist, dass wir in Sprache denken. Während das Sprechen ohne Denken schwerlich möglich ist, so geht das Denken allerdings auch ganz wunderbar ohne Sprache. In der Wissenschaft wird dieses Phänomen „mentalesisches Denken“ genannt. Konkret bedeutet dies: Sprache ist lediglich das Vehikel, mit welchem Inhalte und Ideen in unseren Denkapparat eingebracht werden. „Verstoffwechselt“ werden die sprachlichen Impulse allerdings in sprachloser und somit mentalesischer Geistesaktivität.6 Von dieser „Sprachlosigkeit“ des eigentlichen Denkvorgangs wusste bereits Albert Einstein zu berichten:
„Die Worte oder die Sprache, in schriftlicher oder gesprochener Form, scheinen in meinem Denkmechanismus keine Rolle zu spielen.7“
Albert Einstein
Sprache brauchen wir beim Denken erst wieder, wenn wir unseren gedanklichen Output greifbar machen oder unsere Gedanken mit anderen teilen und uns damit mitteilen möchten. Das sprachlose Denken erfolgt häufig assoziativ. Das heißt, ein Gedanke ergibt sich aus dem anderen. Nicht selten kommt man vom Hölzchen auf’s Stöckchen und ist manchmal überrascht, wie man beispielsweise blitzeschnelle gedanklich von einem Wollflusen in der Ecke in die schottischen Highlands kommt. Das mentalistische Denken ist ein vernetzter Vorgang, den ich selbst als überaus frei erlebe. So ist es für mich leichthin möglich, verschiedene Gedanken zur selben Zeit nebeneinander, miteinander oder gar übereinander zu denken. Schwierig wird es nur, wenn wir die Quintessenz unseres Denkprozesses versprachlichen möchten. In diesem Fall muss nämlich die Vielzahl der zeitgleich und vernetzt bestehenden Gedanken in die lineare Form der Sprache gegossen werden. Dies ist deshalb herausfordernd, weil wir nur einen Gedanken bzw. ein Wort nach dem anderen formulieren können. Die hiermit einhergehende Herausforderung bringt Sir Francis Galton wie folgt auf den Punkt:
„Es ist für mich ein ernstes Hindernis beim Schreiben und noch mehr beim mündlichen Erklären, daß [sic] ich mit Worten nicht so leicht denke wie sonst.8“
Sir Francis Galton
Verzerren, Tilgen, Generalisieren. Um achtsam mit der Aufnahmekapazität unseres Gegenübers zu sein, müssen wir das, was wir zum Ausdruck bringen wollen, zudem auf ein für unser Gegenüber sowohl sprachlich verständliches als auch gedanklich nachvollziehbares und aufnehmbares Maß reduzieren. Neben rein sprachlichen Aspekten (in welcher Sprache, in welchem Slang etc.) müssen wir auch die Reihenfolge und die Menge bestimmen, in der wir das vernetzte Ganze, das uns bewegt, vermitteln möchten. Bei alledem ist es wichtig, aus der Vielfalt unserer Gedanken und Assoziationen diejenigen Aspekte auszuwählen, die nach unserem Dafürhalten für unser Gegenüber die Tiefenstruktur unseres Erlebens und Denkens am besten abbilden. Die Gesamtheit dieses Prozesses wird in der Linguistik Codierung genannt.9 Bei der Codierung wird u.a. das aus unserer Sicht Unwichtige getilgt, das Grundsätzliche verallgemeinert und das, was uns besonders wichtig erscheint, in seinen Dimensionen verzerrt:10
Tilgen (= Weglassen von Informationen)
BEISPIEL
„Um Rührei zu machen, verquirlst du Eier, salzt und pfefferst das Ganze und gibst die Eiermasse dann zu Butter oder Fett in die Pfanne.“
Getilgt wurde in diesem Fall, dass die Eier erst aufgeschlagen und aus der Schale befördert werden müssen, wie viel Salz und Pfeffer zu nehmen ist und dass der Pfeffer gemahlen sein sollte. Zudem wurde getilgt, dass das Fett oder die Butter bereits gut heiß sein muss, die Butter allerdings nicht zu sehr, da sie eine eingeschränkte Hitzebeständigkeit aufweist.
Sinn und Zweck des Tilgens ist es, vermeintlich unnötige Informationen wegzulassen, um die Nachricht möglichst „schlank“ zu halten.
Generalisieren (= vom Einzelfall zum Allgemeinen)
BEISPIEL
„Männer hören nicht zu und Frauen können nicht einparken.“
Die tatsächliche oder scheinbare Häufung eines Phänomens wird als allgemeingültige Regel formuliert, bei der all die Individuen unberücksichtigt bleiben, die als Männer durchaus gut zuhören und als Frauen gut einparken können.
Generalisierungen haben den Zweck, den Austausch zu vereinfachen, indem Ausnahmen oder Einzelfallbetrachtungen bewusst oder unbewusst ausgeklammert werden.
Verzerren (= Über- oder Untertreibung)
BEISPIEL
„Oh, das tut mir aber leid, dass ich Ihnen aufgefahren bin – zum Glück hat Ihr Auto nur eine klitzekleine Macke…“
„Geht’s noch, hier von klitzekleiner Macke zu sprechen? Mein Auto ist völlig verbeult!“
Verzerrungen können die Wahrnehmung eines Phänomens gezielt beeinflussen. Mit ihnen lenken wir der Blick auf das für uns Wesentliche (vgl. z.B. Karikaturen) und können von uns erwünschte emotionale Reaktionen auslösen oder (zumindest) fördern.
In der Alltagskommunikation erfolgt der Codierungsprozess in aller Regel unbewusst. Häufig wird dabei das in seiner Tiefenstruktur vielfältig verästelte, vielschichtige, ganzheitlich verknüpfte (und damit sprachlich schwer bis nicht vermittelbare) Netz von Gedanken und Assoziationen zu einer einzigen Nachricht verdichtet. Diese verdichtete Nachricht kommt laut Schulz von Thun quadratisch11 daher und ist aufgrund der erfolgten Reduktion auf das für uns Wesentliche sowohl praktisch (im Sinne von mit Leichtigkeit handhabbar) als auch gut (im Sinne von gut übermittelbar).
Da unsere Mitmenschen allerdings äußerst selten Gedanken lesen können, reicht es nicht aus, wenn wir unsere Gedanken für uns behalten. Damit das, was uns bewegt, tatsächlich bei unserem Gegenüber ankommen kann, muss die codierte Nachricht in einem weiteren Schritt in Richtung unseres Gegenübers übermittelt werden. Dies kann zum Beispiel (fern)mündlich, schriftlich oder auch nonverbal (bspw. durch Winken, Schulterzucken, „Stinkefinger“ zeigen etc.) geschehen. Bereits in diesen Übermittlungsprozess des Sendens und Empfangens können sich erste Fehler einschleichen und im ungünstigsten Fall weitreichende (und manchmal äußerst unerquickliche) Auswirkungen auf die nachfolgende Kommunikation haben. So kann eine Nachricht in diesem Stadium etwa auf folgende Art und Weise fehlerhaft/ mängelbehaftet beim Gegenüber ankommen:
Unvollständig (= die empfangende Person hört oder liest bspw. nur einen Teil der Nachricht)
BEISPIEL
Anna raunzt ihren lästigen Verehrer an und sagt:
„Martin, ein für alle Mal: Ich liebe dich nicht.“
Als sie das „nicht“ sagt, rauscht gerade ein Güterzug an ihnen vorbei.
Falsch (= aufgrund akustischer Probleme, Tippfehler oder ähnlicher Entstehungsmängel)
BEISPIEL
Ich frage meine Freundin Sandra, ob sie mir aus Capri eine rote Hose mitbringen könne. Drei Wochen später steht sie mit einem roten Rosenstock vor der Tür, den sie extra für mich aus Capri mitgebracht hat.
Gar nicht (= etwa durch Verlust der Nachricht, Übersehen werden oder anderer Übermittlungshindernisse)
BEISPIEL
Frank hat Kopfhörer mit Musik auf den Ohren, während Lisa zunehmend ungeduldig zum dritten Mal aus der Küche ruft:
„Kannst du bitte endlich die Spülmaschine ausräumen?“
Wenn ich in meinen Seminaren zu „Wertschätzend Klartext reden“ den Weg der Nachricht erkläre, frage ich beim Übermittlungsprozess regelmäßig, welche möglichen Fehlerquellen es bei der Übermittlung der Nachricht denn geben könne. In den allermeisten Fällen bekomme ich von den SeminarteilnehmerInnen die Antwort, dass vermutlich die empfangende Person etwas anderes als das verstehe, was die sendende Person gemeint habe. Mittlerweile bin ich nicht mehr überrascht, diese Antwort zu bekommen und habe gelernt, dass in unserer herkömmlichen Kommunikation offensichtlich zumeist davon ausgegangen wird, dass die empfangene Nachricht selbstverständlicherweise der gesendeten Nachricht entspricht.
Pfropf im Ohr. Technische oder akustische Übermittlungsfehler sind auch nach meiner Erfahrung eher selten. Allerdings sollten sie deshalb nicht per se ausgeschlossen werden. Neben den bereits genannten Übermittlungsfehlern existiert ein weiteres erstaunliches (psycho-logisch12 allerdings durchaus nachvollziehbares) Phänomen: Die Nachricht geht der Empfängerin oder dem Empfänger zu, wird aber aufgrund stark prägender und verinnerlichter Vorannahmen (= Glaubenssätze, vgl. S. →) und Vorerfahrungen unbewusst und beinahe zeitgleich mit dem Zugang so dominant interpretiert, dass die ursprünglich empfangene „Tonspur“ überschrieben wird. Das tatsächlich Gesagte ist dann nicht mehr abrufbar, so, als wäre das Gehörte in seiner ursprünglichen Form gar nicht zugegangen (vgl. auch S. →). Dieses Phänomen kann zu gewichtigen Missverständnissen führen, die unentdeckt nur schwer aufgelöst werden können.
BEISPIEL
Nur Kritik gehört
Zu Beginn meiner Trainingstätigkeit war ich noch ziemlich unsicher, ob ich wirklich „gut genug“ als Trainerin sei. In diesem Zusammenhang erinnere mich noch lebhaft an die Abschlussrunde eines Inhouse-Seminars in einer großen Firma, in der sich die Abteilungsleiterin recht kritisch zu einigen der Seminarinhalte und der Abschlussübung geäußert hatte. Im Nachgang war ich äußerst frustriert und fest davon überzeugt, das Seminar „total in den Sand gesetzt“ zu haben. Vielleicht können Sie sich meine Überraschung und mein Staunen vorstellen, als meine Seminarassistenz mir daraufhin ihre Notizen zu den Abschlussfeedbacks überreichte und ich dort die fast durchgängig sehr positiven Rückmeldungen der anderen Teilnehmenden las. Ganz offensichtlich waren all die positiven Rückmeldungen an mir „vorbeigerauscht“, so dass ich mich schlichtweg nicht an sie erinnern konnte.
Subjektivität der Bedeutungsgebung. Eine erfolgreiche Übermittlung der Nachricht stellt sicher, dass die Nachricht der empfangenden Person so zugehen kann, wie sie von der sendenden Person tatsächlich gesendet wurde. Nach ihrem erfolgreichen Zugang muss die Nachricht nun von der empfangenden Person im Hinblick auf ihren tieferen Sinngehalt decodiert werden. Mit anderen Worten: Die Nachricht wird mit der ihr gegebenen Oberflächenstruktur in die eigene Tiefenstruktur der empfangenden Person übertragen und erfährt hierdurch eine individuelle Bedeutungszumessung. Dazu wird in einem zumeist unbewusst ablaufenden inneren Prozess die empfangene Nachricht mit den Vorerfahrungen und dem Vorwissen der empfangenden Person verknüpft und erhält auf dieser Grundlage eine tiefere Bedeutung. Da jeder Mensch mit einem ganz individuellen Erfahrungs- und Wissenspool ausgestattet ist, ist die individuelle Bedeutungszumessung und damit das, was verstanden wird, sehr stark von der Erfahrungswelt der jeweilig empfangenden Person abhängig.
Komplexität durch Reduktion. Aufgrund der Eigenheiten des individuellen Decodierungsprozesses kann es leicht zu Missverständnissen oder Fehlinterpretationen kommen. Dies liegt insbesondere daran, dass sich mit der sprachlichen Reduktion die Komplexität und Vielschichtigkeit und damit die Auslegungsbedürftigkeit der jeweiligen Nachricht erhöht. Mit anderen Worten: Je reduzierter und im wahrsten Sinne des Wortes einfacher die Nachricht wird (zum Beispiel „Was hast du denn da gekocht?“), umso weniger bilden sich die unterschiedliche Ebenen der Tiefenstruktur (= die Ganzheit des innerlich Bewegten) in dieser einen und vielfach auslegungsbedürftigen sowie auslegungsfähigen Oberflächenstruktur (= die tatsächlich formulierte Nachricht) ab. Mit folgendem Schaubild möchte ich meine Ausführungen zum Weg der Nachricht veranschaulichen:
Komplexität hoch vier. Über die Vielschichtigkeit der Nachricht hat bereits Schulz von Thun viel Grundlegendes geschrieben. In seinem Vier-Seiten-Modell13 (vgl. Anhang, S. →) geht er davon aus, dass jede Nachricht vier unterschiedliche Ebenen von Botschaften enthält:
•
Sachinformation
Zahlen, Daten, Fakten
•
Selbstkundgabe
Wie fühle ich mich und was brauche ich?
•
Beziehungsbotschaft
Wie stehe ich zu dir und wie bewerte ich unsere Beziehung?
•
Appell
Was möchte ich von dir?
Hierzu ein Beispiel: Fred und Johannes wollen sich einen gemütlichen WG-Filmabend machen. Als Fred ins Wohnzimmer kommt sagt er zu Johannes: „Wow, ist das kalt hier!“
•
Sachinformation
„ Es ist der kälteste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das Fenster im Wohnzimmer ist auf und die Raumtemperatur beträgt – 20° Celsius.“
•
Selbstkundgabe
„ Ich friere!“
•
Beziehungsbotschaft
„ Du bist echt ein Depp, dass du bei diesen Temperaturen seit heute Morgen das Fenster auf hast!“
•
Appell
„ Mach das Fenster zu, die Heizung an und gibt mir eine Decke!“
Das Wissen darum, dass jede Nachricht Sachinformationen, Selbstkundgabeanteile, Beziehungsbotschaften und mindestens einen Appell enthält, erachte ich für den persönlichen Decodierungsprozess und die Klärung der Frage, was die sendende Person vermitteln möchte, als äußerst hilfreich. Unabhängig hiervon bleiben die in der jeweiligen Nachricht tatsächlich enthaltenen Botschaften der sendenden Person weiterhin unklar. Vermeintliche Klarheit schafft an dieser Stelle erst die individuelle Bedeutungszumessung der empfangenen Nachricht anhand (höchst)persönlicher Interpretationen des (vermutlich) Gemeinten. Sowohl für die bewusste als auch für die unbewusste Interpretation der empfangenen Nachricht nutzt der oder die EmpfängerIn zahlreiche Decodierungshilfen, wie zum Beispiel:
Gegebener Kontext
Persönliche Vorerfahrungen
Spezifisches Vorwissen – sowohl hinsichtlich der Thematik als auch hinsichtlich der sendenden Person
Nonverbale Botschaften, wie Mimik, Gestik oder Tonfall.
Trotz dieser Decodierungshilfen ist es der empfangenden Person bei ihrer persönlichen Bedeutungszumessung schlichtweg unmöglich, auf alle interpretationsrelevanten Faktoren in der Tiefenstruktur des oder der SenderIn zuzugreifen. Dieser Zugrifffunktioniert insbesondere dann nicht, wenn
der Austauschprozess sehr reduziert und einfach gestaltet ist (etwa wegen Zeitdrucks oder fehlender Kultivierung eines bewussten Austauschprozesses, aber auch bei E-Mails, SMS oder kryptischen Kommentaren),
wir die sendende Person nicht allzu gut kennen (aufgrund fehlenden Vorwissens, wobei gerade auch vermeintliches Vorwissen im Sinne von „Ich kenne dich nur zu gut…“ eine gefährliche Falle und damit ein häufiger Grund von Missverständnissen sein kann, vgl. S.
→
),
die Beziehungsebene nicht störungsfrei ist (hierzu gleich mehr). Störungen auf der Beziehungsebene führen besonders leicht zur Entstehung von Missverständnissen.
Nichtwissen. Je länger und intensiver ich mit Menschen arbeite, desto mehr komme ich zu der Erkenntnis, dass es ohne einen intensiven Austausch- und Verständigungsprozess annähernd unmöglich ist, unser Gegenüber (und häufig auch uns selbst) in der Tiefe des tatsächlich Gemeinten zu verstehen. Um dies nur ansatzweise zu illustrieren, möchte ich den Satz „Was hast du denn da gekocht?“ anhand Schulz von Thuns Vier-Seiten-Modell näher beleuchten und sichtbar machen, wie unterschiedlich dieser kleine, schlichte Satz allein schon innerhalb der einzelnen Botschaftsebenen und unter Berücksichtigung der jeweiligen mitgesendeten nonverbalen Botschaften interpretiert werden kann.
Sachinformation
„Wie nennt sich dieses Gericht?“
„Aus was für Zutaten besteht es?“
„Wir hatten vereinbart, dass du Pizza machst. Nun habe ich Reis mit Pilzen auf dem Teller.“
„Vor zwei Tagen hatten wir ein Gespräch, in dem ich dir sagte, dass ich Pilze in der letzten Zeit schlecht vertrage. Nun bekomme ich einen Teller mit einem Gericht, das aus Reis und Pilzen besteht.“
„Ich habe dir bereits mehrfach gesagt, dass ich Pilze nicht vertrage. Gleichwohl hast du im letzten Monat zum fünften Mal etwas mit Pilzen gekocht.“
Selbstkundgabe
„Ich bin begeistert, weil das so toll aussieht.“
„Ich bin neugierig zu erfahren, was das ist.“
„Ich bin enttäuscht, weil ich mich auf Pizza eingestellt habe.“
„Ich bin besorgt, weil ich Pilze nicht vertrage und kein Bauchweh haben möchte.“
„Ich bin echt frustriert, weil ich damit ernst genommen werden möchte, dass ich Pilze nicht vertrage.“
Die Selbstkundgabe kann aber auch weitaus komplexer sein – und ist es nach meiner Erfahrung in der Realität auch meistens. Insofern können sich hinter „Was hast du denn da gekocht?“ auch folgende Regungen verbergen:
„Ich mag es nicht, wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden und finde, das hat auch was mit Respekt zu tun.“
„Ich bin zwar überrascht, weil wir Pizza ausgemacht haben, bin aber ganz angetan von dem, was ich da auf dem Teller sehe.“
„Ich bin echt irritiert, weil ich verstehen möchte, weshalb du wieder ein Pilzrisotto kochst, obwohl ich dir schon mehrfach sagte, dass ich Pilze nicht vertrage.“
Beziehungsbotschaft
„Du bist echt experimentierfreudig und kreativ.“
„Du machst nie das, was wir ausgemacht haben!“
„Du kannst echt nicht kochen!“
„Dich interessiert doch absolut gar nicht, was ich dir sage!“
„Du bist ein egomaner Narzisst! Ich bin dir im Grunde doch völlig egal.“
„Wenn du so weitermachst, sind wir bald getrennte Leute.“
Appell
„Mach weiter so!“
„Halt dich endlich mal an Absprachen!“
„Lern endlich kochen und gib dir mal mehr Mühe!“
„Nimm mich ernst mit dem, was ich sage!“
„Verändere dich gefälligst!“
Ich erhoffe mir, dass mit diesen Beispielen klar wird, worauf ich abzielen möchte: „Was hast du denn da gekocht?“ klingt auf das erste Hinhören sehr einfach und damit erst mal klar und eindeutig. Allerdings: Wenn wir uns anschauen, was sich hinter „Was hast du denn da gekocht?“ alles (bis hin zur Beziehungsfrage) verbergen kann, dann wird sichtbar, wie komplex, vielschichtig und auslegungsbedürftig auch so ein kleiner, schlichter Satz sein kann.
Wollen wir tatsächlich „Wertschätzend Klartext reden“ braucht es auf der Seite der sendenden Person eine bewusste Komplexitätsreduktion der Nachricht. Ziel dieser Komplexitätsreduktion muss es sein, erhöhte Eindeutigkeit und Klarheit hinsichtlich der einzelnen Botschaften zu fördern. Ab S. → zeige ich auf, wie mit einer bewussten Kommunikation auf Grundlage der Gewaltfreien Kommunikation in vier Schritten die Komplexität von Nachrichten maßgeblich und ganz gezielt reduziert werden kann.
Auf der Seite der empfangenden Person, ist wiederum bewusstes Nachfragen und ein achtsames Überprüfen des vermeintlich Verstandenen das oberste Gebot. Denn mal ganz ehrlich: Weshalb sollte unsere eigene und ganz individuelle Interpretation des Gehörten tatsächlich mit dem übereinstimmen, was unser Gegenüber im Grunde vermitteln wollte?
Belastbares Fundament. Wie weiter oben (S. →) bereits erwähnt, wird der Prozess der persönlichen Interpretation oder Bedeutungszumessung maßgeblich davon beeinflusst, wie störungsfrei die Beziehungsebene zwischen SenderIn und EmpfängerIn ist. Je mehr Störungen auf der Beziehungsebene existieren, umso leichter kann es zu Fehlinterpretationen (im Sinne von „im Zweifel gegen den Angeklagten“) und Missverständnissen kommen. Letztlich ist auch das nicht neu. Gerade deshalb bin ich allerdings immer wieder bass erstaunt, wie selten ich es erlebe, dass Menschen in ihrer alltäglichen (aber ebenso professionellen) Kommunikations- und Beziehungsgestaltung gezielt darauf achten, ob sie sich noch in einer störungsfreien Beziehung mit ihrem Gegenüber befinden.
„Wertschätzend Klartext reden“ erfordert nach meinem Verständnis daher neben einer bewussten Kommunikationsführung eine ebenso bewusste und konsequent-achtsame Beziehungsgestaltung. Damit wird es möglich, gegebenenfalls bestehende Störungen auf der Beziehungsebene bereits frühzeitig wahrzunehmen und aufzulösen.
3Exkurs
Die Kunst der Führung
Wenn ich ausführe, wie wichtig eine konsequente und achtsame Beziehungsgestaltung ist, dann kommt mir immer wieder die NLP-Technik von Pacing und Leading14 in den Sinn. Pacing bedeutet bewusstes Angleichen an und Einschwingen auf unser Gegenüber. Dieses Angleichen und Einschwingen geschieht auf verschiedenen Ebenen, wie zum Beispiel Tonalität, Sprechgeschwindigkeit, Ausdrucksweise und Körperhaltung. Das Pacing dauert so lange, bis wahrnehmbar ein guter und tragfähiger Kontakt erreicht ist. Diesen tragfähigen Kontakt nennt man im NLP Rapport15, im allgemeinen Sprachgebrauch spreche ich allerdings von „gleicher Wellenlänge“. Ziel des Pacings ist es, über den hergestellten Gleichklang eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, über die dann das Leading, d.h. ein gezielter (Gesprächs-)Führungsimpuls, erfolgen kann.
Ich tanze leidenschaftlich gerne argentinischen Tango und auch dort merke ich, wie wichtig das Pacing für eine tragfähige Führung ist. Im besten Fall schwingt sich die führende Person erst auf die ihr folgende Person ein, bevor der eigentliche Tanz beginnt. Beim Tango Argentino geschieht das bestenfalls dadurch, dass man nicht gleich beim ersten Takt „lostanzt“, sondern die ersten zwei, drei, manchmal auch vier oder mehr Takte dafür nutzt, um miteinander in Kontakt zu kommen. Hierzu wird ganz sachte die Musik aufgenommen und in kleinste, gemeinsame Bewegungsimpulse (zumeist in Form von geringfügigen Gewichtsverlagerungen) umgesetzt. Erst wenn das Paar in einem tragfähigen Kontakt ist, beginnt die eigentliche Führung in den offensichtlichen Tanz hinein.
Obwohl ich selbst als NLP-Master ausgebildet bin, stehe ich einer Reihe von NLP-Methoden kritisch gegenüber. Dies insbesondere dann, wenn Methoden des NLP vorwiegend technisch oder als Mittel zum Zweck eingesetzt werden, um jemanden dorthin zu bewegen, wo man ihn oder sie gerne hätte. Wichtig für mich ist eine spürbare, menschlichverbindende Haltung, bei der ich wahrhaft mit meinem Gegenüber in Beziehung treten und in Beziehung bleiben und mich gemeinsam mit ihm in eine Richtung bewegen möchte, die für uns beide stimmig ist.
In meinem Verständnis geht es beim Pacing und Leading deshalb darum, über die ganze Dauer des Austausches hinweg, sehr genau bei uns und unserem Gegenüber hinzusehen und wahrzunehmen, ob wir noch in tragfähiger Verbindung und Beziehung sind. Achtsame Kommunikation bedeutet für mich, kleinste Anzeichen von Dissonanz wahrzunehmen und ernst zu nehmen (wie bspw. Zurückweichen, Vorbeugen, Augenbrauen zusammenziehen, erhöhter Muskeltonus, schnelleres, lauteres Sprechen, Veränderung der Tonalität oder der Wortwahl etc.). Im Falle einer wahrgenommenen Dissonanz bietet es sich an, bewusst zu entschleunigen und wieder einen voll tragfähigen Rapport herzustellen. Dann erst ist es nach meiner Erfahrung sinnvoll, mit dem Austausch oder einem neuen Führungsimpuls fortzufahren. Mit anderen Worten: Sobald die Beziehung nicht mehr voll tragfähig ist, empfiehlt es sich, den Fokus vom eigentlichen Austausch auf die Beziehungsgestaltung zu legen und zwar so lange, bis die Beziehung wieder tragfähig genug für einen neuen Führungsimpuls ist.
Auch hier ist beim Tango Argentino eine entsprechende Analogie zu finden: Der Tango Argentino ist ein modularer und hoch improvisierter Tanz. Das bedeutet, dass die folgende Person nie wirklich weiß, was als Nächstes auf sie zukommt. Fehlinterpretationen und Missverständnisse sind beim Tango Argentino also vorprogrammiert. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn mit der Fähigkeit, flexibel und kreativ das aufzunehmen, was sich gerade offenbart, kann viel gerettet werden. Häufig entstehen gerade aus Missverständnissen und vermeintlichen Fehlern neue, spannende und nicht selten auch sehr charmante Schrittkombinationen. Allerdings ist ein kreativer Umgang mit Fehlinterpretationen nur dann möglich, wenn der Kontakt noch tragfähig ist. Ist das Tanzpaar durch das, was gerade passiert, aus seinem tragfähigen Kontakt „gerutscht“, zeigt sich häufig, wie souverän und gleichzeitig auch einfühlsam die führende Person tatsächlich ist. Wenig souveräne und gleichzeitig einfühlsame Führende tanzen häufig weiter und „verschlimmbessern“ damit zumeist das beginnende Chaos auf dem Tanzparkett. Führende, die neben dem Wissen um die Schritte auch Einfühlungsvermögen und Souveränität mitbringen oder entwickelt haben, entschleunigen in der Regel den Tanz und suchen den Kontakt oder Rapport zu der Person, die ihnen folgt. Erst wenn der Rapport wieder tragfähig ist, führen sie in neue Schrittkombinationen hinein.
Womöglich klingt diese entschleunigte Art der Kommunikations- und Beziehungsgestaltung für Sie sehr zeitraubend und deshalb wenig praxistauglich. Allerdings: Haben Sie sich schon mal überlegt, wie viel Zeit die saubere Auflösung einer misslungenen Kommunikation in Anspruch nimmt und wie viel Zeit und Energie Missverständnisse rauben, bis sie wirklich bereinigt sind? Ganz zu schweigen von den langfristigen Beziehungsstörungen, die oft mit kleinen Missverständnissen beginnen, sich aber mit der Zeit zu einem wuchernden Geschwür in der Beziehung auswachsen?
Auch hier möchte ich bei der Analogie des argentinischen Tangos bleiben. Mir persönlich ist es bspw. sehr viel lieber, bei einem beginnenden Rapportbruch oder Kuddelmuddel auf der Tanzfläche für ein paar Takte in die Entschleunigung zu gehen, wenn ich dadurch die Chance habe, wieder in tragfähiger Verbindung und Harmonie tanzen zu können. Die TänzerInnen16, die mir dies durch die Art ihrer Führung ermöglichen, bleiben mir über lange Zeit in bester Erinnerung. Weniger erquicklich sind die Erinnerungen an „übereifrige“ Führende, die vor lauter vorwärtseilender Schrittkombinationen mich und die primäre Idee des Tango Argentinos (nämlich ein getanztes „In-Beziehung-Sein“) zu vergessen scheinen.
Verdummungseffekt. Je mehr ich über zwischenmenschliche Kommunikation lerne, umso mehr stellt sich bei mir ein wohltuender Verdummungseffekt ein. Verdummung in dem Sinne, dass ich einfach nicht mehr glauben mag, dass ich das, was ich höre, tatsächlich auch verstehe. Gezieltes Nachfragen bei auslegungsbedürftigen Formulierungen und gezieltes Spiegeln dessen, was ich meine verstanden zu haben, sind integrale Bestandteile meiner Kommunikationskultur geworden. Dies fördert zum einen ein besseres Verstehen und ein tieferes Verständnis meines Gegenübers. Zum anderen erspart es mir aber auch eine Menge zeitraubender und letztlich sinnloser Interpretations- und Grübelarbeit. Sinnlos deshalb, weil nach meiner Erfahrung jedes noch so ambitionierte „Heruminterpretieren“ und jede noch so angestrengte Grübelei nicht wirklich viel bringen, wenn es darum geht, verlässlich Klarheit zu bekommen, was das Gegenüber mit dem von ihm Gesagten wirklich zum Ausdruck bringen will. Ohne dialogische Exploration kann ich letztlich niemals sicher sein, ob ich mit meinen Interpretationen und eigenen Sinngebungsversuchen das Gehörte wirklich richtig decodiert und damit verstanden habe.
Demut, Demut, Demut. Meine innere Haltung wiederum ist geprägt von einer tiefen Demut vor der Welt meines Gegenübers, die für mich voller noch unentdeckter Wunder steckt. Und weil ich zutiefst an die wundervolle Einzigartigkeit unserer inneren Welten glaube, kann und will ich mir nicht mehr anmaßen, davon auszugehen, dass ich dieses Wunder ohne vertiefenden Austausch mit meinem Gegenüber aus meiner beschränkten und individuellen Sicht erfassen und ermessen kann. Und so bin ich – wie in der Schweiz so treffend formuliert wird – „gwundrig“ geworden und mag mit gezieltem Nachfragen und Spiegeln mehr und mehr eintauchen in die wunder-bare, wunder-volle und manchmal auf den ersten Blick auch wunder-same Welt meiner Gegenüber.
Um mich immer wieder an den Zustand des „gwundrig“-Seins zu erinnern, habe ich mir erlaubt, das seit der Antike geflügelte Wort „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ (bzw. dem Sinn nach stimmiger übersetzt: „Ich weiß, dass ich nicht weiß“17) gedanklich weiterzuführen und mir damit ein Lebensmotto zu schaffen, das ich hier gerne mit Ihnen teilen möchte. Es hilft mir im Alltag immer wieder dabei, in der demütigen Haltung vor der Einzigartigkeit unserer inneren Welten zu bleiben.
„Ich weiß, dass ich nicht weiß,
Sokrates
und
ich bin offen, das Wunder deiner Welt durch dich zu entdecken.“
Piroska Gavallér-Rothe
Giftige Dosis. Wie Paracelsus schon wusste: Die Dosis macht das Gift;18 und so ist mir wichtig, an dieser Stelle klarzustellen, dass mir das Gebot des rechten Maßes durchaus bewusst ist. Selbstverständlich spiegele auch ich nicht ständig jede Kleinigkeit wider. Und ja, auch ich bin weiterhin fähig, auch mal ungezwungen mit meinen Mitmenschen zu plaudern und Small-Talk zu betreiben, ohne zu hinterfragen und beständig zu spiegeln. Wenn es aber um einen sinnhaften Austausch rund um eine wirklich bedeutsame Thematik oder Beziehungsklärung geht, in dem mir gegenseitiges Verstehen und Verständnis wichtig sind, dann wechsle ich ganz selbstverständlich in den kommunikativen Achtsamkeitsmodus und arbeite mich Schritt für Schritt spiegelnd durchs Gespräch.
4Exkurs
Wie sprichst denn du?
Mir ist durchaus bewusst, dass die Art, wie ich Kommunikation gestalte, stark davon abweicht, wie für gewöhnlich Kommunikation abläuft. Insofern verwundert es mich nicht, dass meine GesprächspartnerInnen ab und an überrascht, manchmal sogar irritiert, reagieren. Achtsamkeit in der Gesprächsführung bedeutet für mich, aufmerksam zu sein sowie wertschätzend und klar anzusprechen, was ich gerade objektiv wahrnehmen kann (zum Beispiel das leichte Zurückweichen des Oberkörpers, etwas weiter geöffnete Augen, ein Runzeln der Stirn etc.). Durch das offene Ansprechen dessen, was ich gerade wahrnehme und das einfühlsame Nachfragen im Hinblick darauf, was das bedeutet, kann ein mögliches Unbehagen meines Gegenübers Raum bekommen und in einen konstruktiven Austausch gebracht werden.
Erfahrungsgemäß sind meine GesprächspartnerInnen deshalb überrascht oder irritiert, weil sie einfach gerne verstehen möchten, was es mit meiner „ungewohnten“ Gesprächsführung auf sich hat. Wenn wir beide hierüber in Klarheit sind, dann wird es im Anschluss möglich, darüber in Austausch und Verbindung zu kommen, weshalb es mir ein Anliegen ist, das Gehörte zum Beispiel immer wieder zu spiegeln, bevor ich antworte oder Rückmeldung gebe. Nachdem ich meine diesbezüglichen Beweggründe näher dargelegt habe, bitte ich in der Regel mein Gegenüber, mir kurz widerzuspiegeln, wie es mich verstanden hat. Alsdann frage ich kurz, wie es ihm mit diesem neu gewonnenen Verständnis geht. In den meisten Fällen löst sich in diesem kurzen Austausch von häufig nicht einmal drei Minuten die anfängliche Irritation auf und es entsteht stattdessen Vertrauen und Offenheit, sich auf die von mir angebotene Kommunikationsform einzulassen.
Manchmal braucht der Prozess allerdings noch eine weitere Schleife. Wenn dies der Fall ist, dann entsteht bei meinem Gegenüber ein neuer Impuls, der zumeist so oder ähnlich klingt: „Ja, das mit dem Verstehen kann ich nachvollziehen – aber mir ist es schon wichtig, dass wir ganz normal miteinander reden können, ich bin ja nicht in einem Kommunikationskurs…“ Auch mit diesem Einwand gehe ich achtsam und wertschätzend um, sodass mein Gegenüber und ich bald schon geklärt haben, worum es ihm im Grunde geht. In der Vielzahl der Fälle geht es bei einem solchen Kommentar insbesondere um Authentizität und Wahrhaftigkeit. Und wieder einmal setze ich das um, was eine vertrauensvolle Beziehung fördert und frage mein Gegenüber, ob es von mir hören mag, wie es mir mit seinen Bedürfnissen nach Authentizität und Wertschätzung geht. Wenn der Austauschprozess wie beschrieben verläuft, habe ich es bis jetzt fast immer so erlebt, dass mein Gegenüber auf diese Frage mit Offenheit und Interesse reagiert. Und in diese Offenheit hinein kann ich dann mit meiner Gesprächspartnerin bzw. meinem Gesprächspartner teilen, wie sehr ich mich freue, dass es ihr bzw. ihm um Authentizität und Wahrhaftigkeit geht – denn um genau das geht es mir auch. Und genau deshalb – und nur deshalb! – möchte ich gerne nachfragen und spiegeln. Denn nur durch eine solche Gestaltung unseres Austauschs habe ich die Möglichkeit, ganz wahrhaftig zu verstehen, was mein Gegenüber im Grunde wirklich bewegt – und genau damit erfüllen sich für mich Wahrhaftigkeit und Authentizität in einer zwar ungewohnten, aber doch auch sehr stimmigen Weise. Wenn ich den Eindruck habe, dass ich meinem Gesprächspartner oder meiner Gesprächspartnerin noch ein weiteres „Stretching der Komfortzone“ zumuten kann, dann frage in einer weiteren Schleife, ob er oder sie bereit ist, mir an dieser Stelle nochmals kurz zurück zu spiegeln, was denn angekommen ist. Hat mein Gegenüber mich so verstanden, wie ich gerne verstanden werden möchte, dann initiiere ich die letzte Schleife, indem ich frage, wie es meinem Gegenüber mit dem von ihm Verstandenen geht. Spätestens jetzt habe ich die allermeisten meiner anfänglich irritiert oder skeptisch reagierenden GesprächspartnerInnen „mit im Boot“ und wir können aus einer sehr tragfähigen Verbindung heraus mit unserem eigentlichen Austausch in einer – für meine GesprächspartnerInnen zumeist ganz neuen – Qualität beginnen.
5Exkurs
Kann man sich Kommunikationstechniken sparen?
Den Einwand, dass man sich doch die Kommunikationstechniken sparen könne, da man ja jetzt in einem „richtigen Gespräch“ und nicht in einem Kommunikationskurs sei, höre ich immer wieder. Anfangs habe ich mit großem Erstaunen hierauf reagiert. Erstaunt, weil ich gerne verstehen wollte, wie man auf die Idee kommen kann, dass Kommunikationstechniken nur etwas für Kommunikationskurse, aber nicht wirklich etwas für das „richtige Leben“, seien. Zudem habe ich auch immer wieder eine gewisse Unsicherheit verspürt, wenn ich dies gehört habe. Unsicherheit verknüpft mit der Frage, ob ein Mensch, der so etwas sagt, tatsächlich verstanden hat, weshalb die in den Kommunikationskursen erlernten Techniken nicht nur im Kurskontext, sondern insbesondere auch im täglichen Austausch wichtig und wertvoll sind.
Seitdem ich gemeinsam mit meinen GesprächspartnerInnen ihre anfänglichen Irritationen in der im vorangegangenen Exkurs beschriebenen Art und Weise wertschätzend kläre, zeichnet sich mir mehr und mehr ein Bild ab, das mich verstehen lässt, weshalb dies so ist:
Viele meiner GesprächspartnerInnen haben bereits in diversen Kursen alle möglichen Kommunikationstechniken kennengelernt. Die Techniken sind aber häufig lediglich als einzelne Werkzeuge bzw. Kommunikations„tools“ abgelegt, ohne in einen umfassenden Sinnzusammenhang integriert zu sein. In einem solchen Fall fehlt häufig das Verständnis in Bezug auf den tieferen und ganzheitlich-konzeptionellen Sinn der einzelnen Kommunikationstechniken. Vergleichen lässt sich dies mit einem Menschen, der ein Haus bauen will und sich dazu die Ausführung von diversen Gewerken zeigen lässt – ohne aber dabei das Konzept „Haus“ ganzheitlich und insbesondere in seiner bautechnischen Bedeutung (Fundament, tragende Wände, Leitungsführung etc.) verstanden zu haben.
Über die Jahre komme ich mehr und mehr zu der Überzeugung: Je tief greifender die Sinnhaftigkeit von Sprach- und Beziehungsgestaltungsprozessen wirklich verstanden wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die intrinsische Motivation erhöht, Kommunikationstechniken jenseits des Kurskontextes bewusst in den Alltag zu integrieren.
Zudem werden Kommunikationstechniken über den Seminarkontext hinaus nur sehr selten weiter gezielt geübt. Die Macht der Gewohnheit ist dabei nur ein Hemmschuh. Häufig fehlt auch ein geschützter Übungsraum, in welchem die neuen Kommunikationstechniken ausprobiert und anhand wohlwollender, konstruktiv-kritischer Rückmeldungen weiterentwickelt werden können. Aufgrund mangelnder Übung bleibt die Anwendung der im Seminarkontext kennengelernter Kommunikationstechniken ungewohnt und wird deshalb leicht als „künstlich“ oder „nicht authentisch“ erlebt.
All dies hat ganz unmittelbare Auswirkungen auf die Gestaltung meiner „Wertschätzend Klartext reden“-Seminare: Bevor ich auch nur einen Hauch der sprachgestalterischen Techniken vermittele, beschäftigen wir uns eingehend mit den Grundlagen und Phänomenen gelingender und nicht gelingender Kommunikation. Es ist mir ein Anliegen, dass meine SeminarteilnehmerInnen zuerst verstehen, was die entscheidenden Stellschrauben für gelingende Kommunikation sind und welche Mechanismen die einzelnen Schrauben in Bewegung setzen. Erst wenn die grundlegende Funktionsweise des Kommunikationsapparats verstanden ist, wenden wir uns den einzelnen Stellschrauben zu und beginnen diese neu zu justieren.
ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST – DER (FÜR-)WAHRNEHMUNGSPROZESS
Im weiteren Verlauf dieses Buches möchte ich immer wieder sichtbar machen, wie die jeweils persönliche Wahrnehmung ganz maßgeblich das Gelingen bzw. Nichtgelingen unserer Kommunikation und unserer Beziehungen beeinflusst. Deshalb ist es mir an dieser Stelle ein Anliegen, diesbezüglich relevante Aspekte des Wahrnehmungsprozesses näher, allerdings auch sehr vereinfacht, zu beleuchten.
Alles ist subjektiv. Spätestens seit Paul Watzlawick19, einem der populärsten Vertreter des Konstruktivismus, wissen wir: Es gibt keine objektive Wirklichkeit und keine allgemeingültige Realität. Die persönliche Wahrnehmung ist subjektiv und überhaupt – die Wirklichkeit ist eine bloße Illusion desjenigen Menschen, der gerade aus seinem kleinen, beschränkten Blickwinkel auf die große, weite Welt schaut.
Dem Großteil meiner SeminarteilnehmerInnen ist der konstruktivistische Ansatz in der Regel bekannt. Dennoch erlebe ich überraschend häufig, wie viele Menschen immer wieder ihren eigenen Interpretationen der (vermeintlichen) Wirklichkeit „auf den Leim gehen“. Sie nehmen ihre eigene Interpretation dessen, was im Außen geschieht, für wahr, anstatt objektiv, bedeutungsoffen und nichtwissend den Stimulus im Außen beobachtend wahrzunehmen. Die Kultivierung einer inneren Haltung, in der wir uns unseres Nichtwissens bewusst sind (vgl. S. → f.) und frei von persönlichen Interpretationen und Bewertungen auf die Welt blicken können, ist für mich von zentraler Bedeutung. Nur so wird es möglich, sich in einem Feld der inneren Offenheit zu bewegen, in dem wir das Verhalten anderer Menschen auf der Basis von Austauschprozessen verstehen lernen mögen, anstatt sich dieses eigenmächtig auf Grundlage persönlicher Spekulationen zu erklären.
Unbewusst und eingeschränkt.





























