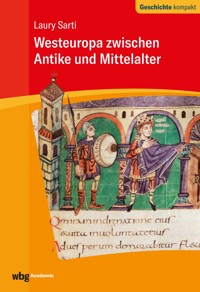
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG)
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Transformation und Zäsur im 5. Jahrhundert Westeuropa durchlebte seit dem 5. Jahrhundert epochale Transformationen, die den Übergang von der Antike zum Mittelalter markierten. Neue Herrschaftsräume und Rechtstraditionen veränderten römische und gentile Identitäten, die Kirche wurde zur Trägerin von Bildung und Kultur und charakterisierte eine Welt, die zunehmend vom Krieg geprägte wurde. Diese Faktoren beeinflussten wiederum die familiären Beziehungen, Siedlungsformen und Bestattungstraditionen. Die Trennung von Militär- und Zivilwesen zerfiel und gab den frühmittelalterlichen Gesellschaften ihren distinkten Charakter. - Wissen kompakt: Übersichtlich, fundiert, verständlich - Ideal zur Seminar-, Referats- und Prüfungsvorbereitung - Auf dem neusten Stand der Forschung - Mit mehreren Karten für einen anschaulichen Überblick Eine grundlegende Einführung in Spätantike und Frühmittelalter Die Mediävistin Laury Sarti beschreibt quellennah, kompakt und auf dem neusten Stand der Forschung die Veränderungen, aus denen die Gesellschaften des Mittelalters hervorgingen. Dieser Band eröffnet einen grundlegenden Einblick in diese faszinierende Epoche, indem die Gegebenheiten im Frankenreich, in Italien und England vergleichend betrachtet werden. Die Reihe ›Geschichte kompakt‹ steht für strukturierte Einführungen in zentrale Themen der Geschichtswissenschaft. Bündige Zusammenfassungen, Zeittafeln, Grafiken und Abbildungen sowie Quellen- und Literaturverzeichnis ergänzen jeweils den Text. Die Bände der Reihe eignen sich somit hervorragend für die Referats- und Prüfungsvorbereitung im Studium.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
GESCHICHTE KOMPAKT
PD Dr. Laury Sarti lehrt Geschichte des Mittelalters an der Universität Freiburg. Dort habilitierte sie sich 2022 mit einer Arbeit zum römischen Erbe in der fränkischen Welt. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören außerdem Fragen zur Mobilität, dem Militärwesen sowie dem Epochenübergang von der Antike zum Mittelalter.
Herausgegeben von
Kai Brodersen, Martin Kintzinger, Uwe Puschner
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
wbg Academic ist ein Imprint der wbg.
© 2023 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt
Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.
Satz: Lichtsatz Michael Glaese, Hemsbach
Einbandgestaltung: schreiberVIS, Seeheim
Einbandabbildung: Miniatur aus dem Stuttgarter Psalter von 801.
Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.bibl.fol.23.
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Printed in Germany
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-534-27537-3
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
eBook (PDF): 978-3-534-27555-7
eBook (epub): 978-3-534-27556-4
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Geschichte kompakt
I. Einleitung: Transformation und Zäsur
II. Historischer Kontext
1. Das Ende der Antike
2. Italien
3. Gallien
4. Britannien
III. Identität und Wandel
1. Gleichzeitigkeit und Wandelbarkeit
2. Römer und die „Anderen“
3.Wer waren die Franci?
4. Fließende Übergänge
5. Die Herkunft der „Anderen“
6. Römertum mit und ohne Rom
IV. Herrschaft und Autorität
1. Könige des Kaisers
2. Postimperiale Könige
3. Herrschaft unterhalb der Könige
V. Gesellschaft und Strukturen
1. Die Oberschicht
2. Freiheit und Unfreiheit.
3. Recht und Gericht
4. Familie und Verwandtschaft
VI. Kirche und Glaube
1. Glaube und Gesellschaft
2. Missionare und Christianisierung
3. Kirchliche Autorität(en)
4. Klöster und Bildung
VII. Kriegsführung und Kriegertum
1. Militär und Gesellschaft
2. Militär und Herrschaft
3. Rekrutierung und Heerstruktur .
VIII. Alltag und Infrastruktur
1. Handel und Austausch
2. Städte und Herrschaftssitze
3. Siedlungen auf dem Land
4. Einzelschicksale im Zeugnis der Quellen.
5. Gräber und Bestattungskultur
IX. Bibliographie
X. Abbildungsverzeichnis
XI. Register
Geschichte kompakt
In der Geschichte, wie auch sonst, dürfen Ursachen nicht postuliert werden, man muss sie suchen. (Marc Bloch)
Das Interesse an Geschichte wächst in der Gesellschaft unserer Zeit. Historische Themen in Literatur, Ausstellungen und Filmen finden breiten Zuspruch. Immer mehr junge Menschen entschließen sich zu einem Studium der Geschichte, und auch für Erfahrene bietet die Begegnung mit der Geschichte stets vielfältige, neue Anreize. Die Fülle dessen, was wir über die Vergangenheit wissen, wächst allerdings ebenfalls: Neue Entdeckungen kommen hinzu, veränderte Fragestellungen führen zu neuen Interpretationen bereits bekannter Sachverhalte. Geschichte wird heute nicht mehr nur als Ereignisfolge verstanden, Herrschaft und Politik stehen nicht mehr allein im Mittelpunkt, und die Konzentration auf eine Nationalgeschichte ist zugunsten offenerer, vergleichender Perspektiven überwunden.
Interessierte, Lehrende und Lernende fragen deshalb nach verlässlicher Information, die komplexe und komplizierte Inhalte konzentriert, übersichtlich konzipiert und gut lesbar darstellt. Die Bände der Reihe „Geschichte kompakt“ bieten solche Information. Sie stellen Ereignisse und Zusammenhänge der historischen Epochen der Antike, des Mittelalters, der Neuzeit und der Globalgeschichte verständlich und auf dem Kenntnisstand der heutigen Forschung vor. Hauptthemen des universitären Studiums wie der schulischen Oberstufen und zentrale Themenfelder der Wissenschaft zur deutschen und europäischen Geschichte werden in Einzelbänden erschlossen. Beigefügte Erläuterungen, Register sowie Literatur- und Quellenangaben zum Weiterlesen ergänzen den Text. Die Lektüre eines Bandes erlaubt, sich mit dem behandelten Gegenstand umfassend vertraut zu machen. „Geschichte kompakt“ ist daher ebenso für eine erste Begegnung mit dem Thema wie für eine Prüfungsvorbereitung geeignet, als Arbeitsgrundlage für Lehrende und Studierende ebenso wie als anregende Lektüre für historisch Interessierte.
Die Autorinnen und Autoren sind in Forschung und Lehre erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Jeder Band ist, trotz der allen gemeinsamen Absicht, ein abgeschlossenes, eigenständigesWerk. Die Reihe „Geschichte kompakt“ soll durch ihre Einzelbände insgesamt den heutigen Wissensstand zur deutschen und europäischen Geschichte repräsentieren. Sie ist in der thematischen Akzentuierung wie in der Anzahl der Bände nicht festgelegt und wird künftig um weitere Themen der aktuellen historischen Arbeit erweitert werden.
Kai Brodersen
Martin Kintzinger
Uwe Puschner
I.Einleitung: Transformation und Zäsur
Wer über die Via Appia Antica wandert, die einst die Porta Capena im südlichen Teil der Stadt Rom mit Brindisi im südöstlichen Apulien verband, wundert sich über den ausgezeichneten Erhaltungszustand. Diese Straße war scheinbar für die Ewigkeit gebaut! Ähnliche Gedanken drängen sich dem Betrachter von Gebäuden wie dem Pantheon in Rom oder der Porta Nigra in Trier auf. Sie haben jene Gesellschaft, die sie errichtet hat, seit Langem überdauert. Nach dem 4. Jahrhundert sollten im Westen Europas erst Jahrhunderte später, z. B. mit der Karlskapelle in Aachen, wieder vergleichbare Strukturen entstehen. Einen ähnlichen Rückgang lässt sich seit der ausgehenden Antike auch im Bildungswesen, im Kunsthandwerk und auch mit Blick auf die allgemeinen Lebensumstände der Menschen feststellen. Was war passiert?
Die Quellen zum 5. Jahrhundert enthalten viele Nachrichten über kriegerische Auseinandersetzungen, die zunehmend auf imperialem Boden geführt wurden. Italien wurde abwechselnd von Römern, Ostgoten und im 6. Jahrhundert auch von Langobarden erobert und beherrscht, und selbst die Ewige Stadt Rom wurde mehrmals das Opfer von Plünderungen. Ähnlich erging es Gallien, das im Süden von Westgoten, im Osten von Burgunden, im Norden von Franken und dazwischen auch von Römern beherrscht, wurde. Glauben wir der Vita des hl. Vedast (c. 7), so war die Stadt Arras im Norden Galliens nach dem Angriff von Hunnen in der Mitte des 5. Jahrhunderts aufgegeben worden und bis in die Zeit des Frankenkönigs Chlodwig I. († 511) nur noch die Heimat von wilden Tieren, die sogar die Kirche bewohnten. Britannien, das bereits im frühen 5. Jahrhundert vom Kaiserreich aufgegeben worden war, wurde bald nicht nur von Pikten und Skoten bedroht, sondern auch von überseeischen Volksgruppen, welche nicht nur die romanisierte Bevölkerung, sondern auch das Christentum bis in die westlichsten Inselregionen verdrängten.
Kaum eine Frage wurde in der Geschichtswissenschaft intensiver diskutiert als jene nach den Ursachen für die Veränderungen, die zur Entstehung einer aus heutiger Sicht als „mittelalterlich“ verstandenen Welt geführt haben. Im 14. Jahrhundert, am Ende jener Epoche, die als „Mittelalter“ bezeichnet wird, entstand die Konzeption eines neuen Zeitalters, das sich an die „Antike“ anschloss und das durch den Niedergang der römischen Gesellschaft geprägt war. Aus diesem Verständnis heraus entstand der lateinische Begriff medium aevum, das „mittlere Zeitalter“, eine Benennung, die sich bis heute erhalten hat. Eng damit verbunden war die Überzeugung, dass das „Mittelalter“ einen Rückschritt gegenüber der Antike darstelle, die bald als Vorbild für die aufblühende „Renaissance“ verstanden wurde.
Die Frage nach dem Niedergang der antiken Gesellschaft und den Ursachen des Untergangs des Römischen Reiches im Westen beschäftigte bereits um 1780 den britischen Historiker Edward Gibbon, der seine Überlegungen in seinem Monumentalwerk History of the Decline and Fall of the Roman Empire zusammenführte. Ursächlich für den Zusammenbruch waren, aus seiner Sicht, der gesellschaftliche Verfall, das Aufkommen des Christentums und die sogenannte Völkerwanderung. Dagegen argumentierte anderthalb Jahrhunderte später der Österreicher Alfons Dopsch, der in seinem Werk Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung (1918–20) für eine stärkere Kontinuität zwischen der Antike und dem Mittelalter plädierte, indem er sich auch vermehrt auf archäologische und dokumentarische Quellen bezog. Seine These wurde wenig später durch den Belgier Henri Pirenne weiter untermauert, indem er in seinem posthum veröffentlichten Werk Mohammed et Charlemagne (1937) die Ansicht vertrat, dass erst die Ausbreitung des Islams im 7. Jahrhundert im Westen zum Ende der antiken Gesellschaft geführt habe. Erst zu diesem Zeitpunkt habe das Mittelmeer seine Funktion als verbindende Seestraße verloren.
Die Frage, ob die antike Welt im 5. Jahrhundert tatsächlich urplötzlich durch den Einbruch barbarischer Horden zusammenbrach oder ob der Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter nicht doch eher als gradueller Prozess stattfand, steht bis heute im Zentrum vieler geschichtswissenschaftlicher Diskussionen. Damit verbundenen Fragen wurde prominent in dem wegweisenden Projekt Transformation of the Roman World (1993–97) nachgegangen, das die Zeit zwischen 400 und 800 als Epoche des Wandels verstand. Doch noch 2005 unterstrichen der britische Historiker Peter Heather und der Archäologe Bryan Ward-Perkins, dass die Bedeutung der kriegerischen Auseinandersetzungen des 5. Jahrhunderts als Ursache für den augenscheinlichen Zusammenbruch nicht unterschätzt werden dürfe. Die Mehrheit der Historiker und Historikerinnen vertritt heute hingegen die Auffassung, dass sich der Übergang von einer als „antik“ verstandenen hin zu einer „mittelalterlichen“ Welt im Rahmen eines kontinuierlichen Wandels vollzogen hat, ein Prozess, der nicht nur durch Kontinuitäten, sondern auch durch Brüche geprägt war.
Die Forschung des 21. Jahrhunderts versteht den Zeitraum zwischen dem 4. und dem 8. Jahrhundert als Epoche für sich, die – wenngleich in der Antike verwurzelt – über einen eigenen Charakter verfügte. Sie wird folglich auch über die jeweiligen Periodisierungsgrenzen hinaus untersucht. Der vorliegende Band möchte dieser Entwicklung Rechnung tragen, indem die unterschiedlichen Veränderungsprozesse im Bereich von Politik, Religion und Kultur in den Gesellschaften Westeuropas am Übergang von der Spätantike zum Mittelalter mit Blick auf drei ausgewählte Regionen vergleichend diskutiert werden. Das ermöglicht es, auf unterschiedliche Entwicklungen innerhalb dieser jeweiligen Themen sowie die ihnen spezifischen Zäsuren und Kontinuitäten einzugehen.
Im Zentrum dieser Einführung stehen die nördliche Hälfte Italiens, das Frankenreich und Britannien südlich des Hadrianswalls. Der Begriff „Westeuropa“ fasst diese sowie weitere Gebiete zusammen. Die genannten drei Regionen sind vergleichsweise gut belegt und weisen wichtige Unterschiede in ihren Rahmenbedingungen auf. Diese Auswahl ermöglicht es dadurch, die historischen Entwicklungen innerhalb Westeuropas stellvertretend auch für andere Gebiete zu untersuchen. Italien hatte seit dem 5. Jahrhundert eine recht komplexe Geschichte, die Halbinsel war auch über diese Zeit hinaus teilweise an das Imperium gebunden, gleichzeitig erlebte Norditalien mehrere Phasen der Eroberung und der Rückeroberung. Auch Gallien war durchgehend romanisiert und selbst die Franken waren mit dem Reich eng vertraut, dennoch weist diese Region seit dem 6. Jahrhundert eine zunehmend eigenständige Entwicklung auf. Britannien hingegen wurde bereits im frühen 5. Jahrhundert bewusst vom Kaiserreich aufgegeben und kurz darauf weiträumig durch Volksgruppen erobert, die nie mit dem römischen Imperium in einem engeren Kontakt gestanden hatten. Die vergleichende Betrachtung dieser drei Räume ermöglicht es, sowohl auf divergierende wie auf vergleichbare Entwicklungen sowie das Ineinandergreifen unterschiedlicher Faktoren innerhalb dieser Prozesse einzugehen. Der zur Verfügung stehende Raum macht es außerdem erforderlich, den chronologischen Schwerpunkt auf die Zeit zwischen dem späten 5. und dem frühen 8. Jahrhundert zu legen. Es versteht sich von selbst, dass auch mit diesem Zuschnitt die anzusprechenden Themen immer nur exemplarisch, nie umfassend, behandelt werden können. Darum wurde davon abgesehen, alle drei genannten Regionen in den Kapiteln jeweils in der gleichen Ausführlichkeit zu diskutieren, sodass durch Schwerpunktsetzung anhand ausgewählter Beispiele auch Fragen im Detail besprochen werden können. Im Zentrum der Darstellungen stehen die Quellen, auf relevante Quellenstellen wird jeweils in Klammern verwiesen. Alle Übersetzungen ohne Verweis stammen von mir.
Mein aufrichtiger Dank geht an Uwe Puschner, der diesen Band angeregt hat, an Anja Rathmann-Lutz, Christian Scholl, Till Stüber, Matteo Taddei und Dominik Waßenhoven, die sich freundlicherweise bereit erklärt haben, Teile des Manuskripts zu lesen, an Rory Naismith und Robert Kasperski, die mir nicht zugängliches Material zur Verfügung gestellt haben, an Helene von Trott zu Solz, die das Manuskript durchgesehen hat, an Nabi Marie Bauermeister, Silvia Girona Espino, Monika Aring da Silva Ramos Mauro und Alexander Veeser, für ihre Hilfe beim Erstellen des Registers, und an Kai Brodersen für die freundliche Kommentierung, an Johannes Klemm für die redaktionelle Betreuung sowie an die Herausgeber für die Aufnahme des Bandes in die Reihe „Geschichte kompakt“.
II.Historischer Kontext
Überblick
Die Zeit der ausgehenden Spätantike und des frühen Mittelalters war eine turbulente Epoche, die im Westen nicht nur das Ende der imperialen Herrschaft, sondern auch die Entstehung unterschiedlicher Königreiche sah. Dieses erste Kapitel bietet einen groben Überblick über die Ereignisgeschichte ab dem späten 4. und bis zum Ende des 8. Jahrhunderts. Dabei wird der Übergang von der imperialen zur königlichen Ordnung nachgezeichnet, indem besonders auf die unterschiedlichen Entwicklungen ab dem ausgehenden 5. Jahrhundert in den für diesen Band zentralen Regionen eingegangen wird. Was wissen wir über das Ende des Römischen Reiches im Westen und welche Herrschaftsformen entstanden infolgedessen? Inwiefern spielten dabei auch Volksgruppen von außerhalb des römischen Raumes eine Rolle?
337
Tod Konstantins des Großen
380
das Christentum wird Staatsreligion
395
administrative Teilung des Römischen Reiches
406/407
Rheinübergang von Vandalen, Sueben und Alanen
410
Goten plündern Rom
um 450
Angeln, Sachsen und Jüten in Britannien
451
Schlacht an den Katalaunischen Feldern
455
Vandalen plündern Rom
476
Absetzung des letzten römischen Kaisers in Italien
486
fränkische Eroberung des röm. Königreichs von Soissons
489
Theoderich und die Westgoten erreichen Italien
ab 493
die Ostgoten herrschen über Italien
um 500
Taufe des Frankenkönigs Chlodwig
508
letzter bezeugter westlicher Konsul
535–554
Gotenkrieg in Italien
ab 568
Langobarden in Italien
595
erstes angelsächsisches Gesetzbuch
567–613
Merowingischer Bruderkrieg
um 625
Grablegung in Sutton Hoo
633
Sieg Pendas und Cadwallons in Hatfield Chase
ab 634
muslimische Expansion
664
Synode von Whitby
687
Sieg der austrasischen Hausmeier in Tertry
751
Absetzung des letzten Merowingerkönigs durch Pippin III.
793
Wikinger überfallen das Kloster Lindisfarne
800
Kaiserkrönung Karls des Großen
1.Das Ende der Antike
Christentum und Imperium
Im Mai 337 endete mit dem Tod Kaiser Konstantins I., des Großen, auch seine mehr als dreißigjährige Herrschaft, in der das Kaiserreich mit Konstantinopel eine neue Hauptstadt im Osten erhalten hatte und das Christentum als Religion neben den altrömischen Götterglauben getreten war. Es dauerte aber fast ein halbes Jahrhundert, bis die christliche Religion, im Jahr 380, durch das Dreikaiseredikt Cunctos populos vom 28. Februar 380 unter Kaiser Theodosius I. († 395) faktisch auch zur Staatsreligion erhoben wurde (cf. Quelle). Die bis zu diesem Zeitpunkt bestehende Religionsfreiheit war damit abgeschafft.
Quelle
Cunctos populos Edikt (Theodosianischer Codex 16.1.2, Übers. Ritter 1977, S. 179)
Alle Völker, über die wir ein mildes und maßvolles Regiment führen, sollen sich, so ist unser Wille, zu der Religion bekehren, die der göttliche Apostel Petrus den Römern überliefert hat, wie es der von ihm kundgemachte Glaube bis zum heutigen Tage dartut und zu dem sich der Pontifex Damasus klar bekennt wie auch Bischof Petrus von Alexandrien, ein Mann von apostolischer Heiligkeit; das bedeutet, dass wir gemäß apostolischer Weisung und evangelischer Lehre an eine Gottheit des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes in gleicher Majestät und heiliger Dreifaltigkeit glauben.
Nur diejenigen, die diesem Gesetz folgen, sollen, so gebieten wir, katholische Christen heißen dürfen; die übrigen, die wir für wahrhaft toll und wahnsinnig erklüren, haben die Schande ketzerischer Lehre zu tragen. Auch dürfen ihre Versammlungsstütten nicht als Kirchen bezeichnet werden. Endlich soll sie vorab die göttliche Vergeltung, dann aber auch unsere Strafgerechtigkeit ereilen, die uns durch himmlisches Urteil übertragen worden ist.
Der Übertritt zum Christentum sollte Kaiser Konstantin dem Großen einen herausragenden Platz in der Geschichte sichern. Nach ihm hat es kaum mehr einen römischen Kaiser gegeben, der ihn an Bedeutung übertraf. Sein Neffe Julian († 363), einer der wenigen männlichen Verwandten des Kaisers, der die politischen Morde zur Sicherung der Machtansprüche der kaiserlichen Söhne überlebt hatte, versuchte nach seiner Ausrufung zum Kaiser im Jahr 360 ein letztes Mal, eine Vormachtstellung des Christentums zu verhindern. Dass dieses Unterfangen schließlich scheiterte, lag sicherlich nicht nur an seinem frühen Tode nur drei Jahre später. Das Christentum war bereits Teil der römischen Welt, Julians Vorhaben entsprach nicht mehr dem Zeitgeist, wie auch sein spöttischer Beiname Apostata (der „Abtrünnige“) bestätigt.
Der Kaiser Constantius II. († 361) hatte bereits 355 seinen Vetter Julian zum Mitkaiser (caesar) erhoben, damit er die Verteidigung Galliens gegen die einfallenden rechtsrheinischen Völkerschaften leiten könne. Julian setzte sich daraufhin bei Straßburg (Argentoratum) gegen eine Gruppe Alemannen durch und schaffte es so, die Rheingrenze (limes) ein letztes Mal zumindest für drei Jahre zu sichern. Die limes-Region dürfte seither zunehmend von Übergriffen geringeren und mittleren Ausmaßes betroffen gewesen sein, auch wenn solche nur vereinzelt in den Quellen erwähnt werden.
Rheinübergang von 406/407
Ein deutlicher Bruch erfolgte im Winter 406/407. Die Temperaturen waren offenbar dermaßen gesunken, dass der Rhein großflächig zufrieren konnte. In jenen Wintertagen gelang es einer größeren Gruppe von Sueben, Vandalen und Alanen, den Fluss trockenen Fußes zu überqueren und so in das römische Territorium einzudringen. Die Rheingrenze war durchbrochen und die immer noch gerne als „Völkerwanderung“ bezeichnete Bewegung rechtsrheinischer Volksgruppen hatte das Innere des Römischen Reiches erreicht. Dieses Ereignis leitete das Ende des römischen Friedens (Pax Romana) ein. Die zeitgenössischen Chroniken berichten in den darauffolgenden Jahren von Übergriffen auf Städte in den rechtsrheinischen Gebieten, einem Geschehen, das auch auf dem Land großflächige Zerstörungen mit sich gebracht haben dürfte.
Militärelite
Im Januar 395 starb mit Theodosius I. der letzte Kaiser an der Spitze eines vereinten Römischen Reiches. Seither fiel die Macht zunehmend an militärische Anführer (magistri militum) wie Stilicho, Aëtius und Ricimer. Viele dieser Heerführer waren keine Römer, sondern entstammten den gentes. Dennoch waren sie durch ihren Dienst im kaiserlichen Heer oder die Bekleidung wichtiger Ämter wie dem Konsulat oder dem Patriziat in die obersten Ränge aufgestiegen. Der halb vandalische Heermeister Stilicho († 408) war außerdem durch Heirat direkt mit der kaiserlichen Familie verbunden.
Stichwort
Magister militum
Als magister militum werden seit dem frühen 4. Jahrhundert die höchsten Anführer der römischen Heere bezeichnet. Zuerst wurde zwischen einem allgemeinen Heermeister der Fußsoldaten (magister peditum) und der Kavallerie (magister equitum) unterschieden, ab dem 5. Jahrhundert war hingegen in den Regionen Italien und Afrika, Gallien, Illyrien, dem Orient und Thrakien jeweils ein magister utriusque militiae für alle Truppen zuständig – neben zwei magistri militum praesentales, welche die kaiserliche Armee leiteten.
Gentes
Der lateinische Begriff gentes wird in den spätantiken Quellen zur Benennung nichtrömischer Volksgruppen und darum in der modernen Forschung gerne als neutrale Alternative zum Begriff „Barbaren“ verwendet, der ebenfalls in den Quellen bezeugt ist.
Ein Hauptgrund für den Machtverlust des Kaisertums im Westen waren dessen Vertreter: 395 wurde der Westteil des Reiches an Honorius († 423), den erst zehnjährigen Sohn des Theodosius, übertragen und im Jahr 425 wurde der erst sechsjährige Valentinian III. zum Kaiser ausgerufen. Folglich wurden die wichtigsten Entscheidungen – neben der kaiserlichen Mutter Galla Placidia († 450) – von den militärischen Autoritäten getroffen. Kaiser Valentinian III. starb im März 455 mit fast 36 Jahren und sollte der letzte Kaiser im Westen sein, dem eine längere Regierungszeit vergönnt war. Zum Zeitpunkt seines Todes bestand der westliche Teil des Kaiserreiches nur noch aus dem Großteil Italiens, Dalmatien sowie Teilen Spaniens und Galliens.
Odoaker
Flavius Odoaker († 493), ein Heermeister, der in seinen frühen Jahren in der Loire-Gegend eine Gruppe sächsischer Seeräuber angeführt hatte, tauchte einige Zeit später in Noricum auf, wo er auf den heiligen Severin traf. Dieser riet ihm, so zumindest sein Biograph Eugippus (Vit. Sev. 7), weiter nach Italien zu ziehen, wo er große Reichtümer erlangen würde. In Italien angekommen, wurde er, dem byzantinischen Historiker Prokop († 562) zufolge (Got. 5.1), in die kaiserliche Leibwache aufgenommen, wo er den magister militum Ricimer gegen den amtierenden Kaiser Anthemius unterstützte. Beide starben jedoch bereits 472, wonach der burgundische Königssohn Gundobad († 516) Ricimers Stellung als magister militum einnahm. Als Nachfolger des Anthemius lösten sich bis 474 die Kaiser Olybrius und Glycerius in kurzen Intervallen ab. Julius Nepos, der Dritte in dieser Reihe, wurde 475 vom Heermeister Orestes aus Italien vertrieben. Orestes erhob daraufhin seinen eigenen Sohn Romulus Augustus zum Kaiser.
Romulus Augustus
Bereits wenige Monate nach seiner Ausrufung, im August 476, wurde der neue Kaiser Romulus Augustus von einem seiner Leibwächter abgesetzt: dem bereits er wähnten Heermeister Odoaker. Den Quellen zufolge hatten sein jugendliches Alter sowie seine Schönheit seinen Bezwinger dazu veranlasst, ihm das für einen abgesetzten Herrscher übliche Ende zu ersparen. Stattdessen wurde ihm mit einer stattlichen Pension von 6000 solidi ein Leben in der villa des Lucullus bei Neapel gewährt.
Ende Kaisertum im Westen
Die Nachwelt kennt Romulus Augustus besser unter dem spöttischen Beinamen „Augustulus“ („Kaiserchen“). Er trug sowohl den Namen des ersten mythischen Königs von Rom als auch den des ersten römischen Kaisers Augustus (cf. Quelle). Aus einer heute immer noch vertretenen Sicht hatte die Entthronung dieses etwa 16 Jahre alten Knaben nicht weniger als das Ende des Römischen Reiches im Westen zur Folge. Sein Nachfolger Odoaker war offenbar der Meinung, dass der ohnehin auf Italien und wenige Exklaven in den übrigen Regionen Westeuropas reduzierte westliche Teil des Reiches keinen eigenen Kaiser mehr benötige. Folglich verzichtete er darauf, sich selbst oder einen Vertrauten in das Amt des Kaisers zu erheben. Die Endgültigkeit dieser Entscheidung unterstrich er, indem er die Reichsinsignien (ornamenta palatii) des westlichen Kaisers zusammen mit eben dieser Begründung mit einer Gesandtschaft nach Konstantinopel schickte. Fortan regierte Odoaker als rex Italiae (Vict. 1.14), das heißt als König von Italien.
Quelle
Jordanes, Gotengeschichte 243
So ging auch das westliche Imperium des römischen Volkes, das der erste der Augusti Octavian Augustus im 709. Jahr seit der Gründung der Stadt zu regieren begonnen hatte, mit diesem Augustulus im 522. Jahr seit dem Beginn der Regierung seiner Vorgänger und jener vor ihm zugrunde und von dieser Zeit an hielten Könige der Goten Rom und Italien. Unterdessen unterwarf Odoaker, der König der gentes, ganz Italien, um unter den Römern die Angst vor seiner Person zu schüren. Folglich erschlug er zu Beginn seiner Herrschaft den Grafen [comes] Bracila in Ravenna und konsolidierte seine Königsherrschaft, die er fast dreizehn Jahre lang hielt, bis zum Erscheinen von Theoderich.
Romulus Augustus war aber nicht der letzte Kaiser im Westen, denn Julius Nepos, der anders als Romulus vom Kaiser in Konstantinopel als Amtskollege anerkannt worden war, starb erst im Jahr 480 in Dalmatien. Dennoch bleibt das Jahr 476 bis heute eng mit dem Fall des Römischen Reiches im Westen und dem Ende der Antike verknüpft. Der Zerfall des Imperium Romanum im Westen stellte aber kein genau datierbares Ereignis dar, sondern einen historischen Prozess, dessen Anfänge bis ins 3. Jahrhundert zurückreichen und der auch lange nach dem Ende des 5. Jahrhunderts nicht abgeschlossen war. Im Folgenden möchte ich mich nun mit einem kurzen Abriss den Ereignissen ab dem ausgehenden 5. Jahrhundert in den eingangs genannten Regionen zuwenden.
2.Italien
Rom 410
Italien war bis ins 4. Jahrhundert weitgehend von Übergriffen durch auswärtige Gruppen verschont geblieben. Erst ab dem 5. Jahrhundert nahm es die Strukturen einer Grenzregion an, ein Prozess, der durch die Plünderungen der Ewigen Stadt Rom im August 410 durch die Westgoten unter der Führung von Alarich I. († 410) eingeleitet wurde. Niemals hatte es seit der fast noch legendenhaften, wenn auch traumatischen, Eroberung durch die Gallier um 387/ 390 v. Chr. einen solchen Übergriff auf das Herz des Römischen Reiches gegeben! Und diesmal sollte eine Wiederholung weit weniger lang auf sich warten lassen: Kaum eine Generation später, im Jahr 455, erfolgte eine erneute Brandschatzung, diesmal durch die Vandalen, und 546 waren es die Ostgoten, denen die Stadt ein weiteres Mal zum Opfer fiel. Im Jahr 472 wurde Rom im Streit gegen den dort residierenden Kaiser Anthemius sogar von den Truppen des magister militum Ricimer belagert und geplündert. Das Ereignis von 410 erschütterte die gesamte römische Welt, und selbst Gelehrte wie die Kirchenväter Hieronymus († 420) oder Augustinus von Hippo († 430) diskutierten die Bedeutung und Folgen dieses Geschehens.
Bis dahin waren die antike Gesellschaft und Organisation intakt geblieben. Die Zeit Odoakers als rex Italiae (476–493) war vergleichsweise ruhig und von Kontinuität geprägt. Einen Eingriff in die bestehenden Strukturen, wie er in anderen Regionen nach dem Niedergang der römischen Herrschaft bezeugt ist, hat es selbst unter ostgotischer Herrschaft (493–553) nicht gegeben. Die bis in die Mitte des 6. Jahrhunderts unangetastet gebliebene politische Einheit Italiens fand erst durch die Langobarden ein Ende. Mit ihrer Herrschaftsübernahme ging eine territoriale Zersplitterung einher, welche die Geschichte Italiens noch bis ins 19. Jahrhundert prägen sollte.
Vandalen
Dennoch war Italien von den Umwälzungen des 5. Jahrhunderts nicht völlig verschont geblieben. Nach der Eroberung Afrikas um 430 durch die Vandalen litt besonders die Stadt Rom unter dem Verlust dieser als Getreidelieferant so wichtigen Region. Die städtische Versorgung war bis dahin weitgehend von den afrikanischen Zulieferungen abhängig gewesen. Gleichzeitig hatte es immer wieder Übergriffe auf italischen Boden gegeben, darunter eine weitere Plünderung Roms durch Geiserichs († 477) Vandalen sowie mehrere Einfälle im Süden Italiens, was die Befestigung der betroffenen Küsten zur Folge hatte. Obwohl es Odoaker gelang, die ebenfalls an die Vandalen verloren gegangene Insel Sizilien gegen eine jährliche Zahlung zurückzugewinnen, musste die Bevölkerung Italiens zunehmend mit den eigenen Ressourcen zurechtkommen.
Ostgoten
Odoaker eroberte um 481 Dalmatien und setzte sich wenig später auch erfolgreich gegen die Rugier in Noricum durch. Damit wurde er wohl dem amtierenden Kaiser Zeno († 491) im Osten zu mächtig. Gleichzeitig waren auch die Ostgoten im Balkanraum für das Kaiserreich zur Bedrohung geworden. Zeno löste offenbar beide Probleme, indem er dem Ostgotenkönig Theoderich den Ehrentitel eines patricius verlieh und ihn dadurch an das Kaiserreich band. Der Anonymus Valesianus aus der Zeit um 535 berichtet, wie Zeno den König anschließend mit dem Auftrag in den Westen lockte, Italien von der Herrschaft Odoakers zu befreien und die Halbinsel im byzantinischen Auftrag zu regieren (Anon. Val. 11.49). Die Zahl der Krieger, die ihn nach Italien begleiteten, schätzt der Historiker Herwig Wolfram auf etwa 20000, was bedeutet, dass sich mit deren Familien bald etwa 100000 Personen nach Westen bewegt haben dürften. Im August 489 besiegte Theoderich erstmals Odoaker, der sich anschließend in Verona verschanzte. Die Belagerung der Stadt endete mit einem weiteren Sieg der Ostgoten, einem Erfolg, an den noch im 9. Jahrhundert im Hildebrandslied mit der Legende um Dietrich (das heißt Theoderich) von Bern (Verona) erinnert wurde. Odoaker gelang erneut die Flucht, endgültig besiegt wurde er erst 493 nach einer dreijährigen Belagerung seiner Hauptstadt Ravenna. Glauben wir dem Chronisten Johannes von Antiochien (7. Jahrhundert, cf. Quelle), so wurde Odoaker während eines Gastmahls in Ravenna eigenhändig von Theoderich erschlagen.
Quelle
Johannes von Antiochien, Chronik 238 (Übers. Krause 2005, S. 174–175)
Theoderich und Odoaker machten einen Vertrag, miteinander über das römische Reich zu regieren und oft trafen sie zusammen, da der eine beim anderen ein- und ausging. Als der zehnte Tag noch nicht um war und Odoaker bei Theoderich eintrat, fassten zwei Goten seine Hände, wie es Bittende zu tun pflegen. Auf dieses Zeichen kamen die, welche sich in den Seitenräumen der Halle versteckt hatten, mit gezogenen Schwertern hervor, schreckten aber doch bei dem Anblick und wagten nicht, den ersten Streich zu führen. Da stürzte Theoderich herein und stieß Odoaker das Schwert am Schlüsselbein in den Körper. Der rief aus: ‚Wo ist Gott?‘, worauf jener erwiderte: ‚Ich tue dir das, was du den Meinen getan hast.‘ Da der Stoß aber tödlich war und das Schwert bis zur Hüfte den Körper durchdrang, soll Theoderich noch gesagt haben: ‚Nicht einmal Knochen scheint das Scheusal im Leib zu haben.‘
Gotenkriege
Auf die blutige Herrschaftsübernahme, der die meisten unmittelbaren Anhänger und Familienangehörigen Odoakers zum Opfer fielen, folgte für die Italische Halbinsel abermals eine vergleichbar friedliche Zeit, diesmal unter der Herrschaft des Gotenkönigs Theoderich. Die römische Bevölkerung sowie der Senat blieben, wie es scheint, von weiteren gewalttätigen Machtdemonstrationen verschont. Die Situation änderte sich erst, als 535 das ehemalige Kerngebiet des Imperium Romanum nicht erneut von außen, sondern vom Kaiser Justinian I. († 565) aus Konstantinopel angegriffen wurde. Die Goten hatten sich zunehmend vom Kaiser abgewandt, diesmal wollte der Kaiser offensichtlich die Rückeroberung Italiens in die eigenen Hände nehmen. Die Halbinsel und die Ewige Stadt Rom sollten wieder unbestrittener Bestandteil des Reiches werden. Das Unterfangen war am Ende erfolgreich, der Preis für den Sieg gegen die Goten allerdings hoch: Italien, das um 554 tatsächlich wieder in das Römische Reich einverleibt wurde, war merklich von den fast zwei Jahrzehnten währenden Auseinandersetzungen geprägt, ganze Städte waren verwüstet. Viele antike Strukturen, die die Herrschaft Odoakers und die der Ostgoten überdauert hatten, wurden erst durch die römische Rückeroberung zerstört. In diesem Rahmen fand auch die für 546 bezeugte Plünderung Roms durch die Ostgoten unter Totila statt. Erst das kaiserliche Eingreifen durch Justinian und die damit einhergehenden Gotenkriege (535–554), nicht das vorangehende Vordringen barbarischer Gruppen, hatten in Italien erhebliche Zerstörungen und damit eine strukturelle Zäsur mit sich gebracht. Forscher wie Hans-Ulrich Wiemer sehen die Antike in Italien darum nicht mit der Absetzung des jungen Kaisers Romulus Augustulus enden, sondern mit dem oströmischen Sieg über die Ostgoten.
Stichwort
Goten
Als Goten subsumieren die Quellen eine spezifische, aber insgesamt polyethnisch zusammengesetzte und sich im Laufe der Zeit verändernde Volksgruppe. Sie wird zuerst an der unteren Weichsel verortet, von wo aus die Gruppe an das Schwarze Meer wanderte. Seit dem 3. Jahrhundert sind die Goten im südosteuropüischen Raum belegt, wo sie mit dem Kaiserreich in Kontakt traten. Seit der Spätantike wird zwischen West- (Terwingi/Visigothi) und Ostgoten (Greutungi/Ostrogothi) unterschieden, ohne dass es sich hierbei um jeweils homogene oder gleichbleibende Gruppen gehandelt haben kann. Sie nahmen in der Spätantike die arianische Form des Christentums an. 418 wurden Westgoten im Süden Galliens um Toulouse angesiedelt, woraus das sogenannte Tolosanische Reich entstand. Durch die Franken verdrängt, breiteten sie ihre Macht in die Iberische Halbinsel aus und gründeten das Toledanische Reich. Die Ostgoten erreichten im 4. Jahrhundert das Schwarze Meer und die Gebiete westlich davon, von wo aus sie im späten 5. Jahrhundert nach Italien zogen und dort ein Königreich gründeten.
Arianer und Homöer
Als Arianer wurden Christen bezeichnet, die der Lehre des Presbyters Arius von Alexandrien († 327) folgten. Die arianische oder auch als homöisch bezeichnete Lehre unterschied sich vom 325 in Nikaia festgelegten katholischen Dogma insofern, dass sie die Wesensgleichheit von Gott und Gottes Sohn abstritt, da Gott allem übergeordnet sei. Der arianisch-homöische Glaubenssatz definierte die Beziehung zwischen Vater und Sohn nicht als wesensgleich, sondern als „ähnlich“ seine Anhänger verehrten die Heiligen, kannten aber weder das Mönchtum noch das Zölibat. Viele gentile Gruppen hatten den christlichen Glauben zu einer Zeit angenommen, als diese Lehre im Römischen Reich weitverbreitet war, und sie unterschieden sich so auch, nachdem diese zur Häresie erklärt worden war, durch ihren Glauben von der römischen Bevölkerung. Hierzu gehörten neben den Goten auch die Burgunder, die Vandalen, die Sueben sowie die Langobarden. 381 erreichte der Theologe Wulfila († 383), der eine gotische Übersetzung der Bibel vorlegte, aber zumindest faktisch die Tolerierung des arianischhomöischen Glaubensbekenntnisses.
Langobarden
Der teuer erkaufte Sieg währte keine vierzehn Jahre. Im Jahr 568 erreichten die Langobarden unter ihrem Anführer Alboin († 572) italischen Boden. Wie die Goten waren sie mehrheitlich arianische Christen, wodurch sie sich von der römisch-katholischen Bevölkerung unterschieden. Die Langobarden waren bis dahin nur am Rande der römischen Welt und vereinzelt auch als römische Hilfstruppen in Erscheinung getreten. Ab dem späten 5. Jahrhundert hatten sie vor allem an der Donau bis in den nördlichen Teil Pannoniens gesiedelt, wo sie an das Gebiet der Ostgoten angrenzten. Der Zusammenbruch der gotischen Herrschaft in Italien hatte es ihnen ermöglicht, sich nach Süden auszubreiten, die genauen Umstände sind aber nur lückenhaft überliefert. Das Eindringen der Langobarden in Gallien und Italien wird in zeitgenössischen Quellen wie den Historien des Bischofs Gregors von Tours († 594) sowie etwas später in den Werken Papst Gregors des Großen († 604, cf. Quelle) zwar vereinzelt erwähnt, ein detaillierter und chronologisch zusammenhängender Bericht findet sich aber erst in der noch zu besprechenden Langobardengeschichte des Paulus Diaconus.
Quelle
Prophezeiung im Traum des Bischofs Redemptus von Ferentino († 586/587) in: Gregor der Große, Dialoge 3.38 (Übers. Funk 1933, S. 183–184)
Bald folgten auch jene furchtbaren Zeichen am Himmel, dass man feurige Lanzen und Schlachtreihen von Norden her kommen sah. Und bald wurde das wilde Volk der Langobarden aus der Scheide seiner Wohnstatt gezogen und wütete gegen unseren Nacken; und das Menschengeschlecht, das in diesem Lande in überströmender Zahl wie eine dichte Saat dastand, wurde dahingemäht und verdorrte. Denn die Städte wurden entvölkert, die festen Plätze zerstört, Kirchen niedergebrannt, Männer- und Frauenklöster dem Erdboden gleichgemacht. Die Landgüter sind verlassen und niemand nimmt sich ihrer an; das flache Land liegt brach und ist verödet; kein Besitzer wohnt mehr dort, und wilde Tiere hausen, wo ehedem viel Volk seine Wohnung hatte. Was in anderen Teilen der Welt vor sich geht, weiß ich nicht. Aber in diesem Land, in dem wir leben, verkündigt die Welt ihr Ende schon nicht mehr, sondern zeigt es bereits.




























