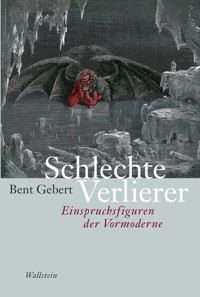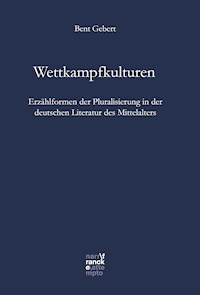
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Bibliotheca Germanica
- Sprache: Deutsch
Wie bringen Gesellschaften der Vormoderne, die keine generalisierten Konzepte von Diversität im modernen Sinne ausbilden, dennoch Vielfalt zur Geltung? Die Untersuchung verfolgt diese Frage anhand deutschsprachiger Wettkampferzählungen des 9. bis 15. Jahrhunderts und ausgewählter Bezugstexte der lateinischen und französischen Literatur. Die gattungsübergreifenden Studien arbeiten heraus, welche Differenzlogiken in Streitdialogen und Narrativen vom Seelenkampf, in Heldenepen, höfischen Romanen, Märtyrerlegenden, allegorischen Dichtungen und Exempelerzählungen greifbar werden. Ausgelotet werden erzählerische Spielräume der Vervielfältigung, die nicht nur Alternativen eröffnen, sondern insbesondere interne Möglichkeiten von Unbestimmtheit kultivieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1132
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bent Gebert
Wettkampfkulturen
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2019 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.narr.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-7720-8653-3 (Print)
ISBN 978-3-7720-0069-0 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2017 von der Geisteswissenschaftlichen Sektion der Universität Konstanz als Habilitationsschrift angenommen. Für den Druck wurde sie überarbeitet.
Herzlich danken möchte ich Ludger Lieb, Michael Schwarze und Juliane Vogel für die Begutachtung der Arbeit und Anregungen aus vielfältigen Expertisen. Danken möchte ich gleichfalls meinen derzeitigen bzw. ehemaligen Konstanzer Kollegen Martin Baisch, Daniel Hütter, Norbert Kössinger, Michael Schwarze und Bernd Stiegler, die in Wettkampfbegegnungen auf dem Badmintonfeld, durch beflügelnde Gespräche und freundschaftliche Unterstützung den Fortschritt der Arbeit förderten. Burkhard Hasebrink hat mich mit ermutigendem Zuspruch, mit fachlichem wie persönlichem Rat seit vielen Jahren begleitet. Udo Friedrich, Burkhard Hasebrink und Susanne Köbele danke ich für die Aufnahme der Arbeit in die Bibliotheca Germanica und einlässliche, kritische Lektüren. Dankbar bin ich der Universität Konstanz für die Übernahme der Druckkosten durch den Young Scholar Fund sowie dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg für die Förderung des Forschungsprojekts, aus dem die Untersuchung hervorging. Viele haben mich von der Entwicklung des Projekts über dessen Ausarbeitung bis zu strapaziösen Korrekturgängen tatkräftig unterstützt: Luca Baumann, Lena Boehler, Elisa Fluk, Nico Kunkel, Céline Martins-Thomas, Martin Schneider, Pia Schüler und Philipp Sigg sei herzlich gedankt.
Die nachfolgenden Studien treten für eine mediävistische Literaturwissenschaft ein, die sich ebenso kritisch ihren theoretischen Grundlagen zuwendet wie ihren historischen Textgegenständen. Wie dieser Spagat produktiv gelingen kann, ist eine offene Frage – darüber und vieles mehr in kleinen und großen Gesprächen mit meiner Frau Eva diskutieren zu dürfen, bedeutet für mich ein großes Glück. Wettkampfkulturen leben, so will das Buch zeigen, von Überraschungen und Unbestimmtheit, die in Beziehungen intensiver Nähe erfahrbar werden. Daher widme ich es meinen Kindern Diana und Jonathan, die seine Entstehung an jedem Tag mit überraschendem Leben erfüllt haben.
Konstanz, im Dezember 2019 Bent Gebert
I Ausgangslagen
1 Zwischen Einfachheit und Vielfalt
»Mittelalterliche Geschichten handeln von Rittern, Prinzessinnen, Drachen, bösen Widersachern, Riesen und Zwergen«, bemerkt Armin Schulz lapidar in seinen Analysen zur Erzähltheorie, doch obwohl höfische Romane und Epen dazu immer wieder schematisch von Aventiure und Konfrontation, von Kampf und Liebe erzählten, erreichten sie bemerkenswerte »Komplexitätssteigerungen«.1 Ein solcher Eindruck trifft einen zweischneidigen Sachverhalt. Wer sich mit mittelalterlichen Erzählungen beschäftigt, kann kaum bestreiten, dass diese tatsächlich aus einem begrenzten Vorrat grundlegender Sujets und hochfrequenter Erzählkerne schöpfen.2 Ihre Protagonisten scheinen »alles andere als komplexe Charaktere«.3 Romane stützen sich auf ›einfache Formen‹, die z.B. dem Märchen ähneln,4 Epen und Kurzerzählungen greifen gleichermaßen zu Mustern und Erzählschablonen.5 Explizite produktionsästhetische Normen zielen auf Integration: Wenn die hochmittelalterliche Schulrhetorik etwa Bearbeitungsroutinen des Erweiterns und Kürzens empfiehlt, dann weniger zur Erzeugung origineller Sinnvarianten als vielmehr zum »Vereindeutigen des bereits Vorhandenen«.6 »Mittelalterliches Erzählen orientiert sich in großem Umfang an vorausgehenden Erzählungen«, deren Tradition durch Erneuerung gepflegt, deren »Grundmuster« als »konstantes Set von Wahrheiten« wiederholt und im »kulturellen Gedächtnis« gesichert werden.7
Andererseits bevorzugen mittelalterliche Geschichten zwar stereotype Elemente und einfache Basisschemata, kombinieren und variieren diese jedoch zu durchaus komplexen Erzählstrukturen und Figurenentwürfen, die mitunter hybrid oder gar brüchig wirken.8 Je nach Perspektive (und Kunst des Interpreten) scheint mittelalterliches Erzählen in seinem Dispositiv des Wiederholens und Erneuerns oft genug zwischen Einfachheit und Vielfalt zu schwanken.9Kürzende Textbearbeitungen können nicht nur pointierend vereinfachen, sondern ebenso neue Sinnvarianten erzeugen,10 einstimmige Wissensbestände können in »plural fokalisierte[m] Erzählen« zugleich vielstimmig aufgeteilt werden.11 Auch lyrische Texte zielen auf »programmatische Steigerung von Komplexität« durch performative »Vielfältigkeit«, während sie gleichzeitig von »Standardisierung« ihres Themenvorrats ausgehen.12 Insgesamt nährt dies den Eindruck: »Wiederholung und Abweichung« scheinen gleichermaßen »zentrale Aspekte« der »mittelalterlichen Kultur« zu bilden, die sich schwer aufeinander reduzieren lassen.13 Und es scheint gerade dieses komplexe Zusammenspiel von Einfachheit und Vielfalt zu sein,14 das oft zu ebenso schwankenden Bewertungen der Modernität volkssprachlicher Literatur des Mittelalters verführt.15
Solches Schwanken ist der mediävistischen Literaturwissenschaft traditionell vertraut.16 Doch verdient es im Kontext kulturwissenschaftlicher Methodologie neue Aufmerksamkeit, insofern es auf grundsätzliche Schwierigkeiten der Kulturwissenschaften im Umgang mit historischen Texten verweist, deren Erzählformen zwischen Einfachheit und Komplexität changieren. Zu diesen Formen gehören nicht zuletzt auch Erzählmuster des Wettkampfs.17 Wenn höfische Romane geradezu obsessiv ritterliche Kämpfe umkreisen und dazu fortgesetzt Erzählschemata von Aventiure und Zweikampf durchspielen,18 erzeugen sie mittels einfachster Sujets und Erzählmittel oft Ergebnisse von schillernder Komplexität. Sie sind in ihren Voraussetzungen freilich reduktiv: Natürlich erzählen auch mittelalterliche Texte vom Zweikampf als Interaktion, bei der man gewinnt oder verliert; auch jenseits literarischer Inszenierung zielen z.B. mittelalterliche Gerichtskämpfe auf eindeutigen Ausgang der Wahrheitsfindung.19 Texte des hohen und späten Mittelalters stellen oft Zweikämpfe in den Mittelpunkt, deren Ausgänge irritierend offen bleiben, indem sie förmlich wuchern – und dies quer zu Sprach- und Gattungsgrenzen.20
Einen besonders eindrücklichen Fall dieser Art liefert in der deutschsprachigen Epik die Krone Heinrichs von dem Türlin (um 1230).21 Durch mehrdeutige Zugeständnisse ermutigt, hatte ein mysteriöser Ritter namens Gasozein die Königin Ginover zu vergewaltigen versucht, als die Aventiure zufällig den Musterritter Gawein zur Rettung herbeiträgt. Nach wenigen Reizworten fliegen die Ritter schemagemäß mit eingelegten Lanzen aufeinander: Beide mit gleichem zorn (V. 11872). Trotzdem bemühen sich die Aggressoren äußerst rücksichtsvoll umeinander. Nach dem ersten Waffengang pausieren Gawein und Gasozein einträchtig in ruowe miteinander (V. 11926), bis ihnen neue Kräfte zuwachsen. Sobald Gasozein sein Schwert entgleitet, lässt ihn Gawein bereitwillig die Waffe aufnehmen (V. 11958–11969) und hilft dem Gegner sogar wieder in den Sattel, als dieser entkräftet vom Pferd fällt (V. 11997–12006). Statt auf Sieg oder Niederlage zielt die Episode immer wieder auf Gleichstand: Jähzornig ersticht Gasozein sein ermüdetes Tier, woraufhin Gawein zum Ausgleich sein eigenes Pferd tötet (V. 12009–32). Wieder brechen beide erschöpft zusammen. Als Gawein schließlich als erster erwacht, eilt er sogleich Dâ hin, dâ sein geselle lak / Vnd noch seins slaffes phlak. / Den began er suoz wechen (V. 12212–12214). Obwohl Vergewaltiger und Beschützer also auf Zweikampfsieg und Niederlage des anderen zielen, suchen sie fürsorglich Symmetrie herzustellen. Dies nimmt geradezu intime Züge an (Gawein weckt Gasozein suoz) – und wird in auffälligen Wiederholungen erzählt. Insgesamt viermal brechen beide ohnmächtig zusammen und pausieren, sobald sich der Zweikampf asymmetrisch zu neigen droht, um sodann den Kampf fortzusetzen. Gawein und Gasozein verschlingen sich dabei in seltsamen Schleifen von Kooperation und Destruktion,22 welche die Kontrahenten im Widerstreit auf paradoxe Weise verbinden – in »strange loops«, wie man mit dem Kognitionswissenschaftler Douglas Hofstadter sagen könnte.23 Schon Heinrich von dem Türlin hebt hervor, wie schwer diese Dynamik für die Beteiligten zu verkraften ist: Ginover, die umkämpfte Dritte, treibt solche Unfähigkeit zur finalen Entscheidung schier zur Verzweiflung (V. 12272–12289). Offenkundig: Solche Zweikämpfe kennen kein Finale, sondern höchstens Erschöpfungszyklen. Sie verleihen dem einfach strukturierten Erzählmuster vom Kampf auf Sieg und Niederlage durch paradoxe Verschlingungen eine Dynamik, die von keiner Figur mehr kontrolliert werden kann. Auch über die Szenenregie des Erzählers wächst sie hinaus. Zwar lenkt die Handlung die Freund-Feinde Gasozein und Gawein an den Artushof zurück, doch weder kann der offene Konflikt um Ginover gelöst werden, noch überhaupt stillgelegt werden. Ein unlösbarer Zweikampf verkettet sich dadurch mit einer Romanhandlung, die auch in vielen anderen Episoden schleifenförmig erzählt. Nicht nur für Richterfiguren wie König Artus werden dadurch Auflösungen schwierig. Auch ihrem Rezipienten verweigern solche Strukturen eindeutige Antworten, wie Justin Vollmann gezeigt hat:24 Wo solche Schleifen beginnen oder enden, wird schwierig zu ermessen, wenn Handlungsketten auf immer neue Wettkämpfe verweisen.25 Ausgestellt wird eine »reine Form: mehr oder weniger geordnete Zusammenhänge, die auf nichts verweisen außer auf sich selbst.«26
Die kooperierenden Feinde der Krone sind bekanntlich kein Sonderfall des spätmittelalterlichen Romans.27 Die nachfolgenden Analysen beleuchten, wie mittelalterliche Erzähltexte in verschiedensten Gattungs- und Diskurszusammenhängen paradoxe Kalküle des Wettkampfs gestalten, die vergleichbare Komplexitätsmuster hervortreiben. Aventiureromane entwickeln sie besonders häufig im Rahmen von Zweikämpfen. So führt etwa Hartmann von Aue den Gerichtskampf von Iwein und Gawein über mehrere Waffengänge und Pausen, die selbst dann noch fortwuchern, als der Gerichtskampf aus formaljuristischen Gründen bei Sonnenuntergang als entschieden gelten müsste:28 Tief im Herzen der Kämpfer aber treiben minne und haz unablässig Zuneigung und Aggression voran.29 Auch der Parzival Wolframs von Eschenbach verschränkt Aggression und Kooperation: vom Gruppenkampf der Artusritter gegen den tranceartig abwesenden Parzival über die Zweikämpfe Gawans auf dem Feld von Joflanze oder der unerkannten Brüder Parzival und Feirefiz bis zum alternierenden Wechsel umfangreicher Passagen, die bald Parzival, bald Gawan folgen.
Aber auch heldenepische Texte entwickeln ihre Kampfbeziehungen in dieser Spannung. Gemeinsam pausieren im Waltharius die Kontrahenten Gunther, Hagen und Walther miteinander, trinken, bespotten und rühmen sich gegenseitig für Verstümmelungen und andere Heldenleistungen; nach einer langen Sequenz von Siegen und Niederlagen balanciert die Erzählung damit einen Zustand aus, der Sieg und Niederlage aufschiebt.30 Selbst wenn Heldenepen ihre Antagonisten holzschnittartig gegenüberstellen, führt sie die Erzählung von Dietrichs Flucht in eine »Endlosschleife« von Kämpfen, die weder Anfang noch Ende zu haben scheinen.31 Ihre Dynamik treibt im Rosengarten zu Worms eine Duellserie voran, die aufwändige Bindungen zwischen Helden herstellt und zugleich tiefgreifend zerstört.32 Nicht immer wird diese Spannung textfüllend entfaltet, sondern kann ebenso episodisch zugespitzt werden. Zu solchen Situationen zählen nicht zuletzt höfliche Grußrituale, mit denen Helden noch den unbeherrschtesten Widersachern Runde um Runde entgegentreten.33 Wettkämpfe zeigen sich dabei als einfaches Muster mit komplexer Verkettungsstruktur, episodisch geschlossen und strukturell offen zugleich. Das reizt vielfach auch die Erzählinstanzen zu besonderen Übertragungen: Während etwa Sivrit den Jagdwettkampf in der 16. Aventiure des Nibelungenliedestriumphal beendet, habe die Jagd auf ihn selbst gerade erst begonnen – Daz jagt was ergangen und ouch niht gar.34
Wenn höfische Romane und Heldenepen diese Kampfdynamik von Schließung und Öffnung besonders häufig mit Signalen von Kooperation und Verweigerung verbinden, lässt sich dahinter eine feudale Distinktionspraxis erkennen, in der Gewinn und Verlust von Ehre grundsätzlich auf wechselseitiger Anerkennung beruhen. Dagegen zeigen die vielfältigen Wettkampfszenarien religiöser Textsorten, dass paradoxe Schleifen keineswegs auf die soziale Logik adliger Selbstdarstellung beschränkt sind. Auch Märtyrerlegenden erzählen so zum Beispiel in unendlichen Kreisläufen von Glaubensdisputen, Foltern und Auferstehungen,35 in denen Heilige und ihre Widersacher sich nicht bloß auszuschalten suchen, sondern gegenseitig immer wieder Spielräume für Machtdemonstration eröffnen. Auch Legenden erzählen in vielen Fällen mittels agonaler ›loops‹ von Kooperation und Destruktion, die vermeintlich einfache Heilserwartungen in riskanter Weise aufs Spiel setzen.36 In vergleichbarer Weise stellen auch Wissensdiskurse des Spätmittelalters epistemische Ordnungen in Gestalt von Wettkämpfen zur Debatte, die weniger auf stabile Lösungen als vielmehr auf fortgesetzte Dynamik zielen.37 Die Beispielliste ließe sich jenseits narrativer Textsorten rasch weiter verlängern.38
Zwischen Einfachheit und Vielfalt eröffnen Wettkampflogiken dadurch Spielräume, die Grenzen und Möglichkeiten ihrer Kontexte experimentell zur Debatte stellen. Antikenromane wie der Eneasroman Heinrichs von Veldeke etwa entfalten im Rahmen von Kampf- und Liebesdarstellungen ein »konkurrierende[s] Nebeneinander von himmlischer und irdischer Handlungsmotivation«, das die Gründungsgeschichte römischer Herrschaft um Geschichten alternativer Liebesformen, religiöser Instanzen und politischer Stile erweitert.39 Ausgangspunkt der Untersuchung bildet dabei die Beobachtung, dass derartige Spielräume nicht schon von Konfliktsujets wie Krieg oder Zweikampf allein begründet werden. Sie entstehen in besonderem Maße, wenn ihre erzählerische Organisation erkennbar an konkurrierenden Darstellungsmodi arbeitet, die wie im Falle des Eneasromans etwa Motivationsarten, Semantiken und Diskurse umfassen. Vielfalt entsteht selbst in solchen agonalen Erzählarrangements, die Schwert und Lanze mit keinem Wort erwähnen. Wettkampf wird somit nicht bloß als Frage nach Motiven und Semantiken, sondern auch nach narrativen Formen von Interesse. Was aber sind dies für Erzählformen, die sich weniger dafür interessieren, wer gewinnt oder verliert, stattdessen aber von Wettkämpfen in unabschließbaren Schleifen sprechen?40 Welcher Kultur entspringen literarische Gegner wie Gawein und Gasozein, die einander im Zweikampf auszuschalten suchen, gleichzeitig aber bis zur Erschöpfung fördern und unterstützen?
Die Beschreibung der einzelnen Motive, die zu diesen Fragen gehören, mutet einfach an: Es geht um Regeln und Akteure agonaler Spiele in feudalen, religiösen und urbanen Erzählkontexten. Und auch an sozialtheoretischen Begründungen für die Exzessdynamik von Kampfformen fehlt es nicht.41 Doch scheinen mir die Schwierigkeiten bereits diesseits motivgeschichtlicher oder literatursoziologischer Einordnungen zu beginnen, sobald sich das Interesse überhaupt auf Spielräume der Vervielfältigung richtet. Sie verschärfen sich gerade in kulturwissenschaftlichen Beobachtungslagen, die sich disziplinärer und gegenstandsbezogener Pluralisierung verdanken. Das klingt zunächst wenig eingängig. Sind kulturwissenschaftliche Untersuchungen nicht besonders dafür sensibilisiert, Texte als Knotenpunkte pluraler Zeichenensembles zu begreifen, die auf Optionalität und Selektivität angelegt sind?42 Wenn die gegenwärtigen Kulturwissenschaften die Gegenstandsgrenzen von Einzeldisziplinen ebenso wie die methodischen Grenzen von Paradigmenfolgen weit hinter sich gelassen haben, gilt die »Tendenz der Kulturwissenschaften zum Pluralismus« heute als unhintergehbar.43 Kulturen wie Kulturwissenschaften, könnte man daher vereinfachend sagen, sind nur unter pluralistischen Vorzeichen zu haben.44
Immer deutlicher zeichnet sich jedoch ab, dass damit Gewinne und Schwierigkeiten zugleich erkauft sind. Als fruchtbar erwiesen sich kulturwissenschaftliche Öffnungen, wenn damit nicht nur Grenzen überschritten, sondern Beobachtungszonen angereichert wurden. Problematisch erwies sich diese Vervielfältigung, sofern nicht im selben Maß reflektiert wird, inwiefern die Gegenstandsbereiche solcher Pluralisierung standhielten. Dadurch wuchsen blinde Flecke zwischen Forschungsoptik und Gegenständen, die nicht nur die Beschreibungsleistungen kulturwissenschaftlicher Forschung ermöglichen, sondern auf unbehagliche Weise auch einschränken. Sie bilden den allgemeinen Anlass und die Ausgangslagen (Kap. I.3–5) der vorliegenden Studien.
Dass vormodernes Erzählen einfach und komplex zugleich erscheinen kann, ist also nicht bloß ein Spezialproblem für Mediävisten, sondern könnte nicht zuletzt auch mit Beschreibungsproblemen grundsätzlicher Art zu tun haben. Zumindest können jüngere Theoriediskussionen der Mediävistik den Eindruck nähren, dass kompakte Begriffe wie etwa das ›Leitkonzept der Alterität‹ diese Schwierigkeiten eher verdeckten als analytisch erhellten.45 Auch ließen sich gängige Merkmale komplexer Texte wie Reflexivität und Polyvalenz häufig nur unter deskriptiven Verwerfungen oder negativen Vorbehalten auf mittelalterliche Erzähltexte anwenden.46 Galten besonders komplexe Texte dementsprechend als ›Frühformen‹ von Reflexivität,47 als herausragende Beispiele der ›Dekonstruktion‹48 kultureller Spielregeln oder als literarische Arbeit ›vor dem Zeitalter der Literatur‹,49 so mussten solche Perspektiven mühsam gegen ästhetische Normen und literarhistorische Modernisierungsthesen anschreiben,50 die Komplexität eher zum Argument von Wertzuschreibung als zum Werkzeug präziser Textbeschreibung machten.51
Die folgenden Überlegungen stellen sich dieser Herausforderung im Kontext von Historisierungsschwierigkeiten, welche die kulturwissenschaftliche Mediävistik mit methodischen Prämissen der Pluralisierung übernimmt. Schwierig sind sie, weil sie keineswegs oberflächlich eingehandelt und insofern leicht verzichtbar wären, sondern gewissermaßen zur Arbeitsgrundlage mediävistischer Textwissenschaften gehören. Meine Arbeitshypothese ist demgegenüber einfach: Wenn mittelalterliche Erzählungen einfach und komplex zugleich erzählen, könnten Typen der Vervielfältigung in den Blick treten, die in diesem präzisen Sinne als nicht-kulturförmig zu betrachten wären, insofern sie einen spezifisch modernen Pluralismus des Kulturellen nicht teilen. Doch mit emphatischen Abgrenzungen dieser Art ist natürlich wenig gewonnen: Wie kann man solche Erzählungen zwischen Einfachheit und Vielfalt beschreiben, ohne dafür den Umweg über Negationen zu nehmen? Die komplexen Formen mittelalterlicher Wettkampferzählungen könnten hierzu exemplarische Anregungen liefern, um Pluralisierungsannahmen der mediävistischen Kulturwissenschaften zur Debatte zu stellen. Wie Kulturwissenschaften sich jenen Objekten stellen, die sich kulturwissenschaftlicher Pluralität widersetzen, könnte dann auch über die Mediävistik hinaus zu einer weniger unbehaglichen, dafür aber brisanteren Frage werden.52
2 Unbehagen in den historischen Kulturwissenschaften
Unbehagen artikuliert sich besonders in historisch orientierten Forschungszusammenhängen, die Pluralisierungskonzepte der Kulturwissenschaft entschieden aufgenommen haben.1 So ist auch die Mediävistik einerseits im Gefolge des ›cultural turn‹ gewohnt, von vormodernen Kulturen zumeist im Plural zu sprechen. Erforscht wurden etwa »Kulturen des Performativen«2 oder die »Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter«,3 um nur zwei prominente Forschungsverbünde des letzten Forschungsjahrzehnts zu nennen. Auch im Rahmen von Projekten und Tagungen dient der Plural der ›Kulturen‹ dazu, neue Sachbezüge vergleichend zu organisieren.4 Andererseits ist hinlänglich bekannt – dies ist im nachfolgenden Kapitel ausführlicher nachzuzeichnen –, dass der Kulturbegriff als historisches Pluralitätskonzept erst seit dem späten 18. Jahrhundert zur Verfügung steht, um Vielfalt von Gesellschaften und ihren symbolischen Ordnungen zu vergleichen.5 Statt auf ein generalisiertes, abstraktes Reflexionssymbol wie den Kulturbegriff stützt sich die historische Kulturtheorie daher eher auf Formen der Reflexion, die eng mit konkreten Artikulationen, Praktiken und Materialitäten verbunden scheinen.6 Kulturtheorien als explizite Theorien irreduzibler Verschiedenheit, so ein weitverbreiteter Konsens, suche man in der Vormoderne vergebens. Kultursoziologische Ansätze leiten daraus die These ab, dass die reflexive Beobachtung von Vielfalt ein spezifisch modernes Kennzeichen sei.7 Erst moderne Kulturbegriffe stellten die Anerkennung von »Diversität«8 und »Kontingenz«9 menschlicher Lebensformen und Symbolsysteme programmatisch in den Mittelpunkt. Die pluralistischen Prämissen der Kulturwissenschaften verdanken sich dieser modernen Beobachtungspraxis.10
Für vormoderne Literatur ist diese pluralistische Beobachtung keineswegs vorauszusetzen. Dies unterstreichen zum einen Studien der mediävistischen Literaturwissenschaft, die der Kultursemantik kritisch gefolgt sind. Kreuzzugsepischen Erzählungen wie dem Rolandslied bescheinigt etwa Peter Strohschneider eine normative Asymmetrie von Christen und Heiden, von Eigenem und Anderem, die sich von modernen Kontingenzperspektiven als vor-kulturelle Konfliktordnung abhebe.11 Wie Marina Münkler zum anderen anhand spätmittelalterlicher Reiseberichte demonstriert hat, erweisen sich deren Wissensordnungen wiederum als flexibel genug, um ethnische, anthropologische und soziale Fremdheitserfahrungen zu artikulieren und in Zeichensystemen der Ähnlichkeit zu verorten, ohne sie gänzlich zu ignorieren.12 Der kulturfunktionale Status mittelalterlicher Textlogiken und Semantiken ist daher von Fall zu Fall zu prüfen und lässt sich keineswegs aus Einzelstimmen generalisieren. Mit Blick auf die Forschung lässt sich zumindest festhalten: Zur großräumigen Epochensignatur scheint »Pluralisierung« nach allgemeiner Einschätzung kaum vor dem 15. Jahrhundert zu taugen. Erst mit dem »Entstehen konkurrierender Teilwirklichkeiten«13 in der Frühen Neuzeit wandeln sich »Erfahrungen epistemischer Irritation«14 zum dauerhaften »Pluralismus institutioneller Gefüge«15. Emphatisch zugespitzt heißt dies, erst seit der Renaissance von vielstimmigen Repräsentationsmöglichkeiten von Wirklichkeit auszugehen.16
Doch schon Texte des Hochmittelalters kreisen um alternative Ordnungen und führen vor, dass sich auch anders handeln, anders glauben und anders wahrnehmen lässt. Zunehmende Mobilität von Personen, Kreuzzüge, Reformbewegungen und Fernhandel vervielfältigen die Spannungen und Differenzen ökonomischer, religiöser, wissenschaftlicher oder juristischer Ordnungen ab dem 12. Jahrhundert rasant.17 Auch die mittelalterliche Gesellschaft Europas geht also aus geschichtswissenschaftlicher Sicht faktisch mit Vielfalt um, ihre gelebten Ordnungen sind keineswegs kohärent, einheitlich oder reduktiv.18 Und schon die Geschichtsschreibung des Mittelalters zeichnet solche Differenzen in Gestalt von »unendlich vielen Geschichten im Plural« auf, die kein Kollektivsingular ›der Geschichte‹ eint.19 Zu Recht unterstreichen daher auch literaturwissenschaftliche Studien: »›Die‹ mittelalterliche Kultur ist ein Konstrukt, das es in dieser Homogenität und Ganzheit niemals gibt und nie geben konnte«.20 Wo literarische Texte wie das Nibelungenlied zugleich kulturelle Selbstbeschreibungen liefern, erzählen sie nie von Alternativlosigkeit, sondern immer auch von der Optionalisierung sozialer Ordnung.21 Und selbst kreuzzugsepische Texte wie der Willehalm Wolframs von Eschenbach experimentieren mit symmetrischen Darstellungsformen,22 entfalten »komplexe Überlagerungen« und Hybridisierungsmöglichkeiten, wo die Konfrontation von Christen und Heiden einseitige Ausgrenzungen erwarten ließe.23
Dennoch symbolisiert die mittelalterliche Gesellschaft diese Vielfalt nicht im positiven Sinne als Diversität. Zwar verfügen mittelalterliche Theologen und Philosophen, Geschichtsschreiber und Juristen durchaus über differenzierte Begriffe, mit denen sie Vielfalt (lat. diversitas, varietas, pluralitas, multitudo und multiformitas, wörtl. auch multiplicitas), Verschiedenheit (z.B. variatio, disparitas) oder Vorgänge der Vervielfältigung (z.B. plurificatio) bezeichnen.24 Anknüpfend an die Differenztheorien platonischer und aristotelischer Tradition systematisierten diese Begriffe nicht nur metaphysische Wesensverschiedenheit und zahlenlogische Vielheit (diversitas numeralis), sondern ebenso die Vielfalt geschaffener Dinge (diversitas rerum), sie galten der Meinungsvielfalt (diversitas opinionum) bis hin zu geistigen Operationen des Unterscheidens (distinctio oder diversitas rationis). In der Regel blieben solche Begriffe von Vielfalt jedoch auf komplementäre Konzepte von Einheit oder Einfachheit zurückbezogen, die keineswegs ein wertneutrales Begriffspaar bildeten. Während Einheitskonzepten in logischer und ontologischer Hinsicht zumeist höhere Dignität zukam, galt Vielfalt als davon abgeleitet und abhängig. Von Boethius und Isidor von Sevilla über Thierry von Chartres und Thomas von Aquin bis zu Nicolaus Cusanus bestand weitgehender Konsens: Vielzahl geht aus Einheit hervor oder mündet in Einheit,25 die Vielfalt der Dinge verweist auf einheitliche Ordnung als Absicht ihres Schöpfers,26 Varietäten sind in der Einheit ihrer Gattung verbunden. Wenn die Einheit der Welt in Vielfalt erfahrbar ist (unitas in pluralitate), so betrachtet Nicolaus Cusanus dies nicht als Reichtum sondern als schrittweise Einschränkung.27 Im gesamten Mittelalter klingt in philosophischen und theologischen Argumentationen ein »Ressentiment« an, das diversitas geradezu topisch mit Falschheit, Verworrenheit und Zwietracht in Verbindung brachte, wie Stephan Meier-Oeser bilanziert: »Während die Assoziation der Einheit mit positiv verstandenen Korrelativbegriffen sich bis in die jüngere Vergangenheit weitgehend konstant durchhält, erscheint die Bewertung der [Vielheit] seit jeher als ambivalent.«28 Diesen Eindruck einer ambivalenten Begriffsgeschichte teilt auch die mediävistische Geschichtswissenschaft bis in jüngste Zeit:
Im Mittelalter selbst war der Begriff des Einen und der Einheit gegenüber der Vielheit deutlich positiver besetzt. Mit ihm wurde der Geist und die Seele assoziiert, die Wahrheit und die Güte, die Ordnung und das Ganze, Liebe und Frieden, die Ähnlichkeit und das Universum. Pluralitas und multitudo belasteten indessen vorwiegend ungünstige Konnotationen, durch die sie, und zwar schon seit der Antike, zur ›Einheit‹ in deutlichen Kontrast gerieten. Die negativen Entsprechungen der Vielheit lauteten auf Verworrenheit und Zwietracht, Falschheit, Andersheit, Teilbarkeit, Bewegung, Materie und so weiter. […] Trotz der unbestreitbaren Höherschätzung des Einen und der Einheit wussten die Philosophen und Theologen des Mittelalters, dass Vielheit natürlich gegeben und unvermeidlich ist. […] Die Verschiedenheit (diversitas) des Besonderen konnte durch ihre Differenz aber durchaus zur positiv bewerten ›Vielfalt‹ (varietas) führen, die mit Schönheit, ja Vollkommenheit verbunden wurde.29
Festzuhalten ist damit zweierlei. Zum einen fehlte es also keineswegs an systematischen Diskursivierungen von Vielfalt im Mittelalter, im Gegenteil: Selbst schwankende Bewertungen, die das asymmetrische Begriffspaar provozierte, bezeugen intensiv geführte Auseinandersetzungen um Vielfalt und Einheit. Der springende Punkt scheint mir jedoch zu sein, dass derartige Konzepte von diversitas kaum positiven Raum für Unbestimmtheit eröffneten – für »unaufgelöste Vielheit«,30 die nicht zugleich von Gesichtspunkten der Einheit bestimmt ist.31
Trotz reicher Debatten und systematischer Diskursivierungen plädieren Texte des Mittelalters selten für Relativismus oder Pluralismus der Ordnungen. Sie bleiben stattdessen weitgehend auf integrative Semantiken eingeschworen, die Erwartungen an logische, metaphysische oder funktionale Einheit mit sich führen.32 Die ältere geistesgeschichtliche Forschung hatte aus diesem Grund die mittelalterliche Gesellschaft vom »Princip der Einheit« her beschrieben,33 das zwar Übertragung, nicht aber Teilung und Vervielfältigung von Herrschaft zulasse.34 Für die jüngere Sozialgeschichte erwuchs daraus das Problem, offenkundige Diskrepanzen zwischen der »realen Vielfalt« mittelalterlicher Lebenswirklichkeiten und den »noch starrer geprägt[en]« Modellen typischer Lebensformen zu beschreiben.35 Beamte und Gelehrte, Handwerker und Kaufleute – sie und andere mehr bilden neue soziale Gruppen in Bewegung, ohne dass deshalb Ständeordnungen des Hoch- und Spätmittelalters vom traditionellen Grundmodell der dreigeteilten Gesellschaft abrücken.36 Wenn Zeitgenossen reflektieren, »daß es Lebensformen in der Mehrzahl geben müsse«,37 manifestiert sich die »Pluralisierung der Lebensformen« selten in mimetischer Abbildung veränderter Lebenswirklichkeiten; was öfter greifbar wird, sind »Widersprüche« ihrer textuellen Artikulation.38
Diese Widersprüche haben ihren Grund nicht zuletzt darin, dass Selbstbeschreibungen der mittelalterlichen Gesellschaft nicht gleichermaßen aus sämtlichen Sphären bzw. Schichten überliefert sind. Vorrangig werden sie von einer Schriftpraxis getragen, die religiösen Institutionen verpflichtet ist, wie Jan-Dirk Müller unterstrichen hat:
Man hat gelernt, die Pluralität und die Antagonismen der mittelalterlichen Kultur zu lesen. An der Dominanz der christlichen Religion, der geistigen Führungsmacht der Kirche und der Prägung der literarischen Kultur durch die schriftkundigen clerici besteht aber kein Zweifel.39
Noch die jüngste Forschung beschäftigen somit Widersprüche, Verwerfungen und Lücken zwischen hegemonialen Selbstbeschreibungen und den historischen Realitäten sozialer Vielfalt, die seit dem Hochmittelalter beschleunigt wachsen. Zwar lässt sich keineswegs mehr vertreten, »die abendländische Christenheit« wäre »regelrecht besessen von der Vorstellung einer notwendigen reductio ad unum in allen Bereichen und auf allen Ebenen«, womit »Vielfalt in die Nähe des Bösen« gerückt wird.40 Ebenso verkürzend wäre es, lediglich von einer Vielzahl »vormoderne[r] kleine[r] Gemeinschaften« auszugehen, »die für die meisten ihrer Mitglieder die Universen waren, in die das Ganze ihrer Lebenswelt eingeschrieben war«.41 Unübersehbar sind vielmehr die Diskrepanzen: Zwischen programmatisch artikulierten Einheitsansprüchen und realer Vielfalt klafft ein ›semantic gap‹.42
Diese Kluft ist nicht allein auf Überlieferungslücken zurückzuführen, sondern betrifft ein positives Darstellungsproblem von Vielfalt. Es prägt und belastet besonders solche Texte, die diese Kluft ausdrücklich zu überbrücken versuchen, wie ein berühmter Sangspruch Frauenlobs andeuten mag. Er wird oft als Stimme literarischer Gesellschaftsreflexion zitiert, die in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts auf die wachsende Vielfalt von Lebensordnungen antwortet:43
In driu geteilet waren
von erst die liute, als ich las:
buman, ritter und pfaffen.
ieslich [] nach siner maze <was>
gelich an adel und an art
dem andern ie. <war> stet der pfaffen sin?
Sie leren wol gebaren,
kunst, wisheit, aller tugent craft,
fride, scham und darzu forchte
die ritterlichen ritterschaft.
der buman hat sich des bewart,
daz er den zwein nar schüfe mit gewinn.
Nu pfaffe, werder pfaffe,
laz ander orden under wegen.
du stolzer ritter, schaffe,
daz ritterschaft dir lache,
nicht nim an dich ein ander leben.
du buman solt <nicht> hoher streben,
daz lere ich dich, durch fremdes prises sache.
Aufschlussreich ist Frauenlobs Spruch weniger dadurch, dass er konservativ für ein dreigliedriges ordo-Modell von buman, ritter und pfaffen plädiert. Ebenso wenig mag überraschen, dass hinter der Behauptung von geburtsständischer Gleichrangigkeit (ieslich nach siner maze […] / gelich an adel und an art) durchaus ungleichgewichtige Funktionszuweisungen der Berufsstände zum Vorschein kommen. Signifikanter ist der Spruch für das angesprochene Darstellungsproblem von Vielfalt, da er unaugesprochene Möglichkeiten voraussetzt: Angesprochen werden horizontale Konkurrenz (ander orden), Optionalität von Lebensformen (ein ander leben als wählbare Alternative) und vertikale Mobilität (hoher streben). Frauenlobs Spruch zeigt somit Spuren komplexerer sozialer Ordnung, als sie die propagierte Ständelehre auffangen kann.44 Doch bleiben sie allenfalls Implikaturen des Textes; statt als positive Differenzierungen erscheinen sie nur im Zerrspiegel von Negationen. Paradoxerweise gibt der Ständespruch also umso weniger von jener sozialer Pluralisierung preis, der er seinen mahnenden Impetus verdankt.
Für literaturwissenschaftliche Zugänge zur Vielfalt der Vormoderne heißt dies zweierlei. Erstens führt auch auf dem Feld der historischen Kulturtheorie kein direkter Weg von der Sozialgeschichte zur Literaturgeschichte. Zweitens zwingt dies zu Umwegen in der Wahl relevanter Texte: Wer nach literarischen Spuren historischer Pluralisierungsprozesse fragt, wird expliziten Gesellschaftsbeschreibungen – ob in Gestalt von Ständelehren,45 Religionsdialogen oder sozialkritischen Kurzerzählungen46 – kaum bevorzugte Aussagekraft zubilligen können als Texten zu anderweitigen Themen. Im Gegenteil: Explizite Gesellschaftsbeschreibungen wie Frauenlobs Spruch liefern Fälle kultureller Selbstbeschreibung, die »ein Übermaß an Vielfalt innerhalb der Semiosphäre zu vermeiden« suchen, indem sie traditionelle Integrationsmodelle beschwören.47 Je ausdrücklicher von Vielfalt die Rede ist, sei es begrifflich oder thematisch, desto weniger lassen sich diese Texte als positive Quellen beim Wort nehmen.
Literatur- wie Geschichtswissenschaft stellt dies vor die methodische Schwierigkeit, Vervielfältigung zu beschreiben, die gleichwohl auf Einheit bezogen bleibt. Sie führt zu schwierigen Befunden: »Europas Vielfalt wurde entdeckt, aber die je besonderen Kulturen und Lebenswelten fielen dabei nicht ganz auseinander«, konstatiert etwa Michael Borgolte.48 Ungelöst ist damit eine methodische Spannungslage: Unter pluralistischen Prämissen untersuchen historische Kulturwissenschaften die Artefakte und Selbstbeschreibungen vormoderner Gesellschaften, die Pluralismus zurückzuweisen scheinen, obwohl sie gleichwohl aus Prozessen und Bedingungen sozialer Vervielfältigung hervorgehen oder diese sogar vorantreiben. Und nach gegenwärtigem Stand stehen der Mediävistik keine Meistererzählungen zur Verfügung, um diese Spannung auf einfache Weise einzufangen.
Dies erzeugt Unbehagen. Wo es zur Sprache kommt, führt es nicht nur zu paradoxen Einschätzungen: »Die Entdeckung der Vielfalt stiftete Distanzbewusstsein und Nähe gleichermaßen«.49 Kontrovers scheint darüber hinaus, ob und welches Konzept von ›Kultur‹ die Darstellung klären könnte. Einerseits wird kritisch betont, »dass Europa in seiner Geschichte niemals eine Einheitskultur gewesen ist«.50 Dennoch reißen die Versuche nicht ab, nach der »gemeinsamen Identität […] einer gemeinsamen kulturellen Tradition« Europas im Mittelalter zu fragen.51 Zum Teil beruht diese Diskrepanz auf unterschiedlichen Forschungsparadigmen:
Die ältere, auf das christlich-lateinische Abendland beschränkte Sicht und die plurikulturale Perspektive auf Europas Mittelalter stehen weitgehend unverbunden nebeneinander, eine Debatte hat nicht stattgefunden und die Zukunft unseres Geschichtsbildes ist ungewiss.52
Doch beschränkt sich diese Diskrepanz nicht auf Forschungsperspektiven, sondern betrifft zugleich das Verhältnis zur Ebene ihrer Gegenstände. Zwischen den »gedachte[n] Einheiten«, die jede Forschung einführt, und der »Vielfalt europäischer Kulturen des Mittelalters«, die sich auf Objektebene finden, wachsen methodische Spannungen, die sich nicht restlos auflösen lassen.53
Einer solchen Diskussion kulturwissenschaftlicher Pluralisierungsannahmen haben sich die historisch orientierten Literaturwissenschaften bislang erst in Ansätzen gestellt.54 Wo etwa die höfische Literatur des Mittelalters als Praxis ›höfischer Kultur‹ an Einzeltexten untersucht wird, steht die Kulturalität mittelalterlicher Literatur selten zur Debatte.55 Darstellungen, die Bewusstsein »für die Pluralität historischer Lebenswelten« schärfen, lassen meist offen, was daraus für den Umgang mit Kulturen abzuleiten wäre, die ein diskrepantes, ambivalentes oder unbegriffliches Verhältnis zu Pluralität charakterisiert.56 Umso bemerkenswerter erscheint diese reflexive Lücke, wenn Forschungsdebatten durchaus das Problembewusstsein für zahlreiche Schieflagen und Inkongruenzen zwischen universalistischen und pluralistischen Diskursen geschärft haben – im Bereich der Altgermanistik betrifft das vor allem das schwierige Verhältnis von ›Geistlichem‹ und ›Weltlichem‹, von ›religiöser‹ und ›säkularer‹ Kommunikation im Mittelalter.57 Auch in dieser Debatte zeichnet sich ab, dass vormoderne Grenzverläufe des Religiösen nicht zuletzt auch die Pluralisierungsvorstellungen der Kulturwissenschaften selbst in diese Beobachtungsschwierigkeiten verwickeln. Immer drängender wird damit für die kulturwissenschaftliche Mediävistik das »Problem«, dass »trotz wachsender Einsicht in die Vielfältigkeit und Heterogenität mittelalterlicher Lebensverhältnisse, Wissensordnungen, Mentalitäten usw. […] deren gemeinsame Basis in der christlichen Religion nie bezweifelt [wurde]«.58
Die vorliegende Untersuchung möchte literaturwissenschaftliche Anregungen liefern, um eine solche Debatte offener als bisher zu führen. Ihre Fragestellung ist nicht nur mit Blick auf das europäische Mittelalter brisant: Wie gehen Gesellschaften, die sich nicht als Kulturen im modernen Sinne beschreiben, d.h. keine ›diversity‹-Konzepte generalisieren, in ihren Praktiken und Kommunikationsformen dennoch mit Vielfalt um? Wenn die folgenden Studien diese Frage exemplarisch an Erzähltexte des Mittelalters stellen, so schwingt darin also das grundlegende Problem der Beobachtbarkeit fremder Ordnung mit. Es mag sich im Falle historisch fremder Gesellschaften verschärfen, stellt jedoch auch eine prinzipielle Herausforderung gegenwärtiger Gesellschaftsbeschreibung dar. Erkenntnisgewinne wären dann weniger darin zu suchen, die historischen Einsatzstellen für Pluralisierungsprozesse einfach zurückzuverschieben (von der frühen Neuzeit ins Spätmittelalter, von der berüchtigten Hochphase höfischer Literatur um 1200 zurück zu frühen Texten?). Der springende Punkt scheint mir vielmehr bei den impliziten Erwartungen der Pluralisierungsdebatte selbst zu liegen. Warum ist es so schwierig, moderne Konzepte der Diversifizierung in die Vormoderne zurückzuverfolgen? Theorietraditionen der Anthropologie und Ethnologie haben dieses Reflexionsproblem mit Kulturbegriffen eher verdeckt als offengelegt.59 Für die nachfolgenden Studien folgt daraus methodische Vorsicht. Nichts zwingt zunächst einmal dazu, Einfachheit und Vielfalt als Alternativen oder gar als Dichotomie aufzubauen. Entsprechend wäre eher nach den Bedingungen zu fragen, unter denen Kulturwissenschaften alternative Ordnungen beschreiben. Will man den Wandel von Pluralitätsformen selbst beschreiben, verlangt dies, formale Beschreibungen zu entwickeln, die nicht schon den Prämissen einer spezifischen Pluralität unterstellt, nicht einem spezifischen Kulturbegriff verpflichtet sind. Wettkämpfe bieten ein besonderes Feld, auf dem sich dieser Wandel von Pluralitätsformen im vorbegrifflichen Feld studieren lässt. Und ein formales Interesse kann helfen, um deren Unterschiedlichkeit möglichst aufmerksam zu registrieren.
3 Aufgabenfeld (I): Produktiver Wettkampf, zerstörerischer Streit?
Wettkämpfe als kulturelle Formen zu begreifen, ist schon deshalb verführerisch, weil sie omnipräsent verbreitet sind. Und doch erschließt sich ihre kulturtheoretische Aussagekraft nicht ohne Weiteres. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass ihre basalen Differenzlogiken sich mit vielen Semantiken und Praktiken anreichern, die sie auf spezielle Kontexte abstimmen und dadurch binden. Für ihre Erforschung bedeutete dies nicht nur Differenzierungsgewinne. Denn oftmals prägen Wettkampfformen auch über solche Kontexte hinaus modellhafte Erwartungen; agonale Praktiken der griechischen Antike, des höfischen Mittelalters oder neuzeitlicher Märkte werden dann rasch zu kulturellen Leitmodellen schlechthin überhöht. Um den Blick nicht von vornherein zu verengen, sollen daher im Folgenden zunächst einige Aufgabenfelder genauer sondiert werden, auf die sich die Frage nach Wettkampfkulturen erstreckt. Auf diesem Weg sind drei Herausforderungen abzustecken, denen sich die Untersuchung stellen muss.
3.1Paradoxe Wettkämpfe: Perspektiven mediävistischer Literaturwissenschaft
Eine erste Herausforderung stellt sich unmittelbar mit den paradoxen Figurationen von Kooperation und Aggression, zu denen höfische Romane zentrale Zweikämpfe verdichten. Ihre Spannung bildet an sich kein Spezifikum der europäischen Adelsliteratur: »gesellig[e]« und »antagonistisch[e]« Dimensionen prägen Wettkampfmuster in verschiedensten Zeiten und Gesellschaften.1 Die mediävistische Forschung hat derartige Paradoxien jedoch bislang eher entschärft, indem sie die Irritationen von Wettkämpfen vorrangig auf Konzepte von Einheit bezog, als Dynamik von Anerkennungsbeziehungen verstand oder gezielt nach ihrer Auflösung suchte. Dies verschärfte nicht nur die Frage, welche Relevanz man paradoxen Formen des Widerstreits zubilligt, sondern auch, wie man diese methodisch erfasst, ohne ihre Irritationspotentiale vorschnell zu harmonisieren.2 Drei Positionen der germanistischen Mediävistik geben dazu wichtige Anhaltspunkte.
Hatten ältere Motivgeschichten die Kämpfe höfischer Epik vor allem als Erkenntnisaufgaben für Figuren und Rezipienten verstanden,3 so lesen sie jüngere sozialgeschichtlich inspirierte Studien als Symbolisierungen adliger Distinktionspraxis nach höfischen Regeln. Für die stratifikatorische Adelsgesellschaft ist die Darstellung von Rang zentral, was im Mittelalter performative Beweise und wechselseitige Bestätigungen von Ehre einschließt, in denen gleichsam symbolisches Kapital angehäuft wird.4 In einem einflussreichen Ansatz hat Harald Haferland für dieses Interaktionsmodell den Begriff des Agon herangezogen.5 Die höfische Literatur spiele in ihren Wettkämpfen ein ›psychosoziales Schema‹6 durch, das die reale »Gewaltfähigkeit des Adels« zugleich auf wechselseitige Kooperation verpflichte:7
Der Wettkampf wird, was die gemeinsame Einhaltung von Regeln betrifft, ein Stück weit als gemeinsame kooperative Praxis behandelt. Dies tilgt etwas von jener Feindseligkeit, die zu jedem Kampf gehört. Sie wird umgefärbt, moduliert. […] Soweit erscheint der Wettkampf als kooperative Praxis.8
Im Interaktionssystem der Ehre stehe somit die »gemeinsame Einhaltung von Regeln« im Vordergrund, die besonders in Zweikämpfen zum Tragen komme und einseitige Gewaltakte zugunsten von Anerkennung zurückdränge.9 Doch bleiben paradoxe Spannungen auch in Haferlands Beschreibung präsent: »Feindseligkeit« gehöre »zu jedem Kampf«, Zweikämpfe folgen schließlich nur »ein Stück weit« der Kooperation. Paradox erscheinen auch die sozialen Strukturierungsgewinne, denen Haferlands systematisches Interesse gilt. So setzen Zweikämpfe als adlige Selbstdarstellungsformen einerseits horizontale Ebenbürtigkeit voraus, wie sie etwa in symmetrischen Wechselreden und ritualisierten Kampfabläufen zum Ausdruck kommt.10 Andererseits zielen sie aber auf vertikale Unterschiede, denn zu kämpfen heißt, den anderen überbieten zu wollen.11 Als Kreis von ununterschieden Gleichrangigen, die sich zu unterscheiden suchen, erweist sich die Wettkampfgesellschaft des Artusromans als zutiefst ambivalent.12 Besonders in höfischen Festszenen
erscheint die Festfreude bereits durch kleinere Störungen von innen her gefährdet: indem Schwierigkeiten dabei auftreten, die sozialen Imperative der Reziprozität und des Agons zugleich zu erfüllen. Das Verhältnis zwischen der virtuellen Gleichheit aller (Tafelrunde) und dem Gebot, dennoch festliche Ordnung auch agonal durch Hierarchisierung herzustellen, ist per se prekär, wenn nicht paradox.13
So allgemein dieser Forschungskonsens zur höfischen Epik geteilt wird, so häufig wird jedoch diese Spannung von Wettkämpfen in Analyse und Theoriebildung aufgelöst. Betonte Haferland vor allem die fairen Regeln, die »Störungen« und Gefährdungen zu zähmen vermögen, so rückt nur eine Seite dieses Verhältnisses in den Blick. Unterscheidet man außerdem den gewaltsamen »Ernstkampf« vom kooperativen »Wettkampf«,14 so bricht jenes Kontinuum in kategorische Teile auseinander, das viele Wettkämpfe der höfischen Epik spannungsvoll zusammenhalten und verdichten.15
Solche Verlagerungen und Unterscheidungen prägen nicht erst die kulturwissenschaftliche Wettkampfforschung, sondern sind, wie noch näher zu beleuchten ist, tief in der Streitsoziologie verwurzelt. Noch auf der Ebene theoretischer Reflexion kann man darin Reaktionen auf Paradoxien sehen, die verschoben, verdeckt oder unterscheidungstechnisch auseinandergelegt werden. Sie zielen darauf, die schwierigen Formen von Wettkämpfen in schlechte Konflikte (»Feindseligkeit«) und gute Wettstreite (»kooperative Praxis«) zu schlichten. Gawein und Gasozein, Iwein und Gawein und viele andere seltsame Wettkämpfer höfischer Romane verstricken sich jedoch in Zuneigung und Aggression zugleich, die oft in keinerlei Auflösungs- oder Erkennensszene harmonisiert werden.
Das hat auch seinen theoretischen Preis. Denn obwohl im agonalen Schema weitreichende Möglichkeiten zu kultureller Reflexion angelegt sind,16 wird fraglich, wem oder was solche Spannungen in höfischen Texten zugerechnet werden. Haferland schlägt dazu vier Bezugsmöglichkeiten vor, die stets Probleme von agonalen Formen offenlegen. So ließen sich ritterliche Zweikämpfe erstens als Praktiken psychosozialer »Involution« lesen, die Manifestationen von sozialer Konkurrenz »in das Verhalten und Handeln einer Person hinein[nehmen]«.17 Erhellend weist Haferland damit auf, dass das alternierende Schema des Wettkampfs nicht bloß als Abfolge sondern genauer als Einlagerungsstruktur zu analysieren ist, das Bezugnahme, Reaktion und Vertiefung miteinander verkettet. Aber binden Wettkämpfe diese Form stets an psychische Strukturen oder an personalen Habitus? Dies mag für Fälle gelten, die etwa agonale Selbstreflexion als Seelenkämpfe gestalten.18 In andere Richtung führen hingegen Zweikämpfe wie das Einleitungsbeispiel der Krone, die ihre komplexen Strukturen ganz an der Oberfläche der erzählten Handlung halten oder als Erzählschleifen gestalten, statt diese in Psychen einzulagern. Mit anderen Worten: Selbstbewusstsein und Selbstreflexion von Figuren bilden oft nicht die entscheidenden Größen, an denen sich Einfachheit oder Komplexität des Erzählens ab- und einzeichnen.19 Mit Haferland selbst wäre daher einzuwenden: Wenn das agonale Schema einer grammatischen »Tiefenstruktur« folgt,20 dann stellen psychosoziale Verdichtungen zwar eine mögliche Konkretisierung dar, doch gibt es andere (und womöglich häufigere) Formen, auf die mittelalterliche Literatur ihre Wettkämpfe bringt, ohne dazu auf die Psyche oder den Habitus von Figuren zuzugreifen.21
Zweitens rechnet Haferland die Komplexitätseffekte von Wettkämpfen tendenziell auf Einzelpositionen zurück. Ihre Spannungsmuster wandern so von der Ebene der Kultur zur Person, wenn der Agon zunächst »als Schema kultureller Identitätsbildung«, dann aber als Frage der Ehre fokussiert wird, die »Grenzen einer Person« markiere und »zur Bestätigung einer persönlichen Identität genutzt wird«.22 In Gestalt von Aventiuren stelle der Roman dieses Prinzip erzählstrukturell auf Dauer: »Personen erfahren sich selbst.«23 Spannungsvoll wächst dadurch die Differenz von Kultur und Einzelperson, wie Haferland einräumt: »Die höfische Öffentlichkeit läßt Ich-Ideale aufleben in einer Repräsentation, die nur schwer vom Ich, von der Person selbst eingeholt wird.«24 Scheinen höfische Wettkämpfe als personale Formung also zunächst griffig beschrieben, so werden damit Spannungen theorietechnisch nur verschoben. Denn im gespaltenen Begriff der Repräsentation kehrt Selbstdifferenz wieder (Ich-Ideale vs. Person selbst), die Identität entgegenläuft. Haferland zufolge beginnt das ›agonale Schema‹ somit zwischen »soziale[n] Situationen« und gesteigerter ›Selbsterfahrung‹ zu oszillieren, ohne dass der Beschreibungsrahmen höfischer Interaktion dafür besondere Erklärungsmöglichkeiten anböte.25
Damit ist drittens die Frage verbunden, ob Wettkampf angemessener als dezentrierende oder als zentralisierende Form erfasst ist.26 Als kooperative Interaktion scheint das agonale Schema zunächst ein dezentrales Zusammenspiel, das auf keine Einzelposition zu reduzieren ist. Mit Blick auf seine soziale Funktion adliger Rangdarstellung betont Haferland jedoch vor allem Bündelungseffekte: »Durch Zentrierung von Aufmerksamkeit strukturiert das agonale Schema Raum und Zeit«, was in der exklusiven Arena des Zweikampferzählens wie in der Inszenierung von Triumph gleichermaßen zum Tragen komme.27 An anderer Stelle hält Haferland hingegen fest: »Agonale Lenkung der Blicke und Zentrierung der Aufmerksamkeit hat es auch mit Koordinationsproblemen zu tun. Nicht jeder kann im selben Augenblick den Mittelpunkt abgeben.«28 Dies gilt genau genommen für jeden Wettkampf, der mindestens zwei Aktanten alternierend beobachtet, dabei aber sein Aufmerksamkeitszentrum fortwährend verschiebt. Regelmäßig führen Zweikämpfe die »Koordinationsprobleme« vor Augen, die sich daraus ergeben: Wettkämpfe oszillieren und bilden seltsame Schleifen, weil ihre Formen sich gerade nicht zentrieren, Akteure in der Beobachtung nicht nebeneinander fixieren lassen, sondern fortgesetzt alternieren. Auch das hat einen paradoxen Kern: Wettkämpfe scheinen ihre Helden besonders dann hervorheben zu können, wenn zugleich auch der andere in gesteigerter Intensität spürbar wird. Agonales Selbstgefühl ist so gesehen nie bei sich.29
Dies macht es jedoch schwierig, Wettkampf als »Nullsummenspiel« zu betrachten, das auf klarer Verteilung von Gewinnen und Verlusten beruht.30 Richtig ist, dass noch die verwickeltsten Wettkämpfe über die zweiwertige Codierung von Sieg und Niederlage anlaufen. Und ebenso ist zu beobachten, dass speziell Wettkämpfe mittelalterlicher Literatur ihre Gewinne und Verluste oft ausdrücklich berechnen und beziffern – mittels ökonomischer Metaphern31oder symbolischer Zahlenspiele.32 Problematisch wäre es allerdings, daraus auf geschlossene Buchhaltung zu schließen: Wiederholungen, Ausdehnungen und Steigerungen unterstreichen vielmehr die Neigung vieler Wettkämpfe zu offenen Rechnungen. Sie ziehen andere Räume, andere Zeiten und andere Akteure hinein und vergrößern soziale Summen. Ihr exzessiver Charakter verweist auf offene Aggregation.33
Sollen Wettkämpfe zu dauerhaften Strukturen stabilisiert werden, ruft dies institutionelle Grenzziehungen und regulierende Richter auf den Plan. Gerade die Entscheidungscodierung von Sieg und Niederlage aber scheint neuerliche Öffnung, Erweiterung und Fortsetzung von Wettkämpfen oft anzutreiben. Auch diese Spannungen paradoxen Wachstums treten zurück, wenn man Wettkämpfe allein auf ihre Entscheidungen hin betrachtet. Die Annahme eines höfisch regulierten Kooperationsmodells übergeht somit eine Reihe von Aspekten, die für eine textnahe Kulturtheorie vormoderner Wettkämpfe fruchtbar sein könnten.
Wichtige Anregungen liefert auch Udo Friedrichs Studie zur »›symbolischen Ordnung‹ des Zweikampfs im Mittelalter«. Im Anschluss an Georg Simmel fragt Friedrich nach dem allgemeinen Vergesellschaftungsprinzip, das so unterschiedliche Konfliktformen wie Duelle und Zweikämpfe, Rivalität und Konkurrenz, Wettbewerb und Wettstreit verbindet. In textnahen Analysen verfolgt Friedrich dabei die »Spannung zwischen Disziplinierung und Entfesselung«, die auch in höfischen Zweikämpfen »auf komplexe Art durchgespielt« werde.34 Gerade in weitgefasster, vergleichender Perspektive zeigt sich somit die Spannung »eines allgemeinen Prinzips«, das in Kämpfen »Vergesellschaftung herstellt und zugleich bedroht«, indem es »den Gewaltcharakter von Vergesellschaftungsprozessen offen [legt]«.35
Dies macht Zweikämpfe tendenziell zu einem Modus von Reflexion: »Im Zweikampf führt der Adel sich seine kulturellen Leistungen vor Augen, diskutiert aber immer wieder auch deren Grenzen.«36 Von Gewalt als paradoxem Motor von Vergesellschaftungsprozessen verschiebt sich der Fokus damit auf Ordnungsleistungen und Grenzziehungen. Als Teil eines »Konfliktlösungsmodells« gelesen, verpflichtet dies Zweikämpfe auf »Bewältigung von Kontingenz« und »Aufrechterhaltung der Ordnung«.37 Reflexion wird damit gleichsam eine Ventilfunktion zugeschrieben: »In der höfischen Literatur wird der Zweikampf zum Medium der Reflexion komplexer sozialer und kultureller Probleme.«38
Auch in dieser Argumentation tritt das schillernde Phänomen des Kampfes damit auseinander in Probleme, die der Lösung bedürfen, und Zweikämpfe, die solche Lösungen bereitstellen oder zumindest reflektieren. Dann jedoch steht zu fragen: Falls Zweikämpfe tatsächlich ein ›Konfliktlösungsmodell‹ darstellen, weshalb leistet sich die höfische Literatur in großer Zahl Wettkämpfe mit aufwändig verschobenen oder verhinderten Lösungen (wie z.B. die Begegnung von Gawein und Gasozein in der Krone oder den Gerichtskampf von Gawan und Gramoflanz im Parzival), Wettkämpfe mit Schein-Lösungen (wie z.B. Artus’ Schlichtungsversuch zum Kampf von Iwein und Gawein oder ambivalente Gottesurteile wie in Gottfrieds Tristan) oder Wettkämpfe mit katastrophalen Auflösungen (wie z.B. im Nibelungenlied)? Zumindest aus Sicht einer Sozialgeschichte, die Gewalt tendenziell als Problemgeschichte thematisierte, geraten solche Kampferzählungen in die Schieflage, Grenzen zu verletzen und Lösungen geradezu zu verwehren.39
Doch formuliert Friedrich zugleich eine Reihe von Anregungen, mit denen sich die experimentellen Züge solcher Kampfmuster genauer erschließen lassen. (1.) Zweikämpfe experimentieren mit Offenheit, indem sie aus relativ einfachen Strukturvorgaben von Sieg und Niederlage zugleich »Spielräume« eröffnen, die in vielfältiger Weise zur »Projektionsfläche sozialen Sinns« dienen. Positionen werden im Zweikampf nicht zentralisiert und durchgesetzt, sondern in solchen Spielräumen ausgehandelt.40 (2.) Zweikämpfe zielen darüber hinaus auf Beobachtungsmöglichkeiten von Ordnung überhaupt.41 Denn sie liefern nicht nur ein »Medium kultureller Selbstdarstellung des Adels«, sondern »Versuchsanordnungen […], die kulturelle Muster reflektieren«.42 Was auf den ersten Blick als ein Interaktionsmuster der Durchsetzung erscheint, enthüllt sich so auf den zweiten Blick als eine operative Form von Kultur als Beobachtung von Beobachtungsbedingungen.43 (3.) Wenn Zweikämpfe Ordnung beobachten, erproben sie zugleich alternative Möglichkeiten: »Verschiedene Besetzungsoptionen können also in Spannung geraten und sich auf komplexe Art überlagern.«44 Wettkämpfe wären dann nicht bloß als Interaktionsmodell von Siegen und Verlieren zu begreifen, sondern als Frage von Formen,45 die durchgespielt, variiert und vervielfältigt werden können. Dementsprechend wären die unabschließbaren Fortsetzungspotentiale von Wettkämpfen als Hinweis zu lesen, dass auch höfische Romane mit offenen Möglichkeiten ihrer Ordnung rechnen.
Die nachfolgenden Studien schließen an diese Anregungen an. Mit Blick auf die mediävistische Forschung fällt jedoch ebenso auf, dass die zivilisierungstheoretische Vorstellung vom ›Konfliktlösungsmodell‹ des Zweikampfs selbst dann noch eine prominente Leitvorstellung darstellt, wenn sie als Negativfolie herangezogen wird. Für Viola Wittmann etwa treibe Wolframs Parzival das »Konfliktlösungsmodell […] an seine Grenzen«, indem die Kampfszenen des Romans dessen »Untauglichkeit in komplexen Situationen« wie dem Bruderkampf von Parzival und Feirefiz vor Augen führten, der konsequenterweise in Gewaltverzicht gipfele.46 Grundlegend bezweifelt Wittmann selbst, dass der Sinn solcher Zweikämpfe in »Ergebnisorientierung« nach Sieger und Besiegtem zu suchen sei.47 Alternativen sucht man dennoch vergebens: Statt bei der paradoxen Spannung anzusetzen, dass viele Kämpfe in Wolframs Parzival sowohl entscheidungsorientiert erzählt werden, als auch Entscheidungen verweigern, werden sie als problematische Reflexionen adliger Identität gelesen.
In anderen Gattungszusammenhängen haben Beate Kellner und Peter Strohschneider umrissen, wie eine solche Theorie ansetzen könnte.48 Ihr Vorschlag setzt bei der agonalen Kommunikation der Sangspruchdichtung an:49 So profiliere sich der Anspruch auf Meisterschaft in der paradoxen Spannung, dass Konkurrenten durch poetisch exponiertes Wissen einerseits zum Verstummen gebracht werden sollen, andererseits aber immer wieder zu Wort kommen müssen, um Bestätigung, Anerkennung und Fortsetzbarkeit von Kommunikation zu garantieren. Diese Wettkampfspannung reflektiert nicht nur die Poetologie des spätmittelalterlichen Meistersangs, der seine komplexer werdenden Liedformen mit agonaler Terminologie belegt.50 Von diesem Kommunikationsparadox her erschließen sich darüber hinaus auch komplexe Redestrategien, die Wissen und Poetik, Reden und Schweigen fortgesetzt potenzieren. Wie diese Spannung von ›Proliferation‹ und ›Destruktion‹ unmittelbar textgenerierend wirkt, belegen die umfang- und variantenreichen Arrangements des Wartburgkriegs. Nicht nur für den Bereich der Spruchdichtung ist dies einschlägig: Viele Wettkampfmuster basieren auf einfachen Formen, die Entfaltungs- und Verwicklungsmöglichkeiten sowohl anstoßen als auch begrenzen. Für eine Theorie von Wettkampfformen, die auch für Erzähltexte fruchtbar zu machen ist, liefert dieses Spannungsverhältnis einen wichtigen Fingerzeig.
Wie weit eine solche Theorie in kulturgeschichtlicher Hinsicht ausholen müsste und auf welche Gegenstandsfelder sie sich erstrecken könnte, ist hingegen eine offenere Frage. Die bisherigen Antworten der Mediävistik weisen in unterschiedlichste Richtungen, von Analysen spezifischer Felder bis zu Agonalitätskonzepten mit globalen Erklärungsansprüchen. Verdanken sich Wettkampfformen in erster Linie innerliterarischer Motivbildung,51 ästhetischer Muster52 oder speziellen Gattungskonventionen? Verweisen dialektische Zuspitzungen und Oppositionsstrukturen53 in literarischen Texte des hohen Mittelalters auf spezifische Erfahrungs- und Repräsentationsmuster besonderer Milieus wie etwa der ›höfischen Kultur‹ des Adels?54 Oder sollten wir Wettkampftexte eher als Produkte eines übergreifenden »mental habit of the Middle Ages« betrachten,55 einer allgemeinen »Neigung des Mittelalters« zu Kontrast, Konflikt und Streit?56 Kommt in ihnen gar eine »fundamentale Agonalität« zum Ausdruck, die für orale Gesellschaften überhaupt – und damit weit über das Mittelalter hinaus – charakteristisch ist?57 Zwischen solchen enger bzw. weiter gesteckten Prämissen äußern sich Stimmen, die literarische Wettkämpfe als historische ›Geschmacksvorlieben‹58 oder ›Moden‹59 bezeichnen. Will man sich nicht mit vagen Einschätzungen begnügen, so birgt die literaturwissenschaftliche Forschung also eine doppelte Gefahr: Wettkämpfe entweder zu eng zu fassen (z.B. als höfisches Interaktionsmuster) oder aber zu entgrenzen (z.B. in Richtung epochaler Muster).
3.2Grundlagen der Konfliktsoziologie
Entkommt man dieser Schwierigkeit, wenn man sich einfach an Grundlagentheorien der Streit- und Konfliktsoziologie hält? Einige der angesprochenen Theorieprobleme – besonders im Blick auf die paradoxe Dynamik von Wettkämpfen – finden sich bereits in klassischen Positionen angelegt. So registriert etwa Georg Simmel1 äußerst feinfühlig, welche Spannungen Vergesellschaftungsprozesse des Streits begleiten. Doch ebenso deutlich zeigen sich die Schwierigkeiten, wie konvergierende und divergierende Bewegungen als Einheit zu fassen seien. Simmel sichtet dieses Problem an einem schillernden Spektrum von Kampfformen der unterschiedlichsten ›sozialen Kreise‹: von Rechtsstreitigkeiten und alltäglichen Aggressionen im Stadtleben bis zur Eifersucht von Ehepartnern, vom Kriegsverhalten der Indianer bis zu Disputen der Wissenschaft, von Rivalitäten unter mittelalterlichen Adelshöfen, Katholiken und Protestanten oder unter Künstlern bis zum biologischen Daseinskampf. Alle diese Fälle verbinde Nähe und Widerstreben, wie Simmel am Beispiel von Konkurrenten erläutert:
Man pflegt von der Konkurrenz ihre vergiftenden, zersprengenden, zerstörenden Wirkungen hervorzuheben und im übrigen nur jene inhaltlichen Werte als ihre Produkte anzugeben. Daneben aber steht doch diese ungeheure vergesellschaftende Wirkung: sie zwingt den Bewerber, der einen Mitbewerber neben sich hat und häufig erst hierdurch eigentlicher Bewerber wird, dem Umworbenen entgegen- und nahezukommen, sich ihm zu verbinden, seine Schwächen und Stärken zu erkunden und sich ihnen anzupassen […]. (S. 327)
Nicht nur triadische Relationen der Konkurrenz setzten solche Nähe voraus, im »Verweben von tausend soziologischen Fäden durch die Konzentrierung des Bewußtseins auf das Wollen und Fühlen und Denken der Mitmenschen« (S. 328). Ganz allgemein müssten jegliche »Gegner ein Gemeinsames haben, über dem sich erst ihr Kampf erhebt« (S. 310): »beiderseitige Anerkennung« der Akteure über gemeinsame Objekte des Begehrens (S. 306), institutionalisierte Streitordnungen und der »Zusammenschluß« (S. 360; 354–368) von disparaten Elementen zu Interessenseiten, Gruppen oder Parteien kennzeichneten jegliche Formen und Sphären des Streits. In strukturellem Sinne sieht Simmel darin »ein Gegeneinander, das mit dem Füreinander unter einen höheren Begriff gehört« (S. 284). Kampf tritt damit als paradoxe Beziehung hervor, die sich unter verschiedenen Aspekten näher bestimmen lässt, u.a.
als zirkulär gebaute, exzessive Dynamik;2
als »Verweben«, das innerhalb wie auch zwischen Streitenden Komplexität aufbaut (S. 328);
als Möglichkeit, Differenz zusammenzuführen und Intensitäten zu verstärken (S. 327, 329);
als Risiko, Relationen und Positionen sowohl zu fördern (S. 325) als auch zu zerstören (S. 289).
Für eine formale Beschreibung von Wettkämpfen liefert Simmel damit wichtige Gesichtspunkte. Ebenso grundlegend ist der Hinweis, dass Streit nicht bloß durch Außenabgrenzung die sozialen Relationen einer Gruppe verstärkt, sondern auch deren Binnenkohärenz durch interne Differenzen erhöht. Für den Zusammenhang von Wettkampf- und Kulturformen ist dies von systematischer Bedeutung, insofern Streit damit als paradoxes Muster der Komplexitätsbildung lesbar wird.3
Trotz ausdrücklicher Neigungen zum Paradoxen,4 trotz deskriptiver Sensibilität: Ebenso deutlich zeichnen sich aber Simmels Schwierigkeiten ab, die paradoxe Form des Streits »unter einen höheren Begriff« zu bringen. Mal bleiben seine suchenden Formulierungen vage (z.B. S. 284: »um zu irgend einer Art von Einheit […] zu gelangen«), dann greifen sie umso entschiedener zu metaphysischen Einheitskonzepten: »streitmäßig[e] Beziehungen« sieht Simmel demgemäß auf das Gesamt einer »Lebenseinheit« rückbezogen, deren »Verbindungen« – »unserem Verstande ungreifbar« – eine »mystische Einheit« bildeten (S. 291). Am häufigsten greift Simmel jedoch zum psychologischen Vokabular der Empfindungen, um paradoxe Zumutungen annehmbar zu formulieren: Verbindende und zerstörende Wirkungen des Kampfes mündeten in ein »Mischgefühl« (S. 293), das »Feinfühligkeit« erhöht (S. 328); auf Basis solcher Gefühle kämen Gruppen im Streit überein, ohne ihre Verbindung explizieren zu müssen (S. 310: »geheimes Sich-Verstehen der Parteien« im »stillschweigenden Pakt«). Umgekehrt zeigt Simmels Exkurs über die Regulierung von ökonomischer Konkurrenz, wie paradoxe Aspekte kategorisch unterbunden werden: Wie es das Leitbild des »›ehrlichen‹ Wettbewerb[s]« vorgebe, sei nur »lautere«, »rein[e]« Konkurrenz in vollem Sinne nützlich, die auf alle »irreleitenden« oder bloß schädigende Handlungen verzichte (S. 346f.). Destruktive Tendenzen, die sich aus der Nähe von Konkurrenzbeziehungen entspinnen können, grenzt Simmel somit aus. Aus paradoxen Dynamiken werden idealisierte Dichotomien von reiner und unlauterer Konkurrenz, von direktem und indirektem Streit.
Gerade diese kategorischen Abgrenzungen haben die Tradition der Konfliktsoziologie nachhaltig geprägt. Einflussreich knüpfte etwa Lewis Coser daran an, der Simmels Analysen kommentierte und in Richtung einer allgemeinen Konfliktsoziologie umarbeitete.5 Im Anschluss daran betrachtet auch Coser den Streit als konstruktiven Faktor sozialer Organisation (S. 19f., 35), da er Konfliktpartner füreinander sensibilisiere, Energien freisetze, Gruppen und Individuen in ihrer Identität bestätige. Und wie Simmel vermerkt auch Coser, dass dabei ambivalente Gefühlslagen von Hass und Begehren wachsen, die sich an gemeinsame Objekte und Regeln heften (S. 75–79). Noch entschiedener als Simmel jedoch weicht Coser destruktiven Tendenzen aus: Konflikte, die von Frustrationen angetrieben werden, Spannungen ableiten, Rache üben oder dritte Ersatzobjekte und Sündenböcke hineinziehen, gelten ihm als ›unecht‹, als ›echt‹ hingegen nur solche Konflikte, die offen zielorientiert verfolgt werden.6 Simmels Nebenbemerkung zum positiven Zielbezug des Streits rückt damit ins Zentrum der Konflikttheorie.
Exzessive Eigendynamiken und potenzierende Übergriffe werden damit weniger als konstitutive Momente von Kampfparadoxien beleuchtet, sondern als parasitäre Auswüchse von geringer Stabilität disqualifiziert, die es zu überwinden gilt. Sie kehren auf forschungsgeschichtlicher Ebene indes wieder: Während Coser etwa der frühen amerikanischen Soziologie ankreidet, Konflikt als strukturgefährdende Krankheit des Sozialen abzuwerten (so die Kritik gegenüber Talcott Parsons: S. 23–25, 29–31), grenzt Coser seinerseits Spuren der Destruktion aus. Statt auf eine paradoxiesensible Konflikttheorie zielt Coser somit darauf, paradoxe Spannungen zugunsten polarer Kontraste aufzulösen.
Dies stellte die Weichen für eine Soziologie, die Konflikte als Motoren der Stabilisierung betrachtet. »Der Konflikt dient dazu, die Identität und die Grenzen von Gesellschaften und Gruppen zu schaffen und zu erhalten«, fasst Coser bündig zusammen (S. 43; so auch S. 184), und »zum Anreiz bei der Einsetzung von Normen und Regeln und Institutionen« (S. 154). Wo gestritten wird, steht somit die Sicherung von Grenzen und Regeln auf dem Spiel. Aus dieser paradoxiefeindlichen Sicht leitet Coser eine folgenreiche Unterscheidung von Streit und Wettstreit ab: »In einem Wettstreit kann der Sieger bestimmt werden nach vorher festgelegten Kriterien, an denen die Kämpfenden gemessen werden. […] Im Streit dagegen stehen den Gegnern nicht von Anfang an solche Kriterien zur Verfügung« (S. 161). Im Rekurs auf Simmel und dennoch Simmels Interesse an paradoxen Einheiten zutiefst entgegengesetzt, begründete dies eine Forschungstradition, die schlechte Konflikte (grenzverletzend oder regellos) und gute Wettkämpfe (in Grenzen reguliert) gegenüberstellte. Weit über die Soziologie hinaus war diese Polarisierung attraktiv für zivilisationstheoretische Argumentationen, die Wettkämpfe bis heute vor allem als Kulturformen der Begrenzung und Pazifizierung werten: als »Transformation eines wilden, unkontrollierten Zustands der Gewalt in einen anderen Zustand […], in dem diese kanalisiert und produktiv nutzbar gemacht wird.«7 Unter regulierten Bedingungen gilt Streit daher als »Motor« fortschrittlicher Konfliktkultur.8
Die heuristische Leistung des Wettkampfkonzepts beschneidet dies erheblich. Auf mittelalterliche Wettkampferzählungen übertragen, verzerrt dies die Verhältnisse: obsessive Gegner wie Gawein und Gasozein in der Krone Heinrichs von dem Türlin wären in grandioser Weise als ›unecht‹ aufeinander fixiert zu betrachten; erzählerische Ambivalenz, wie sie Hartmanns Iwein in der Begegnung der Freund-Feinde Gawein und Iwein auskostet, wäre in höchstem Maße als ›uneigentlich‹ zu betrachten. Kategorische Unterscheidungen von Streit und Konflikt, Wettbewerb und Kampf etc. führen so gesehen in theoretische Sackgassen – oder aber in Paradoxien, die Gegner als verbunden zeigen, theoretische Abgrenzungen als durchlässig erweisen.9 Nur zögerlich lassen sich aktuelle Beiträge der Konfliktsoziologie auf diese Schwierigkeiten ein.10 Und auch mediävistische Studien vertiefen ihre Aporien eher, wenn man nach den Grenzen zwischen fairen Spielen und Ernstkämpfen,11 zwischen Gewaltvermeidung und deren Verstärkung sucht.12
Für eine historische Kulturtheorie des Wettkampfs sind dies gute Gründe, nicht schon vorab Wettbewerb, Wettstreit, Kampf, Konflikt oder Streit gegeneinander auszudifferenzieren, sofern dies Einsichten in die paradoxen Grundlagen agonaler Formen verstellt. Für ein solches formales Verständnis von Streit wirbt hingegen Dirk Baecker, demzufolge gerade das paradoxe Widerspiel von Anziehung und Distanz kulturelle Spielräume eröffnet:
Die Symbole der Tausch- und Kommunikationsmedien, so unsere These, stellen sicher, dass es ebenso attraktiv ist, sich auf eine entsprechend ausgezeichnete Handlung und Kommunikaton einzulassen, wie von ihr abzulassen. Das ist ihr Widerstreit.13
Ganz gleich, in welchen symbolischen Medien sie sich verdichtet: »Kultur als Widerstreit«14 motiviert auf paradoxe Weise dazu, sich einzulassen, aber jederzeit auch ablassen zu können. Gilt dies für alle agonalen Formen? Wettkämpfe, so wäre zu überlegen, könnten dafür nicht bloß verdichtete Einzelepisoden bereitstellen, die punktuell zur Debatte stehen. Sie könnten vielmehr die Anreize steigern, Widerstreit fortgesetzt auszubauen – auf sichtbaren Bühnen und zu umfangreichen Handlungsprogrammen.
3.3Alternative Theorieangebote
Bekanntlich gibt es andere Theorietraditionen, die Streitparadoxien noch eingehender pflegen als mediävistische Literaturwissenschaft und Soziologie. Dazu gehören zum einen philosophische Stimmen von den Vorsokratikern bis zu Nietzsche, von Hegel bis zu Heidegger, die sowohl destruktive als auch produktive Aspekte des Streits beleuchten. Ebenso ließen sich poststrukturalistische Positionen ausführlicher bedenken, die auf die Dynamik unauflösbarer Konflikte als Quelle diskursiver Vielfalt verweisen.1 Mit Blick auf solche Ansätze wäre jedoch kritisch zu fragen, inwiefern sich philosophische Streitkonzepte der Antike oder Neuzeit in textanalytische Methoden übersetzen ließen, die mittelalterliche Streitformen angemessen erschließen und mit kulturtheoretischen Fragen vermitteln. Dass Widerstreit etwa Differenz wiederholt und variiert, ist grundsätzlich ernst zu nehmen, liefert jedoch kaum nähere Aspekte für die Analyse.2