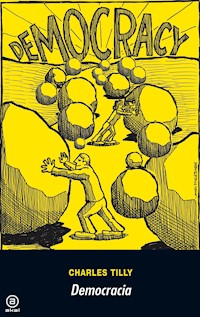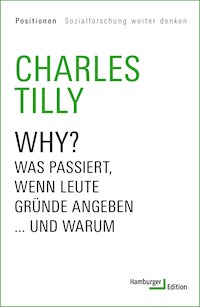
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hamburger Edition HIS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit einer Einführung von Thomas Hoebel und Stefan Malthaner Menschen geben von klein auf Begründungen an oder fordern von anderen Gründe ein, und dies tun sie ein Leben lang. Der namhafte Soziologe, Historiker und Politikwissenschaftler Charles Tilly untersucht die Art und Weise, wie Menschen Beziehungen zu anderen Menschen aus den von ihnen angegebenen Gründen aufbauen, verhandeln oder beenden. Unabhängig von dem, was sie sonst noch tun, wenn sie Gründe angeben, gestalten Menschen durch Begründungen ihr soziales Leben. Das Buch handelt nicht davon, ob angegebene Begründungen richtig oder falsch, gut oder schlecht, plausibel oder unglaubwürdig sind. Vielmehr konzentriert es sich auf den sozialen Prozess des Begründens. Jede Art von Begründung hat bestimmte Eigenschaften und variiert im Inhalt – je nachdem, welche sozialen Beziehungen die Gebenden und die Nehmenden von Gründen miteinander verbinden. Insofern hat jede neben anderen Konsequenzen auch Auswirkungen auf ihr soziales Miteinander: Begründungen bestätigen eine bestehende Beziehung, sie bringen sie wieder in Ordnung, erheben Anspruch auf eine neue Beziehung oder bestreiten einen solchen Anspruch. Ebenso handeln Menschen, die Gründe geben oder nehmen, damit ihren Status zueinander aus, ob sie gleichrangig oder ungleich sind. In allen Fällen hängt jedoch die Akzeptanz von angegebenen Begründungen davon ab, ob sie zu den sozialen Beziehungen passen, die zwischen den Beteiligten vorherrschen. Tilly beschreibt forschend, gleichsam einfühlend, was geschieht, wenn Menschen in ihrem Umfeld Gründe angeben, Gründe präsentiert bekommen oder solche miteinander aushandeln. Angereichert mit Anekdoten über alltägliche soziale Erfahrungen bietet Tilly den Leserinnen und Lesern eine faszinierende Geschichte über die Bedeutung von Begründungen in ihrem Leben. In der Reihe Positionen erscheinen klassische und neue Texte, die sich damit auseinandersetzen, was wegweisende Sozialforschung methodisch und theoretisch ausmacht, und die aufzeigen, was sie leisten kann. Sozialforschung weiterdenken heißt, mit Positionen zu experimentieren, die inspirieren und irritieren, weil sie die theoretischen und methodischen Konventionen sozialwissenschaftlichen Forschens hinterfragen, überwinden oder neu arrangieren. Die ausgewählten Werke fordern allesamt heraus; sie geben Orientierung und enthalten überraschende Einsichten; sie machen Deutungsangebote und ermuntern zu Kritik. Ziel der Reihe des Hamburger Instituts für Sozialforschung ist es, methodisch und theoretisch kreativen Impulsen mehr Gewicht in wissenschaftlichen und öffentlichen Diskursen zu verleihen. Dazu versammelt Positionen sowohl Originaltexte als auch Übersetzungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
PositionenSozialforschung weiter denken
In der Reihe Positionen erscheinen klassische und neue Texte, die sich damit auseinandersetzen, was wegweisende Sozialforschung methodisch und theoretisch ausmacht, und die aufzeigen, was sie leisten kann.
Sozialforschung weiter denken heißt, mit Positionen zu experimentieren, die inspirieren und irritieren, weil sie die theoretischen und methodischen Konventionen sozialwissenschaftlichen Forschens hinterfragen, überwinden oder neu arrangieren. Die ausgewählten Werke fordern allesamt heraus; sie geben Orientierung und enthalten überraschende Einsichten; sie machen Deutungsangebote und ermuntern zu Kritik.
Ziel der Reihe des Hamburger Instituts für Sozialforschung ist es, methodisch und theoretisch kreativen Impulsen mehr Gewicht in wissenschaftlichen und öffentlichen Diskursen zu verleihen. Dazu versammelt Positionen sowohl Originaltexte als auch Übersetzungen.
CHARLES TILLY
WHY?
Was passiert, wenn Leute Gründe angeben … und warum
Aus dem Englischen von Enrico Heinemann
Mit einer Einführung vonThomas Hoebel und Stefan Malthaner
Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung
Mittelweg 36
20148 Hamburg
www.hamburger-edition.de
© der E-Book-Ausgabe 2021 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-993-5
© der deutschen Ausgabe 2021 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-341-4
© der Originalausgabe 2006 by Princeton University Press
Titel der Originalausgabe: »Why? What Happens when People Give Reasons … and Why«
Umschlaggestaltung: Wilfried Gandras
INHALT
THOMAS HOEBEL | STEFAN MALTHANER
Warum Tilly lesen?
CHARLES TILLY
Vorwort
Warum Gründe angeben?
Konventionen
Geschichten
Codes
Fachliche Erklärungen
Gründe miteinander in Einklang bringen
Bibliografie
Zum Autor
THOMAS HOEBEL | STEFAN MALTHANER
Warum Tilly lesen?
Why? ist ein Buch über Gründe, die Menschen angeben, und über die sozialen Konsequenzen, die diese Begründungen haben. Ein Buch, das beschreibt, welche Arten von Gründen Menschen typischerweise anführen, wenn sie sich oder einander fragen, warum etwas stattgefunden hat, sich regelmäßig ereignet, weiterhin passiert oder gemacht werden sollte. Wenn Sie sich also fragen, warum es sich lohnen könnte, mit der Lektüre von Why? zu beginnen und es nicht nur bei den ersten Zeilen seiner Einführung zu belassen, dann sind Sie schon mitten im Thema.
Sein Autor, der US-amerikanische Sozialforscher Charles Tilly, ist, wie er selbst einleitend betont, nicht der Erste, der sich mit der Frage befasst, was es mit Gründen auf sich hat. Er steht hier »auf den Schultern von Riesen«1, indem er C. Wright Mills, Kenneth Burke oder Erving Goffman darin folgt, dass Begründungen nicht unabhängig von der Situation betrachtet werden sollten, in denen Menschen nach Erklärungen für etwas verlangen. Welche Gründe jeweils Akzeptanz finden oder nicht, so der Kerngedanke, hat weniger mit dem infrage stehenden Vorgang zu tun, der erklärt werden soll. Zentral ist vielmehr die Form, in der jemand Gründe angibt, und das Verhältnis, in dem die Gesprächspartnerinnen2 zueinander stehen.
Jedoch ist Tilly der Erste, der den Vorschlag macht, systematisch zwischen typischen Formen von Gründen zu unterscheiden – und auf dieser Basis danach fragt, welche sozialen Konsequenzen es hat, dass sich Menschen dieser Formen bedienen. Er unterscheidet vier dieser Formen (wobei er nicht davon ausgeht, dass sie im sozialen Verkehr zwischen Menschen in Reinform zu finden sind, sondern sich für gewöhnlich überlappen): Konventionen sind in dieser Perspektive typisch für Situationen, in denen sich jemand verspätet (»Der Bus ließ auf sich warten«), sich kurzzeitig falsch verhält (»Entschuldigung, das war keine Absicht«) oder unverhofft etwas Erfreuliches erlebt (»Glück gehabt!«). Geschichten sind demgegenüber elaboriertere Erzählungen mit einem bestimmten Kreis an Beteiligten und einem bestimmten Handlungsverlauf, der eine kausale Abfolge von Ereignissen nahelegt (wobei Tilly betont, dass Geschichten nicht darauf angewiesen sind, dass sich, würde man sozialwissenschaftliche Methoden anlegen, diese Kausalzusammenhänge auch belegen ließen). Bei Codes handelt es sich um Formeln, die eine autoritative Kraft von bestimmten offiziellen Instanzen oder formellen Verfahren unterstellen, deren Arbeit und Funktionsweise aber meistens gar nicht genauer bekannt sind. Man denke an richterliche Urteile oder Juryentscheidungen. Fachliche Erklärungen schließlich sind Aussagen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, wie sie Spezialisten für ein bestimmtes Sachgebiet formulieren, wenn sie z.B. nach der Statik eines Bauwerks gefragt werden, um dessen Einsturz zu erklären, oder die institutionelle Diskriminierung von Bevölkerungsgruppen untersuchen, um Ursachen für deren Beständigkeit zu benennen.
Die sozialen Konsequenzen, die daraus erwachsen, dass Menschen sich bestimmter Begründungsmuster bedienen, verortet Tilly in erster Linie in ihren Beziehungen zueinander. Was auch immer Individuen sonst tun, wenn sie Gründe angeben – sie drücken damit etwas über ihr Verhältnis zwischen sich selbst und anderen aus. Diejenigen, die Gründe anführen, und diejenigen, die sie empfangen, arbeiten in dieser Situation an ihrer Verbindung zueinander. Sie knüpfen, bestätigen, verhandeln, reparieren oder leugnen ihre Beziehung – abhängig davon, ob die Gründe und die Form ihrer Präsentation zu der sozialen Situation passen, in der sie einander begegnen, in der sie sich aus dem Weg zu gehen versuchen, in der sie voneinander lesen oder aneinander denken. Gründe und ihre jeweilige Form sind in dieser Perspektive niemals nur sachbezogene Gesprächsbestandteile, sondern haben einen unmittelbaren Gestaltungseffekt auf menschliche Beziehungen.
Why?, im Original erstmals im Februar 2006 erschienen3, gilt vielen Kollegen als Kuriosum in Tillys langer Liste an Publikationen.4 Das hat maßgeblich damit zu tun, dass viele ihn als einen Forscher kennen, der sich mit langfristigen historischen Makro-Prozessen befasst, insbesondere mit der sukzessiven Durchsetzung kapitalistischen Wirtschaftens und zentralstaatlicher Herrschaft in Westeuropa. Ein Buch über Gründe, Konversationen und soziale Beziehungen? Ein »Mikro-Buch«? Das hat durchaus Erstaunen ausgelöst.
So richtig können und wollen wir die Aufregung nicht teilen. Aus unserer Sicht ist Why? ein Buch, dass sich relativ bruchlos in die Forschungsbiografie Tillys einfügt. Dafür möchten wir im weiteren Verlauf einige Gründe anführen – und damit gleichzeitig deutlich machen, warum es sich lohnt, nicht nur das vorliegende Buch, sondern »Tilly« insgesamt zu lesen. Legt man Tillys eigene in Why? verwendete Typologie von je unterschiedlichen Formen von Gründen an, so hat unsere Begründung sicherlich am ehesten den Charakter einer Geschichte – nicht so sehr mit einem klaren Anfang, einem Mittelteil und einem Ende. Ein solcher Umgang mit ihm als Protagonisten hätte ihn vermutlich selbst stark gelangweilt.5 Sie ist daher eher anekdotisch, Schlaglichter werfend, besondere Merkmale seiner Arbeitsweise skizzierend, dabei aber auch längere Linien nachzeichnend.
Tilly selbst ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Jedes seiner Bücher beginnt mit einer unterhaltsamen, oft detailliert erzählten Episode, die ihm als Ausgangspunkt seiner Argumentation dient. Auch in vergleichenden Abhandlungen führt er immer wieder lange Geschichten ein. Was liegt also näher, als für unsere Geschichte über Tilly eine Episode zu nutzen, die er selbst erzählt hat.
Dijon, Frühjahr 1975
Das Stadtarchiv von Dijon befindet sich in dem alten Palais der Fürsten von Burgund am Place de la Liberation. Tilly ist wieder einmal in Frankreich unterwegs, nicht in Paris, wo er eine kleine Wohnung hat, sondern in einer der Städte, die mit der sukzessiven Zentralisierung staatlicher Herrschaft ab dem 16. Jahrhundert ihren eigenen Status als weitgehend eigenständige regionale Zentren einbüßten. Er sitzt über alten Akten, über vorrevolutionären Schriftstücken zur kommunalen Polizey – wobei darunter nicht die heutige Institution der Ordnungs- und Sicherheitswahrung zu verstehen ist, sondern die sich um alle möglichen Sachverhalte kümmernde städtische Verwaltung. Konkret befasst Tilly sich mit 45 lokalen Revolten und Unruhen zwischen 1635 und 1775, die in den Akten zu finden sind, beispielweise als 1668 nicht weiter bezeichnete Personen das Gerücht streuten, die Kopfsteuer solle erhöht werden, und nach einem erneuten Lanturelu riefen. In den 1620er Jahren war Lanturelu ein populäres Lied in der Region, das 1630 einer regionalen Revolte gegen die Entscheidung Kardinal Richelieus, Steuerprivilegien des Burgund aufzuheben, ihren Namen gab.6
Plötzlich schwillt draußen Lärm an. Tilly sieht auf, geht ans Fenster. Menschen marschieren vorbei, es sind mehrere Hundert. Einige tragen eine merkwürdige Puppe, andere Banner und Schilder. Es zieht ihn vor die Tür. Jemand drückt ihm ein Flugblatt in die Hand: Der Demonstrationszug, mehrheitlich aus jungen Leuten bestehend, richtet sich gegen den Vorschlag des französischen Bildungsministers, das staatliche Budget für Sporterziehung zu kürzen und ein verpflichtendes Sportangebot an Schulen zu streichen – für Studierende in diesem Bereich eine massive Einschränkung ihrer Berufschancen. Die Puppe soll offensichtlich den Minister darstellen. Auch in anderen Städten wird an diesem Tag protestiert, wie Tilly später erfährt.
Die Episode findet sich in einem Aufsatz Tillys, der 1977 in der Zeitschrift Theory and Society erschienen ist: Getting It Together in Burgundy, 1675–1975. Sie verrät so einiges über seinen Arbeitsstil und sein Verständnis von Sozialforschung, wie es uns schließlich auch Jahre später in Why? wieder begegnet. Sein eigenes Storytelling ist im Kern ein Kontrapunkt gegen die Art und Weise, wie Soziologen schreiben, sei es in den 1970er Jahren oder in den 2000ern. Tilly leidet förmlich daran, was er so an Texten aus dieser Richtung zu lesen bekommt – zumindest geben ihm viele Bücher, Artikel und Manuskripte, die über seinen Schreibtisch wandern, reichlich zu denken.7 Viele Soziologinnen hätten Schwierigkeiten anzugeben, wer eigentlich in welcher Weise gegenüber wem handelt, sie schrieben im Passiv und zu abstrakt – wo dann niemand mehr irgendetwas im Kontakt mit anderen tue. Demgegenüber dienen Geschichten Tilly dazu, das Geschehen, für das er sich interessiert, zu situieren und in seinem spezifischen historischen Kontext zu erörtern. Und damit nicht genug. Sie dienen ihm oftmals – der Frühlingstag im Burgund ist dafür exemplarisch – auch dazu, sich selbst als Forscher zu verorten und über sein Arbeiten Auskunft zu geben.
Das Material für seine Geschichten, aus denen Tilly dann komplexe Argumente aufbaut, gewinnt er in der Regel aus Archiven. Mit ihrer Hilfe versucht er, sich ein Bild von der Zeit zu machen, in der die Archivmaterialien entstanden sind, wobei er sich vor allem für das öffentliche Leben aus Sicht möglichst aller Beteiligten interessiert. Er schreibt keine Analysen über die Taten (vermeintlich) großer Männer, sondern über kollektives Handeln. Dafür arbeitet er in erster Linie mit Akten aller Art, mit Berichten anderer, mit Statistiken – nicht als Ethnograf oder Sammler natürlicher Daten mit Diktiergerät oder Camcorder, obwohl er ein genauer Beobachter ist. Es ist charakteristisch für sein Arbeiten, dass er in Dijon nicht mit den Protestierenden mitzieht und sie in Gespräche verwickelt, sondern seine Informationen über das Geschehen maßgeblich aus einem Flugblatt bezieht und – »My thoughts turned back three centuries to 1675«8 – sich nach kurzer Unterbrechung wieder den Akten zuwendet.
Wenn sich Tilly in Why? mit Gründen befasst, die Menschen in ihren Konversationen nennen, dann ist er dafür nicht eigens losgezogen und hat Unterhaltungen gelauscht und aufgezeichnet. Er befasst sich auch nicht konversationsanalytisch oder soziolinguistisch damit, wie sich Konversationen in situ entfalten und welche Richtungen sie nehmen, wenn die Beteiligten Warum-Fragen stellen.9 Er greift auf Dokumente und eigene Erfahrungen zurück – nicht zuletzt weil es ihm weniger um die Konversationen selbst geht, sondern vielmehr um die situative Angemessenheit von Begründungen und die damit verknüpfte Beziehungsqualität zwischen den Beteiligten.
In Why? behandelt er vielfältige Themen. Die Aushandlung zwischenmenschlichen Vertrauens kommt genauso zur Sprache wie die Vernachlässigung von Brandschäden in der Nuklearstrategie des US-Militärs oder Tillys eigene Krebserkrankung – um nur einige Beispiele zu nennen. Why? ist aber vor allem ein Buch, dass erkennbar unter dem Eindruck von 9/11 geschrieben ist. Dafür bedient er sich neben dem Bericht der National Commission on Terrorist Attacks upon The United States vor allem diverser Reportagen, die dazu erschienen sind.
Indem Tilly sich schwerpunktmäßig mit bereits vorhandenen Dokumenten befasst, ist er bereits eine Spur abstrahierender unterwegs, als es sich insbesondere »Hermeneutiker der Straße« wünschen würden. Sie befassen sich insofern ebenfalls mit Begründungen als sie analysieren, wie sich Menschen konkret begegnen und welche Handlungspläne sie dabei Schritt für Schritt entwerfen.10 Und da sie sich im Unterschied zu Tilly nicht nur auf das gesprochene und geschriebene Wort, sondern auch auf die leibliche, emotionale, ästhetische oder sinnliche Dimensionen eines Geschehens konzentrieren,11 haben sie durchaus einige Argumente in der Hand, mit denen sich Tillys Herangehensweise kritisieren ließe. Aber tut das dem grundsätzlichen Erkenntnishorizont von Why? nennenswerten Abbruch? Schwer zu sagen. Halten wir Tilly daher lieber zugute, dass Why? durchaus als tastendes, suchendes Buch angelegt ist, im Ganzen fast schon selbst als Geschichte, die mit der vierstelligen Unterscheidung von Konventionen, Geschichten, Codes und fachlichen Erklärungen dazu anregt, im gesellschaftlichen Alltag selbst den Funktionen und Folgen von gegebenen oder verweigerten Begründungen nachzuspüren – sei es als Forscherin oder als Gesprächsteilnehmer.
Geschichtenerzählen ist somit, das klingt bereits an, kein Selbstzweck für Tilly. Es scheint fast, als traute er seinen eigenen empirischen Ergebnissen und analytischen Argumenten nicht recht über den Weg, solange er sie nicht in einer detaillierten, lebendigen Erzählung über tatsächliche Menschen fassen kann. Nachdem er zeit seines Forscherlebens extensiv Gebrauch von ihnen gemacht hat, setzt er sich in den 2000er Jahren, zeitgleich mit der Arbeit an Why?, noch einmal intensiv mit Storys und Storytelling auseinander. In Stories, Identities, and Political Change findet sich einerseits eine explizite Theorie über Geschichten und wie sie erzählt wurden. Tilly betrachtet beides zusammen als den dominanten Modus, wie sich Menschen in ihrem Alltag fragliche Sachverhalte zu erklären suchen. Er spricht hier von standard stories, die für gewöhnlich Individuen, mitunter auch kollektive Entitäten (»Die Partei hat immer recht …«), und ihren Charakter zum Ausgangspunkt haben, und ein bestimmtes Bauprinzip. Standardgeschichten zu erzählen, so Tilly, beinhaltet:
»start with a limited number of interacting characters, individual or collective. […] Treat your characters as independent, conscious, and self-motivated. Make all their significant actions occur as consequences of their own deliberations or impulses. […] With the possible exception of externally generated accidents – you can call them ›chance‹ or ›acts of God‹ – make sure everything that happens results directly from your characters’ actions.«12
Diese, im Alltag so dominanten Standardgeschichten halten für gewöhnlich jedoch keiner genaueren Analyse von Kausalbeziehungen stand. Tillys Appell an Sozialwissenschaftlerinnen lautet daher: Wenn sie ein Geschehen erzählen, müssten sie sich bemühen, reflexiv und kritisch auch komplexe Verlaufsmuster, Zufälle und nicht intendierte Effekte kollektiven Handelns zu erfassen. Sie hätten die Aufgabe, »superior stories« zu schreiben.13
Mit seiner theoretischen Reflektion des Geschichtenerzählens gibt Tilly somit andererseits auch implizit Auskunft darüber, wie er selbst arbeitet. Geschichten waren für ihn mehr als schiere Anekdoten, die zur nachträglichen Illustration seiner Argumente dienten. Rückblickend ist gut erkennbar, dass er seine theoretische Perspektive in einem ständigen Prozess des Erzählens seiner Forschung entwickelte, in dem das Auffinden und eigene Schreiben von Geschichten eng miteinander verwoben waren. Sie dienten ihm elementar zur Konstruktion fachlicher Erklärungen, er theoretisierte mit ihrer Hilfe direkt am Gegenstand. Die Episode aus Dijon beispielsweise ist nicht einfach nur eine nette Eröffnung eines Textes. Sie führt unmittelbar auf das Argument zu, dass die Geschichte des Burgund als eine Geschichte wiederkehrenden öffentlichen Aufruhrs begriffen werden kann, sich aber auch eine signifikante Transformation im regionalen »Repertoire« kollektiven Handelns finden lässt, wie Tilly schreibt. Zwar geht es vielfach darum, lokale Interessen gegen zentralstaatliche Zugriffe und eine sich durchsetzende Marktlogik zu behaupten, doch finden sich nach und nach neue Formen des Protestes. Ein Demonstrationszug, wie er ihm 1975 beiwohnt, ist ein Kind des 19. Jahrhunderts. Aufstände wegen einer schlechten Versorgung mit Nahrungsmitteln (food riots), wie sie in den Akten des 17. und 18. Jahrhunderts dokumentiert sind, verschwinden dagegen ab den 1850er Jahren.14
Burgund, 1675 bis 1975
Die Episode in Dijon verrät nicht nur einiges über den Arbeitsstil Tillys, der sich später auch in Why? wiederfindet. Der Aufsatz, den die Geschichte eröffnet, verkörpert en miniature, dass die 1970er Jahre in vielen Hinsichten ein Schlüsseljahrzehnt in der Forschungsbiografie Tillys sind.15 Er legt in dieser Zeit viele Grundsteine für sein späteres Werk und schärft sein akademisches Profil, ist auch endlich in einer hinreichend gesicherten Position, dies zu tun. Seit 1969 ist er Professor für Geschichte (später auch für Sozialwissenschaften) an der University of Michigan und leitet dort das Center for Research on Social Organization, von dem aus er sein Forschungsprogramm umzusetzen beginnt.16Zugute kommt ihm dabei im selben Jahr auch eine Einladung des Committee on Comparative Politics des US-amerikanischen Social Science Research Council unter Leitung von Gabriel Almond. Tilly führt in den Folgejahren eine Forschungsgruppe an, die sich mit Staatsbildung in Europa befasst.17
Allein der Publikationsort von Getting It Together in Burgundy ist aufschlussreich. Theory and Society ist zu diesem Zeitpunkt noch eine recht junge Fachzeitschrift, gegründet von Alvin Gouldner mit dem Ziel, sozialtheoretischen Ansätzen einen Raum zu bieten, die sich kritisch gegen den seinerzeit dominanten Strukturfunktionalismus einerseits und den akademischen Neo-Marxismus andererseits wenden, und beiden etwas Eigenständiges entgegensetzen.18 Tilly findet hier den passenden Ort, um seine Vorstellungen einer geschichtsbewussten Sozialforschung zu präsentieren.
Einerseits geht es ihm darum, vorherrschende soziologische Vorstellungen sozialen Wandels in ihre Schranken zu weisen. Vor allem die weit verbreitete Annahme, dass gesellschaftliche Entwicklungen geradlinig, gerichtet und irreversibel verliefen, nimmt er ins Visier – und kritisiert die Annahme modernisierungstheoretischer Fortschrittserzählungen, dass sich Gesellschaften, die dabei oftmals mit Staaten in eins gesetzt werden, immer weiter arbeitsteilig differenzierten, ohne dass gegenläufige Tendenzen, wie die Konzentration von Ressourcen in den Händen weniger, nennenswert zur Kenntnis genommen würden.19 Er richtet sich damit auch gegen evolutionistische und deterministische Vorstellungen von Sozialität, die menschliches Handeln als etwas begreifen, das sich reaktiv bestimmten gesellschaftlichen Makrobedingungen füge.20 Dafür legt er sich wiederkehrend Émile Durkheim als sozialtheoretischen Gegner zurecht21, kritisiert aber eigentlich die funktionalistische Gesellschaftsauffassung von Talcott Parsons.22
Andererseits, und eng mit seiner Kritik an Fortschrittserzählungen verknüpft, hält er der Soziologie vor, zu schmalspurig über die Gegenwart zu arbeiten23 – und sich gleichzeitig nicht davor zu scheuen, weit ausgreifende gesellschaftshistorische Thesen mit hohem Abstraktionsgrad zu formulieren, ohne dafür belastbare Daten zu haben. Historische Vorgänge würden dabei nomothetisch unter vermeintliche Gesetzmäßigkeiten menschlichen Zusammenlebens verbucht; Erkenntnisse über das Hier und Jetzt dazu genutzt, etwas über längst vergangene Zeiten zu sagen.24 Das ist für Tilly schlicht inakzeptabel. Seine Arbeitsweise zielt demgegenüber darauf ab, nicht nur, wie schon angesprochen, historische Daten zu sammeln, sondern sie möglichst auch aus ihrem Entstehungskontext heraus zu interpretieren.25 Das bedeutet nicht zuletzt, sich überhaupt für ihre Entstehung zu interessieren.26 Menschliches Handeln und seine Konsequenzen hängen davon ab, wie es situiert ist und welche sozialen Beziehungen involviert sind, wie Tilly schließlich auch in Why? geltend machen wird. In den 1970er Jahren grundiert diese Einsicht bereits seine methodologische Position, ohne dass er sie allerdings so explizit benennt.
In Getting It Together in Burgundy findet sich wie unter dem Brennglas Tillys Gegenmodell zur damals dominanten Soziologie, das er über die Jahre in zahlreichen soziohistorischen Studien erarbeitet.27 Vier Charakteristika sind besonders erwähnenswert:
1) Tilly betrachtet historische Kontinuitäten und Diskontinuitäten gleichermaßen. Konkret entfaltet er in Getting It Together ein historisch-soziologisches Argument über Kontinuitäten und Diskontinuitäten öffentlichen Protestes, indem er – wie schon angesprochen – Repertoires kollektiven Handelns in den Mittelpunkt seiner Analyse stellt.
2) Er arbeitet fast immer vergleichend. So verfolgt er im Fall des Burgund eine diachrone Perspektive, nicht zuletzt indem er nach dem möglichen Zusammenhang zwischen der Kundgebung, die er beobachtet, und der langen Reihe öffentlicher Auseinandersetzungen fragt, die er im Archiv findet: »Are the turbulent events of 1675 and 1975 knots on the same long thread?«28 In der Regel verschränkt er jedoch diachrone und synchrone Vergleiche, indem er mehrere Regionen und Staaten in Bezug zueinander setzt. Oder er vergleicht, wie im Fall von Why?, in theoriebildender Absicht nicht historische Vorgänge, sondern bestimmte Muster sozialer Aktivitäten, die sich an diversen Orten und zu diversen Zeiten finden.
3) Kennzeichnend für Tillys Arbeitsweise ist ebenfalls, dass er sowohl sensibel für Vorgänge auf lokaler Ebene ist als auch geografisch weit ausgreifende langfristige Prozesse erörtert (die wiederum nötig zu begreifen sind, um lokales Geschehen deuten und einordnen zu können). Wie sein Freund und Kollege Sidney Tarrow es formulierte: »His work constantly shifted from the very macro to determinedly micro levels of social reality, often trying to embed the latter within the former.«29 In Getting It Together findet sich dabei in Grundzügen eine These, die er in den 1970er und 1980er Jahren sukzessive ausarbeitet, dass nämlich die Geschichte Westeuropas zwischen 990 und 1990 anhand von zwei »Basismechanismen« begriffen werden müsse: einerseits der sich in Städten konzentrierenden Akkumulation von Kapital und Ausbeutung menschlicher Arbeit, andererseits der durch Kriege angetriebenen Zentralisierung und Rationalisierung staatlicher Herrschaft.30 So argumentiert er mit Blick auf das Burgund, dass sich etwa Repertoires öffentlichen Protestes maßgeblich im Zuge dieser beiden Makrovorgänge herausbilden, nämlich als Auseinandersetzungen um Verfügungsrechte über Land und Ressourcen sowie um zentralstaatliche Ansprüche auf Steuern und Personen, um Kriege zu finanzieren und zu führen. Dabei wandeln sich nicht zuletzt auch die Koalitionen, die sich engagieren. Während im 17. Jahrhundert durchaus auch lokale Notabeln Konflikte anführen, die sich für gewöhnlich dann auch gegen regionale Mitstreiter richten, verschwindet diese Organisationsform in den darauffolgenden Jahrhunderten – »as the importance of patronage and the possibility of alliance with regional power-holders declined«31. Proteste werden weitgehend zur Sache der einfachen Leute – Bauern und Arbeiterinnen – und richten sich nun oftmals gegen die Notabeln selbst, die vor Ort zentralstaatliche Agenden um- und durchsetzen.32
4) Lokale Vorgänge wie im Burgund sind Tilly zufolge aber nicht einfach durch langfristige sozialstrukturelle Veränderungen zu erklären, geschweige denn schlicht durch sie angetrieben. Er entwirft vielmehr ein Modell kollektiven Handelns, das auf das konkrete Zusammenspiel von Interessenlagen (»interests«), Handlungsgelegenheiten (»opportunities«) und Organisationsformen (»organization«) abhebt.»Whether we are watching seventeenth-century winegrowers or twentieth-century students, we notice that they do not seize every opportunity to act on their interests, and do not react to every opportunity in the same way. How they are tied to each other, what ways of acting together are already familiar to them, and which sorts of news they have alerted themselves to, affect how much they act, in what manner, and how effectively.«33
Das skizzierte Handlungsmodell bildet ein Jahr nach Getting It Together auch das konzeptuelle Herzstück der Monografie From Mobilization to Revolution, die ihn spätestens zu diesem Zeitpunkt zu einem der einflussreichsten Forscher macht, an dem es in Fragen historischer Soziologie, Staatsbildung und sozialer Bewegungen kein Vorbeikommen mehr gibt.34 Der implizite Rationalismus und strukturelle Bias dieses Modells – kollektives Handeln unterliegt danach letztlich einer Nutzenabwägung in Hinblick auf Gelegenheitsstrukturen (»opportunity structures«) und verfügbare Ressourcen – erweist sich zunächst als analytisch produktiv, ermöglicht er es doch, die Bedingungen von Mobilisierungsprozessen deutlich präziser zu fassen. Er wird jedoch in den folgenden Jahren erhebliche Kritik auf sich ziehen, nicht zuletzt von Tilly selbst, der zunehmend erkennt, dass Gelegenheiten interpretationsbedürftig und Dynamiken kollektiven Handelns weit kontingenter sind, als zunächst angenommen.35Getting It Together und From Mobilization to Revolution stehen allerdings auch dafür, dass Tilly zwar sowohl mikroskopisch und makroskopisch argumentiert, sich seine zentralen Thesen und seine Theoriebildung zunächst jedoch weitgehend auf »big structures« und »large processes« beziehen, die er mithilfe von »huge comparisons« analysiert – um die drei Formeln zu nutzen, die zusammen den Titel eines seiner berühmtesten Bücher bilden.36 Lokale Geschehnisse – auch dies sei hier kritisch angemerkt – registriert er eher, als dass er sie vertiefend theoretisiert. So fragt er auch nicht genauer danach, wie sich Interessen, Opportunitäten und Organisationsformen konstituieren, sondern stellt sie eher als in seinem Material auftretend fest – ebenso wenig wie er sozialtheoretisch erörtert, ob und inwiefern die Kategorien, die er für seine mikroskopische Registratur lokaler Vorgänge nutzt, eigentlich genau genug sind, um das zu bezeichnen, was sie kenntlich machen sollen.
New York, 1990er Jahre
Ende der 1970er Jahre ist ein Buch wie Why?, das sich damit beschäftigt, wie ein Interesse an Gründen soziale Beziehungen stiftet oder auflöst – die soziale Organisation zwischen Menschen –, für Tilly undenkbar. Nicht nur, dass er sich zu diesem Zeitpunkt nicht mit Fragen befasst, wie sich Mikrogeschehnisse und Kategorien zu ihrer Beschreibung formen, kurz: wie sie in die Welt kommen. Nicht nur, dass ihm ein disziplinäres Umfeld fehlt, in dem diese Fragen verhandelt werden (erst die 1980er Jahren werden einen so genannten cultural turn in den historisch arbeitenden Sozialwissenschaften bringen, in dem Fragen wie die genannten die Tagesordnungen [mit-]bestimmen); es mangelt ihm auch an Leuten in seinem Nahumfeld, die ihn mit solchen Fragen konfrontieren.
Das ändert sich, als Tilly zunächst 1984 als Distinguished Professor for Sociology and History an die New School for Social Research in New York City wechselt und schließlich 1996 – sein langjähriger Freund Harrison White hat die Hände im Spiel37 – als Joseph L. Buttenwieser Professor of Social Science an die Columbia University berufen wird. Während Netzwerke sozialer Beziehungen, »how they [people] are tied to each other«, wie er 1977 formuliert (siehe oben), immer schon ein zentraler Bezugspunkt seines historisch-soziologischen Denkens waren – er gilt deswegen als Strukturalist –, beginnt er Ende der 1980er Jahre, Anfang der 1990er Jahre, die kulturelle Seite sozialer Strukturen zu analysieren und zu überdenken, wie sie eigentlich ihre jeweils kontextbedingte Gestalt gewinnen. Das hat viel mit dem New Yorker Umfeld zu tun, in dem er sich nun bewegt. Im Kontakt mit White, dem damals noch jungen Mustafa Emirbayer, ab 1991 Assistenzprofessor an der New School, und vielen weiteren, oftmals auch jungen Forschenden entsteht ein Forschungsansatz, den Ann Mische rückblickend als »New Yorker Schule« der relationalen Soziologie bezeichnen wird.38
In den Worten des »relationalen Realismus«39, der sich in dieser Zeit herausschält, betreiben White, Tilly und Emirbayer brokerage40. Sie bringen eine Vielzahl von Leuten zusammen, die sich ohne ihr Zutun vermutlich nicht zu intensiven Fachgesprächen zusammengefunden hätten. Brokerage ist ein typischer »relationaler Mechanismus«, durch den sich Verbindungen zwischen Personen und sozialen Kreisen verändern.41 a) White organisiert eine Reihe von Minikonferenzen zur Netzwerk- und Kulturforschung mit einer illustren Schar von sehr unterschiedlich arbeitenden Gästen.42 b) Zusammen mit Doug McAdam und Sidney Tarrow veranstaltet Tilly eine Workshopreihe, die Forschende zu sozialen Bewegungen, Revolutionen, Nationalismus und Demokratisierung zusammenbringt und unter Mitwirkung von Ron Aminzade, Jack Goldstone, Liz Perry und William Sewell bald als »Invisible College of Contentious Politics« gilt, das sich u.a. mit der Konstruktion kollektiver Identitäten befasst. c) Emirbayer führt eine Studiengruppe »Theory and Culture« an, die sich vor allem an Doktorandinnen richtet.
Für Tilly selbst erweist sich dieses brokerage als ungemein inspirierend und produktiv. Nachdem er soziale Interaktionen auf lokaler Ebene bisher meist nur registriert hat, beginnt er nun verstärkt mit ihrer Theoretisierung. Sein Weggefährte Tarrow spricht rückblickend davon, dass »es in den 1990er Jahren zu einem grundlegenden Wandel in seiner Ontologie kam, der die Überreste seines ursprünglichen Strukturalismus beseitigte und zu einer Flut von ›relationalen‹ Arbeiten im letzten Jahrzehnts seines Lebens führte.«43 Zuspitzend formuliert liegt Tillys Augenmerk nicht mehr primär auf den strukturellen Handlungsgelegenheiten und -bedingungen von kollektiven Akteuren unterschiedlichen Organisationsgrads, sondern auf Mechanismen, die spezifische Prozesse der sozialen und politischen Strukturbildung, -transformation und -auflösung zu erklären helfen.44
Der relationale Realismus, an dem Tilly nun mit anderen arbeitet, ist im Kern eine mechanismenbasierte Prozessanalyse, wobei die Phänomene, für die sich Tilly interessiert, dieselben bleiben wie in den Jahren zuvor – darunter u.a. die Formation von Staaten45, Repertoires kollektiven Handelns46 oder Formen sozialer Ungleichheit47. Er wird jedoch sensibler für Konstitutions- und Konstruktionsfragen. Sie lenken seinen Blick auf die »Mikroebene« des sozialen Lebens, er fragt danach, wie die »Transaktionen«48 zwischen Menschen gestaltet sind, durch die sowohl kategoriale Bedeutungen der sie umgebenden Dinge einschließlich ihrer selbst in die Welt kommen als auch soziale Strukturen entstehen und sich wandeln. In dieser Perspektive begreift er auch Mechanismen im Kern als »Mikro-Prozeduren«49. Es handelt sich dabei einerseits um Ereignisse oder Interaktionsmuster, durch die sich die Beziehungen zwischen sozialen Einheiten verändern, wobei es sich bei diesen Einheiten um Personen oder Kollektive handeln kann. Andererseits ähneln sich diese Ereignisse in ihrer Gestalt. Sie treten in diversen Situationen auf, weisen jedoch innere Regelmäßigkeiten auf, sodass sie vergleichbare Effekte hervorbringen, obwohl die äußeren Umstände variieren.50
In Dynamics of Contention, das die empirischen, theoretischen und methodologischen Diskussionen der Contentious-Politics-Workshops verdichtet und als ein Schlüsselwerk dieses Forschungsansatzes gelten kann, schlagen McAdam, Tarrow und Tilly gemeinsam vor, analytisch zwischen mindestens drei Sorten von Mechanismen zu unterscheiden. Neben den bereits angesprochenen relationalen Mechanismen sprechen sie hier zum einen von »kognitiven Mechanismen«, die sich auf die Wahrnehmung und Bedeutung richten (z.B. Klassifikationssysteme), zum anderen von »Umwelt-Mechanismen«, die sich auf das soziale Leben auswirken (z.B. Naturkatastrophen).51 Mithilfe dieser Grundbausteine für eine erklärungsstarke Sozialforschung machen sie dann in abstrakter Weise Prozesse zum Thema. Der Gedanke ist so simpel wie brillant: Prozesse bilden sich schlicht aus der spezifischen Verkettung von Mechanismen.52 »Mechanismenbasierung« entwickelt sich in diesen Jahren somit zu einer wesentlichen theoretischen Trademark Tillys. Sein Mechanismusbegriff stieß durchaus auf Kritik.53 Gleichwohl wurde diese Vorgehensweise so erfolgreich, dass man heute noch zu seinen Studien greift, wenn es um Fragen der Dynamik von Protestkampagnen oder der Entstehung und Transformation sozialer Entitäten geht.
Nicht übersehen werden darf jedoch – und das ist ein wichtiger Punkt –, dass sich Tilly in New York ebenso zu einem verkappten Symbolischen Interaktionisten und Quasi-Pragmatisten entwickelt, der nicht nur Transaktionen, Interaktionen und soziale Beziehungen als »central stuff of social life« betrachtet, sondern insbesondere auch Konversationen.54 Ohne zwar Herbert Blumer, der den Begriff des Symbolischen Interaktionismus geprägt hat, direkt zu zitieren, denkt Tilly in eine sehr ähnliche Richtung. Es sind vor allem Gespräche, Geschichten und Erzählungen, mit denen Menschen ihre Beziehungen zueinander justieren. Zugleich tragen sie elementar dazu bei, dass so etwas wie Jobs, Organisationen oder Ethnien vielen Menschen als mehr oder weniger unverrückbare Angelegenheiten erscheinen, aus denen ihr Leben besteht.55
Ein Buch wie Why? wird für Tilly in dieser Schaffensphase nicht nur denkbar im wahren Sinne des Wortes, sondern geradezu zwangsläufig. Es entsteht aus der wachsenden Konvergenz zentraler gedanklicher Linien seiner bisherigen Arbeit mit interpretativ-interaktionistischen Ansätzen und in Auseinandersetzung mit dem zu dieser Zeit in der Protestforschung prominenten cultural turn und konstruktivistischen Debatten. Tilly selbst etwa spricht, wie Viviana Zelizer in ihrer großartigen Besprechung von Why? schreibt, seit Mitte der 1990er Jahren von der Aufgabe eines »tunneling under the post-modern challenge«56. Er erkennt – und propagiert mit Nachdruck! –, dass sich in Prozessen kollektiven Handelns jede Menge sozialer Konstruktion findet, ja soziale Konstruktion diese Prozesse förmlich erst hervorbringt. Und wie Randall Collins treffend formuliert, verfolgt Tilly dazu bereits in den 1990er Jahren einen »Contentious Social Interactionism«, es findet sich deutliche Bewegung hin zu einer explizit prozessualen und relationalen Perspektive.57 Tilly geht dabei aber noch nicht so weit, auch Interaktionssituationen genauer in den Blick zu nehmen. Diesen Schritt macht er jedoch schließlich in Why? – und das Buch erinnert in vielerlei Hinsicht an Erving Goffman, der wie kein anderer für die Analyse von »Interaktionsordnungen« steht und auch in Why? entsprechende Würdigung findet.
New York, 2001–2005
Es ist beeindruckend, wie viel Material Tilly zusammenträgt, um in Why? seine Sicht auf den gleichsam situativen wie beziehungsstiftenden Charakter von Gründen zu erläutern. Das Buch belegt ein weiteres Mal, dass Geschichtenerzählen für Tilly bedeutet, konsequent am Gegenstand zu theoretisieren. Er ist auch in der Spätphase seines Schaffens nicht der Typ, bestimmte Prämissen oder Annahmen allein wegen ihrer logischen Stimmigkeit bis in die letzte Konsequenz weiterzuführen. Er sucht die Erdung in der empirischen Forschung und interessiert sich für analytische Perspektiven, soweit und solange sie Einsichten über einen Gegenstand versprechen.
Die einleitenden Sätze des ersten Kapitels von Why? führen die Leserinnen direkt an den Morgen des 11. Septembers 2001 zurück, als die Flugbegleiterin Betty Ong um 8.19 Uhr ihrer Fluggesellschaft mitteilt, dass die Maschine mit der Flugnummer AA 11 gekapert worden sei, und als die ersten Menschen versuchen, sich einen Reim auf das Geschehen zu machen. Wenige Stunden später werden nicht nur Tausende New Yorker, sondern Millionen Menschen vor den Bildschirmen sitzen und zu begreifen suchen, warum zwei Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers geflogen sind. »Warum brachten die Entführer die Flugzeuge unter ihre Kontrolle und steuerten sie in die Türme? Warum gingen die Gebäude in Flammen auf und stürzten ein? […] Warum habe ich mich so verhalten, wie ich mich verhalten habe? […] Was verursacht Terrorakte?«58, sind nur einige der Fragen, mit denen sich Menschen an diversen Orten und in unterschiedlichen Positionen, »ob Leute aus der Regierung, Rettungskräfte oder Collegestudierende«59, in Folge befassen.
Tilly hat darauf keine Antworten. Ihm geht es in Why? auch gar nicht darum, eine schlüssige Erklärung für 9/11 zu geben. Er zeigt vielmehr, wie Menschen ein Geschehen zu einem gleichsam erklärungsbedürftigen und erinnerungswürdigen Ereignis formen, das Reaktionen fordert, indem sie nach seinen Gründen fragen, Erklärungen geben und sich nicht zuletzt ihrer Solidarität vergewissern. Um es noch einmal hervorzuheben: Soziohistorische Zustände, Ereignisse, Prozesse und Episoden sind aus Tillys Sicht konstruierte Sachverhalte – sie kommen durch Beschreibungen und Bezeichnungen zustande.60 So haben McAdam, Tarrow und Tilly in ihrer Schlüsselstudie Dynamics of Contention deutlich gemacht, wie bedeutsam interpretative Prozesse im Rahmen einer Vielzahl von Äußerungen, Begegnungen und Texten dafür sind, dass sich kollektive Identitäten, wie bei der Entstehung einer sozialen Bewegung, formen und daraus dann gemeinsame Handlungsentwürfe entstehen – nicht selten mit Blick auf gemeinsame Konstruktionen eines politischen Gegners.
Why? schließt in Sachen Prozessualität, Interpretation und Narrativität an Contentious Politics an. Und wie bereits in Getting It Together in Burgundy und in From Mobilization to Revolution interessiert ihn weiterhin kollektives Handeln und soziale Organisation, hier jedoch stärker auf soziale Beziehungen hin gedacht. Why? ist jedoch weniger auf politische Konflikte gemünzt. Außerdem ist es zugleich allgemeiner und spezifischer angelegt: allgemeiner mit Blick auf diverse Situationen, nicht nur politische, in denen Menschen nach Gründen fragen – spezifischer insofern, als sich Tilly nicht für alle möglichen interpretativen Prozesse interessiert, sondern im Kern für Konversationen, in denen Menschen (sich) etwas erklären und dadurch ihre Beziehungen zueinander gestalten.
Inhaltlich gesehen ist Why? somit weit weniger ein Kuriosum in Tillys Werk, als es so mancher Beobachterin erscheint. Was jedoch auffällt, ist seine Form. Why? ist im Kern ein langer Essay, weniger eine strenge wissenschaftliche Abhandlung. So wirkt das Buch, wie auch andere seiner späten Schriften, offener, suchender und experimentierfreudiger als so manche seiner Schriften im Themenfeld Protest, Staat und Revolution in den 1980er und 1990er Jahren, wo seine Erörterungen oftmals sehr gefestigt erscheinen und er mit einem Set an sehr fixen Annahmen und Überzeugungen arbeitet, die manchmal fast zu rigide wirken, auch sprachlich.61
Why? zeigt demgegenüber wie kaum ein anderes seiner Bücher, wie offen, wissbegierig und suchend Tilly in seinem Nachdenken ist, wie stark er andere Ansätze rezipiert und seine eigene Arbeit daraufhin überprüft, dabei aber immer auch eigenen Prämissen treu bleibt. In seiner fast schon berüchtigten Bescheidenheit zitiert Tilly gerne seinen Freund Harrison White, um seinen eigenen Anteil an intellektuellen Durchbrüchen herunterzuspielen. White pflegte zu sagen, dass im Grunde alle Ideen, die er hatte, vorher immer schon irgendwo in seinem persönlichen Netzwerk herumgewandert seien. Und tatsächlich lässt sich manches in Tillys Ausführungen besser verstehen, wenn man seine Gesprächspartnerinnen und Gegenüber in den Blick nimmt. Aber vielleicht ist Tillys Bescheidenheit auch ein Stück weit die Koketterie eines sozialwissenschaftlichen Superstars, dessen Beiträge zur Forschung außer Zweifel stehen.
Charles Tilly, 1929 bis 2008
Charles »Chuck« Tilly ist am 29. April 2008 in New York gestorben. Wenige Wochen später wäre er 79 geworden. Die zahlreichen Nachrufe und ein Symposium des American Sociologist zu seinen Ehren geben einen Eindruck davon, welche Spuren er insbesondere in den US-amerikanischen Sozialwissenschaften hinterlassen hat und welche Karrierewege er anderen dabei geebnet hat.
In den Nachrufen zeichnet sich ebenfalls ab, dass es gar nicht so leicht ist, das Forschungsprofil von Tilly mit einer Eindeutigkeit suggerierenden Kategorie zu umreißen. Soziologe oder Historiker? Tilly war in beiden Disziplinen gleichermaßen engagiert.62 Strukturalist oder relationaler Realist? Das hilft höchstens weiter, wenn man sich ernsthaft auf Tillys forschungsbiografische Lernkurve einlässt. Nun, die Versuche, Tilly in eine bestimmte Schublade zu stecken, sagen wohl vor allem etwas über diejenigen aus, die diese Versuche unternehmen. Neil Gross ahnt schon kurz nach seinem Tod, dass viele sozialwissenschaftliche camps »ihren Tilly« beanspruchen werden.63 Aber ist das nötig? Wollte man die Vielfalt seines Wirkens angemessen charakterisieren, dann war Tilly vermutlich ein Sozialhistoriker-Soziologe-Bewegungsforscher-Politikwissenschaftler-Relationaler-Realist-Quasi-Pragmatist. In erster Linie war er aber ein unglaublich bescheidener, hilfsbereiter und (selbst-) ironischer Mensch, der einen großen Freundeskreis hatte und Menschen in seinem Umfeld besser machen konnte in dem, was sie gerade beschäftigte. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass er ein wissbegieriger, selbstkritischer und lernfähiger Sozialforscher war.
Aktuell läuft sein Werk Gefahr, zu sehr auf seine Implikationen für die Bewegungsforschung wahrgenommen zu werden – gerade in Deutschland, wo er insgesamt recht wenig rezipiert (worden) ist (und wenn, dann vor allem in den Geschichtswissenschaften). Dass er letztlich an einer relational-prozessualen Sozialtheorie arbeitete, die sich mechanismischem Denken bediente, aber vor allem auch einen pragmatistischen Zug hatte, das gilt es eher noch zu entdecken.
Der Tod unterbricht Tilly mitten in der Arbeit. Er hätte gern noch ein Buch darüber geschrieben, wie alles Soziale aus Transaktionen entsteht und sich verändert, erzählt er Ende 2007.64 Dazu kommt es jedoch nicht mehr. In Why? sind dazu jedoch bereits einige Bausteine enthalten, wenn man insbesondere an die sozialen Konsequenzen von Begründungen denkt, die Menschen austauschen. Ebenso steht Why? aber auch für einige interessante Rätsel, die Tilly selbst nicht mehr bearbeitet und uns hinterlassen hat. Rainer Schützeichel sieht zum Beispiel eine erhebliche Spannung zwischen pragmatistischer Handlungstheorie und mechanismischer Prozesstheorie, er spricht hier von einem »grundlegenden Kompositionsproblem«.65Why? deutet an, in welche Richtung sich dieses Problem bearbeiten ließe, verknüpft Tilly doch typische situative Problemlagen in der Begegnung von Menschen (»Was ist hier los?«, »Warum ist das passiert?«, »Wie hast du das gemacht?«) damit, dass ihre konkrete Bearbeitung – das Angeben von Gründen – ein relationaler Mechanismus ist, der Beziehungen bestätigt, transformiert oder auflöst (wobei es durchaus erstaunlich ist, dass Tilly diesem Gedanken im Rahmen seines Essays nicht detaillierter nachgeht). Allerdings ist Why? nicht einfach nur eine Fortsetzung des relationalen Realismus mit pragmatistischen Mitteln. Tilly stellt sich mit Mills, Burke oder Goffman zwar auf Schultern von Riesen, verbindet seine Mills-Rezeption aber auch mit einer klugen Kritik. Tilly erörtert, dass dieser in seinem berühmten Essay über ein »Vokabular für Motive«66 die Zuschreibung von Motiven nahezu gleichsetze mit dem Angeben von Gründen – und dass Mills mehr oder weniger sage, dass Motive immer die soziale Aktivität des Rechtfertigens, der Rationalisierung und des Reparierens verrichteten.67 Lassen sich Motive aber einfach nur auf ein bestimmtes Sprechen reduzieren? Die Lektüre von Why? wäre ein Anlass, Gründe und Motive sozialtheoretisch gerade nicht synonym zu behandeln und die Diskussion dazu erneut zu eröffnen. Die Schultern von Tilly bieten dafür ohne Zweifel ausreichend Platz. Er ist im Zuge seines langen Forscherlebens selbst zu einem Riesen geworden.
1 Robert K. Merton, Auf den Schultern von Riesen. Ein Leitfaden durch das Labyrinth der Gelehrsamkeit, Frankfurt a.M. 1983.
2 Die Autoren, der Übersetzer und der Verlag verfolgen das Ziel gendergerechter Sprache, indem sie wahllos zwischen den grammatikalischen Geschlechtern wechseln.
3 Charles Tilly, Why? What Happens When People Give Reasons … and Why, Princeton 2006.
4 Ein exzellenter Überblick findet sich auf den Seiten des Social Science Research Council:http://essays.ssrc.org/tilly/resources [1. 12. 2020].
5 Charles Tilly, »George Caspar Homans and the Rest of Us«, in: Theory and Society 19 (1990), 3, S. 261–268, hier S. 261.
6 Charles Tilly, »Getting It Together in Burgundy, 1675–1975«, in: Theory and Society 4 (1977), 4, S. 479–504, hier S. 480.
7 Charles Tilly, »Writing Wrongs in Sociology«, in: Sociological Forum 1 (1986), 3, S. 543–552, hier S. 545.
8 Tilly, »Getting It Together in Burgundy«, S. 483.
9 Gary Alan Fine, »Why and Why Not?«, in: European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie 47 (2006), 3, S. 468–471, hier S. 469.
10 Jack Katz, »Epiphanie der Unsichtbarkeit. Wendepunkte bei Unruhen: Los Angeles 1992«, in: Axel T. Paul/Benjamin Schwalb (Hg.), Gewaltmassen. Über Eigendynamik und Selbstorganisation kollektiver Gewalt, Hamburg 2015, S. 63–102, hier S. 87.
11 Jack Katz, »Fourfold Tables v. Three Dimensional Realities«, in: Qualitative Sociology 29 (2006), 4, S. 557–563, hier S. 559.
12 Charles Tilly, Stories, Identities, and Political Change, Lanham 2002, S. 26.
13 Ebd., S. 39–41.
14 Tilly, »Getting It Together in Burgundy«, S. 495.
15 George Steinmetz, »Charles Tilly, German Historicism, and the Critical Realist Philosophy of Science«, in: The American Sociologist 41 (2010), 4, S. 312–336.
16 Davor liegen Jahre der Wanderschaft, nicht nur »im Niemandsland zwischen Geschichte und Soziologie«, wie er sein eigenes Arbeiten charakterisiert (Charles Tilly, »Clio and Minerva«, in: Hans-Ulrich Wehler (Hg.), Geschichte und Soziologie, Köln 1976, S. 97–131, hier S. 99), sondern auch von Stelle zu Stelle. Nachdem er in den 1950er Jahren an der Harvard University Soziologie studiert, wo er vielen Personen begegnet, die er später als seine Lehrer bezeichnen wird (darunter George C. Homans, Barrington Moore und Samuel Hutchison Beer), promoviert er 1958 mit einer Studie über die Gegenrevolution in der westfranzösischen Vendée 1793, die er in ihrem engen Zusammenhang mit zentralstaatlichen Verwaltungsreformen einige Jahre zuvor erörtert. Hoffnungen, dauerhaft in Harvard bleiben zu können, erfüllen sich nicht. Bis er in Michigan ankommt, arbeitet er als Tutor und Assistenzprofessor an der University of Delaware (bis 1962), nur als Gastprofessor in Harvard (bis 1965), wo er allerdings eine lebenslang währende Freundschaft mit Harrison White schließt, und schließlich als Professor für Soziologie an der University of Toronto (bis 1969) (Willfried Spohn, »Neue Historische Soziologie: Charles Tilly, Theda Skocpol, Michael Mann«, in: Dirk Kaesler (Hg.), Aktuelle Theorien der Soziologie, München 2005, S. 196–230, hier S. 198–200).
17 Nachdem das Komitee Staaten bisher zwar vergleichend, aber doch eher für sich und ohne Beziehungen zueinander betrachtet hatte sowie – eher empiriefern – mit einer fortschreitenden Modernisierung rechnete, fordert die Arbeitsgruppe unter der Leitung von Tilly dieses Denken nun grundlegend heraus. Der gemeinsame Aufsatzband The Formation of National States in Western Europe lenkt die Aufmerksamkeit stattdessen darauf, wie viele Staaten eigentlich zwischenzeitlich verschwanden und wie elementar gesellschaftliche Konflikte und zwischenstaatliche Kriege sind, um die europäische Geschichte zu verstehen. Das hatten Almond und seine Kollegen bis dato kaum auf dem Schirm; Charles Tilly (Hg.), The Formation of National States in Western Europe, Princeton 1975; ders., »The Long Run of European State Formation«, in: Publications de l’École Française de Rome 171 (1993), 1, S. 137–150, hier S. 138; Craig Calhoun, »A Voice We Will Miss«, Social Science Research Council, 2008, https://www.ssrc.org/pages/a-voice-we-will-miss/ [18. 10. 2020]).
18 Janet Gouldner, »Opening Remarks: Alvin Gouldner’s ›Theory and Society‹«, in: Theory and Society