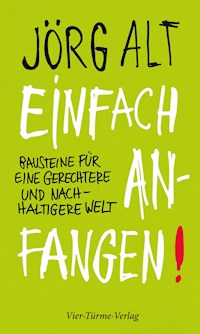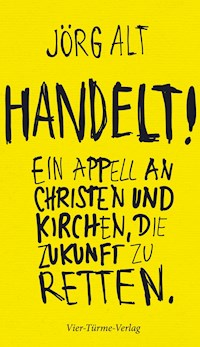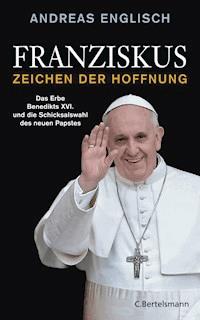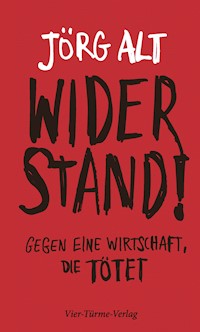
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vier-Türme-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
»Zunehmend dringlicher wird in unterschiedlichsten weltanschaulichen Gruppen der Zivilgesellschaft die Frage: Was ist zu tun, um ein "Weiter-So" zu stoppen? Um die Überlebensgrundlagen der Menschheit zu schützen und lebensdienlichere Praktiken zu fördern? Muss man verstärkt stören, wo das Wirtschaftssystem zerstört? Sand ins Getriebe streuen? Dem Rad in die Speichen greifen? Wenn ja, wie? Und mit welchen Mitteln?« Es wird viel über Klimaschutz gesprochen und zunehmende Wetterextreme machen spürbar deutlich, dass der Klimanotstand näher rückt. Gleichzeitig ist bekannt, was jetzt zu tun wäre, um diese Entwicklung zu verlangsamen oder gar aufzuhalten. Dennoch kommen Politik und Gesellschaft nicht in angemessenes Handeln. Teile der Klimagerechtigkeitsbewegung wollen mit Aktionen Zivilen Ungehorsams und Zivilen Widerstands auf diesen Missstand aufmerksam machen. Sind solche Aktionen gerechtfertigt? Auf diese und weitere brennend aktuelle Fragen sucht der Autor Jörg Alt, selbst engagiert im Bereich Umweltschutz und globaler sozialer Gerechtigkeit, in diesem Buch Antworten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jörg Alt
Widerstand!
Gegen eine Wirtschaft, die tötet
Vier-Türme-Verlag
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie. Detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Printausgabe
© Vier-Türme GmbH, Verlag, Münsterschwarzach 2022
ISBN 978-3-7365-0453-0
E-Book-Ausgabe
© Vier-Türme GmbH, Verlag, Münsterschwarzach 2022
ISBN 978-3-7365-xxxx-x
Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Erstellung: Dr. Matthias E. Gahr
Lektorat: Marlene Fritsch
Covergestaltung: Finken und Bumiller
www.vier-tuerme-verlag.de
1 Vorwort
Lange Jahre waren mir Artensterben, Klimawandel und anderes zwar irgendwie als Problem bekannt, aber ich hielt es nicht für dringlich. Ich erinnere mich noch gut an meine Reaktion auf die Kyoto-Verhandlungen 1997: »Kompliziertes Zeug – das überlasse ich den Experten.« Und auf den Fehlschlag von Kopenhagen 2009: »Naja, dann klappt es halt beim nächsten Mal!«
Erst Greta Thunberg und die Bewegung Fridays For Future, die mit der Schulpflicht brachen aus Sorge um ihre Zukunft, waren Anlass, mich näher mit diesen Problemen zu beschäftigen und beispielsweise verstehen zu wollen, was Klima-Kipppunkte sind. Erst recht schockierte mich dann die Bereitschaft von sechs jungen Menschen, vor der Bundestagswahl 2021 in einen unbefristeten Hungerstreik zu treten, um sicherzustellen, dass die drei KanzlerkandidatInnen neben Corona, Wirtschaftswachstum und der Schwarzen Null den Themen wie Klimawandel, Artensterben und den Sorgen der jungen Generation eine gleich große öffentliche Beachtung schenken.
Zunehmend wächst meine Wut. Ich frage mich: Wie konnte es so weit kommen, dass junge Menschen mit ihrer Bereitschaft, sich zu Tode zu hungern, darauf aufmerksam machen müssen, dass der Klimawandel schon jetzt abseits der Kameras Hungertote fordert? Zugleich wachsen meine Liebe und Bewunderung für all jene, die seit Jahren alles riskieren, um die Gesellschaft aufzurütteln – ihr Studium, gute Noten, ihre Karriere, ein einwandfreies Führungszeugnis, ihren guten Ruf ...
Wie sehr man sich bislang auch bemühte: Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mögen inzwischen die Sprache der Fridays For Future sprechen, aber der Graben zwischen Reden und Handeln ist nach wie vor groß und weit. Das belegen »Klimapäckchen« nationaler Regierungen, unzureichende Ergebnisse der Glasgower Klimakonferenz und die Diskrepanz zwischen Absichtsbeteuerung und präzisen Festlegungen im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Wenn jedoch Wirtschaft, Gesellschaft und Politik das Unvermeidliche und Erforderliche immer noch verdrängen oder nicht einsehen wollen oder können? Oder eine Notlage keine Zeit mehr für herkömmlich-bewährte Methoden lässt? Was bleibt dann an Möglichkeiten? Dieses Buch beschäftigt sich daher mit Zivilem Ungehorsam und Zivilem Widerstand.
Bevor es losgeht, wie üblich einige wichtige Vorbemerkungen:
– Anders als in früheren Büchern kann ich mich dieses Mal kaum auf Literatur stützen, die auf ausreichend belegten Forschungsergebnissen basiert. Weil es um Prozesse geht, die jetzt gerade im Gang sind, ist auch die Reflexion darauf ein laufender Prozess.
– Dabei referiere ich Diskussionen, an denen ich teils beteiligt bin, die ich teils nur zur Kenntnis nehme. Wichtig ist es mir aber, mit diesem Buch eine konstruktive Diskussion von Motivation und Mitteln anzustoßen und darüber im Gespräch mit Akteuren und Verantwortlichen zu bleiben.
– Um der Kürze sowie besserer Lesbarkeit willen verzichte ich auf konsequentes Gendern.
– Mein Schwerpunkt liegt auf der katholischen Tradition, da ich die protestantische nicht gut genug kenne.
– Ich danke den 21 Test- und GegenleserInnen. Deren Rückmeldungen haben sehr zur Lesbarkeit dieses Buchs beigetragen. Vergelt’s Gott!
– Sicher werden Sie an vielen Stellen sagen: »Dazu bräuchte es einen Beleg« oder »Dazu würde ich gerne mehr lesen«. Hierfür biete ich eine nach (Unter-)Kapiteln angelegte, ausführliche Bibliografie online an unter https://tinyurl.com/LiteraturWiderstand
– Aktuelles findet Berücksichtigung bis zur Abgabe des Manuskripts am 1. Juni 2022.
2 Einführung
»Handelt!«, der erste Band meiner Themenreihe zur sozial-ökologischen Transformation, richtete sich in erster Linie an Christen und Kirchen. Dies ist in Zeiten, da wir es nicht länger mit Einzelkrisen, sondern einer systemischen Krise zu tun haben, deshalb von Bedeutung, weil jedes kritisierte System aus Sicht der in sozialen Bewegungen Aktiven auf sechs »Säulen der Unterstützung« ruht, die es stabilisieren: Regierung, Medien, Sicherheitskräfte, Wirtschaft/Gewerkschaften, (Hoch-)Schulen sowie Kirchen und Glaubensgemeinschaften. Letztere deswegen, weil hier grund-legende Werte, die eine Gesellschaft prägen, bewahrt und weitergegeben werden und deshalb deren Organisation und systemische Struktur beeinflussen. Daraus folgt: Wollen wir systemische Missstände beseitigen, gilt es, Menschen, die diesen »Säulen« zuzurechnen sind, dafür zu gewinnen, sich von der Unterstützung des Bestehenden abzuwenden und stattdessen Veränderung mitzutragen. Hinsichtlich Kirche und Religion bedeutet dies, dass es wünschenswert wäre, wenn sich Gläubige für eine »moralische Revolution« bei den gesellschaftlichen Leitwerten engagieren würden und so dabei helfen, bisherige Leitwerte zu ächten und durch neue Leitwerte zu ersetzen. Konkret: Wollen wir nach jahrzehntelanger Dominanz des Neoliberalismus ein sozial gerechteres und ökologisch nachhaltigeres System installieren, dann sind auch Kirchen und Glaubensgemeinschaften gefordert, insbesondere wenn sie Instrumente wie die Katholische Soziallehre besitzen.
Im zweiten Band meiner Themenreihe, »Einfach anfangen!«, legte ich dar, was genau am bisherigen System das Überleben der Menschheit gefährdet, warum es sich so hartnäckig und erfolgreich hält und wie wir uns davon schrittweise befreien können. Wir haben alle nötigen Mittel und Möglichkeiten, so meine These, um das Ruder noch herumreißen zu können – wir müssen es nur endlich tun. Und das führt zur Notwendigkeit des hier vorgelegten Buchs.
Denn obwohl wir alle wissen, was das Problem ist, obwohl wir alle wissen, was getan werden müsste und könnte, geschieht einfach nicht genug und nicht im erforderlichen Tempo. Die jungen Menschen bei Fridays For Future gingen auf die Straßen und verweigerten den Schulunterricht. Dabei wurden sie unterstützt von Scientists For Future, einem Zusammenschluss von fast 30.000 Wissenschaftlern in den deutschsprachigen Ländern. Es kam zu Demonstrationen, Petitionen, Meetings, Absichtserklärungen und Versprechen. Faktisch ist daraus ein »Klimapäckchen« geworden, welches das Bundesverfassungsgericht umgehend in der Luft zerriss und an die Bundesregierung zurücküberwies, deren Nachbesserungsvorschläge aber ebenfalls die Note »ungenügend« verdienten. Auch die 26. Weltklimakonferenz in Glasgow änderte wenig daran, dass die Welt weiterhin auf Kurs zu einer drei Grad Celsius höheren Durchschnittstemperatur ist. Und so weiter und so fort.
»Was«, so fragen junge Menschen und ihre Unterstützer heute, »müssen wir noch tun, dass man unsere Sorgen endlich ernst nimmt und ins angemessene Handeln kommt?« Dabei berufen sie sich auch auf Papst Franziskus und seinen bekannten Ausspruch:
Wie das Gebot »du sollst nicht töten« eine deutliche Grenze setzt, um den Wert des menschlichen Lebens zu sichern, müssen wir heute ein »Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität der Einkommen« sagen. Diese Wirtschaft tötet. (Evangelii Gaudium 2013, Nr. 53)
Aber Evangelii Gaudium ist in seiner Deutlichkeit keine Ausnahme. An anderer Stelle führt Franziskus aus: Diese Wirtschaft führt dazu, dass wir »mitten im Dritten Weltkrieg (stecken), allerdings in einem Krieg auf Raten«. Dabei wird Gewalt »›stückweise‹ auf unterschiedliche Arten und verschiedenen Ebenen ausgeübt (und verursacht) unermessliche Leiden, um die wir sehr wohl wissen: Kriege in verschiedenen Ländern ...; Formen von Missbrauch; Zerstörung der Umwelt« (Papst Franziskus, 2014 u. 2017).
Zunehmend dringlicher wird in unterschiedlichsten weltanschaulichen Gruppen der Zivilgesellschaft die Frage: Was ist zu tun, um ein »Weiter-So« zu stoppen? Um die Überlebensgrundlagen der Menschheit zu schützen und lebensdienlichere Praktiken zu fördern? Muss man verstärkt stören, wo das Wirtschaftssystem zerstört? Sand ins Getriebe streuen? Dem Rad in die Speichen greifen? Wenn ja, wie? Und mit welchen Mitteln?
Aus der Geschichte der Menschheit lernen wir, dass ein Umsteuern bei vielen Problemen stets mit kleinen Gruppen entschlossener Menschen begann, die sich mit dem Status Quo nicht mehr abzufinden bereit waren und dazu übergingen, Gesetzen den Gehorsam zu verweigern und ungerechten Gesellschaftsordnungen Widerstand entgegenzusetzen. Sie brachen soziale Konventionen, Traditionen und Gesetze im Namen von und Bezug auf vermeintlich oder tatsächlich höhere Wertnormen und scheuten den Konflikt mit der Mehrheitsgesellschaft nicht. Diese Menschen protestierten teils gewalttätig, teils gewaltfrei, teils in Mischformen. Sind diese Proteste anhaltend, können Mehrheitsgesellschaft und Machthaber sie irgendwann nicht mehr ignorieren und müssen sich dazu verhalten. Mal geschah dies, indem man den Protest zum Schweigen brachte, manchmal aber auch, indem man das Anliegen ernst nahm und Abhilfe schaffte. Leider geschah Letzteres allzu oft erst, nachdem die Realitäten nicht mehr zu leugnen waren und diese das System stärker bedrohten als der Protest.
Wir beobachten in unserer Zeit die beginnende Zerstörung unterschiedlichster, komplexer und miteinander vernetzter ökologischer, ökonomischer und sozialer Teilsysteme, ein drohender Kollaps der menschlichen Zivilisation wird uns von der Wissenschaft vorhergesagt. Zugleich klammern sich allzu viele an ihre Besitzstände und hoffen, dass alles nicht so schlimm werden wird, dass es nicht so schnell kommt, dass es nicht hier kommt, dass es ohne Verzicht gehen wird – was von den Profiteuren des »Weiter-So und Mehr-Davon« aktiv gefördert wird. All dies rechtfertigt meiner Meinung nach das Nachdenken über und das Praktizieren von Zivilem Ungehorsam und Zivilem Widerstand, zumal in jenen Ländern, die am Zustandekommen der herrschenden Probleme meistverantwortlich sind, am meisten profitieren, unter den Folgen am wenigsten leiden und zudem nach dem Prinzip der Leistungsfähigkeit die meisten Mittel haben, um umsteuern zu können.
Zuvor gilt es aber zu erklären, was ich unter »Gewalt«, und deshalb unter der Gewalttätigkeit unseres (Wirtschafts-)Systems verstehe.
3 Gewalt
Ich wähle eine soziologische Gewaltdefinition, denn diese folgt einer umfassenderen Sicht auf die Dinge als die einzelner Berufsgruppen wie etwa Juristen. Eine solche zitiert das auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung eingestellte Politiklexikon wie folgt:
Gewalt bedeutet den Einsatz physischer oder psychischer Mittel, um einer anderen Person gegen ihren Willen a) Schaden zuzufügen, b) sie dem eigenen Willen zu unterwerfen [...] oder c) der solchermaßen ausgeübten Gewalt durch Gegengewalt zu begegnen (Schubert & Klein).
Ein ganz zentraler Punkt: Von Gewalt spricht man, wenn Menschen betroffen sind – insofern gibt es auch keine »Gewalt gegen Sachen« sondern »Sachbeschädigung« – dazu mehr in 7.3. Es gilt sodann zu beachten, dass es sich dabei nicht immer um physische Gewalt handelt, sondern um vielfältigste Formen von Druck, auf den Menschen mit vielfältigsten Gegenmitteln reagieren, um ihm standzuhalten, auszuweichen oder eben Widerstand zu leisten.
Auf den ersten Blick ist dies ein enger Gewaltbegriff, da er nur das Handeln von Personen gegen Personen zu betreffen scheint. Er wäre also passend, wenn wir im »Weltkrieg auf Raten« die kriegführenden Parteien tatsächlich kennen. Das aber ist möglich, denn wenn man genauer hinschaut, sind viele der ca. 250 zwischen- oder innerstaatlichen Kriege und Konflikte, die es seit Ende des Zweiten Weltkriegs weltweit gab und gibt, sogenannte »Stellvertreterkriege«, in denen Großmächte direkt (mit Soldaten) oder indirekt (durch Waffenlieferungen) beteiligt sind.
Gewalt kann aber auch strukturelle und kulturelle Ursachen haben, wie durch die Publikationen des Friedensforschers Johan Galtung bekannt wurde. Er erläuterte die Notwendigkeit, den Gewaltbegriff auszuweiten, wie folgt: Wenn ein einzelner Mann seine Frau schlägt, übt er direkte personale Gewalt aus. Wenn aber 1.000 Männer ganz normal und ungestraft ihre Frauen schlagen können, deutet dies auf diskriminierende Strukturen und kulturelle Normen hin. Ähnliches gilt für größere Kontexte: Wenn etwa die Lebenserwartung im globalen Norden ganz selbstverständlich doppelt so hoch ist wie an anderen Orten auf der Welt, dann ist der Grund für diese Tatsache ebenfalls in struktureller Gewalt zu suchen (Galtung, 1969, S. 171). Schaut man auf diesem Hintergrund nochmals auf die Welt, werden weitere Belege dafür schnell deutlich. Etwa dort, wo es um strategische Kontrolle von globalen Handelswegen geht (Somalia, Jemen) oder um die Sicherung von Rohstoffen wie Öl, Erze oder Mineralien – Ressourcen also, die das Wirtschaftssystem am Laufen halten. Auch der russische Angriff auf die Ukraine wäre nicht ohne jene Gelder möglich gewesen, die eine auf fossile Treibstoffe angewiesene Weltwirtschaft an Russland zahlt. Schlagartig wurde deutlich, wie schnell wirtschaftliche Gegenabhängigkeiten einen Atomkrieg plötzlich zu einer realen Möglichkeit werden lassen und auch anderswo auf der Welt menschenrechtsverachtende und Terror finanzierende Autokratien am Leben halten.
Strukturelle und kulturelle Ungerechtigkeit sowie Gewalt sind ebenfalls Themen der Theologie, etwa der Theologie der Befreiung oder der Katholischen Soziallehre. Das Zweite Vatikanische Konzil betrachtet in Nr. 25 der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes mit Sorge die »gegenseitigen Verflechtungen und Abhängigkeiten«, aus denen »objektive Verhältnisse« entstehen, die Menschen »vom Tun des Guten abhalten und zum Bösen« antreiben. Am Beispiel: Unter neoliberalen Einflüssen wurden Kapital und Märkte einst durch politische Entscheidungen dereguliert. Aus der Fülle von einzelnen Entscheidungen haben sich vorher nicht vorhandene, systemische Strukturen gebildet, die wiederum auf ihre Schöpfer zurückwirken und auf diese Zwang ausüben: Staaten müssen vor Steuerwettbewerb und angedrohtem Kapitalabzug zittern und selbst mächtige Banker sind nur noch eingeschränkt handlungsfähig. Einer gestand mir einst: »Natürlich würde ich gerne eine andere Politik mit meinem Institut fahren – wenn ich das aber tue, bestrafen mich das Kapital und die Märkte.« Dies zeigt: Strukturell-systemische Gewalt löst sich irgendwann von den persönlichen Verursachungen los und wird zu einer eigenständigen Gewaltquelle. Struktur erzeugt dann auch keine Gewalt, sondern Struktur ist dann Gewalt – und niemand kann wählen, ihr ausgesetzt zu sein oder nicht. Ist es damit, in den Worten von Papst Franziskus, endgültig zu einer »Diktatur der gesichtslosen Wirtschaft« gekommen (Papst Franziskus, 2013a)?
Dem würden Befreiungstheologen widersprechen, etwa Ignacio Ellacuría, ein Jesuit und Universitätsprofessor, der aufgrund seiner Sicht der Dinge und seiner Überzeugungen 1989 ermordet wurde. Seiner Meinung nach sind es »die für diese Strukturen Verantwortlichen, die Gewalt anwenden« (Maier, 1992). In der Tat: Es ist bekannt, welche 100 Konzerne für 72 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind (Carbon Disclosure Project, 2017). Oder welche »Superreichen« mit ihren Jets und Jachten einen besonders unverhältnismäßigen Anteil an der weltweiten Umweltverschmutzung haben: Die Top 10 Prozent der reichsten Menschen verursachen 35 bis 45 Prozent der weltweiten Emissionen – zehnmal so viel wie das ärmste zehn Prozent (IPCC 2022b, S. 9). Es ist bekannt, welche Eliten sich am Verkauf von fossilen Brennstoffen bereichern und dadurch in die Lage versetzt werden, ihre Völker zu unterdrücken und Terror zu finanzieren: Russland, Saudi-Arabien, Katar, Iran ... All dies belegt den von Papst Franziskus in Laudato Si angesprochenen Punkt: »Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt und eine der Gesellschaft, sondern eine einzige und komplexe sozio-ökologische Krise« (Nr. 139).
4 Diese Wirtschaft tötet
Drei Beispiele, warum der Papst mit seiner Aussage über die herrschende Wirtschaft Recht hat: Er beklagt in seinem obigen Zitat den Zusammenhang zwischen Waffenproduktion, Waffenexport und den Folgen wie Krieg und Vertreibung. Hierzu gäbe es viele Belege anzuführen, einer aus Deutschland mag dazu genügen. Zwar gibt es in Deutschland Waffenexportkontrollen, die verhindern sollen, dass deutsche Waffen ihren Weg in die Konfliktgebiete dieser Welt finden. Diese Regeln und erst recht die entsprechenden Kontrollen sind allerdings löchrig und leicht zu umgehen. Im März 2021 urteilte etwa der Bundesgerichtshof höchstrichterlich, dass der Export von über 4.000 Schusswaffen des deutschen Waffenherstellers Heckler & Koch mithilfe erschlichener Ausfuhrgenehmigungen nach Mexiko illegal war.
Sodann gibt es empirisch gut belegte Zusammenhänge zwischen bestimmten Formen der Umweltverschmutzung und vorzeitigen Todesfällen. Durch Feinstaub, der durch fossile Verbrennung entsteht, sterben beispielsweise jährlich mehr als 10 Millionen Menschen früher, als sie müssten (Vohra, Vodonos, & al., 2021).
Schließlich seien die Folgen des Klimawandels genannt, an dessen menschlicher Mitverursachung in der seriösen Wissenschaft keine Zweifel mehr bestehen: Der im Vorfeld der Pariser Klimakonferenz vorgestellte UN Report »The Human Cost of Weather Related Disasters« (UNISDR, 2015) stellt fest, dass in den Jahren 1995 bis 2015 90 Prozent aller Katastrophen weltweit wetterbedingt waren: Fluten, Dürren, Stürme ... Auch wenn es keinen genauen Prozentsatz dafür gibt, wie hoch der Beitrag des Klimawandels dazu ist, so kann man »beinahe sicher sein« (»almost certain«), dass es in den vor uns liegenden Jahrzehnten zu einer zahlenmäßigen und qualitativen Zunahme solcher Ereignisse kommen wird.