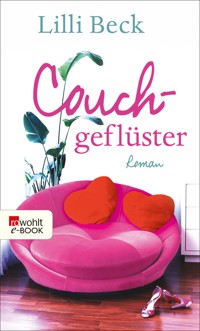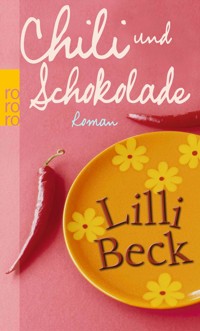9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Halt dein Gesicht in den Regen, jeder Tropfen ist ein Kuss von mir ...«
München, April 1945. Nach einem verheerenden Fliegerangriff irrt der elfjährige Paul mit einem Koffer durch Trümmer und Verwüstung. Auf der Suche nach einem Versteck trifft er ein kleines Mädchen. Sie heißt Sarah, hat wie er ihre Familie verloren – und sieht seiner Schwester verblüffend ähnlich. Um nicht allein zu bleiben und von den Behörden nicht getrennt zu werden, schließen Paul und Sarah einen Pakt: Von nun an werden sie sich als Geschwister ausgeben. Ihr Plan geht auf. Doch wie hätten sie ahnen können, dass ihre Notlüge Jahre später ihr Verhängnis werden würde …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
München, April 1945. Nach einem verheerenden Fliegerangriff irrt der elfjährige Paul mit einem Koffer durch die Trümmerlandschaft. Auf der Suche nach einem Versteck trifft er auf ein kleines Mädchen. Sie heißt Sarah, hat wie er ihre Familie verloren – und sieht Pauls Schwester verblüffend ähnlich. Um in der verwüsteten Stadt nicht allein zu sein und von den Behörden nicht getrennt zu werden, schließen Paul und Sarah einen Pakt: Von nun an werden sie sich als Geschwister ausgeben. Ihr Plan geht auf. Doch wie hätten sie ahnen können, dass Jahre später ihre Notlüge ihr Verhängnis werden würde – und dass sie sich würden verstecken müssen, um sich lieben zu dürfen …
Autorin
Lilli Beck wurde in Weiden/Oberpfalz geboren. Nach der Schulzeit begann sie in einer Autowerkstatt eine Ausbildung zur Großhandelskauffrau. 1968 zog sie nach München, wo sie von einer Modelagentin in der damaligen In-Disko Blow up entdeckt wurde. Erste Fotos in Paris. Anschließend arbeitete sie zehn Jahre lang für Zeitschriften wie Brigitte, Burda-Moden und TWEN. Sie war Pirelli-Kühlerfigur und Covergirl auf der LP Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz von Marius Müller-Westernhagen. Nach der Geburt ihrer Tochter wechselte sie hinter die Kamera als Visagistin. Zwischendurch absolvierte sie ein Schauspielstudium, war Cutter-Assistentin, bekam erste TV- und Filmrollen und begann zu schreiben. Lilli Beck lebt in München.
Ebenfalls von Lilli Beck bei Blanvalet erschienen:
Glück und GlasMehr als tausend Worte
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.instagram.com/blanvalet.verlag
Lilli Beck
Wie der
Wind und
das Meer
Roman
Dieses Buch erhebt keinen Faktizitätsanspruch, obwohl reale Fakten und Unternehmen erwähnt werden. Die beschriebenen Personen, Begebenheiten, Gedanken und Dialoge sind fiktiv.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de Umschlagmotiv: Keystone-France/Hulton Archive/Getty Images
ED · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-18916-7V005www.blanvalet-verlag.de
Eine Lüge ist manchmal die bessere Wahrheit.
1
Mittwoch, 25. April 1945
Paul duckte sich instinktiv, als er die zischenden Pfeiftöne hörte, die wieder fallende Bomben ankündigten. Gleich darauf folgte das donnernde Geräusch der Einschläge. Sekunden später das Krachen der Explosionen, begleitet vom Klirren zerberstender Fensterscheiben und dem nachfolgenden Einstürzen der Häuser. Verängstigt presste er die Handflächen auf die Ohren und öffnete gleichzeitig den Mund, wie es alle taten. Ständig wurde gewarnt, dass durch die Wucht des Einschlags schwere Lungenschäden möglich seien, und es hieß, dass man so die mächtigen Druckwellen ausgleichen könne.
Kellerwände vibrierten. Einmachgläser zersprangen. Putz bröselte von den Wänden. Dichte Staubwolken verdunkelten das ohnehin schwache Licht der Petroleumlampen. Jeder der Anwesenden tauchte hastig sein Taschentuch in einen der bereitstehenden Wassereimer und hielt es sich vor Mund und Nase, um nicht am dichten Mauerstaub zu ersticken.
Kurz drauf verebbten die Geräusche. Stille trat ein. Niemand sprach über die ausgestandenen Todesängste. Über die Furcht, verschüttet zu werden. Jämmerlich zu ertrinken, wenn ein Wasserrohrbruch den Keller überflutete. Oder sich wie eines der kleinen Kinder eingenässt zu haben. Viele beteten für das Ende des Krieges. Manche fürs Überleben. Andere für den Einmarsch der Alliierten. Nur verblendete Fanatiker glaubten noch an den Endsieg, den die Volksempfänger verkündeten.
Erneut ertönten die zwei gefürchteten Heulperioden der Sirenen von je acht Sekunden. Paul wusste sehr genau, was sie bedeuteten: akute Luftgefahr! Tiefflieger. Wer sich jetzt noch draußen aufhielt, sollte tunlichst in die Sicherheit der öffentlichen Bunker fliehen. Doch wer zu spät kam, fand keinen Einlass mehr. Manche suchten in ihrer Not Deckung in den noch unbeschädigten Häusern. Wie eine Nachbarin, die letzte Woche vom Hamstern zurückkam und es nicht mehr rechtzeitig in den Keller geschafft hatte. Nach der Entwarnung fand man sie zwischen den Trümmern, den Rucksack noch im Tod umklammernd.
Pauls Stiefmutter ordnete das lange dunkle Haar ihrer zitternden Tochter Rosalie, versuchte ihr Zöpfe zu flechten, um Normalität vorzutäuschen. Andere Hausbewohner lenkten Rosalie mit allerlei Fragen ab.
»Wie heißt deine Puppe?«
»Hat sie ein eigenes Bettchen?«
»Oder schläft sie bei dir?«
Rosalie antwortete nicht, sie hatte schreckliche Angst. Genau wie ihre tapfere Mutter, ihr Bruder Paul, Onkel Fritz, Tante Tilli und die anderen Bewohner des Schwabinger Gebäudes an der Danziger Freiheit.
Die Bombardierungen dauerten nun schon viele Stunden an, und die Sirenen heulten beinahe ohne Unterlass. Wie so oft in den letzten Tagen waren sie um Mitternacht aus dem Schlaf gerissen worden – sie schliefen ohnehin nur noch in Kleidern –, hatten sich die bereitstehenden Koffer und Körbe gegriffen, die Mäntel übergeworfen und waren in die Schutzkeller gehastet. Hier harrten sie nun auf unbequemen Holzbänken und Küchenstühlen aus. Die Erwachsen bezwangen ihre Furcht mit launigen Unterhaltungen oder stellten sich auf einer der wenigen verstaubten Matratzen schlafend. Niemand traute sich zwischen den einzelnen Alarmen nach oben. Nicht einmal, um die Notdurft zu verrichten. Wer es gar nicht mehr aushielt, musste den Kübel benutzen, der in einer entfernten Ecke stand.
»Keine Angst, kleine Rosie«, tröstete Tante Tilli mit aufgesetzter Fröhlichkeit. »Unser Haus ist nicht in Gefahr. Die werfen ihre vermaledeiten Bomben nur auf ganz besondere Gebäude. Solche wie den Bahnhof, auf Kirchen und sogar auf Krankenhäuser. Außerdem bist du ein Glückskind, wo du doch die schreckliche Flucht aus Pommern bis nach München überstanden hast. So ein paar Bomben können dir nichts anhaben.« Sie selbst stülpte sich bei jeder anrauschenden Bombe den großen Kartoffeltopf über den Kopf, als könne der sie vor dem Tod retten.
»Amen«, sagte Onkel Fritz, der Mann von Tante Tilli, der zum Luftschutzwart der Hausgemeinschaft und zum Hüter der Notfallapotheke bestimmt worden war. Er überprüfte auch regelmäßig, ob im Falle eines Brandes genügend Sandsäcke vorhanden waren.
Paul wollte nichts von alldem hören. Er sehnte sich nach Hause. Nach dem elterlichen Gut in Pommern, den gelben Kornfeldern im Sommer, den kreischenden Möwen über der Ostsee. Vor allem wollte er nicht an die Flucht erinnert werden. An die Kälte, den Hunger und die ekligen Kleiderläuse, die das schreckliche Fleckfieber übertrugen, das seinen Vater und ihn während der Flucht gepackt hatte. Tagelang waren sie mit hohem Fieber auf dem Pferdekarren dahingedämmert. Im Fieberwahn hatte er von zu Hause geträumt. Von warmen Suppen, Kernseife und heißem Wasser, sauberen Nachthemden und seinem dicken Federbett ohne Läuse. Von den geliebten Großeltern, die auf der Flucht an Entkräftung gestorben waren. Im Traum war er im Meer geschwommen, hatte das salzige Wasser auf seinem Gesicht gespürt. Doch es waren die Tränen seiner Stiefmutter gewesen, die weinend über ihn gebeugt war. Sein einst so starker Vater hatte den Kriegstyphus nicht überlebt. Nur er war »dem Tod von der Schippe gesprungen«, wie es der Treckführer genannt hatte. Abgemagert und vollkommen entkräftet, waren er, seine kleine Stiefschwester Rosalie und die Stiefmutter in der bayerischen Hauptstadt angekommen. Dort waren sie von Onkel Fritz, einem Cousin seiner Stiefmutter, aufgenommen worden. Deren Wohnung war wie durch ein Wunder unversehrt. Sogar fließendes Wasser gab es noch.
»Es grenzt an Zauberei, dass uns bis jetzt noch keine einzige Bombe erwischt hat«, hatte der Onkel immer wieder gesagt. »Seit Kriegsbeginn wurden wir von sechsundvierzig Fliegerangriffen heimgesucht. Über siebentausend Brandstellen haben den Himmel über München lodern lassen. Ganze Straßenzüge sind in Trümmerfelder verwandelt worden.«
»Eine unbeschädigte Wohnung ist heutzutage wertvoller als ein frisch geschlachtetes Schwein«, hatte Tante Tilli lachend hinzugefügt. »Wenn ich nach der Entwarnung in die Badewanne steigen und mir den Kellerdreck abwaschen kann, singe ich fröhlich vor mich hin.«
Paul hörte der Tante gerne zu, wenn sie ganz laut das Lied vom Seemann schmetterte, den nichts erschüttern konnte. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern, keine Angst, keine Angst, Rosmarie … Gegen das ständige Loch in seinem Magen half jedoch kein noch so lustiger Gassenhauer.
Seine Stiefmutter hatte sich von ihrer massiv goldenen Halskette, einem wertvollen Hochzeitsgeschenk, getrennt, um Lebensmittel zu schachern. Onkel Fritz wusste, wohin sie gehen mussten. Entweder in die Bogenhauser Möhlstraße, zum Hauptbahnhof oder in diverse Wirtshäuser; überall waren Schwarzmärkte entstanden. Die Reichsmark war wertlos geworden, doch solange man etwas zum Tauschen besaß, gab es alles, wonach einen gelüstete.
»Es ist natürlich streng verboten«, hatte der Onkel erklärt »aber der Mensch muss essen, deshalb pfeifen wir auf Verbote.«
Am Gründonnerstag hatte er Onkel Fritz in ein Wirtshaus begleiten dürfen, um Eier für Ostern zu tauschen. Das Fest war auf den 1. April gefallen, ein echter Aprilscherz, wurde allgemein gelacht. Eier hatten sie keine ergattert, mangels Futter wollten die Hühner nicht mehr legen. Aber einmal hatten sie doch Glück. Ein echter Persianermantel von Tante Tilli hatte zwei Kilo Zucker, ein Kilo Bohnenkaffee und eine ganze Tafel Schokolade eingebracht.
Daran wollte Paul aber jetzt nicht denken. Dem nagenden Gefühl in seinem Bauch nach musste es lange nach Mittag sein, und die letzte Mahlzeit hatte er gestern Abend verspeist. Ein trockenes Stück Brot mit etwas Salz. Butter, Wurst oder gar einen richtigen Sonntagsbraten hatte er seit dem Verlassen des Gutshofs nicht mehr gesehen.
Zur Ablenkung starrte er auf den Wäschekorb, der neben Tante Tilli stand. Ihre zaundürre schwarze Katze kauerte darin mit angelegten Ohren. Ein Zeichen, dass sich die arme Mieze genauso fürchtete wie er. Vor dem letzten Bombeneinschlag hatte sie noch gemaunzt, seitdem aber keinen Mucks mehr von sich gegeben. Ob sie tot war?, überlegte Paul. Vielleicht verhungert, sie war schrecklich abgemagert, weil Tante Tilli kaum was zu fressen für sie hatte. Zum Mäusefangen war das Tier längst zu schwach, wobei Paul bezweifelte, dass auch nur eine einzige Maus die andauernden Bombardements überlebte.
Ob Menschen Mäuse essen konnten? Vielleicht gebraten? In der Not würde er es versuchen. Diese Viecher galten auf dem Gut nicht als Haustiere, denn sie übertrugen Krankheiten, und die Köchin hielt ständig zwei bis drei Katzen, um der Plage Herr zu werden.
Pauls Magen knurrte lautstark in die Stille hinein. Onkel Fritz schubste ihn kumpelhaft an.
»Wenn’s hart auf hart kommt, schlachten wir die Katze«, flüsterte er. »Schmeckt wie Kaninchen.«
Paul hielt sich die Ohren zu. Der Onkel liebte derbe Scherze. Er würde niemals ein Haustier essen. Niemals! Lieber würde er hungern. Er liebte Tiere. Alle Tiere, sogar Spinnen oder Schlangen. Hunde waren seine Lieblingstiere. Zum zehnten Geburtstag hatte er Flecki, einen kleinen struppigen Terrier, bekommen.
Paul verdrängte die Erinnerung an den lustigen Spielgefährten mit aller Macht, dennoch hörte er wieder den Gnadenschuss, den sein Vater kurz vor der Flucht abgegeben hatte. Immer und immer wieder gellte dieser grauenvolle Knall durch seinen Kopf. Er schluchzte auf, gleichzeitig schossen ihm die Tränen in die Augen, und Rotz tropfte ihm aus der Nase.
»Hör auf, dem Jungchen Angst zu …«, schimpfte Tante Tilli ihren Mann, wurde aber von einer erneuten Detonation unterbrochen, die heftiger war als alles zuvor.
Die Wände wackelten, als würden sie jeden Moment einstürzen. Steine fielen heraus. Das Regal mit den restlichen Einmachgläsern krachte in sich zusammen. Sauer eingelegte Gurken mischten sich mit süßer Erdbeermarmelade.
»Volltreffer!« Onkel Fritz sprang von der Holzbank auf. »Raus, raus, raus … alle schnell raus hier …«, brüllte er, so laut er konnte, um das Grollen der berstenden Mauern zu übertönen.
Koffer, Taschen und sonstige Bündel wurden zusammengerafft, alle hasteten dem Ausgang zu.
»Paul, nimm Rosalie an die Hand«, rief seine Stiefmutter ihm zu, während sie einen Rucksack schulterte und sich dann nach zwei Koffern bückte.
Paul ergriff zuerst den kleinen Lederkoffer. Darin befanden sich die Lebensmittelmarken, ein Taschenmesser, das seinem Vater gehört hatte, Ausweise, Geburtsurkunden und die Besitzurkunden für den Gutshof.
»Du bist der letzte männliche Nachkomme und Erbe unseres Familienstammsitzes. Eines Tages werden wir in die Heimat zurückkehren, und mit den Papieren kannst du deine Ansprüche belegen«, hatte sein Vater in seiner letzten Stunde zu ihm gesagt.
Paul legte sich Vaters Ledergürtel, der als Trageriemen durch den Griff gezogen war, über die Schulter. Mit der anderen Hand packte er Rosalie am Ärmel.
Doch sie schrie nach ihrer Mama und biss Paul in die Hand. Wütend ließ er sie los.
»Schneller … Leute … lauft … lauft … lauft …« Brüllend trieb Onkel Fritz die Menge zur Eile an, schnappte sich selbst den Katzenkorb und bugsierte Paul Richtung Ausgang.
Paul blickte über die Schulter nach Rosalie, die sich am Mantel ihrer Mutter festklammerte.
Mamakind, schoss es ihm durch den Sinn, während er den Dokumentenkoffer mit beiden Händen fest umklammerte. Gleich drauf wurde er von drängenden und schubsenden Menschen den schlauchartigen Keller entlang zum Ausgang geschoben.
»Scheißführer. Dem haben wir die Sauerei zu verdanken«, hörte er Tante Tilli noch fluchen.
Ein ohrenbetäubender Knall verschluckte Tillis Fluch. Wände stürzten polternd ein. Notlichter erloschen. Panikschreie gellten durch die Dunkelheit. Sekunden später verstummten sie.
Nur das krachende Poltern der einstürzenden Hauswände war noch zu hören.
2
Pauls Augen brannten wie damals im Fieber. Blinzelnd versuchte er sich zurechtzufinden. Riesige Flammen loderten aus den Bombenkratern, züngelten an Häusern hoch, fraßen sich durch die Stockwerke. Dachbalken fielen donnernd herab, schlugen durch Fußböden und zertrümmerten auf ihrem Weg nach unten auch noch die letzten brauchbaren Möbelstücke. Frei gesprengte Ofenrohre und Wasserleitungen ragten aus den Mauerresten wie mahnende Finger. Dazu ertönten die Klagen der Überlebenden, die Schreie der Verwundeten und der Mutlosen, die nach dem Tod riefen.
Paul nahm weder den süßlichen Phosphorgeruch noch den Untergang um sich herum wahr. Wo war seine Schwester, wo die Stiefmutter, wo Onkel und Tante? Hatten sie den Keller rechtzeitig verlassen können? Unter Tränen kniff er die Augen zusammen. Doch die dichten Staubwolken und der Rauch der zahlreichen Feuer ließen ihn nur die Umrisse hastender Gestalten erkennen, die orientierungslos aus dem Feuer flohen.
»Rosaliiie!«, schrie er in alle Richtungen. »Rosaliiie!«
Langsam sanken die Staubwolken nieder und umhüllten die traurige Trümmerlandschaft mit einem grauen Schleier. Gnädig erstickten sie die Flammen, um am Ende doch nur das schreckliche Ausmaß der Verwüstung zu offenbaren.
Wo sich vor wenigen Stunden noch vier- oder fünfstöckige Häuser aneinandergereiht hatten, ragten jetzt Ruinen in diesen grauenerregenden Apriltag. Manche Gebäude standen ohne Frontseite da, boten ungeschützte Einblicke in die Wohnungen. Bei einigen hatten nur die Brandmauern standgehalten. Andere wirkten wie mit einem scharfen Messer durchgeschnitten, umringt von einem gigantischen Steinhaufen. Völlig unversehrt war kein einziges Haus.
Inmitten der Steinwüste wurde Paul allein von der Angst um seine Familie beherrscht. Er spürte sein Herz rasen, sein Magen krampfte sich zusammen, und ihm war speiübel, obwohl er seit vielen Stunden nichts gegessen hatte.
Wo war der Schutzkeller? Er konnte den Zugang nicht ausmachen. Inzwischen war es Nacht, erhellt von Flammen, die ihn bis zur Blindheit blendeten. Wieder und wieder drehte er sich um die eigene Achse, brüllte voller Angst »Rooosaliiie … Rooosaliiie …« und ein verzweifeltes »Muttiii« – Schreie eines Kindes, das die Zerstörung wohl sah, sie aber nicht begreifen konnte. Eines Kindes, das den Anblick der herumliegenden Leichen verdrängte. Das sich mit aller Kraft gegen die Gewissheit wehrte, alles verloren zu haben.
Pauls Schreie aber blieben unbeantwortet. Verhallten mit denen der anderen Rufer, die nach Kindern, Eltern, Nachbarn suchten. Keiner kümmerte sich in den Sekunden des Untergangs um einen weinenden Elfjährigen, der sich in kindlicher Not an einen Koffer klammerte.
Da! Hatte sich dort nicht ein Steinhaufen bewegt? Paul zog die Nase hoch, wischte mit dem Mantelärmel seine Tränen ab und stolperte zwischen den Trümmern zu der Stelle. Ein dumpfes Gluckern war zu hören. Einen Atemzug später bahnte sich eine Wasserfontäne den Weg durch die Ziegelsteine und schoss senkrecht in die Höhe. Eine bislang unversehrte Wasserleitung war geplatzt.
Paul erschrak, wich instinktiv der zischenden Fontäne aus. Als er zwischen den Steinen einen Halbschuh erspähte, füllten sich seine Augen erneut mit Tränen. Seine Stiefmutter hatte solche Schuhe getragen. War es ihrer? Lebten sie und Rosalie noch? Womöglich unter den Trümmern? Schafften sie es nicht, sich allein zu befreien?
Verzweifelt blickte er sich nach einem Werkzeug um, nach irgendetwas, das sich zum Graben eignete. Endlich fand er eine Parkettdiele, wie sie auch in Tante Tillis Wohnzimmer gelegen hatte. Ein Ende war verkohlt, der Rest roch noch ganz schwach nach Bohnerwachs. Vielleicht war es aber auch Einbildung. Nur der Wunsch nach einem Zeichen, die Hoffnung, etwas Vertrautes zu finden. Etwas, das ihm Zuversicht gab.
Die Parkettdiele erwies sich als untauglich zum Graben. Zuerst brachen nur kleine Stücke ab, schließlich zersplitterte der klägliche Rest in Pauls Händen. Den Schiefer, der unter seine Haut gedrungen war, spürte er nicht. Der Wille, seine Familie zu finden, war stärker.
Entschlossen stellte er den Koffer neben sich ab und begann im Schein der Flammen mit bloßen Händen zu graben. Er ignorierte den Zuruf einer Frau, die ihn mit »Des hat doch keinen Sinn, Bub« zum Aufgeben bewegen wollte.
Lange Zeit warf er nur Mauersteine von einem Haufen auf den anderen. Dann fand er den Kartoffeltopf von Tante Tilli, und später lugte der Fuß einer Puppe aus den Trümmern hervor, Rosalies namenloser Stoffpuppe, von der Großmutter für sie genäht und aus der nun Sägespäne herausquollen. Aufgeregt ackerte er sich durch die Trümmer, noch eifriger jetzt, und erfrischte sich nur kurz mit dem Wasser der noch immer blubbernden Leitung. Er schuftete ohne Rücksicht auf die Glasscherben, an denen er sich die Hände zerschnitt, um doch nur Ziegel umzuschichten und endlich zu begreifen, dass er sie niemals finden würde. Dass sie für immer unter den Trümmern begraben waren. Dass er allein zurückgeblieben war.
Die Erkenntnis ließ ihn bewegungslos an Ort und Stelle verharren. Entkräftet saß er auf dem Koffer, mit der Puppe in seinen Armen, den eigenen Tod herbeisehnend. Ohne seine Familie gab es für ihn kein Überleben. Woher sollte er etwas zu essen bekommen? Der leere Topf würde ihm wenig nutzen. Wo sollte er unterkommen, wo schlafen oder sich waschen? Auch wenn er sich ums Waschen am wenigsten sorgte. Den nächsten Winter würde er sicher nicht überstehen.
Er war auf dem Land aufgewachsen, wusste alles über Ackerbau und Viehzucht und scheute keine Arbeit. Er konnte Kartoffelsorten benennen und am Wuchs der Apfelbäume erkennen, wann sie einen Schnitt nötig hatten, damit sie im nächsten Jahr wieder reichlich Früchte trugen. Er hatte ein Gespür für Pferde, konnte Kühe melken und den Rahm der Milch zu Butter schlagen. Er war fähig, mit einem Brennglas Stroh zu entflammen, aber auch mit Steinen Funken zu erzeugen und mit dürren Ästen ein Feuer zu entfachen. In der Heimat hätte er gewusst, wo Karotten, Kartoffeln und Zwiebeln für eine Suppe zu finden wären. Seine Großmutter hatte ihm sogar beigebracht, wie man Apfelstrudel zubereitete. Aber wie man ganz allein in einer fremden Großstadt überlebte, davon hatte er so viel Ahnung wie der Stier vom Tangotanzen. Die Erinnerung an den Lieblingsscherz seines Großvaters ließ ihn aufstöhnen. Nein, es war unmöglich, allein zu überleben. Warum nur stürzte keine Mauer auf ihn herab?
Doch der herbeigesehnte Tod ließ auf sich warten. Der Hunger nicht. Sein Magen knurrte mittlerweile so laut, dass es auch für andere zu hören gewesen wäre. Obwohl keine der herumirrenden Gestalten den verlassenen Jungen wahrnahm. Paul ahnte, dass er bald verhungern oder erfrieren würde, denn die Nächte waren im April noch empfindlich kalt.
»Warum nur hat mich das Fleckfieber nicht dahingerafft«, wimmerte er leise.
Schließlich siegte der Hunger über seine Mutlosigkeit. Vielleicht war es auch die spürbare Kälte. Nachdem die großen Feuer erloschen waren, kam ihm die Nachtluft noch kälter vor, und er fröstelte trotz des Wollmantels. Er träumte vom wärmenden Kachelofen in Pommern, der bis ins Frühjahr angeheizt worden war. Von den duftenden Bratäpfeln zu Weihnachten und von Flecki, der neben ihm auf der Ofenbank gelegen hatte. Sein Hals war wie zugeschnürt, als er mit einem Mal glaubte, ein flackerndes Licht zu sehen.
Lange Zeit starrte er darauf, bis ihm endlich klar wurde, dass es keine Einbildung war. Möglicherweise waren es dicke Dachbalken, die langsam verglommen. Die großen, durch Brandbomben entstandenen Feuer nagten noch lange als Glut an Möbeln, Parkettdielen und Türstöcken. Daran wollte er sich wärmen.
Paul verstaute die Stoffpuppe im Koffer, zog den Schulterriemen über den Kopf und taumelte mit dem Topf in der Hand über die Schutthügel durch die Finsternis. Auch die Straßenbeleuchtung war ein Opfer der Bomben geworden; der zunehmende Mond gab nur wenig Helligkeit ab, und so orientierte er sich an dem Licht in der Ferne.
An der Danziger Freiheit, Ecke Herzogstraße war das Flackern erloschen. Schemenhaft sah er den Milchladen offen stehen. Das Gitter, das Einbrecher abhalten sollte, war durch die Bomben zerfetzt worden, die Scheiben der Auslage zersplittert und die Ladentür aus den Angeln geflogen. Hier hatte er noch vor wenigen Tagen endlose Stunden mit der Blechkanne für Milch angestanden und doch nur ein wenig Magermilch erhalten. Ob sich im Laden etwas Essbares fand? Er zögerte, bevor er sich schließlich doch über die Trümmer ins Ladeninnere tastete.
Nach wenigen wackeligen Tritten bemerkte er, wie etwas an ihm vorbeihuschte. Eine Katze? Vielleicht die von Tante Tilli? Oder hatten Mäuse und Ratten doch überlebt? Was immer es auch gewesen war, es war zu dunkel, um es im Weglaufen zu erkennen.
Paul blieb stehen. Langsam gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit, und er vermochte die Umrisse der noch vorhandenen Gegenstände zu erkennen. Von der Ladentheke, unter der die großen Milchkannen deponiert waren, aus denen die Ladnerin mit einer Kelle Milch geschöpft hatte, war nur noch ein armseliges Häuflein Holz übrig.
»Wer ist da?«
Eine kratzige Stimme durchbrach die Stille.
»Paul …«
»Ich kenn keinen Paul. Verschwind …«
Paul nahm all seinen Mut zusammen. »Ich hab Hunger.«
»Wer nicht? Und jetzt hau ab, sonst kannst was erleben.«
»Bitte, ich weiß nicht wohin«, bettelte Paul.
Die Antwort war ein Stein, der durch die Nacht flog und Paul am Kopf traf. Er schwankte kurz, dann sackte er lautlos in sich zusammen. Aus der Sekunden dauernden Ohnmacht wurde er durch einen Fußtritt geweckt. Als Nächstes spürte er, wie jemand an dem Koffer zog, der unter ihm lag. Instinktiv strampelte er mit den Beinen und landete einen Treffer.
»Auuu … du kleiner Saukerl … das wirst du mir büßen …«
Paul war schnell wieder auf den Füßen.
Den Koffer fest umklammert, den Topf gerettet, stolperte er mehr, als dass er rannte, über den mit Mauerschutt bedeckten Boden ins Freie.
Das schmerzhafte Erlebnis hatte ihn erschöpft. Müde schleppte er sich über den Platz. Geduckt hinter einem Steinhaufen, verbrachte er den Rest der Nacht, auf dem Koffer sitzend, mit einer Hand einen Ziegelstein umklammert. Beim nächsten Mal wäre er vorbereitet.
3
Paul versuchte sich hochzurappeln, fiel vor Schwäche aber sofort wieder auf den Koffer. Mutlos blinzelte er durch die Ruinengerippe den ersten Sonnenstrahlen entgegen. Flüchtlinge auf der Suche nach Angehörigen zogen mit ihren Karren durch die Straßen. Im Morgengrauen kaum zu erkennende Gestalten kletterten zwischen den Trümmern umher. Mit bloßen Händen buddelten sie in den Steinbergen, wie er es gestern getan hatte. Zwei Männer schleppten einen leblosen Körper davon. Eine in Decken gehüllte Frau wiegte ein schreiendes Bündel. An ihrem Rockzipfel hing ein kleines Mädchen.
Paul dachte an Rosalies Puppe. Ob er sie dem Mädchen schenken sollte? Vielleicht bekam er von der Mutter dafür etwas zu essen. Tränen liefen über seine Wangen bei der Vorstellung, das letzte Andenken wegzugeben. Als er aufsah, war die Frau mit den Kindern verschwunden, die Chance vertan. Er packte den Koffer, legte den Gürtel um seine Schultern, griff nach Tillis Kartoffeltopf und stakste langsam über die Steinwüste, vorbei an der gebrochenen Wasserleitung, die noch leise blubberte.
Er blieb stehen, kniete nieder und schüttete sich kaltes Wasser ins Gesicht. Abrupt war er wach. Er trank einige gierige Schlucke, die ihm derart heftige Magenkrämpfe verursachten, dass er das Wasser vermischt mit Magensäure wieder hochwürgte. Sein Körper reagierte mit einem heftigen Schweißausbruch. Keuchend zog er den Mantel aus und kramte in seiner Hosentasche nach dem Taschentuch, um sich die Säure vom Mund wischen zu können.
Etwas war in das Tuch eingewickelt. Vorsichtig faltete er es auseinander. Ein Stück trockenes Brot.
Seine eiserne Ration!
Wie hatte er die nur vergessen können?
Gierig biss er ein großes Stück ab, um es gleich wieder in die Hand zu spucken. Nein. Er durfte es nicht verschlingen, als besäße er mehr als genug. Er musste sich beherrschen.
Tapfer wickelte er den Brotrest wieder in das Taschentuch. Das abgebissenene Stück teilte er in Krümel und kaute an jedem länger als an einer ganzen Scheibe.
Mit dem Brotrest in der Hosentasche machte er sich auf den Weg. Wo genau er entlanglief, war durch die allgegenwärtige Zerstörung nicht mehr zu erkennen. Unwichtig für ihn, es zählte allein, die Trümmerwüste nach Essbarem zu durchstreifen. Jemand transportierte einen Stapel Geschirr auf einem Leiterwagen. Eine Frau starrte weinend auf einen verkohlten Brotkorb in ihren Händen. Er fand nur Steine, manchmal auch Dachziegel oder zertrümmerte Möbelstücke. Und überall beobachtete er Menschen, die sich nach Parkettdielen oder Holzbalken bückten und sie auf den Schultern wegschafften.
Ob er etwas mitnehmen sollte, falls er etwas Brauchbares fände? Aber wie transportieren? Der Riemen des Koffers drückte bereits schwer auf seine mageren Schultern. Außerdem schleppte er Tillis Kartoffeltopf, und die Sonne schien mittlerweile so warm, dass er den Mantel unter dem Arm trug.
Ein leises Wimmern riss ihn aus seinen Gedanken. Er blieb stehen, versuchte zu orten, woher das Geräusch kam. Es klang wie ein Tier. Ein verletzter Hund? Von herabgefallenen Trümmern eingeklemmt? Zu schwach, um zu bellen?
Pauls Fantasie malte schreckliche, kaum zu ertragende Bilder. Jetzt hörte er es ganz deutlich. Es kam aus dem Haus zu seiner Linken. Die vordere Front war weggerissen, sodass es wie ein riesiges, halb zerstörtes Puppenhaus aussah.
Vorsichtig näherte er sich. Vor dem Erdgeschoss versperrte ein Trümmerberg die Sicht, dahinter musste das arme Tier liegen. Er umrundete das Hindernis – und blieb ungläubig stehen. Es war kein Tier, sondern ein kleines Mädchen. Es hatte ihm den Rücken zugewandt. Im ersten Moment glaubte er an eine Sinnestäuschung. Aber die zerzausten dunklen Locken waren unverkennbar.
Rosalie!
Paul kniff die Augen zusammen, um sicherzugehen, dass er nicht träumte. Doch als er sie wieder öffnete, saß das Mädchen unverändert da. So schnell es ihm über den angehäuften Schutt möglich war, rannte er zu ihm.
»Rosalie … Rosalie … Rosalie …«
Die Kleine reagierte, drehte sich um und sah ihn mit rot verweinten Augen an.
Paul erstarrte ungläubig. Musterte sie sekundenlang. Aber egal, wie eindringlich er sie auch ansah, sie war nicht seine Stiefschwester. Doch sie sah ihr unfassbar ähnlich. Das magere Gesicht, die dunklen Augen und der hübsche Mund. Einzig ihre graue Trachtenjacke über dem karierten Rock unterschied sich von Rosalies dunkelblauem Wollmantel.
Die Enttäuschung schmerzte so sehr, dass er am liebsten laut gebrüllt hätte. Er war endgültig allein, fühlte sich, als habe er seine Familie ein zweites Mal verloren. Entkräftet ließ er den Mantel fallen, setzte sich neben das Mädchen, und sosehr er auch gegen das Gefühl des Verlassenseins ankämpfte, er vermochte seine Tränen nicht zurückzuhalten.
Das fremde Mädchen sah ihn hilfesuchend an. »Ich finde meine Mutti nicht mehr … meinen Vati auch nicht …«
Was sollte er darauf antworten? »Hast du dich verlaufen?«, fragte er schließlich.
»Da war eine Bombe … die Mauer ist eingestürzt … und ich bin weggerannt … immer schneller …«
Paul fragte nicht weiter. Er wusste, was ihr Gestammel bedeutete. Lange Zeit blieb er nur weinend neben ihr sitzen und sprach kein Wort, so sehr schämte er sich seiner Tränen. Wie oft hatte sein Vater ihm gesagt, dass Männer nicht weinten und er, als letzter Mann der Familie Greve, tapfer sein müsse.
»Meine Familie ist auch gestorben …«, sagte er schließlich. »Ich wünsche mir …« Den Rest sprach er nicht aus. Er wollte das Mädchen nicht noch mehr ängstigen. Stattdessen begann er, von Pommern zu erzählen, von Flecki, den Pferden, Weihnachten mit den Großeltern und vom Gutshof. Von den Störchen, die ihre Nester auf den Dächern der Dörfer bauten, die ihre Jungen dann mit Fröschen fütterten, und wie er mit seiner Schwester im Meer um die Wette geschwommen war.
Sie hörte ihm ganz still zu, doch plötzlich fing sie wieder an zu weinen. »Ich hab … so Hunger …«, schluchzte sie.
Paul holte das Stück Brot, das er hatte aufheben wollen, aus seiner Hosentasche und gab es ihr.
Ungläubig starrte sie es an, dann auf Paul.
Er nickte schweigend. Auch wenn sein Magen unablässig knurrte, hatte er zu großes Mitleid mit dem Mädchen, das ihn so sehr an seine kleine Schwester erinnerte.
Sie nahm das Brot, biss ein kleines Stück ab und gab ihm den Rest zurück.
Paul brach für sich ein Stückchen ab, schob es sich in den Mund und wickelte den kläglichen Rest wieder in das Taschentuch. Die eiserne Ration schwand dahin. »Hast du keine Verwandten?«, fragte er.
Sie zuckte zusammen. Von ferne drang das Hupen eines Wagens zu ihnen. Verängstigt sprang sie auf und stolperte über die Trümmer davon, hinein in die Ruine.
Paul schnappte sich Koffer, Mantel und Topf, folgte ihr, holte sie ein und zog sie in eine Ecke, vor der aus sie die Straße nicht mehr sahen. »Was hast du?«
Erst als die Hupe verklang, flüsterte sie ihm zu: »Wenn mich die Nazis erwischen, stecken sie mich ins Gas.«
Paul war schockiert. »Welches Gas?«
Leise antwortete sie: »Weißt du nicht, dass Hitler alle Juden umbringen will? Und dann macht er Seife draus.«
»Aber du bist doch keine Jüdin, du trägst keinen Stern auf deiner Jacke«, wandte Paul ein.
»Mutti hat unsere Sterne abgerissen, als wir wegen der Fliegerangriffe aus unserem Versteck fliehen mussten«, sagte sie und begann von ihrer Mutter zu erzählen und von ihrem Vater. »Als noch kein Krieg war, haben beide am Theater gearbeitet. Meine Mutti ist eine bekannte Volksschauspielerin, und mein Vati ist Spielleiter. Ich durfte immer hinter der Bühne schlafen. Aber das weiß ich nicht mehr genau, weil ich noch zu klein war.«
»Und was ist dann passiert?«
»Als der Krieg angefangen hat, haben meine Eltern bald keine Arbeit mehr bekommen, wie alle Juden, und wir mussten uns vor den Nazis verstecken. Deshalb sind wir aufs Land gezogen, weg von München, wo Mutti noch auftreten konnte, weil sie so bekannt war und die Menschen sie geliebt haben. Aber dann hat ein neidischer Kollege unser Versteck verraten, und ein Freund von Vati hat uns hinter einem Kleiderschrank versteckt, sonst wären wir auch in ein Lager verschleppt worden.«
Wenige Meter entfernt war Donnergrollen zu hören. Einen Augenblick später krachte eine Hausruine mit lautem Getöse in sich zusammen.
Die Kleine fing wieder an zu weinen.
»Hab keine Angst«, tröstete Paul sie und legte einen Arm um ihre mageren Schultern. »Ich beschütze dich.«
Er wusste, dass er gegen Kanonen und Panzer wenig würde ausrichten könne, doch seit er nicht mehr allein war, fühlte er sich wieder stark.
»Vor den Nazis kann mich niemand beschützen«, schluchzte sie.
»Der Krieg ist bald vorbei, und dann kommen die Alliierten und stecken alle Nazis ins Gefängnis«, versicherte Paul. »Mein Onkel Fritz hat mir das genau erklärt.«
»Aber meine Mutti hat gesagt, ich darf niemandem verraten, dass ich Sarah heiße …«, stieß sie weinend hervor.
Paul überlegte. »Hast du denn Papiere mit deinem Namen?«
Sarah schüttelte den Kopf. »Ich hab nichts mehr. Gar nichts. Nur, was ich anhabe.«
Paul überlegte, wie er dem Mädchen helfen könnte. »Sag einfach, dass du meine Schwester bist und Rosalie heißt«, schlug er, einer Eingebung folgend, vor. »Mit Familiennamen heißen wir Greve. Ich bin der Paul. Wir sind die Geschwister Greve. Kannst du dir das merken?«
Sarah blickte ihn verständnislos an. »Nie im Leben können wir Geschwister sein.« Sie schubste ihn weg. »Du bist blond und hast blaue Augen. Ich habe dunkle Augen und fast schwarzes Haar.«
»Doch, du siehst genauso aus wie meine Schwester. Warte, ich zeig dir ein Foto.« Paul öffnete den Koffer und kramte einen Umschlag hervor. »Hier.« Er reichte ihr ein Schwarz-Weiß-Foto. »Das bin ich mit Rosalie, vor drei Jahren an der Ostsee. Ich hab dir doch erzählt, dass wir immer um die Wette geschwommen sind.«
Sarah blickte lange auf das Foto. »Aber warum bist du so blond, und warum hat sie so dunkle Locken?«
Geduldig erklärte Paul ihr, dass seine Mutter bei seiner Geburt gestorben war und sein Vater wieder geheiratet hatte. »Und mit seiner neuen Frau hat er dann ein Mädchen bekommen. Rosalie ist also meine Halbschwester, deshalb sah sie so anders aus. Ich habe sogar Papiere, die das beweisen. Wie alt bist du?«
»Im Juli werde ich zehn«, antwortete Sarah.
»Rosalie wäre Ende September neun Jahre alt geworden. Aber den Unterschied merkt keiner, du bist nämlich genauso klein wie Rosalie«, sagte er.
Sarah war nicht überzeugt, doch Paul ließ sich nicht beirren. Er wollte nicht allein sein. »Das Foto ist ein guter Beweis, dass wir Geschwister sind. Und wir haben jetzt ein Familiengeheimnis. Das ist etwas ganz Besonderes.«
»Wirklich?«
Paul legte ihr Rosalies Puppe in die Arme. »Wirklich«, wiederholte er. »Unsere Familie hat sogar einen Wahlspruch: Wir gehören zusammen wie der Wind und das Meer. Zusammen sind wir stark, zusammen kann uns nichts geschehen.«
»Wie der Wind und das Meer?«, wiederholte Rosalie.
Paul nickte bekräftigend. »Warst du schon einmal am Meer?«
Rosalie überlegte einen Moment. »Ja, am bayerischen Meer.« Ein schwaches Lächeln umspielte ihren Mund.
»Hier gibt es ein Meer? Ja, wo soll das denn sein? Ich hab nur von den riesigen Bergen gehört.«
»Das sind die Alpen. Unser Meer liegt auf dem Weg dorthin und heißt Chiemsee.«
»Ein See ist aber kein Meer, auch wenn er noch so groß sein mag«, belehrte er sie.
»Aber der Chiemsee hat Ebbe und Flut, ganz genau so wie ein richtiges Meer«, beharrte sie.
»Na gut, Rosalie, du hast gewonnen«, lächelte Paul sie an.
Erstaunt blickte sie auf. »Du hast Rosalie zu mir gesagt.«
»Ja, das ist jetzt dein Name, daran musst du dich schnell gewöhnen«, sagte Paul. »Das üben wir gleich mal. Wie heißt du?«
»Sarah Silbermann …«
»Nein, Rosalie Greve«, verbesserte Paul.
Ihre dunklen Augen wurden feucht. »Ich kann nicht denken, weil ich so großen Hunger hab«, erwiderte sie.
Wortlos holte Paul den Rest Brot aus der Hosentasche, teilte ihn und reichte das größere Stück seiner neuen Schwester.
Dankbar blickte sie ihn an.
Der kleine Rest war schnell gegessen. Hatte den Hunger nicht bekämpft, stattdessen die geschwächten Körper daran erinnert, dass sie essen mussten, um zu leben.
Den letzten Krümel noch im Mund, erinnerte Paul sich an die Lebensmittelkarten. Doch mit Marken allein war wenig anzufangen, wenn man kein Geld hatte. Er besaß nicht eine Reichsmark, um auch nur einen Schluck Milch zu erstehen. Die Taschen seiner neuen Schwester waren ebenfalls leer. Ihre gesamte Habe trug sie am Leib.
Paul ließ sich nicht entmutigen. Das Gefühl, nicht mehr allein zu sein, das Mädchen als seine Schwester anzunehmen, verlieh ihm neue Kraft. »Wir stellen uns einfach bei einer Schlange an, vielleicht können wir die Zigarettenmarken von meinem Onkel eintauschen. Die sind nämlich auch in dem Koffer.«
Rosalie schaute ihn unsicher an. »Und wenn jemand fragt, wo unsere Eltern sind?«
»Dann behaupten wir einfach, die stehen in einer anderen Schlange für Brot an«, antwortete Paul.
»Und wenn niemand die Marken will?« Rosalie schien sich nicht so einfach überzeugen zu lassen.
Paul hatte sich aufgerappelt, legte sich den Tragegurt über die Schulter und griff nach dem Kochtopf. »Wir durchsuchen jetzt erst mal die Ruinen. Wirst sehen, wir finden was. Irgendwas finden wir bestimmt.«
Das Mädchen rührte sich nicht von der Stelle.
»Komm mit, Rosalie«, drängte Paul.
»Ich bin nicht deine Schwester!« Trotzig warf sie ihm die Puppe vor die Füße. »Ich heiße Sarah, merk dir das, und ich will zu meiner Mutti.«
Pauls ohnehin wackeliger Optimismus zerfiel wie eine von Sprengbomben getroffene Hausmauer. Nur mit letzter Kraft gelang es ihm, den Kloß in seinem Hals runterzuschlucken und sich die Worte seines Vaters ins Gedächtnis zu rufen: Männer weinen nicht.
»Vielleicht … finden wir deine Eltern. Vielleicht … suchen sie ja auch nach dir …«, sagte er zögernd, ohne wirklich daran zu glauben. Die Möglichkeit, Sarahs Eltern lebend wiederzusehen, erschien ihm geringer als die Chance auf ein warmes Essen.
Doch sein unüberlegtes Versprechen zeigte Wirkung. Die Kleine schien die Hoffnung noch nicht aufgegeben zu haben. Flugs war sie auf den Beinen, griff nach der Puppe und nahm Pauls Hand. »Los, komm … schnell.«
»Wo sind wir jetzt und wo war euer Versteck?«, fragte er, weil er nicht wusste, ob er sich in der Trümmerwüste verlaufen hatte. »Wir brauchen die Adresse, damit wir wissen, wo wir suchen müssen.«
Sarah zog an seiner Hand. »Wir sind in der Ludwigstraße, nicht weit entfernt vom Odeonsplatz, und unser Versteck war hier gleich um die Ecke … und jetzt komm endlich …«
»Ich kenne mich in der Stadt nicht so gut aus.«
»Aber ich«, unterbrach sie ihn. »Auch wenn wir uns drei Jahre lang verstecken mussten, in der Innenstadt finde ich mich gut zurecht.«
4
Sarah zog Paul hinter sich her wie ein störrisches Maultier. Er mochte sich mit dem Tod seiner Familie abfinden, sie aber würde nicht eher aufgeben, bis sie ihre Eltern gefunden hatte.
Langsam stakste sie über die Trümmer der Stadt, den Blick konzentriert auf die Steinberge gerichtet, um auch nicht den winzigsten Hinweis auf ihre Eltern zu übersehen. Ihr glühender Wunsch, sie zu finden, ließ Sarah alles um sie herum ausblenden. Die nahezu völlig zerstörte Altstadt. Menschen, die in Kellern oder in Ruinen hausten. Ausgemergelte Kriegsgefangene, die dazu verdammt waren, den Schutt wegzuräumen. Erschöpfte, zerlumpte Flüchtlinge, die ihre Bollerwagen laut ratternd um die Bombenkrater lenkten. Verletzte Soldaten auf Krücken, mit verbundenen Armen oder Köpfen, die um Zigaretten bettelten. Getrieben von der Sehnsucht nach Mutter und Vater, rannte sie zu jedem leblosen Körper, den sie in den Trümmern entdeckte. Betrachtete Tote nur kurz und gefühllos, als wären es Schaufensterpuppen.
»Das bedeutet, dass sie vielleicht noch leben«, tröstete Paul sie nach stundenlanger vergeblicher Suche. Es klang, als wolle er ihre Hoffnung nicht zerstören.
Erst ein dreimaliger Dauerton innerhalb einer Minute riss Sarah aus ihrer fieberhaften Aktion. Panisch schreckte sie auf, sah sich zitternd nach einem Schlupfwinkel um.
Paul blickte in den wolkenlosen Himmel. »Ungefährlich, nur ein Kleinalarm.«
»Woher weißt du das?«
»Das sind Mosquito-Jagdbomber«, erklärte Paul. »Mein Onkel Fritz hat mir genau erklärt, wenn die in zehntausend Meter Höhe fliegen, sind sie harmlos wie Schmeißfliegen.«
Sarahs Anspannung ließ etwas nach, und mit der Puppe in der Hand stolperte sie weiter durch die Trümmerlandschaft. Paul folgte ihr mit Koffer und Kochtopf. Er suchte nach Essbarem. Löwenzahnblätter oder Gänseblümchen, die sie gegen den quälenden Hunger kauen konnten. Sarah war nicht interessiert an Grünzeug, die Bombenfeuer hatten ohnehin alles verschmort. Überall ragten Äste verkohlter Bäume in den Himmel. Zahlreiche Sträucher waren bis zu den Wurzeln abgebrannt. Wie sollten zarte Pflänzchen solch ein Inferno überlebt haben?
Endlich erspähte sie zwischen den Steinen ein grobes Stück dunkelgrünen Stoff. So eine Jacke hatte ihre Mutter getragen.
»Paul!«, rief sie aufgeregt. Er stellte den Koffer ab und half ihr, den Schutt zur Seite zu räumen.
Sarahs hoffnungsvolle Aufregung wich tiefer Enttäuschung, als ein verdreckter Rucksack mit Ledereinfassungen und braunen Schulterriemen zum Vorschein kam.
»Vielleicht ist was Essbares drin.« Eilig öffnete Paul den Fund und förderte lediglich ein gelbes Buch zutage. Die Bären-Fibel, das erste Lesebuch für Schulkinder. Wütend schleuderte er es von sich.
Sarah holte es zurück, blätterte darin und begann zu singen. »In meinem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus, es sind darin fünf Stübchen, grad wie in einem Haus …«
Kurz lauschte Paul ihrer hellen, klaren Stimme, doch dann schrie er: »Hör auf … hör sofort auf! Wie kannst du nur singen, wenn dein Magen knurrt?«
Sarah blickte ihn mit großen Augen an. »Singen erinnert mich an meine Mutter …« Sie stockte. Tränen rannen über ihre Wangen. »Dann vergesse ich den Hunger.«
»Pfoten weg, das ist meiner!«
Die Hand eines mageren Kerls in schmuddeligen zerfetzten Kleidern versuchte nach dem Fundstück zu greifen. Paul reagierte schneller und zog den Rucksack weg.
Sarah duckte sich hinter Paul und schielte nach oben, zu dem fremden Jungen, der unvermutet neben ihnen aufgetaucht war. Auf seinem Kopf saß eine Schildmütze, unter der fettige blonde Haarsträhnen hervorlugten. Er war einen Kopf größer als Paul und schien auch um einige Jahre älter zu sein.
»Verschwinde!« Paul ballte kampfeslustig die freie Hand zur Faust.
Der fremde Junge sammelte hörbar Speichel im Mund, kniff die Augen zusammen, als visiere er ein Ziel an, und spuckte dann direkt neben Pauls Füße. »Das ist mein Revier, und deshalb ist der Rucksack auch meiner. Kapiert?«, knurrte er. »Also her damit, und dann verzieht euch, aber dalli.«
Sarah blieb hinter Paul stehen, der den Revierbesitzer nur wortlos anstarrte.
»Biste taub?«
Sarah zupfte Paul am Ärmel. »Lass uns lieber gehen.«
»Und was, wenn wir bleiben?« Paul reichte Sarah Kochtopf und Rucksack. Mutig tat er einen Schritt auf den Gegner zu, setzte den Koffer ab, stellte sich breitbeinig davor und verschränkte die Arme.
Der Schmuddeljunge zuckte kurz mit dem ganzen Körper, als habe ihn jemand angerempelt. Beim nächsten Atemzug warf er sich gegen Pauls Schulter. Gemeinsam gingen sie zu Boden. Paul landete unsanft auf dem Koffer und stöhnte auf.
Sarah beobachtete das Gerangel voller Angst. Doch dann überlegte sie nicht länger, brüllte: »Lass meinen Bruder in Ruhe!«, und attackierte den Fremdling mit wütenden Fußtritten.
Sarahs Angriff beendete den Streit, bevor Blut geflossen wäre. Die Kämpfer kamen mit leichten Schrammen davon. Umständlich rappelten sich beide auf, standen sich dann aber minutenlang unschlüssig gegenüber.
Argwöhnisch fixierte der fremde Junge Paul und Sarah. Keiner sagte etwas, nur Sarahs knurrender Magen war zu hören.
»Wieso rennt ihr zwei allein hier rum?«, fragte der Fremdling. »Wo sind eure Eltern?«
Paul sammelte Speichel, wie sein Gegner es vorhin getan hatte, und spuckte auf die Steine. »Das geht dich gar nichts an.«
»Genau«, setzte Sarah nach, die sich an Kochtopf und Rucksack klammerte.
Der Junge lachte hämisch. »Wer einen Kochtopf mit sich rumschleppt, kann kein Zuhause haben. Logisch, oder?«
Sarah und Paul ließen die Köpfe hängen.
»Los, mitkommen!«, kommandierte der Fremde plötzlich.
Paul rührte sich nicht. »Wohin?«
»Wirst schon sehen. Oder haste die Hosen voll?«
Sarah wusste nicht, ob Paul Schiss hatte; sie selbst fürchtete sich sehr vor diesem Rowdy, zugegeben hätte sie es jedoch nie und nimmer.
Theo, so hieß der schmutzige Kerl, war fünfzehn. »Ich bin der Anführer einer Bande«, verkündete er stolz, während er über die Steinberge voranging. »Ich und meine Kumpels haben einen trockenen Unterschlupf in den Ruinen, aber keinen Kochtopf. Und das ist euer Glück. Kapiert?«
»Logisch«, knurrte Paul, der den Koffer schleppte.
Sarah hatte den Rucksack geschultert, darin die Puppe und das Buch. Den Kochtopf hielt sie in einer Hand, mit der anderen klammerte sie sich an Pauls Ärmel. Das Wort »Bande« klang in ihren Ohren nicht gerade beruhigend, andererseits bekamen sie vielleicht etwas zu essen. Und ihr Hunger war längst größer als ihre Angst vor diesem ruppigen Jungen.
Theo führte sie nach wenigen Metern durch einen halb verschütteten Hauseingang in einen Hinterhof. Auch hier häuften sich die Trümmer, dazwischen eingekeilt zwei verbogene Wäschestangen. Er wandte sich nach rechts zu einem weniger beschädigten Wohnhaus, an dem eine kurze Außentreppe nach unten führte.
»Unser Lager«, sagte er, als sie in einem Waschkeller landeten. »Einigermaßen trocken, hat die Bombardierung unbeschadet überstanden. Manchmal gibt’s auch Wasser …« Er zeigte auf den Kupferkessel in der Ecke. »Dort sammeln wir es.«
Sarah fröstelte, als sie sich umsah. In einem ähnlichen Kellerloch hatte sie sich mit ihren Eltern viele Nächte lang versteckt. In solch einem in Stein gemauerten Kessel wie dem in der Ecke hatten sie sich gewaschen. Darunter befand sich eine eiserne Ofenklappe. Sie wusste, dass an den Waschtagen Feuer in dem Ofen gemacht worden war, um das Wasser im Kessel mit der darin eingeweichten Wäsche zum Kochen zu bringen. Jetzt war der Kessel mit einem schweren runden Holzbrett abgedeckt. Ein verdreckter Küchenstuhl, ein Klapphocker, dem die dazugehörige Waschschüssel fehlte, und ein angesengter Polstersessel dienten als Sitzgelegenheiten. Auf dem nackten Fußboden lagen zwei dreiteilige blaue Matratzen. Darauf ein Berg schmutziger Kleider, ein zerschlissenes Brokatkissen, ein gelbliches Leintuch und zwei graue Decken. Es war kalt hier unten, und es roch modrig nach nasser Wäsche, die nicht trocknen mochte.
Theo ließ sich auf die Matratze fallen. »Setzen.« Er wies mit einer Kopfbewegung zu den Stühlen »Und jetzt will ich wissen, wer ihr seid und warum ihr allein zwischen den Trümmern rumrennt.«
»Was sollen wir hier?«, entgegnete Paul feindselig.
Theo verzog den Mund. »Ihr habt doch Kohldampf, oder?«
Sarah senkte den Kopf. Paul blickte zur Seite.
»Sag ich doch«, brummte Theo zufrieden, stand auf und ging zu dem Waschkessel in der Ecke. Er öffnete die Eisenklappe, langte mit der Hand hinein und förderte ein Stück Kommissbrot zutage. Er reichte es Paul. »Mehr hab ich nicht.«
Sarah starrte auf das Brot, überlegte aber nicht lange und griff schnell danach. Es war trocken und bröselte, als sie es auseinanderriss. Aber das kümmerte sie nicht. Es würde den ärgsten Hunger vertreiben. Eine Hälfte gab sie Paul. Gierig biss sie in die andere. Sie hätte weinen können vor Glück. Stattdessen lächelte sie Theo an und sagte höflich: »Danke.«
Auch Paul bedankte sich, und noch während er kaute, erzählte er von der Flucht, dass sie Geschwister wären und die Eltern bei dem gestrigen Fliegerangriff verloren hätten.
»Wenn ihr Bruder und Schwester seid, fress ich ’nen Besen«, sagte Theo, der Paul mit zweifelnder Miene zugehört hatte.
Paul hob trotzig das Kinn. »Dann friss doch!«
»Wir sind die Geschwister Greve«, mischte sich Sarah ein. »Ich heiße Rosalie, und das ist mein Bruder Paul.« Sie lächelte Paul zu. »Zeig ihm das Foto … wo wir im Meer schwimmen waren.« Sie stotterte vor Aufregung. Würde Theo ihnen glauben? Oder würde er sie davonjagen? Zurück in die Trümmer? Auch wenn sie der feuchte, muffige Keller an die Zeiten der Angst erinnerte, bedeutete er doch ein Dach über dem Kopf.
Paul kramte die Bilder aus dem Koffer.
Sarah griff nach seiner Hand, während er Theo erklärte, was es mit dem unterschiedlichen Aussehen auf sich hatte.
»Aha«, brummte dieser, als er das Foto betrachtete. »Aber eigentlich seid ihr nur Halbgeschwister.«
Paul blickte ihn furchtlos an. »Wir haben denselben Familiennamen, und nur darauf kommt es an.«
Sarah war es egal. Halb oder nicht, schon während der Fußtritte gegen Theo war sie unwillkürlich zu Rosalie geworden, und dabei sollte es von nun an bleiben. Wie Paul wollte sie nicht allein sein, wollte eine Familie haben und einen Platz, wo sie schlafen konnte, bis sie ihre Eltern gefunden hätte. Tillis Topf war sozusagen die Eintrittskarte zur Bande. Theo meinte, er sei schon lange auf der Suche nach einem Kochgeschirr. »Um die Kartoffeln nicht mehr ins offene Feuer schmeißen zu müssen, weil sie dann immer zur Hälfte verbrennen, bis sie fertig sind«, erklärte er und fügte großspurig hinzu: »Und weil ich endlich mal wieder was Warmes essen will.« Als wäre es die normalste Sache der Welt, in einem Waschkeller zu kochen.
»Suppe kochen ist keine große Kunst«, behauptete Paul lässig. »Vorausgesetzt, wir können die Zutaten besorgen.«
Das Wort »besorgen« entlockte Theo die Geschichte, was mit seiner Familie geschehen war. Im März war er wie schon öfter allein aufs Land zum Hamstern gefahren und hatte bei seiner Rückkehr die Eltern und zwei kleinere Geschwister nicht mehr finden können. Sie waren im Bombenhagel umgekommen. Tagelang war er durch die zerbombte Stadt gelaufen, anderen elternlosen Kindern begegnet und hatte sich mit ihnen zu einer Bande zusammengeschlossen. Niemand kümmerte sich in diesen chaotischen Zeiten um ein paar herumstreunende Halbwüchsige oder darum, wer im Waschkeller einer Ruine hauste. »Das Leben geht weiter«, sagte Theo zwischen den einzelnen Sätzen und zog dabei die Nase hoch.
Rosalie hielt sich an ihrer Puppe fest. Sie spürte, dass Theo mit diesen Worten nur verbergen wollte, wie tieftraurig er war. Auch sie würde den Verlust ihrer Eltern niemals verwinden. Egal, wie glücklich sie über ihren neuen Bruder war.
Theo schloss seine Erklärungen mit der ersten und einzigen Regel der Bande: »Jeder muss am Ende des Tages etwas Essbares ergattert haben. Woher, ist egal.«
»Was meinst du damit?«, fragte Paul misstrauisch.
»Es gibt ’ne Menge Tricks, wie man zu was kommen kann.« Theo schob sich grinsend seine Mütze zurück. »Morgen nehme ich euch mit auf Beutezug.«
Paul öffnete den Koffer, holte die braune Karte mit den Zigarettenmarken raus und zeigte sie Theo. »Damit müsste doch einiges an Beute zu machen sein. Ohne, dass wir klauen.«
»Nun hab dich mal nicht so«, konterte Theo, sammelte Speichel und spuckte in den Wasserabfluss, der mitten im Steinboden eingelassen war. »Mundraub ist nicht strafbar. Aber die Marken und auch das Taschenmesser sind natürlich Gold wert.«
»Das Messer ist ein Andenken an meinen Vater, das gebe ich niemals her. Nur über meine Leiche«, protestierte Paul.
Theo zuckte mit den Schultern. »Meinetwegen. Hast du auch noch was zum Tauschen, Rosalie?«
Sie schüttelte den Kopf. »Alles, was ich besitze, hat mein Bruder im Koffer.« Sie betonte »Bruder« vielleicht ein wenig zu sehr, aber es klang so schön, fast wie ein Zuhause.
Die anderen Bandenmitglieder tauchten nach und nach auf. Zuerst die Geschwister Klara und Erika, elf und zehn Jahre alt. Die dunkelblonden Mädchen mit den schmalen, traurigen Gesichtern hatten ihre Verwandten auf dem Flüchtlingstreck über das zugefrorene Frische Haff verloren. Mit dem Treck waren sie noch nach München gekommen, wo sie Verwandte hatten, die sie jedoch nicht fanden. Nach Tagen des Herumirrens waren sie verstört und halb verhungert von Theo aufgelesen worden. Sehr viel wohlgenährter sahen sie immer noch nicht aus; barfuß in fleckigen Kleidern, über denen sie zu große, schmutzige Strickjacken trugen, deren Ärmel bis über die Hände hingen.
Als Rosalie die traurige Geschichte der beiden hörte, war sie umso glücklicher, jetzt Pauls Schwester zu sein. Und dass Theo ihnen ihre Geschichte geglaubt hatte, war für sie wie das Bestehen einer schweren Prüfung.
Klara und Erika hatten ein paar schrumpelige Kartoffeln, eine Zwiebel und ein Büschel Radieschenkraut ergattert. Woher, wollten sie nicht verraten. Aber sie würden daraus Suppe kochen, jetzt, wo sie einen Topf hatten.
Später kamen der zwölfjährige Franz mit den Sommersprossen und der dunkelhaarige Georg zurück. Georg war fast dreizehn, ziemlich hochgeschossen, und auf seiner Oberlippe schimmerte bereits ein dunkler Flaum. Die beiden Vettern waren im März von einer Kinderlandverschickung zurückgekehrt, doch die Eltern waren verschwunden. Auch in den elterlichen Wohnungen, die sich im selben Haus befanden, hatten sie keine Nachricht vorgefunden. Die Väter von Franz und Georg waren weder Juden noch in der Partei, aber die Nachbarn hatten etwas von einer Verhaftung wegen Schwarzhandels geflüstert. Das Haus war bald darauf einer Sprengbombe zum Opfer gefallen. Franz und Georg hatten später nur noch Matratzen und Decken retten können.
Die beiden Vettern brachten jeder ein Ei mit, das sie stolz vorzeigten.
Theo, ganz der großmäulige Bandenführer, klopfte den beiden auf die Schultern. »Gut gemacht.«
Rosalie betrachtete die weiße Beute mit ungläubigen Augen. Sie hatte schon ewig kein echtes Ei mehr gesehen. Auch an den Geschmack erinnerte sie sich kaum noch. Während sie sich in München verstecken mussten, waren sie auf die Güte anderer angewiesen, die ihnen von ihren Lebensmitteln etwas abgaben. Oft hatten sie tagelang nichts weiter zu sich genommen als dünnflüssigen Mehlbrei. Auf dem Land hatte ihnen noch manch mitfühlende Bäuerin frische Milch, ein halbes Brot oder auch mal einen Apfel zugesteckt.
»Wo habt ihr die her?«, fragte Paul.
»Möhlstraße, aber nicht geklaut«, sagte Georg mit erhobenem Kopf. »Dort werden jetzt Bretterbuden für den Schwarzmarkthandel aufgebaut, niemand hat was dagegen, und die Befreier schauen zu. Wir haben geholfen, Nägel einzuschlagen, und dafür die Eier bekommen.«
Rosalie schossen Tränen in die Augen. Die Gegend um die Möhlstraße war ihre Heimat gewesen. Mit ihren Eltern und den Großeltern hatte sie in einer der Villen gewohnt. Die ersten Jahre nach der Machtergreifung Hitlers waren sie durch die Bekanntheit ihrer Mutter noch sicher gewesen. Erst 1941, sie war sechs Jahre alt und mit den Eltern auf einem Gastspiel in Nürnberg, verschleppten die Nazis die Großeltern in ein Lager und beschlagnahmten die Villa. Hätte nicht ein Nachbar die Eltern im Theater benachrichtigt, wären auch sie der Gaskammer nicht entkommen. Trostsuchend griff sie nach Pauls Hand. Wenn Georg nicht log, standen in der vornehmen Bogenhauser Straße keine Villen mehr, sondern nur noch Bretterbuden.
»Morgen gehen wir alle dorthin. Da ist bestimmt noch mehr zu holen«, sagte Theo und verkündete dann der Bande: »Paul und Rosalie gehören jetzt zu uns.«
»Was bringt ihr mit?«, fragte Georg, der Paul von Anfang an mürrisch beäugt hatte.
»Einen Kochtopf!«, erklärte Rosalie hoch erhobenen Hauptes.
»Lebensmittelmarken und …« Paul machte eine kleine Pause und wurde mindestens einen Kopf größer. »Zigarettenmarken!«
Die anderen musterten ihn wie einen unverschämten Lügner. Als er die Marken vorzeigte, starrten sie darauf, als handle es sich um das Tischleindeckdich. Verständlich, dass in den nächsten Minuten nur noch darüber geredet wurde, was damit alles zu schachern war.
Vorerst wurde im Hinterhof ein Feuer entfacht. Das in den Trümmern gesammelte Holz von zersplitterten Türstöcken, Fensterrahmen oder Parkettdielen hatte die Bande mit Steinen getarnt. Die teilweise lackierten Holzstücke qualmten mehr, als sie tatsächlich brannten. Der Rauch biss in den Augen, brachte alle zum Husten, und es dauerte lange, bis eine Glut entstanden war, auf die Paul den mit Wasser gefüllten Topf stellen konnte.
Paul erklärte, wie lange die Suppe aus den zerkleinerten Zutaten kochen musste. Rosalie erinnerte sich daran, wie er vom Gutshof erzählt und dass er der Köchin regelmäßig über die Schulter geguckt hatte.
»Hätten wir eine Pfanne«, sagten die Schwestern beinahe einstimmig, als sie gemeinsam um das Feuer saßen und in die köchelnde Suppe starrten, »gäb’s Bratkartoffeln mit Spiegeleiern.«
Allein die Erwähnung von so etwas Köstlichem ließ alle Kinder still werden und von Bratkartoffel-Zeiten träumen.
Als Rosalie mit Paul und den anderen auf den Matratzen lag, fand sie lange keinen Schlaf. Ihr Magen knurrte immer noch. Die wässrige, fettlose Suppe hatte nicht lange vorgehalten. Von den Eiern hatten Paul und sie als Neulinge nichts abbekommen. Sie mussten sich erst beweisen. Und genau davor fürchtete sie sich. Sie war doch nur ein kleines Mädchen, besaß nur die Kleider am Leib und konnte nichts, außer wunderschön singen. Das jedenfalls hatte ihr Vater gesagt. Der Gedanke an ihn machte sie so traurig, dass sie aufschluchzte. Paul bemerkte es, nahm sie in den Arm und streichelte ihr Haar.
»Warum weinst du?«, flüsterte er.
»Sind meine Eltern tot?«
Paul antwortete nicht.
Rosalie hörte ihn schwer atmen. »Wir haben doch so lange genau an der Stelle gesucht, wo wir unser Versteck hatten, und sie nicht gefunden … «
»Ich weiß«, antwortete Paul. »Ich glaube, sie konnten sich nicht mehr befreien, und deshalb haben sie mich dich finden lassen, damit du nicht allein bist. Wir zwei gehören jetzt zusammen.«
»Wie der Wind und das Meer«, murmelte sie leise, und der Gedanke ließ sie endlich einschlafen.
5
Paul hatte in den letzten Wochen unzählige Ecken und Straßen von München gesehen. Mittlerweile fand er sich gut zurecht in der Stadt. Auch wenn kaum jemand dieses Meer aus Ruinen und Trümmern noch als Stadt bezeichnen mochte. Der Krieg war längst aus, das hatte sich bald auch bis zu den Kindern herumgesprochen, aber unversehrte Gebäude, Straßen ohne Bombenkrater oder intakte Trambahnschienen waren so selten wie ihre vollen Mägen. Nur einmal hatten sie gehofft, für lange Zeit satt zu werden.
Theo war Anfang Mai mit einer schier unglaublichen Nachricht vom Brennholzsammeln zurückgekehrt. »Es herrscht totale Anarchie, die Versorgungslager werden geplündert.«
Keiner von ihnen hatte je das Wort »Anarchie« gehört.
Theo erklärte den anderen die Bedeutung. »München hat momentan keinen Bürgermeister, keine Regierung und auch keine Polizei, und solange die Befreier nicht bestimmen, wer für Ordnung sorgen muss, herrscht eben Anarchie. Das bedeutet, jeder schnappt sich, was er kriegen kann. Los, wir holen uns Käse und Butter aus dem Lager in der Rosenheimer Straße.«
Auf dem Weg nach Haidhausen, wo sich das Vorratslager befand, mahnte Theo alle zur Vorsicht. »Ihr müsst gut aufpassen. Wenn euch jemand schubst oder drängelt, dann wehrt euch, schlagt zurück. Ich habe gehört, es geht zu wie im Kampf. Einer hat mir Geschichten erzählt von Mehlsäcken, die aus den Regalen gerissen wurden und auf dem Fußboden zerplatzt sind. Von zerbrochenen Ölflaschen, die sich mit dem Mehl zu einem gefährlichen Splitterbelag vermischen. Angeblich gibt es immer wieder Verletzte, man müsse sogar um sein Leben fürchten.«
In der Rosenheimer Straße angekommen, mussten sie nicht fragen, wo genau sich das Versorgungslager befand. Eine Menschenschlange zeigte ihnen den Weg. Als sie schließlich mit der Menge zum Eingang gelangten, wurden sie über eine Treppe hinunter in ein endloses Kellergewölbe geschoben.
Paul hielt Rosalies Hand fest. Als sie unten angelangt waren und er die Massen an Butter und Käse erblickte, glaubte er sich im Schlaraffenland.
»Es stinkt nach Limburger«, flüsterte Rosalie ergriffen.
In hohen Regalen lagerten riesige Wagenräder von Schweizer Emmentaler, Gouda aus Holland und kiloweise Butter.
»Schnapp dir, so viel du kriegen kannst«, sagte Paul und langte nach einem Laib Gouda, der direkt vor seiner Nase lag. Doch schon riss eine große Männerhand den Käse aus dem Regal. Die ausgehungerte Menschenmasse war außer Kontrolle. Rücksichtslos wurde um die fettreiche Beute gerangelt. Paul spürte Fußtritte, Ellbogen und Fäuste im Rücken. Jeder kämpfte, um an die bis zur Decke reichenden Regale zu gelangen. Unmengen von Butter und Käse landeten auf dem Boden. In dieser Ausnahmesituation dachte niemand an den Nachbarn und jeder nur an sich selbst. Frauen hatten die Schuhe ausgezogen und standen bis zu den Knöcheln in einer schmierigen Masse, Kinder saßen auf Butterbergen und griffen mit den Händen in das so lange vermisste Fett. Männer stopften sich die mitgebrachten Behältnisse voll und fluchten dabei über die verdammten Nazibonzen, die alles nur für sich gehortet hatten.
Inmitten des Getümmels versuchte Paul nun mit Theos und Georgs Hilfe einen der begehrten Käselaibe zu ergattern. Die Mädchen stürmten die Butterregale. Trotz eines bedrohlichen Ringkampfes gegen zwei fremde Jungs gewann Paul mit den anderen die Schlacht um den Käse. Doch sie kamen nicht weit damit. Auf der Straße wurden sie von zwei erwachsenen Männern mit Fußtritten und Faustschlägen attackiert, die schließlich mit der Beute abhauten.
Die Jungs fluchten, die Mädchen weinten, auch sie waren nur fettverschmiert aus dem Keller entkommen. Paul war, wie seine Großmutter gesagt hätte, vor lauter Wut wilder als ein angeschossener Eber.
Das passiert mir nicht noch einmal, schwor er sich, nicht wissend, dass sie nie wieder die Gelegenheit bekommen würden.
Die Hoffnung auf fettigen Käse und dick beschmierte Butterbrote platzte wenige Tage später, als die Befreier Dr. Karl Scharnagl zum neuen Oberbürgermeister ernannten und dieser die öffentliche Ordnung wiederherstellte.
»Uns bleiben immer noch die Zigarettenmarken«, erinnerte Paul die anderen.
In der Möhlstraße tauschten sie die Marken gegen Kommissbrot und sogar Wurst. Ein, zwei Tage lang würden sie satt werden.
Auf dem Schwarzmarkt hatten sie beobachtet, wie eine noch ungerupfte Ente den Besitzer wechselte. Auf dem Heimweg in den Waschkeller seufzte Theo leise »Entenbraten« vor sich hin.
»Das war eine Wildente«, mutmaßte Paul.
»Woher willst du das wissen?«, fragte Georg.
»Hausenten haben weiße Federn.«
Theo schob seine Schildmütze nach hinten, kratzte sich an der Stirn und grinste dann frech. »Im Englischen Garten schwimmen massenhaft Enten im See rum.«
Wie man so ein Federvieh abmurksen, ausnehmen und zubereiten musste, davon hatten sie zwar nicht die geringste Ahnung, aber erst mal hieß es, eines zu fangen. Der Rest würde sich schon finden. Als die Kinder tags darauf mutig losstürmten, war nicht eine Ente zu sehen und auch kein Schwan – weder auf dem Kleinhesseloher See noch im Eisbach. »Alle eingefangen und längst aufgefuttert«, knurrte Theo mit seinem Magen um die Wette.
»Oder sie haben sich beim letzten großen Fliegeralarm zu Tode erschreckt und liegen nun auf dem Seegrund«, meinte Franz.
»Ist doch egal, ob sie gefangen wurden oder vor Schreck gestorben sind, jedenfalls gibt’s für uns keinen Braten«, sagten die Schwestern.
Noch etwas war heiß begehrt auf dem Markt: Schnürsenkel und Glühbirnen. Schnürbänder rissen schnell, und kaum eine Glühbirne hatte die zahllosen Bombardierungen überlebt.
»Und das Zeugs lässt sich ganz einfach besorgen«, meinte Theo und wusste auch, wo: »In den Trambahnen. Sobald sie wieder fahren.«
»Da können wir lange warten«, unkte der sommersprossige Franz. »Im Moment fährt nämlich überhaupt keine, weil die Schienen vom Bombenfeuer verbogen oder ganz aus der Straße gerissen sind.«
»Am Bahnhof ist auch ein Schwarzmarkt, dort haben sich zwei Trambahnfahrer erzählt, dass es noch ewig dauern wird, weil unser Straßenbahnnetz das am schwersten beschädigte in allen drei Westzonen ist«, ergänzte der schlaue Georg, dessen dunkles Haar wie das der anderen Kinder von einem hellen Staubschleier überzogen war und dringend einer Wäsche bedurfte.