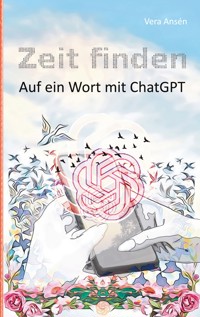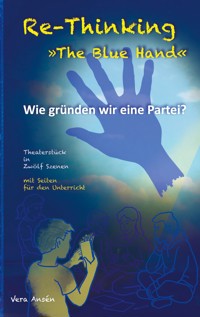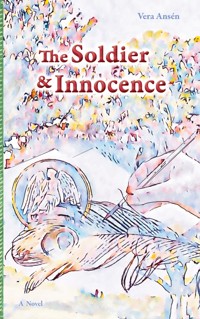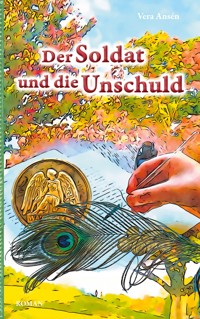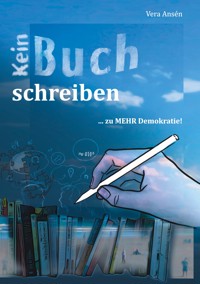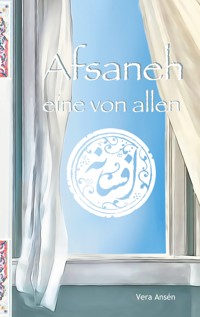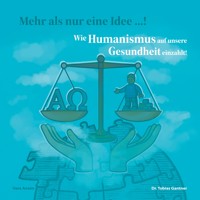
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Mehr als nur eine Idee ...!
- Sprache: Deutsch
Nachgefragt: Anlässlich eines hundert Jahre alten Fundstücks zur Reformpädagogik lädt Vera Ansén den Keynote-Speaker Dr. Tobias Gantner zum Gespräch ein, denn sie hat viele Fragen an den Healthcare Futurist. Könnte ein Teil der Lösung unserer heutigen Gesundheitsversorgung in zurückliegenden Debatten liegen? Gesundheit und Bildung vom Menschen her zu denken, ist den engagierten Eltern nicht fremd. Wie entsteht Gesundheitskompetenz? Warum macht Selbstwirksamkeit stark? Was verbindet Humanismus, Schule und Versorgung - heute und morgen? Kommen Sie mit hinter die Bühne, und folgen Sie in diesem Coffee-Table-Paperback einer Reflexion, die Lust auf Mehr macht! Ein Buch für alle, die wissen wollen, wie wir morgen gesünder, klüger und menschlicher leben können. Bleiben Sie neugierig, wir sind es auch!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 77
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lieber Nachbar,
ich schreibe Dir aus Den Haag, weil mir ein Gedanke nicht mehr aus dem Kopf geht, den Du sicher spannend findest:
Du kennst ja das Pflegemodell Buurtzorg – selbstorganisierte Teams, keine Hierarchie, volle Verantwortung bei den Pflegekräften.
Was viele nicht wissen: Die Niederlande sind auch ein Land mit besonders vielen Jena-Plan-Schulen, also reformpädagogischen Einrichtungen, die schon seit Generationen auf Selbstverantwortung, Kooperation und dialogisches Lernen setzen.
Hier gibt es auch signifikant weniger Krankenhäuser als sonst wo. Geringere Gesundheitsausgaben pro Kopf. Weniger ist mehr? Trotz geringer Bettenzahl und Krankenhausdichte erreicht man hier sehr gute Gesundheitsindikatoren.
Ich frage mich zunehmend, ob das kein Zufall ist. Wenn Menschen in so einem Bildungssystem aufwachsen, sind sie viel eher bereit, auch in der Arbeitswelt und ihrem Leben andere Wege zu gehen und sich gemeinsam für Ziele zu organisieren?
Buurtzorg könnte also nicht nur eine simple Innovation im Gesundheitswesen sein, sondern auch ein Produkt kultureller Vorprägung durch ein Bildungssystem, das Vertrauen und Verantwortung von klein auf förderte.
Steckt hier nicht Lösungspotenzial für die anderen europäischen Lander drin? Wie bereitest Du die deutsche Pflegepolitik auf den demographischen Wandel vor?
Herzlich Dein Marcin
Inhalt
Brief vom Nachbarn
Vorwort „Nie wieder"
Altwerden in unserer Demokratie
Zum Gespräch
Gesundheitsausgaben
Humanismus verspricht
Schule nach Jena-Plan
Hackathons
Healthcare Futurists
Schlusswort
Vorwort
Nie wieder Krieg, da sind sich Menschen seit Gründung des Völkerbunds einig, ist schon mal eine hervorragende Maßnahme zu mehr Gesundheit!
Bereits Religionen hatten immer wieder gemahnt: Du sollst nicht töten! Wie aber gemeinsam zu leben sei, damit sich die Erfahrungen des ersten Weltkrieges unter den Völkern Europas nicht wiederhole, war vielen Menschen vor einhundert Jahren die Frage, die sie in vielen internationalen Kongressen zwischen 1921 und 1925 zu erörtern suchten. Über 1100 an der Zahl und alles ohne Internet oder Reisemöglichkeiten, wie sie uns heute offenstehen.
Allen voran Reformpädagogen wie Maria Montessori, John Dewey, Rudolf Steiner, Peter Petersen, Ellen Key oder Célestin Freinet um nur einige zu nennen, die offen von der „Notwendigkeit einer neueuropäischen Erziehung" sprachen. Die Interessierten diskutierten nicht über bessere Lehrpläne oder effizientere Bewertungssysteme, sondern über die Frage, ob Bildung helfen kann, künftige Katastrophen zu verhindern. Weniger ein pädagogischer Reflex als ein politischer. Die Reformpädagogik war bereits vor dem Ersten Weltkrieg ein weites Feld, voller Hoffnungen und Positivbeispiele.
Der Zeitzeuge Petersen*, Begründer der Jena-Plan-Schulen, dokumentierte diese Diskursbereitschaft vor einhundert Jahren in seiner schmalen Schrift, „Die Neueuropäische Erziehungsbewegung“.
Vorwort.
Dieser Schrift liegen die Vorträge zugrunde, welche ich im Oktober 1923 auf einer pädagogischen Woche hielt, die die „Pädagogische Gesellschaft“ Kopenhagens veranstaltete und die damals unter dem Titel „Den nyeuropaeiske Skolebevaegelse“ gedruckt wurden, seitdem auch in andere Sprachen übersetzt sind und übersetzt werden. Sie wurden im Sommersemester 1926 in erweiterter und den jüngsten Erfahrungen angepaßter Form als Vorlesung für Studierende aller Fakultäten an der Universität Jena gehalten. Für weitere Einzelheiten der Schulpraxis der neuen Erziehung verweise ich auf die Bände II und III dieser Sammlung.
31. Juli 1926
Petersen.
Es ging um nichts weniger, als Bildung zum wirkmächtigsten Mittel einer Nation zu erklären, das den Einzelnen zur Mitverantwortung bemächtigt. Dass die Vertreter dieser Bewegung in Deutschland später von den Nationalsozialisten vereinnahmt, zerschlagen oder ins Exil gezwungen wurden, gehört zur deutschen Geschichte.
Die Neueuropaisehe Erziehungsbewegung
*Peter Petersens Nähe zum späteren NS-Regime wird kritisch hinterfragt. Viele Schulen benannten sich in den letzten zwanzig Jahren um.
Peter Petersen
Die Klärung, inwiefern, durch wen und aus welchen Gründen sich Petersen dem Nationalsozialistischen Lehrerbund (NSLB) anschloss, ist unter Auswertung von Briefen und Tagebüchern möglich.
Im historischen Kontext bleibt zu bemerken, dass gerade die Bemühungen der Reformpädagogen zum Teil in ein System der Jugenderziehung mündeten und von einem System allverpflichtender Schulpflicht durchdrungen wurden, das heute zurecht als Zivilisationsbruch gilt.
Während die Weimarer Republik die Schulpflicht als staatliches Erziehungsinstrument verstand, betont die UN-Kinderrechtskonvention das individuelle Recht auf Bildung als Teil der Persönlichkeitsentfaltung.
Die Jena-Plan-Schulen gehen auf Petersens Arbeitsweise zurück und setzen bis heute auf altersgemischtes Lernen, Wochenplanarbeit und Gemeinschaftsbildung. In Deutschland entstanden ab den 1970er-Jahren zahlreiche Schulen mit Jena-Plan-Ansätzen, international ist das Modell besonders in den Niederlanden weit verbreitet und systemisch verankert.
Und heute so im Frieden? Wünschen wir uns „ein langes Leben"! Am besten gleich Longevity...
Ohne Kultur des Zugehens auf Erfahrungswissen wird das mit dem Altwerden in unseren Demokratien nicht so einfach. Die Frage, wer soll für die Gesundheitskosten einer alternden Gesellschaft aufkommen - und wie - bringt allerhand Druck in die bestehenden Systeme.
Eine Demokratie, die auf Mitwirkung und Verantwortung setzt, gerät ins Schlingern, wenn die zahlenmäßig größte Bevölkerungsgruppe zunehmend aus dem Erwerbsleben ausscheidet. Nicht, weil sie nicht mehr will, sondern weil sie irgendwann nicht mehr kann, oder weil sie schlicht keine Hör- und Sichtbarkeit mehr bekommt.
In allen Zeiten gilt es, gemeinsam die Voraussetzungen für ein stabiles, friedliches Zusammenleben zu schaffen.
Nie wieder?
100 Jahre später lohnt der kritische Blick, warum die Forderung nach einer neueuropäischen Erziehung zunächst nicht zu MEHR Frieden führte.
Als Humanisten suchten die Forschenden, das aufgeklärte Individuum in den Dienst einer verantwortungsvollen Gemeinschaft zu stellen. Zu lange hatte Schule dienende Untertanen hervorgebracht. Neue Wege und eine gemeinsame Sprache wie Esperanto sollten Ausdruck dieses neuen völkerverständigenden Miteinanders werden.
Schule? Moment mal, das ist dieser Ort, zu dem alle hingehen, solange sie jung sind, denken Sie jetzt vielleicht? Während wir vom lebenslangen Lernen und der Schule des Lebens reden, gab es in Deutschland gerade einmal seit 1919, mit Einführung durch die Weimarer Republik, eine allgemein verbindliche Schulpflicht, die den Schulbesuch von mindestens neun Jahren vorsieht. Dies führte dazu, dass Klassen zunächst nicht unbedingt nach Altersstufen getrennt organisiert wurden, sondern verschiedene Jahrgänge parallel in einem Raum und teils mit Klassenstärken von bis zu 80 Schüler*innen unterrichtet wurden. Wie Schule als BILDUNG FÜR ALLE zu organisieren sei, beschäftigte die Menschen auf allen Ebenen. Das mit dem „Nie wieder Krieg unter den Völkern" hatten sich viele auf die Fahne geschrieben.
Nicht nur Pädagogen beanstandeten, dass der Humanismus seit dem 14. Jahrhundert vor allem BILDUNG FÜR WENIGE hervorgebracht hatte. Eine sich vernetzende, globalisierende Jugend sah den Humanismus als Kampfbegriff, dessen veralteter Parlamentarismus sie in die Gasfelder des ersten Weltkriegs geschickt habe. Ob bewusst oder unbewusst, schrieben sie das Skript für eine neue Ordnung, unter der Europa erzittern sollte. Sie geißelten „den" Humanismus, der hinter ihren Erwartungen zurückblieb, vor allem wegen der verheerenden Ausprägung im herkömmlichen Schulbetrieb, der keine ausreichend selbstbewussten, talentoffenen Menschen hervorbrachte. Andere Kritiker mahnen, dass „die" Reformpädagogik dem Faschismus in Italien, Spanien, England und nicht zuletzt Deutschland einen Weg bahnte, den Nationalisten zu beschreiten wussten.
Petersen wiederum sah in der übergreifenden, gemeinsamen Sprache Esperanto eine Chance für Europa, sich vor einer wachsenden Übermacht von China, Japan und dem anglo-amerikanischen Austausch zu schützen. Wie seltsam vertraut solch Bemühen heute klingt, denken wir zum Beispiel an die europäischen Gesetze zum Datenschutz und Regeln zur Kl-Nutzung? Also doch Abgrenzung? Tatsächlich reproduziert die Durchsetzung einer Schulpflicht finanzielle Schranken und nur wenige Kinder mit einem klaren Begabungsprofil profitierten von der humanistisch geprägten Schule der Jahrhundertwende.
Auf zahlreichen Kongressen zwischen 1921 und 1925 beschrieben Reformpädagogen aus unterschiedlichen Ländern, welche verheerenden Zustände sie bei Schulprüfungen vorfanden. Anders konnten sie sich nicht erklären, wie sich „vor Kraft strotzende junge Menschen" millionenfach einem Vernichtungskrieg mit Gas hingeben konnten. Festzuhalten bleibt, dass die unermüdlich tagenden Reformpädagogen glühende Europäer waren, die sich auf die notwendige Schaffung des Völkerbundes und gemeinsamer Forschung beriefen, ebenso wie auf den neu etablierten Schiedsgerichtshof, der jenseits einer „gestrigen Diplomatie" für den gerechten Ausgleich berechtigter Interessen sorgen sollte.
„Nie wieder Krieg!" war ihr zentrales Entwicklungsziel, für das Schule zum politischen Raum wurde. Während die humanistischen Schulen über BELOHNEN UND BESTRAFEN Anreize zum Lernen in die junge Seele pflanzen, wusste die reformpädagogische Schule, die intrinsische Motivation, was der Einzelne in Selbstwirksamkeit für das Gemeinwesen hervorzubringen weiß, anzusprechen. Dass über eine solche Bewegung noch viel mehr Menschen in Krieg und die furchtbarsten Verwendungen zu schicken waren, lässt sich angesichts der verheerenden Zerstörungskraft weder als Treppenwitz noch als Vogelschiss der Geschichte bezeichnen.
Warum also eine Quelle wie Petersen überhaupt anschauen? Weder der Ideengeschichte des Humanismus noch der Bildung unserer Kinder nützt es, wenn wir Geschichte als „Great Man Theory" betrachten. Die Neugier, Dingen auf den Grund gehen zu wollen, als auch der Hang zur Morphologie, dem Erkennen von Mustern, lässt uns diesen Zeitzeugenbericht zur Hand nehmen. In der Medizin gilt das Votum „Wer heilt, hat Recht" und setzen wir uns mit Jena-Plan-Pädagogen unserer Tage auseinander, staunen wir, was möglich ist. Reformpädagogik scheint viel besser zu sein als ihr Ruf?
Selbstwirksamkeit und Verantwortung für sich und andere als Erziehungsziel ernst zu nehmen, ist eine ständige Herausforderung. Insbesondere für die relati vjunge Regierungsform der Demokratie.
„Kein Krieg" hat weder an Attraktivität eingebüßt, noch fehlt es an Daten, die zeigen, wie schlechte, gesundheitliche Bedingungen die Lebenserwartung mindern und die Fähigkeit zur Selbstfürsorge einschränken.
Die hundertjährigen Gedanken zur neueuropäischen Erziehungsbewegung zum Anlass nehmend, reflektieren wir, inwiefern der Humanismus auf die Gesundheit von Menschen einzahlt. Mehr als nur eine Idee!
Die Freiheit des Individuums entfaltet sich erst dort voll, wo Bildung nicht nur Wissen vermittelt, sondern Menschen zur Selbstbestimmung befähigt. Im Denken, im Fühlen, im Handeln. Bildung ist nicht nur ein Schlüssel zur Teilhabe, sondern zur Menschwerdung im besten Sinne: Sie macht aus dem abhängigen Subjekt einen freien Menschen, der für sich und andere Verantwortung zu übernehmen weiß. Erst mit der Ausweitung als Bildung für alle