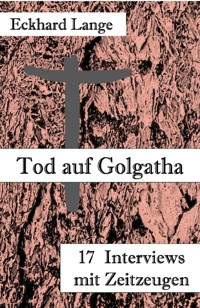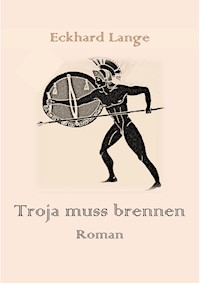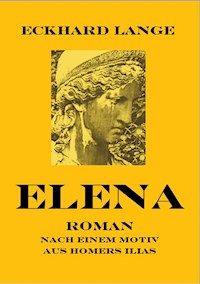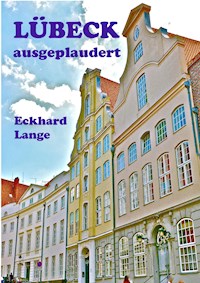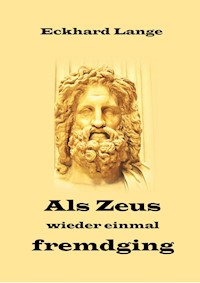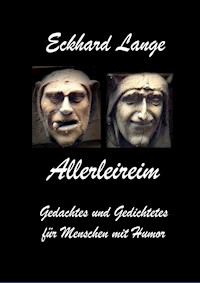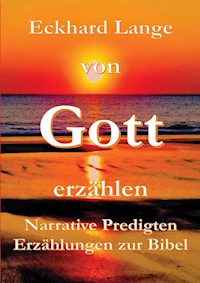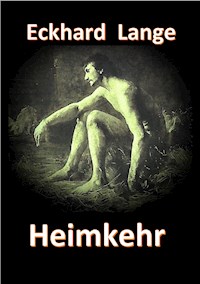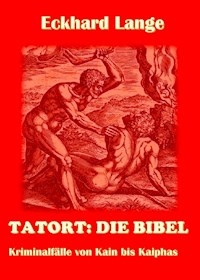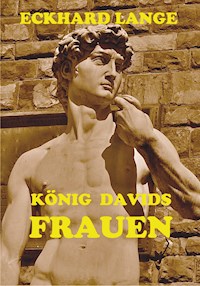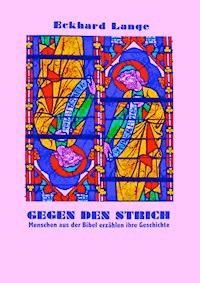Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Antike Sagen - für unsere Zeit erzählt
- Sprache: Deutsch
Der Pharmaunternehmer Eicke Yolck wird von seinem Halbbruder Peer aus der Firma gedrängt, sein Sohn Jason dadurch um sein Erbe betrogen. Der Onkel schickt den Studenten nach Greifswald, um dort an Unterlagen über ein neu entwickeltes, hochwirksames Medikament zu kommen, und mit Hilfe von Madeleine Coldenius gelingt ihm der Diebstahl. Doch der Preis, den Madeleine dafür zahlen muß, ist hoch. Dennoch werden die Liebenden um den Erfolg betrogen. Als Jason danach mit Kristin Ohnne, Erbin einer Hotelkette, eine neue Verbindung eingeht, versucht die enttäuschte und verzweifelte Madeleine, deren Hochzeit zu verhindern, aber das kostet nicht nur sie selbst das Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eckhard Lange
Wie in einem Spiegel
Roman nach Motiven der Sage von Jason und Medea
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
DIE SAGE VON JASON UND MEDEA VORWEG
ERSTER TEIL: IOLKOS - KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
ZWEITER TEIL: KOLCHIS - KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
DRITTER TEIL: NOCH EINMAL - IOLKOS - KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
VIERTER TEIL: KORINTH - KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
ERSTER EPILOG
ZWEITER EPILOG
Impressum neobooks
DIE SAGE VON JASON UND MEDEA VORWEG
Aison, Sohn des Kretheus, herrschte über Iolkos in Thessalien, bis er von seinem Halbbruder Pelias vom Thron gestürzt wird. Sein Sohn und rechtmäßiger Erbe Jason kommt in die Obhut des Zentauren Cheiron, der ihn mit Hingabe erzieht.
Zum Manne geworden, kehrt Jason in seine Vaterstadt zurück und fordert sein Erbe, das Königtum über Iolkos. Pelias sagt es zu, verlangt jedoch als Bedingung, Jason möge das Goldene Vließ herbeischaffen, das – dem Gott Ares geweiht – in dessen Hain im fernen, barbarischen Kolchis bewahrt wird, von dessen König Äetas bewacht.
So macht sich Jason auf, begleitet von vielen griechischen Helden segelt er mit dem Schiff Argo gen Osten und erreicht er endlich Kolchis. König Äetas will ihm das Vließ überlassen, verlangt jedoch nahezu unmögliche Heldentaten als Vorleistung und hofft damit, den Jüngling zu beseitigen. So soll er den Drachen töten, der das Vließ bewacht. Aber seine Tochter Medea, Priesterin und kenntnisreich in magischen Zauberkräften, entbrennt in Liebe zu dem jungen Griechen und hilft ihm, nicht nur alle Aufgaben zu erfüllen, sondern auch das Vließ zu erbeuten und damit – und mit ihr – zu entfliehen. Um die Verfolger abzuschütteln, lockt sie deren Anführer, ihren Bruder Absyrtos, in einen Hinterhalt, wo er getötet wird.
Zurückgekehrt nach Iolkos, wird Jason erneut vertröstet, Medea aber bewirkt mit ihren Zauberkräften, dass der König stirbt. Allerdings bemächtigt sich nun dessen Sohn des Thrones, Jason und Medea müssen um ihr Leben fürchten und fliehen mit ihren beiden kleinen Söhnen nach Korinth.
Kreon, Herrscher in Korinth, gewährt den Vertriebenen Asyl, fürchtet jedoch die Zauberkräfte Medeas. So dringt er darauf, dass Jason seine Tochter Kreusa ehelicht, Medea aber soll erneut verbannt werden. Jason willigt ein. Da sendet die tief Enttäuschte der Königstochter ein vergiftetes Kleid zur Hochzeit, Kreusa und mit ihr auch Kreon verbrennen, als sie es anlegt.
Es war wohl erst der Tragödiendichter Euripides, der der alten Sage in seinem Drama „Medea“ einen neuen Schluss anfügte: Medea, rasend vor Zorn, tötet, um den treulosen Jason zu treffen, die eigenen Kinder. Mit dieser damals sicher publikumswirksamen Ergänzung wurde aus der betrogenen und gedemütigten Fremden die düstere, grausame, ganz von Leidenschaften beherrschte Barbarin, als die sie in die europäische Überlieferung eingegangen ist.
ERSTER TEIL: IOLKOS - KAPITEL 1
Der Himmel hatte sich nach und nach zugezogen, aufkommende Windböen trieben das Wasser gegen die Holzpfähle, die die Uferkante stützten. An den Stegen begannen die Boote einen erregten Tanz, zerrten an den Haltetauen, während die Leinen gegen die stählernen Masten schlugen – ein vielstimmiges Konzert begann, unterlegt vom konstanten Rauschen, das der Wind in den Ohren erzeugte, begleitet vom Taktschlag der Wellen, wenn sie gegen Ufer oder Bootsrümpfe klatschten.
Jason liebte diese Stimmen über dem Wasser, liebte den Anblick der bewegten Förde, und stets überkam ihn der Wunsch, ganz allein hinauszusegeln, durch den Meeresarm zu kreuzen auf der Suche nach der offenen See. Es war verboten, bei solchen Wetterlagen die Boote zu benutzen, zu groß war die Gefahr, dass die Jollen zu weit krängten und dabei kenterten. Und doch – wie gerne hätte er jetzt die „Nixe“ losgemacht, das Vorsegel gesetzt und sich einfach vom Wind treiben lassen. Doch die Regeln waren streng, verbotenes Segeln hätte vielleicht sogar zum Schulverweis führen können, und das durfte er keinesfalls riskieren.
Wohin hätte man ihn dann verweisen können? Er wusste es nicht. Lenorenlund war seine einzige Heimat, sein Zuhause, seitdem es dort, im Binnenland, unter den backsteinernen Türmen seiner Geburtsstadt, kein Zuhause mehr gab für ihn. In der hellen Gründerzeitvilla zwischen der lindenbestandenen Allee und dem weiten Wasserspiegel der aufgestauten Wakenitz war kein Platz für ihn, dort hatte sich Peer Yolck, der Halbbruder seines Vaters, eingenistet. Die Mutter war nun schon lange tot, und der Vater hatte sich – beleidigt und enttäuscht, ja, wohl auch betrogen und getäuscht – leicht verdrängen lassen. Ein kleines Zimmer im Altersstift am Stadtpark genügte ihm, nichts hatte er mitgenommen außer seinen Erinnerungen, die ihm die Gegenwart zur Qual machten.
Selten nur verließ Eike Yolck das Haus, um wenige Schritte in den Park hinein zu tun, nie aber ging er weiter bis zur Allee, die den Park nach Westen hin begrenzte. Nie mehr wollte er einen Blick auf jenes Haus werfen, in dem nun der Bruder Hof hielt und Unternehmer, Künstler oder Lokalpolitiker zu seinen Festen lud. Es war einsam geworden um Eike Yolck, den einst so erfolgreichen Unternehmer, und auch von Jason, dem einzigen Sohn, der doch sein Erbe hätte werden sollen, erhielt er nur hin und wieder eine Postkarte mit nichtssagenden Grüßen. Der Bruder war es, der dem Sohn den Aufenthalt in Lenorenlund finanzierte, er hatte ihn dort untergebracht und damit aus der Nähe des Vaters vertrieben – auch aus der Nähe des Werks am Südrand der Stadt, das nun sein Werk war. Und er brüstete sich noch damit, dem Neffen diese gute, aber eben doch kostspielige Ausbildung zu ermöglichen.
Wohin also hätte Jason gehen können, wo er nicht einmal in den Ferien in die Heimatstadt zurückkehrte, sondern es vorzog, als einer der wenigen Schüler im Internat zu bleiben – so wie auch jetzt in diesen schulfreien Herbstwochen. Hier war sein Zuhause, hier waren die Menschen, mit denen er reden konnte, denen er sein Vertrauen schenkte und die ihm vertrauten. Hier waren die Mitschüler, die Erzieher, die Lehrer, hier war seine ganze kleine Welt. Und die große Welt – das war dort zu seinen Füßen, das war das Wasser, die Weite der Förde, und weiter draußen die See; das war der Himmel darüber und die Wälder hinter dem Schloß, in dem das Internat seinen Mittelpunkt hatte.
Jason saß auf dem Steg, er hatte die Füße auf die flache Reling der „Nixe“ gestützt und spürte dem Schaukeln des Bootes nach. Die ersten Tropfen fielen, aber das störte ihn wenig. Er war die Nässe gewöhnt, wenn er die Jolle gegen den Wind drehte und Spritzwasser ins Boot schlug. „Sie sollten sich lieber ein trockeneres Plätzchen aussuchen für Ihre Träumereien, Jason,“ sagte plötzlich eine vertraute Stimme hinter ihm. Er musste sich nicht umdrehen. Es war Dr. Scheer, sein Tutor, Lehrer für Naturwissenschaften am Gymnasium Lenorenlund. Es war der Mann, der ihm in den letzten Jahren zum Vater geworden war, so sehr, dass er den leiblichen Vater fast vergessen hatte – nicht einmal ein Foto besaß er von ihm, nur das Bild der Mutter bewahrte er in seinem Schreibtisch.
Auch Dr. Scheer war nicht in die Ferien gefahren wie die meisten seiner Kollegen, auch für ihn war Lenorenlund Arbeits- und Urlaubsort zugleich. Und wenn Schüler und Lehrer Internat und Schule verlassen hatten, wenn ungewohnte Ruhe über den umliegenden Häusern lag und das Schloss bewohnerlos auf die Förde hinabblickte, dann genoss der Studienrat erst die ganze Schönheit dieser Landschaft, die er gerne durchwanderte, allein mit seinen Gedanken und seinen Ideen. Und er genoss es, diese Ideen in den leeren Labors auszuprobieren, ohne den Zwang, erklären zu müssen, allein mit seiner Neugier, seiner Lust am Experiment. Dass dann manchmal auch einer seiner Abiturienten, Jason Yolck, auftauchte und zuschaute, störte ihn wenig, denn der junge Mann erfasste stets schnell den Sinn der Anordnungen, stellte nur selten, aber dann meist kluge Fragen und war ihm so oft schon zur Hilfe gekommen, wenn er sich in den eigenen Gedanken verrannt hatte.
Der Regen ließ noch auf sich warten, Dr. Scheer hatte sich neben seinen Schüler gesetzt und blickte ihn von der Seite an: „Sie sind der einzige, von dem ich nicht weiß, was er nach dem Abitur unternehmen wird,“ sagte er dann vorsichtig. Es lag ihm schon lange auf der Seele, mit dem jungen Mann über seine Zukunft zu reden. Er wusste, dass dessen Familienverhältnisse schwierig waren, dass er sonst keinerlei Gesprächspartner hatte, aber er wollte sich ihm nicht aufdrängen. Doch die Prüfungen würden in wenigen Monaten beginnen, Bewerbungen mussten rechtzeitig geschrieben werden, und die sonst unumgängliche Zeit bei der Bundeswehr schien dem Lehrer ein verlorenes Jahr, ganz abgesehen davon, dass Jason Yolck nicht zum Befehlsempfänger taugte.
„Ich weiß es auch nicht.“ Jason sagte es ohne jede Emotion. Es war einfach eine Feststellung. Er hatte den Gesprächen seiner Klassenkameraden schweigend zugehört, ihre Pläne und Ziele zur Kenntnis genommen, ohne Neid, aber auch ohne Bewunderung. Er wusste, dass er einmal eine Selbstverpflichtung eingegangen war mit der Aufnahme in diese Schule, die mit den Worten begann „Ich bekenne mich zur Übernahme von Verantwortung für mich selbst...“ Der ganze folgende Ehrenkodex dieser Einrichtung hing damit ab von dieser einen Voraussetzung. Und jenes andere große Wort kam ihm in den Sinn, dass man andere nur lieben kann, wenn man sich selber liebt. Aber wie sollte er sich selber lieben, wenn er nirgendwo solche Liebe erfahren, vorgelebt bekommen hatte. Verantwortung für die anderen, die Mitschüler, die Gemeinschaft – ja, die hatte er gezeigt in diesen Jahren. Aber wie sollte er jetzt für sich selbst Verantwortung übernehmen, wenn er nirgends einen Weg sah, der in seine eigene Zukunft führen würde? Interessen hatte er schon, vieles reizte ihn, auch manche Studienrichtung – aber was war das Ziel für ihn selbst? Er wusste darauf keine Antwort, und er wusste niemanden, den er fragen konnte. Doch nun hatte ihn ein anderer gefragt.
„Sollten wir vielleicht einmal darüber reden?“ Der Lehrer bemühte sich, genauso emotionslos zu sprechen. „Natürlich nur, wenn Sie es möchten,“ fügte er in gleichem Tonfall hinzu. Eine Weile herrschte Schweigen, dann nahm Jason die Füße vom Boot und zog sie an sich. „Ich weiß, irgendetwas muss geschehen. Und es muss wohl auch bald geschehen,“ sagte er. „Wenn schon nicht mir, dann bin ich es doch der Schule schuldig.“ Dr. Scheer nickte: „Und die Schule will Ihnen auch helfen. Manchmal ist es nicht leicht, allein den richtigen Weg zu finden. Gehen müssen Sie ihn selbst, und finden wohl auch. Aber suchen können wir gemeinsam.“ Und nach einer Pause fuhr er fort: „Wie ist es – kommen Sie heute Abend zu mir? Auf ein Gläschen Wein, und für eine gemeinsame Suche.“ Er legte dem jungen Mann die Hand auf die Schulter, dann erhob er sich etwas schwerfällig. „Dieser Steg ist doch nicht mehr die passende Sitzgelegenheit in meinem Alter,“ sagte er entschuldigend. Er ging, ohne eine Antwort abzuwarten. Er wollte nichts erzwingen. Der Junge braucht Zeit zum Nachdenken, ich werde ja sehen, ob er kommt.
KAPITEL 2
Jetzt, wo alles vorbei ist, wo es keine Zukunft mehr gibt außer dem Tod, kann ich, nein, muss ich mir Rechenschaft geben. Erleben nicht Sterbende ihr Leben noch einmal, ein ganzes Leben in wenigen Sekunden? Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt, aber ich muss den Film zurückspulen bis zum Anfang. Ich muss wissen, warum alles so gekommen ist, damit ich meine eigene Schuld erkenne. Immer habe ich anderen die Schuld gegeben, aber war das gerecht? Ich muss dir dein Leben erzählen, Jason Yolck, und ich werde dich dabei ansehen, hier, in diesem Spiegel werde ich dir in die Augen blicken, und du wirst mir nicht ausweichen können. Ich muss dir dein Leben erzählen, ehe du stirbst, damit du selbst entscheiden kannst, welche Schuld du trägst.
Das erste, woran ich mich erinnere, ist diese kleine Holzglocke über meinem Bett. Jeden Abend hat die Mutter den Klöppel herausgezogen, um die Spieluhr in Gang zu setzen. Das war der Augenblick, wo sie sich dann herabbeugte, um mir Gute Nacht zu sagen. Nie wäre ich eingeschlafen ohne dieses Ritual. Manchmal kam auch der Vater mit an mein Bett, doch das war letztlich nicht wichtig. Es war dieser mütterliche Geruch, es war die kleine Melodie, es war ihre sanfte Stimme, die ich brauchte, um den Schrecken der Dunkelheit zu ertragen. Sie begleiteten mich in die Nacht, ließen mich schreckliche Träume überstehen, denn ich träumte furchtbare Dinge, auch wenn ich nie wusste, was dabei geschah. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich manchmal erschrocken aufwachte, zitternd vor Furcht vor etwas, was nie in meinem Leben greifbar wurde. Aber es war da, war eine andere Wirklichkeit, war wie die dunkle Materie im Kosmos, ungreifbar, unfassbar und doch vorhanden.
Dann weitete sich meine Welt, das Haus mit der geschwungenen Treppe, der dunkel getäfelten Halle, den hohen Räumen im Erdgeschoß, in denen ich mich nie zuhause gefühlt habe – das alles tritt mir vor die Augen. Vor allem aber die wunderbar lichten Zimmer im oberen Stockwerk mit ihren Möbeln aus hellem Eschenholz, zwischen denen ich spielen konnte – und dann der Garten hinter dem Haus, wenig gepflegt und deswegen voller Träume und Abenteuer, der kleine Steg an seinem Ende, von dem aus man über das Wasser blicken konnte auf die Mauern und Türme der Stadt wie auf die Burg, die mir der Großvater zum fünften Geburtstag schenkte mit Rittern und edlen Damen. Beschützt war ich dort und geborgen, auch wenn ich immer wieder gewarnt wurde, nicht zu nahe ans Wasser zu gehen. Aber nie haben die Eltern dort einen Zaun setzen lassen, stets vertrauten sie auf ihr Wort und auf meine Einsicht.
Jetzt, am Ende meines Lebens – auch wenn ich längst noch nicht jenes Alter erreicht habe, wo Menschen zu sterben haben, aber es ist dennoch für mich das Ende dessen, was man Leben nennen kann – jetzt also weiß ich, worin das Glück besteht: dass man Vertrauen haben kann und vom Vertrauen getragen wird. Aber ich hatte es all die Jahre danach vergessen, und heute, wo ich es erkenne, gibt es niemand mehr, dem ich vertrauen könnte, und wohl auch keinen, der mir vertrauen würde. Das ist bitter, aber es ist die Wahrheit.
Es waren die Jahre der Unschuld, und selbst die Schule konnte sie nicht zerstören. Dabei mochte ich dieses große graue Gebäude ebenso wenig wie den Lärm dort, ich mochte die Lehrerin nicht, und auch die meisten Kinder waren mir zuwider, nur mit wenigen konnte ich spielen, auf dem Pausenhof und auch zu Hause in unserem Garten, denn dieser Garten war mein Paradies und sollte es bleiben, kein Unwürdiger sollte es entweihen. Aber ich lernte gerne und eifrig, jedes Geheimnis, das sich mir offenbarte, erfüllte mich mit Freude; und da war dann auch jener Lehrer mit dem ungepflegt langen Haar und dem rötlich-braunen Bart, der es verstand, Geheimnisse geheimnisvoll zu entschlüsseln, der von allem zu erzählen wusste, spannend wie in einem Abenteuer. Das hat mich mit der Schule versöhnt.
Und einmal bin ich einem ganz anderen Geheimnis begegnet, auch wenn ich es erst viel später enträtseln konnte: Ich weiß nicht mehr, aus welchem Anlass es geschehen sein mochte, aber der Vater nahm mich eines Tages mit in die Fabrik, die sein Lebenswerk war. Und staunend durchschritt ich Räume, in denen gläserne Behälter vielfarbige Flüssigkeiten enthielten, in den Männer und Frauen in weißen Kitteln, mit weißen Hauben und weißen Tüchern vor dem Mund, merkwürdige Geräte bedienten. Staunend nahm ich fremdartige Gerüche wahr, sah große Maschinen, die kleine runde Teilchen in silberne Tafeln pressten, auf lange Bänder auswarfen und dann in Schachteln verpackten. Es war das erste Mal, dass ich die Firma Yolck Pharma betrat, und es sollte für lange Jahre auch das einzige Mal bleiben. So blieben diese Hallen für mich ein mystischer Ort, brannten sich diese Bilder in mein Gedächtnis ein als ein Zauberwerk, das mein Vater am Laufen hielt.
Damals wusste ich noch nicht, dass es der Großvater war – ein würdiger Herr, stets mit Weste unter dem Sakko, mit korrekt gebundener Krawatte und blankgeputzten Schuhen ausgestattet – der in der Stadt eine Apotheke betrieb und noch im letzten Jahr des großen Krieges zwei Patente angemeldet hatte, auf denen alles beruhte. Es waren neuartige Medikamente, die bald weltweit genutzt wurden und die nun in jenen Hallen am Stadtrand produziert wurden. Aber erst der Vater machte aus der Yolck Pharma KG ein Unternehmen, das bis in die letzten Winkel dieser Erde lieferte und dennoch allen Übernahmeversuchen der Großen dieser Branche widerstand. Niemand war es gelungen, diese Medikamente durch bessere oder wenigstens gleichwertige zu ersetzen, jeder Arzt, jedes Krankenhaus war auf die Lieferungen dieser Firma angewiesen, und weil unsere kleine Familie nur wenig von den gewaltigen Gewinnen für sich verbrauchte, wurde der Vater bald auch zum geschätzten Mäzen, zum angesehenen Wohltäter in unserer Stadt und auch weit darüber hinaus.
Eigentlich hätte ich meinen Vater bewundern müssen, aber ich war wohl viel zu klein, um seine Leistung zu verstehen. Und Teil dieser Leistung war es ja, dass er selten im Hause war und noch seltener Zeit für den Sohn hatte. Nein, mein Vater war ein Fremder für mich, und er ist es auch noch heute, wenn auch auf eine andere Weise. Mein Leben war geprägt von Mama, und sie liebte ich mit der ganzen Kraft meiner Kinderseele. Dass auch er sie liebte, über alles liebte, habe ich erst erfahren, als wir sie verloren hatten.
Es geschah alles so plötzlich damals, und ich habe es nicht verstehen können – ja, auch nicht verstehen wollen. Sieben Jahre war ich alt, gerade hatte ich die erste Klasse hinter mich gebracht und freute mich auf die Ferien, die wir gemeinsam an der Ostsee verbringen würden, in dem kleinen Ferienhaus, das der Vater gekauft hatte, als ich drei wurde. Da hieß es plötzlich, Mama sei krank. Der Vater ging mit besorgtem Gesicht durchs Haus, Ärzte kamen und gingen, ich durfte nicht zu ihr, sie brauche Ruhe, sagte man zu mir. Und dann kamen statt der Ärzte Männer in schwarzen Anzügen, der Vater schickte mich ins Kinderzimmer, aber ich sah, wie seine Hände zitterten. Durch das Fenster sah ich, wie die schwarzen Männer etwas genauso Schwarzes, Längliches aus dem Haus trugen, und ich verstand nicht, was dort vor sich ging. Es war der Großvater, der danach zu mir kam, sich umständlich neben mich setzte und mit einer merkwürdig fremden Stimme sagte: „Du musst jetzt sehr tapfer sein, Jason. Deine Mutter ist nun fort, für immer.“ Und als ich ihn nur erschrocken anblickte, nahm er mich in den Arm – es war das einzige Mal, dass er mir so nahe kam – und ergänzte: „Sie ist gestorben.“
Ich habe nicht geweint damals, nein, denn ich wusste nicht, was das bedeutete. Ich wollte nur zu ihr, irgendwo musste sie doch sein, und als ich das nicht durfte, habe ich geschrien und getobt, und mein Vater stand ratlos und hilflos dabei, weil er selber am liebsten geschrien hätte vor Schmerz. Nein, er konnte mich nicht trösten, er konnte mich nicht einmal umarmen. Er hat mich allein gelassen, weil er selber so allein war. Aber das habe ich nicht verstanden damals.
Plötzlich war das Haus leer, niemand, der mich rief, der nach mir fragte, der mich ins Bett brachte, niemand, der mich anlächelte und streichelte. Irgendwann sind sie dann alle zum Friedhof gegangen, aber an mich hat niemand gedacht, eine fremde Frau kam ins Haus und paßte auf mich auf. Es gab keinen Blick auf Mamas totes Gesicht, es gab keinen letzten Blumengruß an ihrem Grab – es war, als gäbe es auch mich gar nicht mehr. Der Vater stand nur schweigend am Fenster, stundenlang, kaum dass er mir einen Blick zuwarf. Dann ging er ins Schlafzimmer, ohne einen Gutenachtgruß an den Sohn, und ich hörte ihn dort manchmal weinen.
Er kam auch mittags nicht mehr ins Haus, wie er es sonst immer getan hatte – es war ja niemand da, der mit dem Essen auf ihn wartete. Irgendwann fiel ihm ein, dass auch ich am Tisch gesessen hatte, und er sorgte dafür, dass eine andere fremde Frau ins Haus kam und für mich kochte. Aber es schmeckte jetzt anders, und nur wenn der Hunger übermächtig wurde, aß ich, was sie auf den Tisch brachte. Ich glaube, sie hat sich viel Mühe gegeben mit diesem fremden Kind, und sie hatte sicher auch Mitleid mit mir, und manchmal versuchte sie auf eine unbeholfene Art, mich zu trösten, oder wenigstens mich abzulenken. Aber ich wollte nicht getröstet werden, ich wollte meine Mama zurück, und so nahm sie mich eines Tages bei der Hand und wanderte mit mir zum Friedhof, durch den Park vor unserem Haus hindurch und ein Stück weit eine Straße entlang, bis hinter einem hohen Eisenzaun mächtige Bäume ragten.
Noch nie war ich an einem solchen Ort gewesen, die hohen Hecken, die dunklen Steine mit den goldenen Schriftzügen, das alles wirkte fremd und beklemmend. Dann war da ein breites Beet, blumenbewachsen, ein mächtiger Stein am hinteren Ende, „Erbbegräbnis der Familie Yolck“ las ich darauf, und seitlich darunter Mamas Name und zwei Jahreszahlen. „Da liegt deine Mutter,“ sagte die fremde Frau und legte einen kleinen Blumenstrauß neben den Stein. „Aber ihre Seele ist nicht hier, sie ist im Himmel, und sicher schaut sie von dort herab und sieht dich.“ Sie hat es gut gemeint, aber verstehen konnte ich nicht, was sie sagte. Wie sollte ich auch begreifen, dass Mama dort tief in der dunklen Erde lag und zugleich vom Himmel herabschaut – wie sollte ich überhaupt verstehen, dass sie fort war, dass sie mich alleingelassen hat.
Die Schule begann, die Lehrerin sagte zu den anderen Kindern, dass ich meine Mama verloren hätte und dass sie nun besonders lieb zu mir sein müssten. Aber das war nach einigen Tagen schon wieder vergessen, und mir war es auch lieb, dass die Schulkameraden mich nicht mehr nach meiner Mama fragten. Ich konnte ihnen doch nicht erzählen, dass sie irgendwo vergraben lag und zugleich im Himmel war.
Den Vater sah ich noch seltener als früher, und wenn er im Haus war, blickte er mich nur traurig an. Erst später erfuhr ich, ich sähe meiner Mutter sehr ähnlich, und das hätte ihn stets an seinen Schmerz erinnert. Und auch das andere habe ich erst viel später erfahren: Dass er zwar täglich fortging, aber nur selten in seiner Fabrik ankam, sondern stundenlang auf dem Friedhof weilte und danach ziellos durch die Straßen lief. Die Aufträge für das Werk, die Produktion, der rechtzeitige Versand – das alles kümmerte ihn nur noch wenig; eine Zeitlang warteten seine Angestellten noch auf die nötigen Anordnungen, dann begannen sie, selbst zu handeln und selbst zu entscheiden. Nur weil zwei treue Prokuristen, die noch unter Großvater gearbeitet hatten, die Geschäfte erledigten, blieb das Werk erhalten. Um die Gewinne allerdings kümmerte sich niemand, es gab keine Spenden mehr von der Yolck Pharma KG, aber es gab auch kaum noch größere Investitionen, weil der unternehmerische Weitblick fehlte. So jedenfalls hat man es mir erzählt – später, als ich schon fort war von zu Hause.
Als der Großvater - Kurt Yolck - die Firma in die Hände meines Vaters legte, verblieb er jedoch als Gesellschafter, nunmehr als bloßer Kommanditist, und in einem Anflug von Großmut trat er einen kleinen Teil seines einliegenden Kapitals an meinen Onkel Peer ab, machte ihn damit zum Mitgesellschafter. Ach, dieser Peer! Eigentlich war er nichts als ein früher Fehltritt des Großvaters, und es gab nur wenig Kontakt zwischen den beiden Brüdern. Kurt Yolck hatte gerade eine Apotheke in der Innenstadt übernommen und sich in die erste Helferin, die er danach einstellen konnte, verliebt. So kam, überraschend und ungewollt, Peer, der erste Sohn, zur Welt, und wie es in den zwanziger Jahren von einem Ehrenmann erwartet wurde, hat der Großvater die Mutter noch vor der Geburt geheiratet und damit den Sohn legitimiert. Doch die Ehe ging ebenso rasch auseinander, wie sie geschlossen wurde – die junge Frau fand einen neuen Liebhaber, Kurt ließ sich scheiden, der Sohn verschwand mit der Mutter aus der Stadt, nur die Alimente verbanden Vater und Sohn miteinander.
Peer Yolck war ein kleiner, untersetzter Mann, schon bald nahezu kahl, aber er hatte einen bohrenden Blick, der mich stets unsicher machte. Und er war auf seine Weise geschäftstüchtig – mit dem ja nur geringen Gewinn, den er der Yolck Pharma KG verdankte, wusste er an der Börse zu einem gewissen Reichtum zu kommen. Er kleidete sich stets nach neuester Mode, pflegte Kontakt zu anderen Geschäftsleuten, heiratete in eine alteingesessene Hamburger Kaufmannsfamilie ein, die allerdings im Nachkriegsdeutschland wenig Anteil am Wirtschaftswunder hatte. Doch der Name behielt seinen alten Klang und öffnete auch dem Schwiegersohn manche sonst verschlossene Tür. So war er auch in unserer Stadt, die ja stets die verarmte Schwester des groß gewordenen Hamburg war, kein Unbekannter.
Und dann, einige Monate nach Mamas Tod, als der Vater noch mit dem Schmerz rang, als die Yolck Pharma ziellos dahintrieb und Großvater sein Werk in Gefahr wähnte, kam es zu jener denkwürdigen Sitzung der Gesellschafterversammlung, aus der Vater mit leeren Händen herausging: Peer bewog seinen Vater, Eike Yolck als Geschäftsführer zu entmachten; gemeinsam schlossen sie meinen Vater aus der Gesellschaft aus, nicht einmal als Kommanditist schien er ihnen noch tauglich, nur eine kleine Rente setzten sie dem Gescheiterten aus. Peer aber wurde zum persönlich haftenden Gesellschafter bestellt, übernahm die Führung und das Vermögen der Firma und bald auch unsere Villa.
Der Vater, willenlos und hilflos, ließ alles geschehen, wie ein Verbannter, ein Aussätziger ließ er sich, kaum fünfzig geworden, in das kleine Zimmer im Stift sperren. Vielleicht hätte er ja wieder zu sich selbst gefunden, wenn die erste Trauer gewichen wäre, doch nun blieb ihm nichts mehr als eben seine Trauer, sie wurde sein Lebensinhalt, und bald war der einst große Gönner seiner Vaterstadt ein Vergessener, lebte er verbittert und gemieden das Leben eines alten Mannes, und es dauerte nicht lange, dann nahm er auch das Aussehen eines alten Mannes an.
Ich war gerade zehn Jahre alt geworden, der Wechsel auf eine weiterführende Schule stand an, doch der Vater war unfähig, eine Entscheidung zu treffen. Es war der Großvater, der sich meiner erinnerte: Er hatte dieser Machtübernahme durch meinen Onkel nur zugestimmt, als dieser versprach, für den Neffen zu sorgen, der nun kein Erbe mehr war, sondern ein verarmter Verwandter: Peer Yolck sagte zu, mir eine exzellente Ausbildung zu verschaffen. So kam ich nach Lenorenlund. Er sagte auch zu, dass ich später – wenn ich es denn wollte – Gesellschafter der Yolck Pharma werden könne. Allerdings, es gab darüber keinen Vertrag, kein Dokument, es war allein das Wort des ehrbaren Kaufmanns, auf das Großvater vertraute. Und bislang hatte das Internat pünktlich mein Schulgeld erhalten, einschließlich einer Summe, die mir als Taschengeld zugedacht war und die ich kaum je in voller Höhe ausgegeben habe.
Es ist deine Jugend, Jason Yolck, du Spiegelbild vor meinen Augen, die ich dir erzählt habe. War es eine schöne Kindheit? Denke nach, urteile nicht vorschnell! Du hast wunderbare Jahre verbracht in jener Villa mit ihrem Garten, nicht wahr? Du hast schreckliche Zeiten durchlebt in deiner Suche nach einer verlorenen Liebe, die dich solange getragen hatte. Du bist furchtbar einsam gewesen, auch das ist wahr. Du hast ein Zuhause gefunden in jenem weißen Schloss auf dem hohen Ufer über der Förde, erst im Dorf und dann in einem der Kavaliershäuser, ein Zuhause mit Freunden, mit Kameraden, die dir Achtung entgegenbrachten, die dir vieles anvertraut haben, mit Lehrern, die mehr waren als Unterrichtende, fürsorglich und väterlich. Hast du etwas vermisst? Kannst du dich beklagen? Denke gut nach, ehe du antwortest! Du musst Rechenschaft geben über dein Leben, ehe es endet, und dieses letzte Zeugnis wird gültig bleiben im Gericht – wer auch immer dich richten wird und welche Gesetze dann gelten mögen. Hast du ausreichend Liebe empfangen, damit man von dir auch erwarten konnte, dass du Liebe verschenken würdest, und hast du es getan? War es wirklich Liebe, was du anderen gegeben hast? Sei ehrlich, Jason Yolck, wenigstens diese eine Mal sei ganz und gar ehrlich, weil es das letzte Mal ist für eine Antwort.
KAPITEL 3
Dr. Scheer war ein hagerer, hochgewachsener Mann, die hohe Stirn wirkte noch höher, seit sein Haaransatz sich unaufhaltsam weiter zurück bewegte. Obwohl er erst Mitte Vierzig war, wurde das schüttere Haar bereits sichtlich grau. Er trug es kurz geschnitten, so dass auch der freie Nacken seine Größe betonte. Wie die meisten Lehrer trug er Jeans und ein dunkles Oberhemd, das angesichts der ungewohnt warmen Temperatur auch am Abend noch völlig ausreichte. Er hatte sein Arbeitszimmer ein wenig aufgeräumt, nicht zu viel, denn er wollte seinem Gast keine bewusste Ordnung vorspielen, aber doch soweit, dass das sonst übliche Chaos auf seinem Schreibtisch gebändigt erschien. Auf dem Tischchen in der Sitzecke standen bereits zwei Kristallgläser und eine Flasche Rotwein – er hatte eine möglichst leichte Sorte gewählt, schließlich erwartete die Schule gerade von ihren bereits volljährigen Schülern, dass sie zurückhaltend umgehen mit allem, was Alkohol enthält. Ein Internat, das schließlich auch Zehnjährige beherbergt, hatte leicht einen guten Ruf zu verlieren.
Der Lehrer war sich nicht sicher, ob Jason Yolck überhaupt seiner Einladung folgen würde. Er hatte sie schließlich bewusst so ausgesprochen, dass sein Lieblingsschüler ohne Schuldgefühle auch fernbleiben konnte. Und doch hoffte er, Jason würde die Gelegenheit nutzen, mit dem Lehrer über seine Pläne zu sprechen – falls er denn überhaupt Pläne hatte. Eben das schien dem Pädagogen fraglich. Er hatte noch einmal einen Blick in die Unterlagen geworfen, die im Sekretariat über jeden Schüler geführt wurden. Seine Leistungen, seine Mitarbeit in den schuleigenen Gilden, seine freiwillig übernommenen Aufgaben im Internat kannte er, dazu bedurfte es keiner Nachforschungen. Aber die familiäre Situation seiner Schüler war ihm nur dort geläufig, wo es Probleme gegeben hatte, und das war bei Jason Yolck nie der Fall gewesen.
Das einzig Auffällige war die Tatsache, dass der junge Mann häufig seine Ferien ganz oder teilweise im Internat verbrachte. Erst jetzt aber wurde Dr. Scheer wirklich bewusst, dass Jason offensichtlich überhaupt kein Zuhause hatte: eine früh verstorbene Mutter, ein Vater, der als Adresse ein Altersstift hatte – wohin sollte der Junge da auch fahren? Die Zahlungen kamen von einem Onkel, doch der Lehrer konnte sich nicht erinnern, ihn jemals bei einer jener Veranstaltungen gesehen zu haben, zu denen Eltern und Angehörige geladen wurden und meist auch erschienen. Nein, Jason hatte kein Elternhaus, und er hatte wohl auch niemand, der ihm jetzt mit gutem Rat zur Seite stehen könnte. Umso wichtiger war, dass er – sein Tutor – ihm das Gespräch anbot.
Fast hatte Dr. Scheer das Warten bereits aufgegeben, als es dann doch noch an der Tür läutete. Er öffnete. Jason stand mit einigen Zetteln im Türrahmen und begann mit einer Entschuldigung: „Es ist leider etwas später geworden,“ sagte er zögernd, „aber ich wollte nicht ganz unvorbereitet kommen. Ich habe dafür die Optionen aufgelistet, die ich mir für die Zeit nach dem Abi vorstellen könnte.“ Der Lehrer musste lächeln: Das war typisch für diesen Schüler, und das machte ihn auch so sympathisch. Er ging sein eigenes Schicksal an wie eine Versuchreihe im Labor – da mussten alle nur möglichen Fehler zunächst ausgeschlossen werden, sollte das Experiment zum Ziel führen. „Kommen Sie herein, Jason. Ich freue mich, dass Sie mir Ihr Vertrauen schenken.“
Er goß die Gläser voll und reichte eines seinem Schüler. „Auf Ihre Hausaufgaben,“ sagte er und hob das eigene Glas. „Lassen Sie hören, was Ihnen alles eingefallen ist.“ Jason ordnete seine Zettel auf zwei Stapel. „Ich denke, es gibt für mich zwei Alternativen – ohne dass ich jetzt über die Finanzierung nachdenke. Die erste wäre ein Studium, die zweite eine Berufsausbildung – als Vorstufe für ein späteres Studium. Sie kennen meine Interessen, Herr Dr. Scheer. Ich finde zwar manches spannend, aber das meiste würde höchstens für ein Hobby reichen. Es sind die exakten Wissenschaften, die mich reizen könnten.“ „Gut,“ mischte der Lehrer sich ein, „lassen wir die genauere Wahl zunächst beiseite. Kommen Sie erst einmal zu Ihrem zweiten Stapel. Der steht unter der Überschrift 'Beruf', wie ich vermute.“
Jason nickte. „Aber hier steht fast überall ein großes Fragezeichen hinter meinen Notizen. Das macht es nicht gerade leichter.“ „Lesen Sie einfach vor, dann reden wir darüber!“ Es wurde ein langes Gespräch, aber Dr. Scheer merkte bald, dass er die Unsicherheiten seines Schülers nicht ausräumen konnte. Irgendetwas stand seiner Entscheidung im Weg, und das blieb unausgesprochen, falls es dem jungen Mann überhaupt bewusst war. Doch dann folgte der Lehrer einer spontanen Eingebung und fragte: „Was mich interessieren würde: Welches Beruf hatte eigentlich Ihr Vater?“ Jason schwieg eine Weile, dann sagte er leise: „Ich glaube, Sie haben mich jetzt festgenagelt. Da ist etwas, was ich mir nie wirklich eingestehen wollte.“ „Möchten Sie darüber sprechen, Jason?“ fragte der Ältere vorsichtig. „Ich will Ihnen keine Geheimnisse entreißen. Aber wenn hier ein Stolperstein im Weg liegt und wir ihn forträumen könnten, dann sollten wir es tun – jetzt tun.“
Wieder brauchte Jason Zeit, um zu antworten, und sein Lehrer wartete geduldig. „Sie haben vielleicht einmal ein Medikament genommen, das von einer gewissen Yolck Pharma stammte,“ begann er endlich. „Das ist – meine Familie. Mein Großvater ist Apotheker.. gewesen, muß ich hinzufügen. Und er hat die beiden Mittel einmal zusammengemischt. Ja, es sind zwei Medikamente, nur zwei, die Yolck Pharma produziert, immer noch nach seiner Rezeptur. Darum hat auch mein Vater Pharmazie studiert, er hat die Mittel ständig verbessert, dem Bedarf angepasst, aber es ist immer noch das alte Patent. Vielleicht wäre er sonst Maler geworden, oder Bildhauer, er hatte, soviel ich weiß, durchaus auch eine künstlerische Ader. Aber es gab das Werk, es gab eine Belegschaft, und vor allem, es gab einen Markt. Ich habe mich nie sonderlich dafür interessiert, und doch – Yolckosar und DiaYolck sind ein Erbe, dem ich mich verpflichtet fühle. Irgendwie.“
„Aber Ihr Vater ist nicht mehr tätig?“ Wieder fühlte Dr. Scheer, dass er sich auf dünnem Eis bewegte mit seinen Fragen. Doch er fühlte auch, dass Jason darauf wartete, endlich einmal über seine Familie zu reden. „Der Tod meiner Mutter hat alles verändert.“ Jason sagte es heftiger, als er gewollt hatte. „Ich war damals noch viel zu klein, um das alles zu begreifen, und ich weiß bis heute nicht, was im einzelnen geschehen ist. Ich weiß nur, dass Vater lange unfähig war, normal zu arbeiten. Und plötzlich war da mein Onkel, der Halbbruders meines Vaters, im Besitz der Firma.“ „Er ist ebenfalls vom Fach?“ fragte der Lehrer. „Nein, ich glaube nicht. Er ist wohl Kaufmann, und das scheint auch zu reichen. Yolck Pharma lebt von diesen beiden Produkten. Es gibt keine Forschung, keine Neuerungen. Und irgendwann werden andere Firmen neue, bessere Medikamente auf den Markt bringen. Es gibt niemand, der das Erbe übernimmt.“ „Außer...,“ Dr. Scheer sagte es sehr leise, sehr vorsichtig, aber es musste gesagt werden, um dieses Jungen hier musste es ausgesprochen werden.
Mit einer raschen, fast unwirschen Handbewegung hatte Jason die Zettel beiseite gewischt, die vor ihm auf dem Tisch lagen. „Sie haben recht,“ sagte er, „aber bin ich dazu verpflichtet? Wäre Vater heute noch Leiter des Betriebes, ich würde ihm nachfolgen; nicht aus Familientradition, sondern weil es eine spannende Aufgabe wäre, weil es mich reizen könnte, aus den alten Rezepturen etwas ganz neues zu entwickeln. Wir haben eine Uni-Klinik, eine medizinische Fakultät, es gäbe viele Wege, zu kooperieren, sich auszutauschen, gemeinsam zu forschen, es gäbe durchaus eine Chance, auch den Pharma-Riesen mit ihren Großlaboren die Stirn zu bieten. Aber Yolck Pharma gehört einem anderen, einem Fremden. - Und mein Onkel ist ein Fremder für mich,“ fügte Jason hinzu, und es klang irgendwie bitter.
Sie schwiegen nun beide, und jeder suchte in Gedanken nach einem Wort, das jetzt nötig war, das weiterführen, helfen, einen Ausweg zeigen könnte. Dr. Scheer versuchte als erster einen solchen Weg: „Haben Sie eigentlich in letzter Zeit einmal mit Ihrem Onkel gesprochen? Wenn er solange Ihre Ausbildung finanziert hat, wird er doch auch Ihre weiteren Schritte begleiten müssen. Ich weiß nicht, ob er dazu verpflichtet ist – er ist schließlich auch in der Vergangenheit nie als Ihr Erziehungsberechtigter bei uns aufgetreten – aber es wird sicherlich eine andere Art von Pflicht geben. Bloßes Interesse an Ihnen als einem nahen Verwandten können wir nach allem, was Sie erzählt haben, doch wohl ausschließen.“
Jason blickte ihn an: „Es sind schon Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Ich glaube, es war am ersten Weihnachtstag. Ich war wohl zwölf oder dreizehn damals, und ich war über die Festtage im Stift bei meinem Vater – sie haben ein Gästezimmer dort, und meine Erzieher damals bestanden darauf, dass ich wenigstens zwei Tage nach Hause fahre. Ja, ich erinnere mich noch genau: Sie sagten 'nach Hause'. Es war so quälend, neben einem Mann zu sitzen, der mir nichts zu sagen hatte, der kaum nach mir fragte, nach meinem Leben hier, nach meinen Leistungen, meinem Wohlergehen. Es war deshalb auch mein letzter Besuch 'zu Hause.' Am ersten Feiertag kam dann Onkel Peer vorbei mit einem Präsentkorb für den Vater, um ihm ein frohes Fest zu wünschen. Für mich hatte er nichts dabei; er war wohl erstaunt, mich dort anzutreffen. Aber immerhin: Er hat mich ausgefragt nach Lenorenlund, sehr sachlich und eigentlich auch ganz freundlich, und doch hatte ich ständig das Gefühl, er wollte nur wissen, ob sich die Ausgaben für das Internat lohnen. Vielleicht war er auch bloß froh, mit jemand reden zu können, denn Vater war zu keinem Gespräch bereit. Seitdem bekam ich jedes Jahr zu Weihnachten ein Paket mit Süßigkeiten und einer Grußkarte, doch die war vorgedruckt und bloß unterschrieben. Ja, und zum Ende jedes Schuljahres einen Glückwunsch und einen Scheck. Ich glaube, er hat einfach vorausgesetzt, dass ich das Klassenziel auch erreicht habe.“
Jason stockte. „Mehr war nicht, Herr Dr. Scheer,“ setzte er dann noch hinzu. Der hatte einen Augenblick den dringenden Wunsch, diesen Jungen dort einfach einmal in den Arm zu nehmen, ihm Zuneigung zu signalisieren, doch er unterließ es. Es wäre gegen das Reglement des Internats gewesen, und es wäre vielleicht auch nicht gut gewesen. So nickte er ihm nur zu, füllte noch einmal die Gläser. Plötzlich fühlte er sich sehr hilflos.
„Sie meinen, ich sollte meinen Onkel kontaktieren?“ fragte Jason in die Stille hinein. „Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Zweck haben wird,“ gab Dr. Scheer nachdenklich zur Antwort, „aber es wäre zumindest einen Versuch wert. Und vielleicht erfahren Sie dann auch Näheres über den Grund Ihres Stipendiums.“ „Ich werde mich nicht dafür bedanken,“ sagte Jason energisch. „Ich weiß, dass er das Vermögen des Vaters an sich gerissen hat. Und letztlich wäre das mein Erbe gewesen.“ Sein Tutor nickte: „Ich kann Sie verstehen, und ich denke, Sie haben damit auch recht. Aber in erster Linie geht es um Ihre Zukunft, um Ihre finanzielle Sicherheit für die Zeit nach dem Abitur. Alles andere mag später geschehen – wenn Sie mehr wissen über das, was damals vorgefallen ist. Und von Ihrem Vater werden Sie es kaum erfahren, fürchte ich.“
Jason schob die Zettel hin und her, die er vor sich zu liegen hatte, dann nahm er einen zur Hand. „Yolck Pharma“ stand darauf, und darunter, mit einem Fragezeichen versehen: „Praktikum.“ Er reichte ihn seinem Lehrer und sah ihn fragend an. Dr. Scheer lächelte: „Keine schlechte Idee, Jason. Sie können Kontakt zu Ihrem Onkel aufnehmen, ohne sich etwas zu vergeben. Und er wird Ihnen einen solchen Wunsch kaum abschlagen können. Nebenbei lernen Sie das Werk kennen, und vielleicht gibt es dort ältere Mitarbeiter, die Ihren Vater noch gekannt haben, die etwas über die damaligen Umstände wissen, die zu diesem... Machtwechsel geführt haben. Vor allem aber: Ein Praktikum ist zeitlich befristet, es bindet Sie nicht, es lässt Ihnen alle Möglichkeiten offen – ein Studium, vielleicht sogar der Pharmazie, einen Eintritt in die Firma, wenn Sie das für richtig halten sollten, und...“ er zögerte einen Augenblick, aber dann sprach er es doch aus: „und möglicherweise sogar einen Rechtsstreit um Ihr Erbe, wenn das juristisch gesehen Erfolg haben könnte.“
„An Pharmazie habe ich auch schon gedacht, oder an irgendeine Kombination von Medizin, Chemie und Informatik – es gibt da ja ganz neue Studiengänge. Aber, Sie haben recht, erst einmal muss ich geklärt haben – für mich selbst geklärt haben – welches Interesse ich an Yolck Pharma habe, und welchen Anspruch ich darauf haben könnte. Wie ich mich dann entscheide, das weiß ich allerdings nicht.“ „Das müssen Sie auch nicht wissen, jedenfalls jetzt noch nicht. Gehen Sie möglichst ohne Vorgaben an die Sache heran, Jason. Und ebenso ohne Vorurteile. Auch Ihr Onkel sollte seine Chance haben. Halten Sie Ihre Seele frei von Bitterkeit – Sie sehen an Ihrem Vater, dass das ein ganzes Leben vergiften kann. Und... es wäre schade um Ihr Leben, Jason.“ Nun streckte der Lehrer doch seine Hand aus und griff nach der des Jungen, der immer noch mit seinen Zetteln spielte. „Und wenn Sie jemand brauchen, um zu reden, Sie wissen, dass Ihr Tutor auch nach dem Abi für Sie da sein wird. Nicht nur, weil es guter Brauch ist an unserer Schule.“
KAPITEL 4
Du lebst ja immer noch, Jason Yolck! Ich sehe dich doch im Spiegel, deutlich sehe ich dich! Oder lebst du nur noch, weil deine Antwort noch immer aussteht, weil du immer noch nicht weißt, wofür dein Leben gut war?
Ja, es ist wahr, ich lebe noch; und manchmal ist es schlimmer zu leben als tot zu sein. Denn ich muss meine Erinnerungen ertragen, ich muss das alles noch einmal leben, ohne es doch ändern zu können. Und ich muss ehrlich sein dabei. Da gilt keine Ausrede mehr – nichts lässt sich beschönigen, nichts lässt sich übermalen. Was grau ist, das bleibt auch grau, und wenn du einen ganzen Regenbogen darüber legst. Wo das rote Blut geflossen ist, da bleibt das Rot, unauslöschbar, da schreit es Tag für Tag, wie einst Abels Blut zum Himmel schrie. Ich lebe noch, sagst du? Oder ist das schon die Hölle – das ewige Erinnern, wo doch der Tod Vergessen bringen soll?
Lass dieses Klagen! Du weißt, dass du dich erinnern musst. Schau mich – schau dich an, genau, noch genauer! Ich bin deine Erinnerung, deine Vergangenheit. Was hast du zu sagen? –
Ist dir bewusst, Jason, Spiegelbild, dass sie dich alle immer nur ausgenutzt haben? -
Du willst deine Schuld auf andere abwälzen! Nimm endlich die Verantwortung auf dich und trage sie, denn du trägst sie für dein Leben. Ganz allein du!
Sie haben mich alle immer nur ausgenutzt, das ist und bleibt die Wahrheit. Onkel Peer, dieser schleimige Coldenius, Kristian Ohnne, alle. Und die Frauen. Ja, die besonders. –
Du stilisierst dich zum Opfer, Jason Yolck, zum unschuldigen Opfer. –
Nein, nicht unschuldig. Ich habe es ja zugelassen. Ich habe stets gedacht, ich sei ihnen überlegen, kenne ihre Tricks, ihre geheimen Absichten. Und ich habe geglaubt, ich hätte die besseren Tricks. Aber ich blieb der Ausgenutzte, der Missbrauchte, der Betrogene. Das fing doch schon in Lenorenlund an – mit Anita, dieser kleinen Hure. -
Ich denke, du hast sie geliebt, Jason Yolck? –
Das ist es ja! Liebe gegen Missbrauch, Vertrauen gegen Betrug, Hingabe gegen Ausbeutung. So war es immer. –
Und du hast nicht ebenso versucht, andere zu täuschen – zu deinem Vorteil, für deine Ziele? Und du willst nun alle Schuld auf andere schieben?