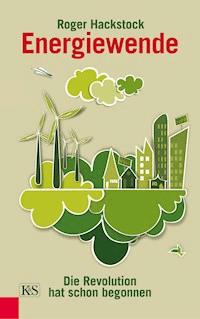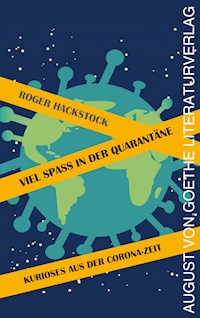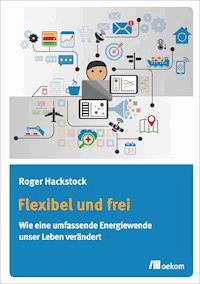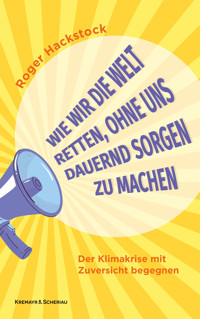
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das gilt auch für die Klimakrise. Empörung und Verzweiflung über die seit Jahrzehnten steigenden Treibhausgas-Emissionen und ihre Folgen für Mensch und Umwelt haben nichts gebracht. Im Gegenteil: Die Angst vor dem drohenden Klimakollaps lähmt und verhindert Veränderung. Roger Hackstock dreht den Spieß um: Er setzt auf Ironie, Humor und Zuversicht. Denn Lachen befreit und öffnet den Blick für neue Strategien. So wird das Bild einer klimaneutralen Zukunft, eines genussvollen Lebens ohne sinnlose Verschwendung von Ressourcen, lebendig. In seinem Buch schafft er Zukunftsbilder, die wir uns schon heute wünschen. Und nimmt uns mit auf eine Reise zu erfolgreichen klimaschonenden Projekten an den unterschiedlichsten Orten der Welt. Dieses Buch schenkt Mut, macht fröhlich und gibt die Kraft, hier und jetzt damit zu beginnen. Packen wir's an!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roger Hackstock
Der Klimakrise mit Zuversicht begegnen
Kremayr & Scheriau
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Kunst der Veränderung
Zukunft in bunten, lebendigen Bildern
Die schöne Welt von morgen
Die Jugend geht voran
Schauen wir nach Tikopia!
Ein neuer Kompass
Wirtschaft neu denken
Packen wir’s an!
Literatur
Vorwort
Darf man Witze über die Klimakrise machen? Aber sicher!
Treffen sich zwei Gletscher. Sagt der eine zum anderen: „Was hältst du vom Klimawandel, ob der uns schaden wird?“ Schüttelt der andere den Kopf: „Ich weiß nicht, wir werden Seen.“ Wenn ich meinen Bekannten bei Fridays for Future solche Witze erzähle, runzeln sie die Stirn und meinen, das Ganze sei aber nicht zum Lachen. Ich finde dagegen, dass gerade die Ernsthaftigkeit des Themas die Notwendigkeit schafft, sich darüber lustig zu machen. Mehr als 40 Prozent der gesamten Treibhausgase seit Beginn der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert wurden in den letzten 30 Jahren ausgestoßen, also seit der ersten Klimakonferenz in Rio de Janeiro im Jahr 1992. Hier scheint es einen eindeutigen Zusammenhang zu geben. Erst seit es Klimakonferenzen gibt, werden fossile Rohstoffe verbrannt wie nie zuvor. Das kann kein Zufall sein, oder? Die Übereinstimmung ist eindeutig …
Das ist natürlich Quatsch und der klassische Fall einer fehlerhaften Schlussfolgerung. Doch der ironische Vergleich erfüllt seinen Zweck, denn: Sich über die Klimakrise lustig zu machen heißt, Zusammenhänge zu übertreiben und absurde Schlüsse zu ziehen, die nicht nur zum Schmunzeln anregen, sondern auch den Reflex auslösen, es richtigstellen zu wollen, weil die Wahrheit eine andere ist. Damit kann man auch jene Menschen erreichen, die nicht von der Dramatik der Klimakrise überzeugt sind, den Witz aber als solchen verstehen.
Als der Weltklimarat IPCC im August 2021 seinen Bericht zur Klimaerwärmung veröffentlichte, kam die internationale Climate Group auf die Idee, alle großen US-Fernsehstationen zu fragen, ob sie den Klimareport in ironischen und heiteren Beiträgen kommentieren könnten. Nach anfänglichem Zögern sagten alle großen Talkshows des Landes zu, an einem Abend im September wurde auf allen Kanälen zur gleichen Zeit über die Erkenntnisse der Klimaforschung gescherzt. Die Moderatorinnen und Moderatoren verglichen den Klimawandel mit Fußball, von dem jeder und jede in Amerika weiß, dass „es draußen etwas gibt, was für den Rest der Welt wirklich wichtig ist, aber niemand kann uns dazu bringen, uns darum zu kümmern“. Ein Video zeigte eine – ernst gemeinte – Werbung des Ölkonzerns ConocoPhillips für den Plan, den gefrorenen Boden der Tundra von Alaska künstlich zu kühlen, um trotz Klimaerwärmung weiter nach Öl bohren zu können, ohne dass die Plattformen im Boden versinken. Was natürlich ein Schuss ins Knie wäre, das würde den Planeten weiter aufwärmen und den Permafrostboden erst recht auftauen.
Ein solches Satirevideo hätte auch zum Klimagipfel 2023 in Dubai gepasst. Der Gipfel wurde von einem Ölmanager geleitet, was bei Klimaforscherinnen und -forschern und Umweltorganisationen auf der ganzen Welt eine Welle der Empörung auslöste. In Wahrheit war es zum Lachen und brachte vor allem eine Gruppe ins Schwitzen, die von Witzen und Gags lebt, das Komische eines Klimagipfels im Ölland aber kaum mehr toppen konnte. Wer heutzutage Kabarettist oder Kabarettistin ist, hat echt ein schweres Leben. Es sei denn, er oder sie kommt auf die Idee, beim Klimaschutz nicht nur Menschen, sondern auch Tiere in die Pflicht zu nehmen, wie Christoph Fritz. Der 1994 geborene Jungstar der österreichischen Kabarettszene, bekannt für seine schüchterne Art, steht meist reglos auf der Bühne, fasst das Mikrofon mit beiden Händen und liefert staubtrockene Pointen ab, die in Verbindung mit seinem zurückhaltenden Wesen besonders komisch wirken. In seinem Programm „Das jüngste Gesicht“ stellt Fritz die Frage, ob das Publikum wisse, dass es inmitten der Klimakrise immer noch Tiere gibt, die jeden Winter mehrere tausend Kilometer in Richtung Süden fliegen. Als das Publikum zu lachen beginnt, blickt er tadelnd in den Saal: „Die machen das, um Urlaub zu machen. Da frage ich mich schon, können die nicht Bahn fahren? Und … äh … jetzt kommt die Pointe. Die heißen sogar Zugvögel.“ Bei diesem Witz muss Fritz selber lachen, wenn auch nur für eine Sekunde, mehr ist bei ihm nicht drin.
Die Klimakonferenz im Ölstaat war der Beweis, dass die Wirklichkeit jeden Gag längst überholt hat. Statt uns darüber zu empören, hilft es, uns lachend klar zu machen, wo wir gerade völlig falsch abgebogen sind, statt uns der Herausforderung zu stellen. Die gelöste Stimmung hilft im besten Fall, uns für Alternativen zu öffnen, die es anzupacken gilt, um die Klimakrise zu überwinden. Humor kann Blockaden lösen, besser als jede Moralpredigt. In der Geschichte der Menschheit wurden während der ärgsten Katastrophen immer Witze gerissen, wenn man nicht mehr weiterwusste. Ich bin in Wien geboren, wo man sich beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs damit tröstete, dass hier alles später und weniger schlimm kommt als anderswo. Ein Sprichwort lautete: „Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.“ Dazu soll Karl Kraus einmal gesagt haben: „Wenn die Welt untergeht, dann gehe ich nach Wien, dort passiert alles zehn Jahre später.“
Vielleicht ist diese Haltung der Grund, warum die Stadt Wien im Jahr 2023 zum elften Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt wurde. Weil die großen Katastrophen der Welt hier immer irgendwie ausbleiben. Zumindest glauben das jene, die hier leben.
Weniger Empörung, mehr Zuversicht
In den letzten 30 Jahren sind die Treibhausgasemissionen weltweit unaufhörlich gestiegen. Sich ständig darüber zu empören und an den Beharrungskräften abzuarbeiten, die der Veränderung im Weg stehen, hatte nicht den erwünschten Erfolg. Die ersten fünf Berichte des Weltklimarates haben klare Botschaften gesandt, die Warnungen wurden immer eindringlicher. Doch das hat niemanden auf die Straße gebracht. Erst die 15-jährige Greta Thunberg fand die rechten Worte, um junge Menschen mitzureißen und zu Schulstreiks auf der ganzen Welt zu bewegen. Die Plakate bei den Klimademos waren durchwegs humorvoll und nahmen Anleihen bei Blockbustern, bei Lokalbesuchen („Was haben Bier und Klima gemeinsam? Beides ist scheiße, wenn es warm wird“), beim Schulalltag und dem Schicksal der Dinosaurier.
Es gilt, diesen Ball aufzugreifen und die bestehenden Verhältnisse nicht mit Aggression, sondern mit Ironie und Zuversicht zu kommentieren. „Es gibt viele Wege zum Glück – einer davon ist, aufhören zu jammern“, soll schon Albert Einstein gesagt haben. Halten wir uns nicht mit ausschweifenden Betrachtungen der aktuellen Probleme auf, sondern fordern wir selbstbewusst eine nachhaltige Zukunft ein. Nicht als ferne Vision, sondern als Alltag heute. Manche zweifeln daran und meinen, dass dies nicht so einfach sei und man die Menschen „vor zu viel Veränderung schützen“ müsse. Denen können wir gelassen entgegnen, dass eine Änderung der Verhältnisse zwar eine Änderung von Gewohnheiten mit sich bringt, wir das aber im Laufe unseres ganzen Lebens durchmachen. Sonst würden wir mit 50 Jahren noch immer die Nächte durchfeiern wie mit 20, was wir klugerweise sein lassen, weil wir uns nicht mehr so schnell erholen. Wer Veränderungen prinzipiell für unzumutbar hält, hat jedenfalls ein seltsames Menschenbild.
Was mich persönlich betrifft, so ist mein Engagement vom Wunsch getrieben, dass es meinen zwei Kindern in der Zukunft einmal besser gehen soll. Wer möchte das nicht? Was ich ihnen in ihrem künftigen Leben ersparen will, ist die Bedrohung durch die Klimakrise und die Sorgen wegen der fossilen Energien. Meine Vision: Im Jahr 2050, die heutige Jugend ist dann längst erwachsen, ist der Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter kein Thema mehr, das Damoklesschwert der Zwei-Grad-Grenze beim Klimaschutz ist verschwunden. Nur noch Historikerinnen und Drehbuchschreiber beschäftigen sich mit der deprimierenden Klimavergangenheit, im Alltag macht sich niemand mehr Gedanken, ob die Sachen im Supermarkt regional und klimaneutral sind. Etwas anderes gibt es nicht mehr zu kaufen. Die extremen Wetterkapriolen der heutigen Zeit haben an Häufigkeit abgenommen, ein klimagerechtes Leben ist unaufgeregte Normalität. Die Menschen finden die Welt in einem Zustand vor, der ihnen nicht ständig auf den Kopf zu fallen droht. Wie jede Generation werden unsere Kinder natürlich ihre Sorgen haben – die Klimakrise gehört nicht mehr dazu. Das ist das Geschenk, das wir der nächsten Generation machen können, wenn wir wollen. Dafür lohnt es sich, die Ärmel aufzukrempeln und die Dinge in die Hand zu nehmen, statt sich in endlosen Diskussionen über Sinn und Unsinn von Klimaschutzmaßnahmen zu verstricken. Mit reden allein wird es für unsere Kinder sicher nicht besser, so viel steht fest. Wir müssen schon etwas dafür tun – und sollten dabei nicht den Humor verlieren. Davon handelt dieses Buch, viel Spaß!
Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.
FRIEDRICH SCHILLER
Die Kunst der Veränderung
„Bio Dino Chicken Nuggets, klar, aber nicht vegan. Vegane Dino Chicken Nuggets, aber nicht bio! Vegane Bio Chicken Nuggets, aber leider nicht Dino. Vegane Bio Dino Nuggets, aber nicht mit Chicken? Vegane Bio Dino Chicken, endlich – aber keine Nuggets!“ Bernie Wagner stand vor dem Regal im Bio-Supermarkt und war verzweifelt. Seine Freundin hatte ihn einkaufen geschickt, um die von ihr geliebten veganen Bio Dino Chicken Nuggets zu besorgen. Doch er fand nur Abwandlungen davon, das würde daheim wieder für Diskussionen sorgen. Die Freundin war eine Ökofluencerin, sie verdiente sich ihren Lebensunterhalt damit, anderen Menschen im Internet zu erklären, wie man nachhaltig lebt. Bernie war Mitte 30 und fand, man könne die Sache mit dem Klimaschutz auch übertreiben, vor allem, wenn er gerade ratlos vor dem Bioregal stand.
Eines Tages äußerte seine Freundin beim Frühstück den Wunsch, sich einen Hund zu kaufen. Bernie mochte Hunde gar nicht. Das brachte ihn auf die Idee, sie mit ihren eigenen Vorsätzen zu konfrontieren.
Bernie Wagner: So ein Hund, ist der nachhaltig? Hat der nicht auch einen CO2-Pfotenabdruck?
Seine Freundin: Der individuelle CO2-Fußabdruck ist ein Propagandainstrument, das die Firma BP entwickelt hat, damit wir uns als Einzelpersonen schlecht fühlen, statt zusammen systemischen Wandel gegen die Ölkonzerne voranzutreiben!
Bernie Wagner: Bist du deppert, es ist wirklich immer eine Gaudi mit dir.
An dieser Stelle bricht regelmäßig Lachen im Saal aus. Das Erlebnis mit der Freundin ist Teil des Programms „Galápagos“, in dem sich der Kabarettist Bernie Wagner über die Verbissenheit lustig macht, die Klimaschützer und Aktivistinnen oft an den Tag legen, wenn sie sich gegen die fossile Welt stellen. Wenn wir über etwas lachen müssen, dann meistens, weil beide Seiten einer Geschichte erkennbar werden, die Spannung zwischen den Polen ist das, was amüsiert. Ich meine damit nicht Galgenhumor à la Dieter Nuhr, der auch zu Lachern führt, aber nur wenig zur Überwindung von Vorurteilen beiträgt. Als Nuhr seinen Jahresrückblick 2019 der Fridays-For-Future-Bewegung widmete, die gerade ihren Höhenflug erlebte, erzählte er, dass auch seine Tochter an den Demonstrationen teilnehme. Um sie „aus tiefstem Herzen zu unterstützen, werde ich im kommenden Winter darauf verzichten, das Kinderzimmer zu heizen“, meinte er grinsend und fand diesen Witz lustig, weil er den Widerspruch auf den Punkt bringe, so Nuhr, dass eine Jugend, die in einer Zeit der Vollversorgung aufwächst, jeden Freitag auf die Straße geht, um gegen diese Vollversorgung zu demonstrieren. Das war natürlich Unsinn, die Jugendlichen protestieren nicht gegen den gesellschaftlichen Wohlstand per se, sondern dagegen, ihn weiter mit fossiler Energie zu betreiben.
Dabei begegnen sie dem Thema mit erstaunlichem Humor. Statt auf den Plakaten apokalyptische Bilder zu zeigen, werden etwa „Kurzstreckenflüge nur für Insekten“ gefordert. Die Missachtung der Klimaforschung wird damit kommentiert, dass „jeder Katastrophenfilm damit beginnt, dass Warnungen von Wissenschaftlern in den Wind geschrieben“ werden. Manche Jugendliche bringen ihr Erstaunen zum Ausdruck, dass sie tatsächlich für die Anerkennung von Fakten auf die Straße gehen müssen. Andere finden, ein schlechtes Plakat sei genau die richtige Antwort auf die Art von Klimapolitik, die ihnen begegnet: So stand etwa beim Klimastreik am 24. September 2021 in Wien auf einem billigen Pappendeckel in krakeliger Schrift zu lesen: „Eure Klimapolitik ist so erbärmlich wie dieses Plakat.“
Den Vorwurf, sie würden ihre schulischen Verpflichtungen wegen der Streiks vernachlässigen, kontern sie mit der Aufforderung an die Erwachsenen, „eure Hausaufgaben zu machen, dann machen wir unsere“. Die meisten der protestierenden Jugendlichen sind im 21. Jahrhundert geboren und können sich leicht ausrechnen, was sie im Jahr 2100 erwartet, wenn die Klimakrise unvermindert fortschreitet. Die Modelle der Klimaforschung zeigen in diesem Fall eine Welt weit außerhalb der klimatischen Komfortzone, die unsere Zivilisation ermöglichte. Der US-amerikanische Klimaforscher Michael E. Mann hat in seinem Buch „Moment der Entscheidung“ anschaulich beschrieben, warum die Erde eigentlich seit 10.000 Jahren auf dem Weg in eine neue Eiszeit sein müsste, unsere Vorfahren aber mit Reisanbau, Viehzucht und Brandrodung so viele Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre entließen, dass die globale Durchschnittstemperatur in den letzten 6000 Jahren fast konstant blieb. Natürlich gab es in der langen Zeit von der ersten Hochkultur der Sumerer bis heute immer wieder Wetterextreme, sie spielten sich aber innerhalb einer globalen Temperaturschwankung von plus/minus einem Grad Celsius ab. Mit der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle haben wir den Thermostat weiter hochgedreht, die Temperatur bleibt nicht mehr in diesem Rahmen, sondern hat 2024 die Plus-1,5-Grad-Marke überschritten. Geht es so weiter, ist das Klima bis Ende des Jahrhunderts in allen Modellen im roten Bereich, die Wetterextreme werden total aus den Fugen geraten, mit heute unvorstellbaren Folgen. Für die Jugend ist es klarerweise keine Option, das einfach abzuwarten.
Doch zurück zum Humor in der Klimakrise. Manchmal geschieht dieser unfreiwillig, wie im Magazin VIA Airport des Grazer Flughafens. Darin fand ich einen Artikel, der mich stutzig machte. In der Öffentlichkeit stehe dauernd der eigene Lebensstil zur Debatte, stand da, man solle weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren und weniger fliegen, um den Planeten zu retten und „unser eigenes gesundes Überleben zu sichern“. Doch es gebe Themen, die ebenso wichtig seien, aber nicht angetastet würden, weil sie einfach zu „reizend“ seien. Ich runzelte die Stirn: Welches Thema könnte das sein? Auf die folgende Idee muss man erst einmal kommen: Es war ein kleines, flauschiges Tier, das bei vielen Menschen zu Hause herumstreunt – der Stubentiger! Eine Hauskatze verursacht pro Jahr beachtliche 300 Kilogramm Treibhausgase, mehr als ein Flug nach Mallorca. Grund dafür ist das Dosenfleisch, das der Katze regelmäßig vorgesetzt wird. Wer also etwas unternehmen will, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern, beginnt am besten zu Hause – bei der Ernährung seiner Katze! Man stelle das Haustier auf regionales Obst und Gemüse um, und schon ist der Flug nach Mallorca kompensiert, das Klima gerettet. Schnurr! Ich fand diese Geschichte sehr erheiternd. Allerdings beschlich mich der leise Verdacht, die Redakteurin könnte das ernst gemeint haben.
Als Quelle für den Dosenfleisch-Vergleich wird das Buch „100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern“ von Tin Fischer und Mario Mensch zitiert, in dem überraschende Fakten aus allen Lebensbereichen in anschauliche Grafiken gepackt sind, die zum Schmunzeln anregen. So ist etwa der Südpol der verwirrendste Kontinent, weil man immer nach Norden gelangt, egal in welche Richtung man losgeht. Eine Weltkarte mit winzigen farbigen Quadraten wiederum zeigt, wie wenig Platz notwendig wäre, um die ganze Menschheit mit Solarstrom oder Strom aus Windkraftwerken zu versorgen. Eine andere witzelt darüber, dass es uns zwar stört, wenn das Eis, das wir gerade schlecken, schmilzt, das Schmelzen arktischer und antarktischer Gletscher uns aber vollkommen egal ist. Meine Lieblingsgrafik ist eine blaue Doppelseite mit einem einzigen schwarzen Punkt, neben dem „Everest-Insel“ steht – das ist alles, was nach einem Meeresspiegelanstieg von 8800 Metern übrigbleibt. „Nur Reinhold Messner hätte überlebt“, steht darunter, der Rest der Welt sei unter Wasser
Im Jahr 2023 wurden Karikaturistinnen und Karikaturisten aus aller Welt eingeladen, ihre besten Arbeiten zum Thema Klimawandel für den Kaktus-Cartoon-Award einzureichen. Der Preis wurde von der Schule des Ungehorsams verliehen, einer vom österreichischen Karikaturisten Gerhard Haderer im Jahr 2017 ins Leben gerufenen Einrichtung. Cartoons setzen sich kritisch und humorvoll mit einem Thema auseinander, in einer Sprache, die alle Menschen über alle Kulturen hinweg verstehen. Das war auch beim Klimathema der Fall, mehr als 1700 Einreichungen aus 80 Ländern trafen ein. „Wir waren über die Anzahl selbst überrascht“, erzählt die Organisatorin Julia Haderer. Die Zeichnungen bringen komplexe Sachverhalte humorvoll und überspitzt auf den Punkt und sind schnell zu erfassen. Da wird am Heck der halb versunkenen Titanic diskutiert, ob es „auch Studien gibt, nach denen wir nicht untergehen“ (der Cartoon gewann den ersten Preis), ein Kreuzfahrtschiff passiert am Nordpol Eisberg-Attrappen aus Holz und ein Vater erklärt seiner erstaunten Tochter beim Wenden der Würstel auf dem Grill, dass er „natürlich für ‚Fridays for Future‘ ist, aber heute ist Donnerstag“. Die Cartoons begegnen der Klimakrise mit Heiterkeit und regen zum Nachdenken an, ohne erhobenen Zeigefinger.
Manchmal fehlt mir die poetische Betrachtung der Klimakrise. Gedichte können amüsieren, man erkennt oft erst hinterher das Ernsthafte, die Weisheit, die in den Texten steckt, wie Kurt Tucholsky einmal gemeint hat. Ab und an greife ich selbst zur Feder und verfasse Reime zur Klimakrise und den Erneuerbaren, stets mit einem Augenzwinkern am Ende (eine lyrische Verzweiflungstat, könnte man sagen). In meinen Gedichten erhielt jede Energiequelle, von Sonne, Wind, Wasser und Holz bis Biogas, einen Reim, was meine Kolleginnen und Kollegen im Haus der Erneuerbaren Energie (wo ich arbeite) erst die Stirn runzeln, am Ende aber doch lächeln ließ. Selbst die fossilen Energien bekamen Reime ab, ich nannte sie „Abschiedsgedichte“, wo sie widerwillig das Feld räumen und schließlich den Heldentod sterben.
Im Herbst 2021 durfte ich mit meinen Gedichten den GLOBAL 2000 Umweltslam in Wien eröffnen, weil sie „so gut zum Thema passen“, wie es hieß. Ich nahm es als große Ehre, den Auftakt zu einem Poetryslam zu bestreiten, dessen Teilnehmerinnen halb so alt waren wie ich. In der Einladung stand, die Texte sollten „Umweltschutz mit Poesie verbinden“ und Visionen einer klimagerechten Zukunft präsentieren, wobei alles erlaubt war, was Unterhaltung bot. Die Siegerin slammte über die U-Bahn in Wien, die typischen Fahrgäste jeder einzelnen Linie wurden auf unterhaltsame Weise porträtiert. Mein Favorit war ein Text von Alexander Hoffelner mit dem Titel „Methan rief die Kuh und stürzte sich in die Schlucht“, der das Klimathema in herrlich absurder und dadaistischer Form behandelte. Die Geschichte beginnt mit einer Kuh, die wegen der hohen Methanemissionen des auftauenden Permafrostbodens ins Weltall geschleudert wird, wo sie am Mond zerschellt. Als Gott das sieht, ist er erbost: Die Menschen hätten es zu weit getrieben. Schließlich hatte er sie in den Garten Eden gesetzt, wo sie „only two jobs“ hatten: Bauen und bewahren. „Bauen und bewahren, nicht zerstören!“ Nach turbulenten Ereignissen, die man nicht zusammenfassen kann, dafür ist die Geschichte zu chaotisch, ruft eine weitere Kuh „Methan“ und stürzt sich in die Schlucht, von wo sie zum Mond geschleudert wird und dort zerschellt. Es war bereits das 22. Rind in dieser Woche und es war erst Montag.
Ich fand diese kuriose Überhöhung der Klimakrise großartig, trotz des ernsten Themas war sie erheiternd und amüsant. Im Grunde zeigte sie, in welch absurde Situation wir uns manövriert haben, die im Grunde niemand glauben kann. Der Poetryslam war ein Versuch, das Thema nicht Expertinnen und Experten, sondern Jugendlichen zu überlassen, mit nur vagen Vorgaben und offenem Ausgang. Das Resultat war ganz anders als bei sonstigen Veranstaltungen, an denen ich teilnahm. Trotz allen Humors wurde zwischen den Zeilen deutlich, worum es ging, ganz ohne Powerpoint. In ähnlicher Weise hatte ich meine Gedichte verfasst, wie jenes, das von meinen Problemen im Beruf handelte.
Naked Sun
Solaranlagen find ich toll,
im Job beschäftigt mich das voll.
Privat sind sie ein Partykiller,
sprech ich davon, wird es gleich stiller.
Wie schafft man’s, dass das Thema packt –
muss man erzählen davon nackt?
Lachen über die Klimakrise
Die Satiresendung „Die Anstalt“, die seit 2014 im deutschen Fernsehsender ZDF ausgestrahlt wird und viele Menschen erreicht, ist der lebende Beweis dafür, dass man Humor auch zur Aufklärung nutzen kann. In einer Sendung aus dem Jahr 2019 dient die Kommandobrücke des Traumschiffs „MS Veränderung“ als Bühne, auf der Kapitän und Besatzung vom Wissenschaftler Isaac Newton, der eine Lockenperücke trägt und in vielen Folgen auftritt, mit kritischen Fakten zur Klimapolitik in Deutschland konfrontiert werden. Der Kapitän vertritt die Regierung, die Besatzung die Expertinnen und Lobbyisten der Energiebranche. Auf unterhaltsame Weise erfährt man die Hintergründe der schleppenden Energiewende, warum es immer wieder zu Vollbremsungen bei Windkraft und Solarstrom kommt und wie die Bevölkerung bei den Abgaswerten von Verbrennungsmotoren in die Irre geführt wurde. Wie immer wurde die Sendung live vor Publikum gespielt, bei Pointen brach lautes Lachen im Saal aus. So war es auch, als Newton sagte: „Sie haben 80.000 Arbeitsplätze in der Solarenergie geopfert, um im Gegenzug 6000 Beschäftigte in der Kohlebranche zu retten.“ Die Antwort des Kapitäns: „Aber die Jobs in der Braunkohle sind viel wertvoller, weil die sind ja nicht erneuerbar!“
In einer anderen Folge begegnet Angela Merkel Isaac Newton beim Wandern. Es wird eine Grafik zum Ausbau der Solarenergie eingeblendet, die im Jahr 2013 einen ungewöhnlich starken Einbruch zeigt. Newton wirft einen kritischen Blick auf die Kanzlerin: „Schauen Sie mal hier, nach 2012, was ist denn das für ein Einbruch da?“ Merkel räuspert sich und antwortet: „Das, ah das, das ist der Altmaier-Knick.“
Newton berührt den Bildschirm und es erscheint ein Bild des damaligen Umweltministers Peter Altmaier, was Gelächter im Saal hervorruft. Altmaier hatte nach drei erfolgreichen Jahren die Förderung für Solarstrom stark gekürzt, was den Markt entgegen aller Ausbauziele absacken ließ. Man könnte aus dem Stoff eine journalistische Aufdecker-Story machen, die Form der Satire war aber besser geeignet, die Erkenntnisse und Zusammenhänge zu vermitteln, ohne beim Publikum Gefühle von Ohnmacht und Verärgerung hervorzurufen. Der Altmaier, denkt man sich, das ist typisch! Das kommt raus, wenn Politikerinnen und Politiker auf die fossile Lobby hören. Die Lobbys werden wir nicht ändern, also muss man bei der Politik ansetzen. Wieso hat Altmaier nach drei Jahren plötzlich die Reißleine gezogen, was war der Grund? Wer hat auf ihn Druck gemacht? Die Mächtigen vor den Vorhang zu holen und über sie Witze zu reißen, stellt ihre Machtposition stärker infrage, als empörte Fachartikel zu schreiben. Mächtige sind sehr empfindlich, wenn man über sie lacht, weil sie das, im Gegensatz zur Empörung, in ihrer Position schwächt. Empörung dagegen macht sie stärker.
Wie wäre es, wenn alle Fernsehsender solche Satirebeiträge bringen würden, vielleicht sogar gleichzeitig? Wie im Vorwort geschildert, hatten es die Organisatorinnen und Organisatoren der Climate Week NYC satt, in nächtelangen Debatten den Stillstand beim Klimaschutz zu bejammern, ohne damit je die Bevölkerung zu erreichen. Es war die Idee des gut vernetzten Produzenten und Autors Steve Bodow, alle großen US-Fernsehstationen zu fragen, ob sie das Klimathema im Rahmen der Climate Week in ihren Talkshows ausnahmsweise mit ironischen und heiteren Beiträgen kommentieren könnten. Überraschenderweise sagten alle zu, die Klimakrise wurde sogar zur besten Sendezeit platziert. Mehr als 20 Millionen Menschen verfolgten dieses historische Ereignis, als ihnen die Moderatorinnen und Moderatoren am 22. September 2021 mitteilten, dass sie heute mehr zum Klimathema erfahren würden und dem auch durch Umschalten nicht entkommen könnten („You Can’t Change the Channel!“). Von Stephen Colbert’s Late Show über die Daily Show von Trevor Noah bis Samantha Bee’s Full Frontal und der Tonight Show von Jimmy Fallon waren alle Quotenbringer dabei. Stephen Colbert wies auf die Tatsache hin, dass nur die Hälfte der über 65-Jährigen sehr besorgt über die Klimakrise sei, was zufällig dem Altersschnitt der US-Senatoren entsprach. „Wenn wir wirklich etwas beim Klimaschutz erreichen wollen, müssen wir ältere Amerikanerinnen und Amerikaner davon überzeugen, sich darum zu kümmern“, folgerte er daraus. Der Bildschirm verwandelte sich ein altes Fernsehgerät aus den 1950er-Jahren, Colbert rückte in Schwarz-Weiß seine Brille zurecht und sprach die Senioren unter den Zuseherinnen an: „Ihre Enkel sorgen sich wirklich um dieses Erden-Zeugs, selbst die Enkelin mit den grünen Haaren und den aufgerissenen Jeans, Sie sollten auf sie hören!“
Jimmy Kimmel verglich die Bevölkerung in seiner Late Night Show Jimmy Kimmel Live! mit „einem Haufen Golden Retriever, die in den Autos auf dem heißen Parkplatz sitzen, deren Besitzerinnen und Besitzer sich weigern, die Fenster herunterzukurbeln“. Zum Video des Ölkonzerns ConocoPhillips, von dem schon weiter oben die Rede war, wurde am Ende sarkastisch verkündet, der Konzern werde auch dann nicht aufgeben, wenn „das Essen durch die Klimakrise knapp wird – dann wenden wir uns dem Kannibalismus zu, laben uns an Menschenfleisch und bohren weiter, bis die Erde zerstört ist und alle tot sind“. Die Versuchung, beim Klimathema in apokalyptische Visionen abzudriften, ist offenbar sehr groß. Eine Telefonnummer erschien und der Moderator forderte die Zuseherinnen und Zuseher auf, ihre Kongressabgeordneten anzurufen und den Beschluss von Gesetzen für eine saubere Energiezukunft einzufordern. Dabei setzte er ein Lächeln auf und warnte, dass „wir diejenigen als Erste essen, die nichts gegen die drohende Katastrophe unternommen haben, wenn dann die Nahrungsversorgung knapp wird“. Trevor Noah sprach das TV-Publikum auf der persönlichen Ebene an und verkündete, die Klimakrise werde die Produktion von Kaffee, Bier und Wein dramatisch reduzieren. Das hätte drastische Auswirkungen auf unseren Alltag, wobei er meinte, Kaffee habe ihm nie wirklich geschmeckt, zumindest das könne er leicht verkraften. Auch James Corden setzte in seiner Late Late Show auf Ironie und berichtete vom Vorhaben bei Lego, nur mehr Steine aus recycelten Plastikflaschen herzustellen. „Ob die dann genauso wehtun, wenn man draufsteigt, ist nicht bekannt“, meinte er lächelnd.
Solche Aktionen sind wichtig, wir brauchen bunte Geschichten, die uns das Klimathema auf andere Weise näherbringen, als es der trockene Bericht eines Weltklimarates vermag.
Ich würde mir wünschen, dass Romanautorinnen und -autoren wie David Safier sich des Themas annehmen, dessen Bücher auf amüsante Weise schildern, wie es Menschen geht, die einer unerwarteten Veränderung ausgesetzt sind. Sein im Jahr 2021 erschienenes Buch „Aufgetaut“ war ein erster Versuch in diese Richtung. Es erzählt die Geschichte von Urga, einer Steinzeitfrau, die gemeinsam mit einem Babymammut 33.374 Jahre lang in einem Eisblock gefangen war. Der Eisblock kollidiert mit einem Kreuzfahrtschiff, eine offensichtliche Hommage an die Titanic, er wird an Bord geholt und im Kühlraum verstaut. Eine Firma namens Cyrogen eilt mit Militärhubschraubern zum Schiff, übernimmt gegen den Willen des Kapitäns das Kommando und taut die Steinzeitwesen auf. Ein Start-up-Gründer und seine elfjährige Tochter, die sich auf dem Schiff befinden, schaffen es gemeinsam mit dem bärtigen alten Kapitän, die Steinzeitwesen aus den Klauen des Militärs zu befreien. Es beginnt eine abenteuerliche Flucht, bei der sich die Steinzeitdame Urga erstaunlich schnell an die völlig veränderte Welt und die neue Umgebung gewöhnt, auch an die ungewohnte Sprache, deren Wörter sie ständig verdreht, was zu amüsanten Dialogen führt. Das kleine Mammut hat es schwerer, es fühlt sich einsam, schließlich ist es das einzige Mammut auf der Welt. In der Geschichte geht es ums Einfrieren und Auftauen, um Liebe und die Suche nach dem Glück. Dem Start-up-Gründer wird im Lauf der Geschichte klar, dass seine Suche nach der optimalen Glücks-App bedeutet, den Menschen zu helfen, sich an den schönen Seiten des Lebens zu erfreuen, statt ständig an den schlechten zu verzweifeln.
Es braucht mehr solche Geschichten, in denen Menschen in die Zukunft katapultiert werden, am besten in eine klimaneutrale Zukunft, in der sie amüsante Abenteuer bestehen, die uns zum Schmunzeln bringen. Ich meine damit nicht belehrende Beispiele wie den Roman „Journey to the Future – A Better World is Possible“ von Guy Dauncey, in dem ein 25-jähriger Kanadier auf wundersame Weise im Vancouver des Jahres 2032 landet und auf eine völlig veränderte Welt trifft. Er begegnet Menschen, die ihm von Selbstverwaltung und Nachbarschaftshilfe erzählen, von Permakultur und kooperativen Wirtschaftsmodellen, die den Alltag bestimmen. Die Straßen sind wesentlich schmaler als heute und von Bäumen, Bänken und Spielplätzen gesäumt. Die Energie wird zur Gänze erneuerbar erzeugt, die Abfälle sind auf ein Minimum reduziert, Treibhausgase spielen fast keine Rolle mehr. In der Medizin haben sich alternative Behandlungsmethoden durchgesetzt, gesunde Ernährung hat bei der Bevölkerung oberste Priorität. Was den Kanadier am meisten verblüfft, ist die Veränderung in der Politik, die insgesamt sehr weiblich geworden ist. Auch in diesem Roman lebt sich der Mensch aus der Vergangenheit schnell in der Zukunft ein, er verliebt sich sogar und wäre gern geblieben, wird aber unvermittelt wieder ins Vancouver des Jahres 2012 zurückkatapultiert. Am Abend vor seiner Rückkehr in die Vergangenheit sinniert er über die erstaunliche Unbeschwertheit der Menschen, die ihm begegnet sind, ihr Selbstvertrauen und ihren positiven Blick aufs Leben. Die Begegnungen im Buch dienen jedoch eher dem Vermitteln von Fakten als einer Erzählung, wie es sich im Alltag einer klimaneutralen Zukunft lebt. Da hoffe ich schon eher auf Autoren wie Safier oder eine Neuauflage von „Raumschiff Enterprise“, um uns eine klimaneutrale Welt emotional näherzubringen.
Humor statt Trauer und Verzweiflung
Vielen Menschen schlägt die Klimakrise aufs Gemüt, es gibt sogar schon Psychologists for Future, die jenen Menschen helfen, die wegen der dauernden Nachrichten über Wetterextreme von Angststörungen und Depressionen geplagt sind. Vor allem junge Menschen sind betroffen, wie Stephan Heinzel berichtet, der an der Technischen Universität Dortmund zum Thema Klimakrise und psychische Gesundheit forscht. „Jeder zweite Befragte zwischen 16 und 25 Jahren macht sich große oder extreme Sorgen wegen der Klimakrise“, so Heinzel in ZDFHeute, was sich in Zorn, Hilflosigkeit und Schuldgefühlen manifestiert. Umso erstaunlicher ist der Humor, den die Plakate der Jugendlichen bei den Klimademos zeigen. Humor kann „ein Schild, eine Abwehr, eine Methode der Verarbeitung von Zuständen“ sein, wie der Journalist Peter Kaiser im Zusammenhang mit dem jüdischen Witz im Deutschlandfunk Kultur schreibt. Das gilt auch, wenn man sich die scheinbare Ausweglosigkeit der Klimakrise vor Augen führt. Man kann verzweifeln oder ein Plakat „Love is in the air!“ hochhalten – wobei „Love“ durchgestrichen und durch „CO2“ ersetzt ist. Ersteres wünschen wir uns alle, Letzteres steht uns dabei im Weg. Was für eine Motivation für Klimaschutz!
Vor Jahren nahm ich am Begräbnis eines lieben Kollegen teil, den ich sehr gemocht hatte. Dabei erlebte ich, wie Humor auch in schwierigen Zeiten helfen kann, belastende und traurige Momente zu verdauen. Es waren fast hundert Freunde und Kolleginnen gekommen, sein