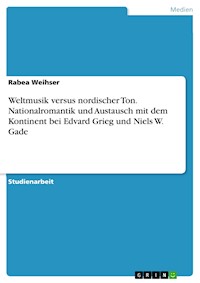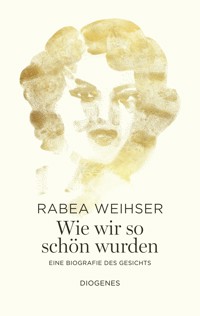
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nichts fesselt unseren Blick wie ein Gesicht. Ist es freundlich, offen, schön? Ungeschminkt, bearbeitet, entstellt? Zieht es uns an, stößt es uns ab? Und warum? Wie sich Menschen zurechtmachen, verrät viel über ihre Sehnsüchte, aber auch über die Gesellschaft, in der sie leben. Von den großen Augen der Pharaonen bis zu den glatten Oberflächen der Social-Media-Beautys führt uns Rabea Weihser durch den verrückten und schillernden Kosmos der Idealvorstellungen. Diese aufregende Expedition zum Grund unserer ästhetischen Vorlieben verändert den Blick auf die Schönheiten und Gesichter unserer Zeit. Gewitzt, anregend, bereichernd.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rabea Weihser
Wie wir so schön wurden
Eine Biografie des Gesichts
Diogenes
Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak Are you smart?
Vor dem Spiegel
Man könnte davon ausgehen, dass wir im Laufe der Jahrtausende immer schöner geworden sind. So viel Medizin, so viel Kosmetik und Technik – Zivilisation ist einfach die allerbeste Erfindung. Wir schauen in den Spiegel und wissen: Der Fortschritt ist mit uns. Wir müssen ihm nur sagen, wie er aussehen soll. Roter Lidschatten, rasierte Augenbrauen, ausgehöhlte Wangen, aufgefüllte Jochbeine oder einfach so, wie es kommt? Alles geht. Und morgen kommt und geht schon wieder was anderes.
In den vergangenen 15 Jahren hat sich das Gesicht des globalen Nordens, der US-amerikanisch geprägten Welt rasant verändert. Diese Entwicklung ist nicht zu trennen von der Verbreitung des Smartphones, der wachsenden Bedeutung sozialer Medien und den Marktlogiken, die darauf aufbauen: Das Gesicht passt perfekt auf den Handybildschirm, das Selfie passt perfekt in den Hochkant-Instagram-Feed, und soziale Medien passen perfekt in das Werbekonzept der Kosmetikindustrie. Menschen, die von diesem System beeinflusst sind, gestalten ihre Gesichter mit zunehmendem Aufwand. Und möglicherweise erleben wir gerade den ästhetischen Zenit. Da hat sich der Homo sapiens ganz ohne Pilates aus dem Vierfüßlergang emporgearbeitet, nur um auf der Höhe seines Fitnessbewusstseins in eine rundliche Buckelhaltung zu regredieren: Er kann seinen Blick einfach nicht mehr vom Smartphone abwenden. Geht es jetzt etwa auch mit der Schönheit des Menschen abwärts?
Moment, welche Schönheit überhaupt? Die sich auf Gene und feinstes Quellwasser beruft oder die mit den erfundenen Lippen und der Haut unter Hochspannung? Es gibt unzählige Spielarten. Und manche Moden sind so flüchtig, dass sie sich auflösen, sobald wir glauben, sie begriffen zu haben. Andererseits gibt es Ideale, die wir so gut kennen, dass wir ihre Koordinaten im Halbschlaf runterbeten können: jaja, Symmetrie, na klar, Goldener Schnitt, die alten Griechen sowieso.
Zwischen Antikenverehrung und den Irritationen unseres mediatisierten Alltags liegen eine Menge loser Fäden, aus denen sich neuer Stoff weben lässt. Zum Beispiel eine Biografie des schönen Gesichts. Am Anfang jeder Biografie steht der Wunsch, ein Wesen zu verstehen. Das Gesicht unserer Gegenwart ist ein schillerndes, beeindruckendes, bedeutungsvolles und komplexes Wesen. Es setzt sich aus einer Unmenge einzelner Gesichter zusammen. Jenen, die uns täglich direkt umgeben, und jenen, die wir auf Bildschirmen oder in Zeitschriften sehen. Wie sie zurechtgemacht sind, verrät uns viel über die Zeit, in der wir leben. Wenn wir es denn entschlüsseln können. Oft genug stehen wir dem Ergebnis ratlos gegenüber. »Warum wollen die jetzt alle gleich aussehen?«, »Ist künstlich etwa natürlich?«, »Soll das schön sein?« Mit dieser Verwunderung beginnt eine Expedition durch die Kulturgeschichte der Selbstgestaltung.
Was Menschen schön finden, folgt schon seit der Steinzeit einerseits biologischen Mustern und andererseits kulturellen Moden. Wir alle wollen gesund sein und dazugehören. Also nähern wir uns mit technischer Hilfe körperlichen Idealtypen an, auf die sich bestimmte Bevölkerungsgruppen zu bestimmten Zeiten geeinigt haben. Gekalkte Haut, eine ausrasierte Damenstirn oder auf die Schläfen gemalte blaue Adern waren vergleichsweise kurzweilige Designtrends. Das männlich-markante Kinn und der weiblich-sinnliche Mund sind hingegen konstant beliebte Bio-Siegel. Heute aber verlieren Geschlechterrollen an Strenge, und es gilt das Versprechen, alle dürften ihren individuellen Ausdruck finden. Normierung oder Freiheit – kein Mensch kann sich konsequent für eine Seite entscheiden. Wann spricht das Archaische aus unseren ästhetischen Vorlieben, wann die Zivilisation? Und wenn Toleranz eine kulturelle Errungenschaft ist: Ist sie denn stark genug, um biologisch bedingte Präferenzen zu überschreiben? Oder ist #Positivity bloß ein nettes Hirngespinst?
In den sozialen Medien wird vehement über diese Fragen gestritten. Manchen scheint dabei völlig klar zu sein, wie eine fortschrittliche, intelligente Person auszusehen hat: Emanzipierte Männer tun dieses, kluge Frauen lassen jenes. Wir kennen solche sektiererischen Reflexe nur allzu gut. Sie sind menschlich. Aber sie ignorieren jede gesellschaftliche Komplexität, anstatt sich ihr interessiert zuzuwenden.
Wer dem Gesicht der Zeit wirklich nahe kommen will, muss ihm mit offenem Blick begegnen. Dieser Blick nimmt historische, philosophische, kunstgeschichtliche, anthropologische, psychologische oder popkulturelle Perspektiven ein, um die vielen Facetten der Schönheit zu ergründen. Er sucht nach Lebensstationen und einschneidenden Ereignissen in der Jahrtausende umfassenden Biografie des Gesichts. Er schaut sich jedes Merkmal – Augen, Nase, Lippen, Haut – ganz genau an und betrachtet, wie es attraktiv gemacht wurde. Dieser Blick verurteilt nicht, sondern fragt nach den Gründen der Behandlung mit Pinsel und Skalpell. Und er widmet sich den wirtschaftlichen und politischen Zusammenhängen, von denen Schönheitsideale seit jeher mitbestimmt werden: Wer Macht hat, kann diktieren, was erstrebenswert, was schön ist. Aus prägenden Erfahrungen, Moden und Ideologien entsteht schließlich ein Porträt, das uns hilft, die Sehnsüchte der Gegenwart nachzuvollziehen.
Es geht immer um Gefallen und Gefallenwollen. Es geht um die Gründe der Selbstgestaltung und die Symbolkraft des Designs. Es geht um die fließenden Übergänge zwischen Hygiene und Kosmetik. Es geht ums Geschäft mit der Unsicherheit. Es geht um Männer, die Frauen Maßstäbe gesetzt haben. Es geht um Frauen, die das Zepter ergriffen. Es geht um die verwirrende Gleichzeitigkeit gegensätzlicher Idealvorstellungen. Es geht um technische Oberflächen und fleischliche Tiefen. Es geht um das Tier in uns und dessen Zähmung. Es geht um die Menschlichkeit, die wir alle von uns erwarten sollten. Es geht um die Grenzen der Natur und die Verantwortung der Kultur. Es geht um die Freude am Staunen, um die ewige Neugier und ganz besonders um die Liebe zum Spiel. Das Gesicht ist ein faszinierender, knallbunter Spiegel unserer Welt. Schauen wir zusammen hinein.
Masken
Unter einer Brücke in Paris, im frostig dunklen Januar 2024, geschah ein kleines Wunder. Seine Bedeutung war nicht allen sofort erkenntlich, aber dass sich hier Bedeutsames vollzog, merkten die Anwesenden sofort. Sie zückten ihre Telefone und schickten Bilder um die Welt. Es war Modewoche, und der fantasiebegabte Designer John Galliano stellte im Zwielicht des Seine-Ufers seine Kollektion für das Haus Margiela vor: eine rauschhafte Fantasie aus der Halbwelt, schattiges Fin de Siècle und zugleich 1929, mit grobem Tweed, abgewetzten Flicken und zerschlissenen Strümpfen, mit Korsagen, Plisséeröcken, transparenten Négligées und Latexlagen. Dazu trugen die Mannequins Gesichter, wie man sie auf dem Laufsteg noch nie gesehen hatte: Sie wirkten wie Porzellanpuppen mit großen, grün oder gelb geschminkten Augen, hohen Brauenbögen, dunklen Herzmündern. In solchen Farben hatte der Maler Kees van Dongen 120 Jahre zuvor die schönen Damen von Paris porträtiert, der Fotograf Brassaï hatte ähnliche Figuren des queeren Amüsierlebens in Schwarz-Weiß dokumentiert. Gallianos Inszenierung war als Gesamtkunstwerk erstaunlich, so dicht in seinen poetischen Bezügen. Und diese Puppengesichter setzten dem Ganzen die Krone auf. Nicht das Make-up an sich war so beeindruckend, sondern dessen wirkungsvolle Lackierung. Diese Köpfe waren männlich, weiblich und menschlich, aber sie glänzten wie polierte Androiden. War es Haut? War es Plastik? War es Keramik? Etwa Metall?
Die Idee stammt von einer Ritterin des Britischen Empire: Dame Patricia Ann McGrath, Jahrgang 1970, Londonerin mit jamaikanischen Wurzeln, hochdekorierte Visagistin und eine der einflussreichsten, kreativsten Frauen in der Modebranche. Ihr Spezialgebiet: die optische Perfektion einer glatten Hautoberfläche. Schon oft hatten sich ihre aufwändigen Stylings für die Vogue zu viralen Trends entwickelt. Glass Skin oder Glazed Donut Skin, angeblich Resultate von Hautpflege, meistens von Make-up und sicherlich von digitalen Kamerafiltern, sind genau ihr Ding. Skin Fetish nennt Pat McGrath ihre Obsession. Sie ist Handwerkerin, sie malt mit analogem Material, sie stellt Gesichter her. Und genau deshalb drehte die Gemeinde der Profi- und Amateur-Visagistinnen im Internet durch, als sie die übermenschlichen Masken der Margiela-Show sah: Wie ist das möglich?! Sofort wurde über Rezepte gefachsimpelt, um diesen zellophanähnlichen Transparentlack herzustellen. Innerhalb weniger Tage waren die Kanäle voller Selbstversuche und Tutorials, bunte glänzende Porzellangesichter überall. McGrath wurde beinahe genötigt, ihr Geheimnis offenzulegen: Aus verschiedenen filmbildenden Gelen, wie sie auch in elastischen Peel-off-Masken zu finden sind, hatte sie eine Flüssigkeit gemischt, die mit der Spraypistole auf das geschminkte Gesicht gebracht und mit dem Fön getrocknet wurde. Das Mysterium war gelüftet.
Worin aber bestand das eigentliche erschütternde Wunder, das sich unter der Pariser Brücke ereignete? Gwendoline Christie, die phänomenale Ritterin aus Game of Thrones, lief als Model in der Show. In einem Kurzfilm der Vogue über den Erfolg der Inszenierung versucht die Schauspielerin zu fassen, worin die Überraschung bestand, die Pat McGraths Maskengesichter ausgelöst haben: »Sie hat sich der Idee des Filters bedient, der offensichtlich auf künstlicher Intelligenz basiert. Sie hat etwas aus der digitalen Welt genommen und es in die materielle Welt gebracht. Das ist etwas vollkommen Neues.« Tatsächlich kannte man ähnliche Masken schon aus Science-Fiction-Welten. Wahrhaftig vor sich gesehen hatte man sie noch nie. Nicht zufällig erinnern die wächsernen Gesichter von Pat McGrath an einen Kurzfilm, der schon 1999 vorwegnahm, womit sich die Menschheit jetzt und in Zukunft beschäftigt: Chris Cunningham läutete mit seinem damals revolutionären, mehrfach preisgekrönten Musikvideo zu Björks All Is Full Of Love das neue Jahrtausend ein. Darin sehen wir zwei einander liebkosende Roboter, deren sensible Körperteile mit weißem, glänzendem Plastik verschalt sind. Glatt und perfekt wie zwei Jahre später der erste iPod, wie eine Apple Mouse oder die ersten AirPods. Heutige Diskurse über die Weiterentwicklung des menschlichen Körpers mit technischen Mitteln oder über die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz auf Basis menschlichen Erlebens stecken bereits in diesem Video, das vor 25 Jahren noch als hochtrabende künstlerische Utopie erschien. Das Wunder von Paris bestand also darin, dass sich Mensch, Maschine, Natur und Kunst zu einer faszinierenden, unheimlichen, kohlenstoffschwarzen Geschichte verstrickten. Und dass dank dieser Masken ein Moment zu erleben war, in dem sich Vergangenheit und Zukunft begegnen.
Die schönste Pointe war zwei Wochen später auf Instagram zu finden. Eine Person, die Modefotos mittels künstlicher Intelligenz erstellt, schrieb dort, sie habe sehr lange gebraucht, dem Programm Midjourney den Margiela-Look beizubringen. Einfach zu komplex. #AIfails.
Natürlich unnatürlich
Es scheint ein unendlicher Ringtausch zu sein zwischen dem Echten und dem Unechten. Wer gerade wen kopiert, wer Vorlage und wer Kopie ist, wechselt ständig. Der ewige Tanz von Natur und Kultur umfasst inzwischen auch die virtuelle Dimension. Digital spiegelt Analog spiegelt Digital spiegelt Analog. Natürliches wird Künstliches wird Natürliches. In den Körperästhetiken der Gegenwart verliert und findet sich der Mensch immer wieder aufs Neue.
Das Gesicht ist eine wesentliche Schnittstelle zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit. Vielleicht sogar die wichtigste. Wir alle verdecken sie mit einer Maske, zu groß das Risiko, gäben wir unser wahres Gefühlsleben zu erkennen. Wir brauchen nicht einmal Material, um der Welt ein falsches Gesicht – oder etwas freundlicher: ein zweites Gesicht – entgegenzuhalten. Ein vorgetäuschtes Lächeln genügt, um soziale Kompatibilität zu vermitteln oder Zudringlichkeit abzuwehren. In kultischen Ritualen, im antiken Drama oder auf der Nō-Bühne, beim aristokratischen Ball oder beim venezianischen Karneval verwandelte man sich mithilfe einer Schalung aus Holz oder Pappmaché, die das erste Gesicht verdeckte. Lange Zeit gehörten Masken als Symbole des Versteckspiels und der Täuschung auf die Theaterbühne. Aber auch im Privaten legten Männer und Frauen täglich vor dem Spiegel eine mehr oder weniger offensichtliche Maske auf, die der römische Arzt Galenus im 2. Jahrhundert Kosmetik taufte. Die alten Griechen benutzten sogar dasselbe Wort, um Gesicht und Maske zu bezeichnen: prosopon. Man geht davon aus, dass sich daraus der Begriff Person entwickelt hat.
In der Antike wurde diese Schnittstelle zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit reichlich untersucht. Ovid war sehr fürs Schminken, aber bitte nur heimlich, um das Mysterium der weiblichen Schönheit zu erhalten. Sokrates hingegen sei ein vehementer Gegner der »Putzkunst« gewesen, »weil sie Gesundheit und Schönheit, die seiner Auffassung nach mit Leibesübungen und Diät erzielt werden können, bloß äußerlich vortäuscht«, wie die Philologin Gesa Dane erklärt. Diese schminkkritische Position hielt sich bis in die Neuzeit und prägte den Geist der Aufklärung. Rousseau trauerte dem menschlichen Naturzustand als gottgegebener Wahrheit nach und reanimierte Ciceros Begriff von Kultur als »zweite Natur«. Kant bezog in dieser Frage gewissermaßen eine Mittelposition zwischen Ovid und Sokrates, als er in seiner Kritik der Urteilskraft schrieb, dass der Mensch das Künstliche nur schön finden kann, wenn es natürlich aussieht.
Für die Biografie des gestalteten, des zweiten Gesichts stellten sich im 18. Jahrhundert viele Weichen: Das Bürgertum wurde selbstbewusster und beanspruchte politische Macht. Die Wissenschaften erfuhren einen enormen Schub. Beides zusammen schlug sich nieder in einer Sehnsucht nach Rationalität und Klarheit, einer Ablehnung des Affektierten, einer Hinwendung zur Natürlichkeit, die allerdings von Leuten wie Rousseau und Kant erst einmal zeitgemäß definiert werden musste. Im Zuge der Französischen Revolution wurde das menschliche Individuum wichtiger. Vermehrter sozialer und ökonomischer Austausch mit anderen ließ auch das Gesicht wichtiger werden. Man wollte jetzt echte Gefühle sehen, kein nobles Puppentheater. Auf den zentraleuropäischen Bühnen hatten daher Holzmasken nichts mehr zu suchen, alle Emotionen sollten echt verkörpert werden. »Die unterhaltendste Fläche auf der Erde für uns ist die vom menschlichen Gesicht«, notierte der Physiker Georg Christoph Lichtenberg damals. Und selbstverständlich: Um diese Unterhaltung führen zu können, um die Ausdrücke lesen zu können, musste der Kopf erst mal alphabetisiert werden. So entstand die gefährliche Lehre der Physiognomik.
Die Entwicklung des Gesichts als multidimensionales Kommunikationsmittel begann also in der Epoche der Aufklärung. Inzwischen leben wir in einer »facialen Gesellschaft«. Diesen Begriff hat der Kulturwissenschaftler Thomas Macho geprägt. Aus einer »Enttäuschung humanistischer Hoffnungen« heraus würden überall Gesichter produziert. Jedes Auto, jedes Haus, jeder Joghurtbecher hat eins. Das menschliche bleibe aber selbstverständlich Maß aller Dinge. Die faciale Gesellschaft überschwemmt uns mit einer Flut an Gesichtern, die uns kommunikativ und ästhetisch herausfordern. Innerhalb von 100 Millisekunden erfassen wir ein Gesicht, bis zu 5000 davon können wir uns merken. Aber unsere Speicher sind voll. 5000 Gesichtern kann man im Doom-Scrolling-Modus auf TikTok an einem Tag begegnen. Besonders der überanstrengte, konsumkulturgeschädigte, urbane Mensch der Gegenwart scheint sich da nach vorzivilisatorischer Einfachheit zu sehnen: Wald- und Bergeinsamkeit, Ferien auf dem Bauernhof oder Digital Detox sind beliebte Urlaubsziele.
Nicht nur Macho fragt sich, wohin diese Entwicklung führen soll, zumal wir nicht nur angefüllt sind mit den Gesichtern anderer, sondern noch dazu mit Bildern unseres eigenen Antlitzes. Noch nie haben wir uns so häufig und so lange selbst beobachtet, in analogen Spiegeln, durch digitale Kameras. Und noch nie war der erste Eindruck so bedeutend, weil wir so viele so kurze Begegnungen mit anderen Menschen haben. Das ist höchstwahrscheinlich alles nicht sehr gesund. »Das Auge ist nicht zur Selbstanschauung gemacht. Und das wohl aus gutem Grund, denn die Menschen brauchen die Informationen, wie sie aussehen, zunächst gar nicht«, sagt der Philosoph Peter Sloterdijk. Die Betrachtung der eigenen Reflexion öffnet dem Vergleich mit anderen die Tür. Und daraus erwachsen oft Verunsicherung und Neid. Wir treten in einen Wettbewerb ein. Mit jeder neuen Technik des Herrichtens, Schminkens und Gestaltens entfernen wir uns weiter von unserer ersten Natur.
Helmuth Plessner hat 1970 in seiner Anthropologie der Sinne versucht, das argumentative Kräftemessen zwischen dem Ursprünglichen und dem Kulturgemachten auszuhebeln. Es sei »nicht weit her mit der menschlichen Natürlichkeit«, schreibt er und meint damit, dass sie nicht allein mit biologischen Begriffen erklärt werden kann. Wenn wir beobachten, wie viel Ideologie manche Leute in ihrem Lastenfahrrad umherkutschieren, wird uns klar, dass jede zur Schau getragene Natürlichkeit das Ergebnis eines kulturellen Prozesses ist. Wer sich heute für einen natürlichen Look entscheidet, ob mithilfe von Demeter-Cremes und Roggenmehl-Haarpuder, No-Make-up-Make-up oder Verjüngungsspritzen, der gestaltet sich. »Menschliche Natürlichkeit ist künstlich, eine überkommene, gelehrte und gelernte, sorgsam gehütete, unter Umständen zäh verteidigte oder nach Erneuerung verlangende Natürlichkeit, deren Wurzeln tief in das physiologische Geschehen von Zeugung, Ernährung und elementarer Lebensfürsorge hinabreichen.« Das Helmuth-Unser. Amen.
Es scheint, als habe sich das aufklärerische Natürlichkeitspostulat heute in ein Transparenzgebot verwandelt. Künstlichkeit ist schon irgendwie in Ordnung, solange offengelegt wird, wie sie hergestellt wurde. Die äußerliche Unberührtheit haben wir hinter uns gelassen. Als Fluchtpunkt bleibt nur eine innere Aufrichtigkeit, die so gern beschworene Authentizität. Ein Blick hinter die Maske macht jedes Theater akzeptabel. Im Schminktutorial oder der Healing Journey nach einer Nasenoperation wird also die Produktion des zweiten Gesichts vor aller Augen zelebriert. Genau wie die #MorningRoutine des französischen Königs in Anwesenheit der Hofgesellschaft aufgeführt wurde. Die heutigen How-to-Videos wollen mit der Preisgabe aller Verschönerungspraktiken zwar im demokratischen Sinne aufklären und Wissen teilen, sind ironischerweise aber einer voraufklärerischen Kultur der Herrschaftsrepräsentanz entlehnt. Der Adel gab mit seinem kostbaren Instrumentarium aus Pudern, Pigmenten, Pinseln und Parfum an und signalisierte durch das ausgiebige Ritual, dass man sich hier um Zeit und Geld nun wirklich keinen Kopf machte, weil die eigene Existenz aller Ökonomie enthoben war. Heute darf man im Mediengenre #GetReadyWithMe an beliebigen Mädchen, Jungs, Frauen, Männern und allen dazwischen beobachten, wie viele Schritte nötig sind, bevor sie sich aus dem Haus wagen, um etwas Geld zu verdienen und neue Produkte kaufen zu können.
Im Optimalfall wird Künstlichkeit als Ergebnis von Kunstfertigkeit geadelt. Profis im Geschäftsbereich der »zweiten Natur« wissen das, unterwerfen sich einerseits dem vom Publikum ausgeübten Offenbarungsterror und ziehen andererseits ihre ökonomischen Vorteile daraus. Pat McGrath wurde »Gatekeeping« vorgeworfen, weil sie nicht sofort ihren Maskentrick verraten hat. Wenige Wochen später brachte sie eigene Produkte auf den Markt, die zum Zellophangesicht verhelfen. Es folgte ein entsprechender Instagram-Filter, womit das Moebius-Band zwischen der körperlichen und der virtuellen Welt geschlossen war.
Im ästhetischen Einheitsrausch der sozialen Medien war der extravagante Margiela-Look eine willkommene Unterbrechung. Gemeinhin »performen« dort gefällige Inhalte, die Vertrautheit vermitteln: Bilder von Avocadotoasts, Berggipfeln, Sonnenuntergängen, Monstera-Pflanzen, Küchenfliesen oder Luftsprüngen am Strand, die anderen ähneln, werden bevorzugt verbreitet. Der Instagram-Algorithmus belohnt Gleichförmigkeit. Er antwortet auf die menschliche Suche nach Stereotypen, während alle glauben, sich auf ihren Profilen ganz individuell zu präsentieren. Das weibliche Idealgesicht, das seit einigen Jahren die digitale Sphäre dominiert und von dort ins echte Leben diffundiert, hat die Journalistin Jia Tolentino Ende 2019 im New Yorker porträtiert. Ihr Essay The Age of Instagram Face sollte den Geist der ausgehenden Zehnerjahre einfangen. Leider, muss man wohl sagen, trifft Tolentinos Analyse auch Mitte der Zwanziger den Kern dieser Beauty-Kultur: Social Media, digitale Fotofilter und plastische Chirurgie hätten zusammen einen Cyborg geschaffen, dem Millionen Frauen nun nacheiferten. Sie beschreibt dieses perfekte Gesicht als eine Greatest-Hits-Sammlung mit rassistischem Grundton. Es sei zwar bevorzugt weiß, aber durchaus ethnisch flexibel, geradezu exotistisch. Ein von ihr befragter Visagist benennt die Puzzleteile mit gebräunter Haut, einem »südasiatischen Einfluss« auf Brauen und Augenform, einem »afroamerikanischen Einfluss« auf die Lippen, einer schmalen, geraden Nase, wie man sie Europäerinnen zuschreibt, und einer Wangenstruktur, »die vorrangig Native American oder nahöstlich ist«. Es gibt diese Gesichter auch in der Realität. Sie gehören den Kardashians, Jenners und Hadids. Aber keine dieser weltberühmten, einflussreichen Frauen wurde so geboren. Sie haben sich diese Masken gemalt, gespritzt und geschnitten.
Filter Wars
Sich stattdessen eine digitale Maske überzuziehen ist bequemer und erschwinglicher. Wenn sowieso der gesamte soziale Austausch online stattfindet, genügt ein passender Face Filter. Das Prinzip »Oben hui, unten pfui«, mit dem die Pandemie aus dem Home Office bestritten wurde, hat der Kosmetikkonzern L’Oréal auf das Gesicht ausgeweitet. Aus Deepfake-Technologie und Zoom-Fatigue entstand 2021 ein Videofilter namens Signature Faces, mit dem man ungeschminkt in jede Onlinekonferenz stolpern konnte und trotzdem noch bunt zurechtgemacht aussah. Eine harmlose Spielerei angesichts der vielen Filter, die vor allem Heranwachsende nutzen, um ihre Selfies zu verändern. Es geschieht auf heimliche Weise wie etwa durch die Kameravoreinstellungen in der Instagram-App oder auf offensichtliche Art wie beispielsweise mit der Bold Glamour-Anwendung auf TikTok. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche nutzergenerierte Filter gesperrt, weil sie fragwürdige Optiken produzierten, sexistische oder rassistische Perspektiven stärkten oder die Entwicklung von Körperwahrnehmungsstörungen beim Publikum begünstigten. Norwegische Influencer müssen deshalb seit 2022 jede Retusche mit einem Button im Bild kenntlich machen. Im Herbst 2023verklagten mehrere US-Staaten den Konzern Meta, zu dem Instagram und Facebook gehören, wegen des schädlichen Einflusses der Beauty-Filter auf Kinder und Jugendliche. Chirurgen berichten, dass junge Leute mit gefilterten Selfies in ihre Praxis kommen und eine wahrhaft virtuelle Realität einfordern. Im Dove Global Beauty Report 2024 fällt auf, dass sich 10- bis 17-jährige Mädchen in China und Indien offenbar besonders stark vom Beauty-Irrsinn auf Social Media unter Druck gesetzt fühlen.
Die Technology Review des renommierten MIT in Boston widmete dem »Kampf um das Instagram-Face« einen ausführlichen Artikel über die negativen Auswirkungen digital bearbeiteter Bildkulturen einerseits und den Anspruch auf Freiheit in der Selbstgestaltung andererseits. Die liberale Position vertritt Florencia Solari. Sie ist professionelle Filter-Entwicklerin und Urheberin von vedette++, der 2019 auf Facebook und Instagram viral ging. Ihre digitale Maske verpasste jedem Gesicht größere Augen, absurd aufgepumpte Wangenknochen, dicke Lippen, ein spitz zulaufendes Kinn und glasierte Haut. Solari beschreibt das Ergebnis als einen Alien auf Botox. Es lag demnach nicht in ihrem Interesse, den Wunsch nach Schönheitsoperationen zu befeuern. Die Leute hätten einfach Spaß daran, außerirdisch auszusehen, sagt sie. Wenige Wochen nach seinem raketenhaften Start wurde vedette++ zusammen mit vielen anderen Filtern aus dem Angebot entfernt. Meta beugte sich damit erstmals der öffentlichen Kritik an einer unkontrollierten Affirmation unrealistischer Körperbilder. Solari nahm zum Tod von vedette++ öffentlich Stellung: »Es war eine Maske, in der Tat. Eine Maske, die uns ermöglicht hat, uns selbst zu entsprechen. Uns auszudrücken über unsere Körper hinaus, über unsere materielle Realität hinaus, um das Transhumane und die Fantasie zu erkunden.« Sie schließt die Frage an, ob konsequenterweise auch die Kardashians verboten werden, ob Bilder von schönen, operierten oder reichen Menschen verboten werden. Und sie hat nicht unrecht. Wer schützt uns alle vor dem – frei nach Goethe – vergleichenden Sehen?
Vielleicht schützen wir uns selbst vor den Folgen, indem wir neue Fähigkeiten entwickeln, um Maskierungen und Täuschungen zu entlarven, wie wir es seit Jahrtausenden immer wieder neu gelernt haben. Berit Glanz formuliert in ihrem kulturwissenschaftlichen Essay Filter bei aller berechtigten Kritik auch eine Hoffnung: »Neuere Forschungen weisen zumindest darauf hin, dass die User*innen ein sehr viel differenzierteres Bewusstsein für Filter haben als angenommen – und sich parallel zur technischen Entwicklung der Authentizitätsbegriff zu verändern scheint.« Zu dieser digitalen Medienkompetenz gehöre eine Art forensischer Blick, der eingesetzte Filter schnell erkenne. Und, so kann man es wohl nennen, ein gewisser positiver Technikfatalismus, der sich in der Auffassung niederschlägt, »dass Filter ein unhintergehbarer Teil der digitalen Selbstpräsentation in den sozialen Medien« sind.
Freiheit bedeutet für die einen, sich auszudrücken und durch Künstlichkeit die Vorstellungen menschlicher Machbarkeit immer weiter zu dehnen. Für die anderen bedeutet es, sich der konsumkapitalistischen Wachstumslogik zu entziehen und sich auf eine – wie auch immer geartete – Natürlichkeit zu besinnen. Die meisten Menschen im 21. Jahrhundert führen ihr Leben im perpetuum mobile zwischen diesen Polen und verzweifeln mehr oder weniger stark daran.
Der 2022 verstorbene Philosoph Gernot Böhme schlug vor, die klassische Kulturkritik, die immer mit dem Gegensatzpaar »natürlich« und »künstlich« arbeite, durch eine neue Betrachtungsweise der Selbstkultivierung zu ergänzen. Seine Kritik der ästhetischen Ökonomie von 2001 entspricht wohl inzwischen der Perspektive der meisten Menschen, die mit dem Spätkapitalismus hadern. Allgemeine Frage: Warum ist das so? Immergültige Antwort: Follow the money. Böhme beschrieb daher die Maskierungen der Menschen, ihre Mode, ihre Schminke in enger Verknüpfung mit den Regeln des Marktes. Man könnte seinen Text als vorweggenommene Analyse des Influencerwesens und dessen Folgen lesen. Das erfolgreiche Individuum will oder muss sich selbst gestalten und aus der Menge herausragen. Dabei ist es auf das jeweilige Warenangebot angewiesen. »Das führt zu einer Eskalation der Ausstattung und ihrer ständigen Erneuerung – weil das Neue jeweils die größte Chance hat, individuell zu sein«, schreibt Böhme. Die ästhetische Selbstkultivierung laufe also Gefahr, in ein nicht zu befriedigendes Begehren umzuschlagen. Und genau dort liegt die Angriffsfläche für die kapitalistische Ökonomie: Du bist ein Mängelexemplar, aber alle Produkte und Dienstleistungen, die du zur Perfektionierung deines Selbstdesigns brauchst, sind verfügbar. Gernot Böhme meint, das Begehren, als Individuum gesehen zu werden und sich selbst zu verwirklichen, sei legitim und ausgesprochen modern, »ist es doch von wirtschaftlicher Seite beliebig ausbeutbar«. Und weil der Kapitalismus immer massenhaft skalieren muss – everything counts in large amounts, wie Depeche Mode sangen –, muss die Individualität zwangsläufig darin untergehen. Bis sie in einem anderen Trend wiedergeboren wird.
Es ist alles Arbeit
Rousseau, Kant, Hegel und ihre Freunde haben uns eine Menge impliziter Aufforderungen zur Selbstoptimierung hinterlassen. Das Credo der Aufklärer könnte man mit »Gestalte dein Leben, und mach was aus dir!« zusammenfassen. Die Soziologin Nina Degele schreibt: »Autonomieimperativ und protestantische Arbeitsethik sind zwei Erbschwestern der Aufklärung. Sie betonen Selbstständigkeit, Leistungsorientierung und Anerkennung als elementare Komponenten moderner Körperinszenierungen.« Imperativ. Arbeit. Leistung. Körper. Inszenierung. Im englischen Diskurs gibt es für dieses Feld einen Begriff: »Aesthetic Labour«. In der Arbeitssoziologie wurden damit zunächst besondere Attraktivitätsanforderungen an Verkaufs- und Servicepersonal bezeichnet. Inzwischen wird er breiter angewendet und entspricht dem feministischen Versuch, die Ressourcen, die Frauen im Patriarchat gezwungenermaßen aufs Sich-schön-Machen verwenden, zu benennen und zu bemessen. Ähnlich wie der Begriff »Care Work« offenlegen sollte, wie viel unbezahlte Sorgearbeit Frauen in der Familie leisten. Denn hätte man sie vor die Wahl gestellt, hätten sie ihre Zeit womöglich anderen Bestrebungen gewidmet.
Obwohl das Konzept der Aesthetic Labour aus dem Alltagshandeln von Frauen abgeleitet wurde, trifft es selbstverständlich auf Personen aller Geschlechter zu, von der Pubertät bis zum Lebensende. Körperhygiene, Fitnesstraining, Diäten, Hautpflege, Haarpflege, Make-up, ach, Kleidung nicht zu vergessen … Das Regime, mit dem wir die Körperhülle formen, die wir anderen zu zeigen bereit sind, variiert im Aufwand und der Wahl der Mittel. Aber ganz ohne kommt wohl heute niemand mehr aus. Menschen, denen die ästhetische Ökonomie weisgemacht hat, sie müssten gut, gesund und gepflegt aussehen, und denen Produkte und Medien einreden, ihr Körper sei unendlich defizitär, geben immer mehr Geld und Zeit für optisches Selbstdesign aus. Anstatt sich zum Beispiel auf ihre Talente, einen interessanten Job und ein erfülltes Sozialleben zu konzentrieren.
Aesthetic Labour ist gesellschaftlich akzeptiert, weil sie einem ökonomischen Denken entspricht, das wir verinnerlicht haben. Was nichts kostet, ist auch nichts wert. Das gilt ganz besonders im Bereich der Körpergestaltung. Sport ist eine anerkannte Methode, weil er eine Transformation durch Leid verspricht. Wer das durchmacht, wird bewundert. »Wer schön sein will, muss leiden« ist der Spruch, mit dem viele Mütter ihre Töchter in zu spitze Schuhe, zu enge Hosen oder zu strenge Diäten geschwatzt haben. »Es gibt keine hässlichen Frauen, nur faule«, soll Helena Rubinstein gesagt haben. Sogar Schminke und Mode – klassisch weiblich-konnotierte Schummeleien – sind anerkannte Formen der ästhetischen Arbeit, solange sie nicht zu auffällig daherkommen. Die Maskierung mit ihrer Hilfe kostet nur Zeit, Geld und Know-how. Man muss was tun, aber immerhin nicht dabei schwitzen.
»Mensch, du siehst heute aber frisch aus.« – »Ach, das ist dieser tolle Concealer, mit dem ich meine Augenringe neutralisiere.« – »Ah, interessant!«
»Siehst frisch aus heute!« – »Du, ich hab mir gestern in der Mittagspause die Tränenrinnen mit Hyaluron unterspritzen lassen.« – »Oh, hm, na, wenn du meinst … ähm, wo denn?«
Schönheitsarbeit mit medizinischer Hilfe wird oft als faul und eitel abgelehnt. Das gilt für Abnehm- oder Verjüngungsspritzen ebenso wie für chirurgische Operationen. Gleichzeitig wollen wir wissen, wie es geht. Es ist dasselbe offene Geheimnis, in dem Kosmetik und Make-up rund 2500 Jahre verharrten: Klatsch, Handbücher und Frauenzeitschriften haben Schönheitstipps verbreitet und für Unterhaltung gesorgt. Heute gibt es dafür YouTube, TikTok oder Instagram. Die Selbstgestaltung, sogar die chirurgische, ist eine öffentliche Praxis. Wie finden wir das? Ovid schmollt schon die ganze Zeit, Kant pudert angewidert seine Zopfperücke, und Max Weber diagnostiziert eine weitere »Entzauberung der Welt«. Seltsamerweise kann selbst das Eingeständnis ihrer Künstlichkeit das Begehren nach Schönheit nicht dimmen.
Zur ästhetischen Ökonomie gehören auch Gamification und eine angenehme User Experience. Winfried Menninghaus schreibt in seiner umfassenden kulturanthropologischen Auseinandersetzung mit Schönheitsarbeit: »Statt nur die ›Pflicht‹ der Frau zu sein, soll es nunmehr allen ›Spaß‹ machen und vor allem aus Freude an einer guten Selbstdarstellung befolgt werden.« Die Vorher-nachher-Shows sind ein lustiger Zeitvertreib. Aber sie entwickeln einen gefährlichen Sog. »So spielerisch und witzig deren ästhetische Codierung im Einzelnen ausfallen mag, das Projekt selbst ist alles andere als ein Spiel oder ein Witz, die auch unterbleiben könnten. Eine Freiheit, nicht zu wählen, das ›Spiel‹ der ästhetischen Selbstbeglaubigung nicht mitzuspielen, gibt es immer weniger.«
Über diesen Zustand kann man sich aus vielerlei Gründen ärgern. Allerdings ist Aesthetic Labour auch für Menschen, die nicht als Models oder Medienpersönlichkeiten arbeiten, eine Produktivkraft. Sosehr uns der Gedanke aus humanistischer Perspektive abstoßen mag: Alle Menschen werden für ihr Aussehen bezahlt. Manche haben viel zu tun, um angenehm auszusehen, andere werden so geboren. Je besser wir aussehen, desto mehr soziale Vorteile haben wir. Nur nicht zu gut, das weckt wieder Misstrauen.
Der wirtschaftsliberale, konsumorientierte Postfeminismus würde Frauen gratulieren, die ihre Schönheit als Währung, ja, als Ware begreifen: »Bravo! Wenn du das System verstanden hast, mach deinen Körper zu Geld.« Dieses Börsianerdenken wirkt jedoch etwas eindimensional. Wer sich unter dem männlichen Blick bis aufs Schamhaar objektiviert und kapitalisiert, verdient bestimmt ein paar Penunsen. Aber kann diese Art der Unterwerfung Freiheit sein?
Frauen haben gelernt, sich den gesellschaftlichen, privaten, immer schneller changierenden Schönheitserwartungen auszuliefern. Die traditionelle Konstruktion von Weiblichkeit ist so eng verknüpft mit Aesthetic Labour, dass viele Feministinnen vehement in Opposition gingen. Manche Thesen – wie die der Bestsellerautorin Naomi Wolf – kommen verschwörerisch daher: Männer würden Frauen mittels falscher Werbe- und Produktversprechen bewusst in die Schönheitsarbeit zwingen, damit diese keine Zeit haben, soziale, politische oder ökonomische Macht aufzubauen. Die mildere Argumentation sieht in dieser »Schönheitsfalle« neben unreflektierten Influencerinnen vor allem erzkonservative Weibchen gefangen, die zum Beispiel als Trad Wives hausfrauenfreundlichen Content für die weltweit erstarkenden Rechtsnationalen ins Internet blasen. Mag man auch nicht.
Schönheitsarbeit kann aber nicht so einfach als antiemanzipatorisch verdammt werden. Winfried Menninghaus erwähnt in diesem Zusammenhang Schlankheit und Sportlichkeit als Gegenentwurf zum klassischen Mutterbild und als Ausdruck von Körperkontrolle, Leistungsbereitschaft und Selbstermächtigung. Es sind schließlich diese Merkmale, mit denen die ersten sogenannten Powerfrauen in der misogynen Arbeitswelt bestehen konnten, während sich die älteren Herren der Konzernleitung über den Wams strichen. Und Menninghaus setzt noch eins drauf: »Außerdem begünstigt die feministische Betonung des kulturellen Produziertseins von Geschlechterrollen auch die Vorstellung einer hohen Formbarkeit der biologischen Gegebenheiten des Körpers und konvergiert insofern mit einer Grundannahme aller modischen Shaping-Strategien.« Der progressive, inklusive Feminismus müsste Aesthetic Labour also sogar gutheißen. Schließlich setzt er sich für die Freiheit der Selbstgestaltung aller Geschlechter ein.
Aus dieser Perspektive schreibt die Kommunikationswissenschaftlerin und namhafte Ökonomin Linda Scott. In ihrem Buch Fresh Lipstick kritisiert sie die aggressive Aversion von Feministinnen gegen Mode und Kosmetik als unangebracht, sogar unmenschlich. Die Lektüre macht deutlich: Wenn Frauen anderen Frauen vorschreiben wollen, wie sie sich zu gestalten haben – und vor allem, wie nicht –, geschieht das meistens auf Basis rigider Ideologien, ob religiös oder politisch motiviert. Eine moralische Überlegenheit an eine bestimmte Mode zu knüpfen ist eine gängige Praxis der Abgrenzung und Abwertung, vor allem unter Frauen. Das habe letztlich zu einer regelrechten Spaltung der Bewegung geführt, nämlich in die »Heldinnen des Geistes« und die »Heldinnen des Körpers«, so Scott. Erstmals in den 1910er-Jahren formuliert, ziehe sich die Bevorzugung des Geistes gegenüber dem Körper bis heute durch viele feministische Schriften. Schöne Frauen können nicht klug sein? Dieser Gedanke erhebt sich kaum über das Niveau eines Blondinenwitzes.
Patriarchat hin, Kapitalismus her: In ihrer Schönheitsarbeit folgen Menschen unterschiedlichen Impulsen. Es sind immer Entscheidungen eines souveränen Subjekts, das jedes Recht haben sollte, seinen Körper nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Und es sind Anpassungen an herrschende Normen. In der Gleichzeitigkeit von Selbstermächtigung und Selbstunterwerfung, betont die Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky, liegt die ganze Faszination.
Für wen wir uns schön machen
Schönheitsarbeit in verschiedenen Dialekten:
»Weil ich es mir wert bin.« (postfeministisch)
»Weil es mir mein Geld und meine Zeit wert ist.« (ökonomisch)
»Weil ihr es mir wert seid.« (soziologisch)
»Weil meine Laune es mir wert ist.« (psychologisch)
»Schön machen wir uns vor allem, weil wir soziale Anerkennung brauchen. Das ist keine ›Frauensache‹, und mit Spaß und Lust hat es nur selten etwas zu tun«, meint Nina Degele. »Schönheitshandeln ist ein Medium der Kommunikation.« Wir inszenieren unser Äußeres, weil wir Aufmerksamkeit einfordern und unsere Identität absichern wollen. Es ist ein Akt der gesellschaftlichen Positionierung. Wie muss ich aussehen, um von bestimmten Menschen anerkannt zu werden und mich gleichzeitig von anderen abzugrenzen? Das Wie wird immer von der jeweiligen Bezugsgruppe definiert, und das können Kolleginnen, Chefs, Sportfreunde, Partner, Kontrahentinnen, Influencer oder Topmodels sein. Wer behauptet: »Ich mache mich schön nur für mich«, muss sich vor diesem Hintergrund wohl eingestehen, dass er sich damit belügt. Man macht sich schön für die Gunst der anderen. Wären keine anderen da, hätte man keinen Grund, seinen Naturzustand in ästhetischer Hinsicht zu verändern. Schönheitshandeln ist also kein Selbstzweck. Oder doch? Vielleicht ein klitzekleines bisschen?
Nikkie de Jager wurde 1994 in den Niederlanden im Körper eines Jungen geboren und ließ ihr Geschlecht in ihrer Kindheit angleichen. Mit 14 lud sie ihr erstes englischsprachiges Schminktutorial auf YouTube hoch. In den kommenden Jahren wurden Nikkies Fertigkeiten immer feiner und ihre Fangemeinde immer größer. Sie liebt die dramatische Drag-Ästhetik. Den maskenhaften Farbauftrag. Contour, Gloss, Bling. Die vollkommene Verwandlung eines Allerweltsgesichts in eine Glamour Queen. 2015 hatte sie auf ihrem Kanal Nikkie Tutorials beinahe eine Million Follower. Und dann löste sie ein Erdbeben aus. In einem Video erzählte die damals 21-Jährige, dass junge Frauen sich neuerdings geradezu schämten, ihren Spaß am Schminken zuzugeben, weil sie so laut dafür kritisiert würden. »Ich habe das Gefühl, als sei Make-up-Shaming neuerdings angesagt.« Es würde den Mädchen unterstellt, sie hätten kein Selbstwertgefühl und sie würden es nur machen, um Jungs zu beeindrucken. Nikkie de Jager wollte beweisen, dass Schminken auch einfach Spaß sein kann. Sie ließ eine Hälfte ihres runden, rosigen Gesichts unmaskiert. Die andere Hälfte verwandelte sie innerhalb von sieben Minuten in eine strahlende Diva. Der Kontrast zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit hätte kaum offensichtlicher sein können. Ihr Tutorial The Power of Makeup ging sofort viral. Allein im ersten halben Jahr erschienen rund 30000 Schminkvideos und Fotos unter demselben Hashtag. Männer und Frauen, Personen mit starker Akne, Brandnarben oder Pigmentstörungen zeigten öffentlich, wie sie wirklich aussahen und wie sie geschminkt aussehen wollten. Bis heute wurde das Originalvideo 43 Millionen mal aufgerufen. De Jager setzt die Tutorial-Serie fort und hat inzwischen auch Kim Kardashian und Adele auf diese janusköpfige Art geschminkt. Durch die schonungslose Gegenüberstellung von Ist-Zustand und Wunsch-Zustand hat The Power of Makeup Normalität sichtbar gemacht und damit auch die Positivity-Bewegung beflügelt.
An diesem YouTube-Trend lassen sich Soziologie, Ökonomie und vor allem Psychologie des Schönheitshandelns ablesen. Natürlich sehen wir sehr viel individuelle Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen. Aber wir sehen auch die Erleichterung in der Lösung. Und wenn Nikkie de Jager mal wieder einen besonders weichen Pinsel testet oder ein neues Glitzerpigment aufträgt und sie ihre entrückte Begeisterung nur noch in einer Kadenz aus »Ooooh, ooo, hold on, ooooh, wow, oh my god, I just, oh, my, I just can’t …!!!« ausdrücken kann, spüren wir sogar, dass im Schminken eine Sinnlichkeit liegt, die einem Selbstzweck ziemlich nahekommt.
Es ist vielfach bewiesen, dass sich geschminkte Frauen selbstbewusster fühlen. Die Biologin und Hirnforscherin Nancy Etcoff konnte 2015 auf Basis einer Langzeitstudie mit 10000 Personen belegen, dass die Attraktivität eines Menschen mit seinem persönlichen Wohlbefinden signifikant zusammenhängt. Andere haben herausgefunden, dass Frauen in Prüfungssituationen bessere Ergebnisse erzielen, wenn sie »ihre Rüstung«, also Make-up, tragen. Diese Befunde sind psychologischer Natur, aber wir können davon ausgehen, dass das gute Gefühl ein interner Spiegel des externen sozialen Belohnungssystems ist: Wir wissen, dass gutes Aussehen gut ankommt, also fühlen wir uns gut, wenn wir wissen, dass wir gut aussehen. Die eigentliche Frage ist, ob Schönheitshandeln, insbesondere Schminken, einen Mehrwert hat, der ganz im Vorgang selbst liegt.
Erstaunlicherweise ist er kaum erforscht. Als verstehe es sich von selbst, dass das kosmetische Ritual auf ähnliche Weise therapeutisch wirkt wie Aschenbechertöpfern, Topflappenhäkeln oder Buntstiftzeichnen. Die Malerei unserer eigenen Maske beschäftigt den Sehsinn, den Geruchssinn und den Tastsinn. Wir berühren unsere Haut, betrachten unser Gesicht, spüren cremige und flüssige Texturen, riechen parfümiertes Puder, schwelgen in Farben. Das Gesicht ist die Leinwand unseres Porträts. Warum sollte sich diese Amateurkunst nicht ebenso positiv auf unser Gemüt auswirken wie die Arbeit an der Staffelei?
Eine kleine britische Studie von 2021 hat 47 Frauen unterschiedlichen Alters ausführlich befragt, warum sie sich schminken. Die Antworten verteilten sich auf vier Begründungen: soziale Erwartungen, Stärkung des Selbstwertgefühls, individueller Ausdruck, Spaß. Mit drei dieser Cluster hatte man gerechnet. Aber dass Make-up sehr häufig als Medium der Kreativität und als lustig oder stimmungshebend beschrieben wurde, hat die Forschenden überrascht. Ums Sich-schön-Machen, weil es Männern gefällt, ging es hingegen selten. »Der Wunsch, Kosmetik zu verwenden, um einfach nur das Selbstbewusstsein zu stärken, und das eben nicht vorrangig durch Verbesserung des Erscheinungsbilds, war überwältigend deutlich«, schreiben die Autorinnen. Sie haben offenbar einen blinden Fleck in diesem Forschungsfeld gefunden. Der Zusammenhang von psychischem Wohlbefinden und Kosmetiknutzung habe unbedingt größere Aufmerksamkeit verdient, meinen sie.
Der sogenannte Lippenstift-Effekt ist ein Lieblingsmythos des Wirtschaftsjournalismus. Leonard Lauder, Vorstand des von seiner Mutter Estée gegründeten Kosmetikkonzerns, prägte diesen makroökonomischen Begriff nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 und während der Bankenkrise 2008. Seiner These zufolge steigt in Zeiten der Rezession der Absatz von niedrigpreisigen Luxusgütern. Mit verlässlichen Zahlen konnte das nie einwandfrei bestätigt werden. Allerdings befand eine Studie von 2012, dass junge Single-Frauen sich während einer Rezession häufiger schminken, um einen Partner zu finden und sich abzusichern. Eine weitere psychologische Erklärung wirkt ebenso einleuchtend. Wer sozialer und wirtschaftlicher Ungewissheit ausgesetzt ist, kann sich durch Konsum immerhin einer gewissen Normalität – und insbesondere durch Kosmetik seines Selbstwerts – versichern. Darüber hinaus betont Linda Scott immer wieder die kreative Kraft der Selbstgestaltung: »Menschen brauchen Innovationen, Vergnügen und Spielerei, um körperlich und geistig gesund zu bleiben. Wenn ihr Leben bedroht ist, müssen sie soziale Gewohnheiten und Ausdrucksformen beibehalten, um ihre Würde zu bewahren, andernfalls verzweifeln sie.« Wir sollten das irrationale, fast obszöne Begehren nach einem kleinen kosmetischen Luxus und dem Spiel mit Farbe in der Dunkelheit vor allem als Zeichen der Menschlichkeit erkennen. Das Gegenteil sei ein Alarmsignal: »Die Abkehr vom Spielerischen und die Vernachlässigung gesellschaftlicher Pflegestandards innerhalb einer Gruppe geben Anlass zur Beunruhigung.«
Diesem existenziellen Aspekt des Lippenstift-Effekts hat die Journalistin Henriette Schroeder 2014 eine Oral History gewidmet. In ihrem Buch Ein Hauch von Lippenstift für die Würde treten 23 Frauen als Zeuginnen unterschiedlicher militärischer oder humaner Krisen auf und erzählen von »Weiblichkeit in Zeiten großer Not«. Da geht es nicht um Verkaufszahlen und Wirtschaftsprognosen, sondern um das – bisweilen sogar lebensgefährliche – Festhalten an einem gestalteten Selbstbild, während in der Welt um diese Frauen herum jede Menschlichkeit und Würde im Chaos versinken.
Schroeder berichtet vom Schicksal der Tschetschenin Zara Murtazalieva, die als 20-Jährige unschuldig in eines der grausamsten russischen Straflager deportiert wurde. Ihr Buch Achteinhalb Jahre: Eine Frau in Putins Lagern ist 2014 in Frankreich erschienen. Murtazalieva schildert, wie Menschen systematisch gebrochen wurden. »Jeden Tag wirst du, symbolisch gesprochen, mit Haut und Haaren durch eine Maschine gejagt, die Hackfleisch aus dir macht. Du sitzt wie ein Tier in der Falle und weißt, dass du es nie schaffen wirst, da herauszukommen. Sie sagten uns jeden Tag, wir seien Huren und keine menschlichen Wesen.« Über Murtazalievas Fall wurde schon während ihrer Haft medial berichtet, in unabhängigen russischen Zeitungen und im Ausland. Sie beschloss, sich der Zermürbung und Aussichtslosigkeit nicht zu ergeben. »Zusammen mit einer Freundin habe ich täglich Yoga-Übungen gemacht, um mein Immunsystem zu stärken. Ich trug regelmäßig Eyeliner und Mascara auf und manchmal sogar eine Gesichtsmaske, die ich mir aus Buttermilch, Sauerrahm und Zitrone, wenn es sie gab, zusammenmischte. Es war keine Routine, es war tägliche Autosuggestion.«
Die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller erzählt in Schroeders Buch von der Repression im kommunistischen Rumänien und wie sich die Diktatur auf die Ästhetik ausgewirkt hat. »So, wie das Individuelle in allen Bereichen verboten war, so war auch die Schönheit verboten.« Und damit meint sie nicht nur die bedrückende Hässlichkeit der Dinge, »von der Getränkeflasche bis zur Kleidung und den Häusern«, sondern auch die ideologisierte Sprache, die Verbote und den Mangel. »Ich wusste, wenn ich mich nicht mehr schminke, wenn mir das nicht mehr wichtig ist, dann habe ich mich aufgegeben. Ich habe mich auch geschminkt, wenn ich nicht zu einem Verhör ging. Aber wenn ich zu einem Verhör ging, vielleicht noch mehr.«
Sind das nun gefallsüchtige, eitle Frauen, die vom männlichen Blick so durchdrungen sind, dass sie selbst im Angesicht des Terrors bereit sind, sich Kosmetik vom Munde abzusparen? Wohl kaum. Vielmehr erkennen wir in diesen Berichten die Kraft des Rituals und die essenzielle Wirkung von Schönheit in einem Umfeld voller Hässlichkeit. Das Schminken ist Ausdruck von Selbstbestimmtheit und Kontrolle. Ganz besonders in Zeiten des Kollapses.
Die westliche Welt erlebt zwar gerade eine Zeit des Wohlstands, aber auch der Verunsicherung alter Gewissheiten. Wie wir in Zukunft leben wollen und ob wir so leben können, wie wir wollen, steht zur Debatte. Wie lange dauert die Zukunft überhaupt noch? Wann ist Schluss auf diesem Planeten? Dann schieben wir solche Gedanken beiseite und quetschen uns in den überfüllten Bus zum Bahnhof. Ist das der Beauty-Horror aus den sozialen Medien, der uns vom Nachbarplatz so beige-pastös anschaut? »Diese Leute, tsssss …«, ätzt es uns durch den Kopf, und wir fühlen uns so alt und beschränkt, wie wir nie werden wollten.
Weltweite Erhebungen des Marktforschungsinstituts Euromonitor haben 2022 ergeben, dass die Generation Z von allen Altersgruppen am ehesten bereit ist, unmaskiert auf die Straße zu gehen. Rund 20 Prozent der zwischen 1995 und 2010 Geborenen tragen gar kein Make-up. Dieser Generation wird ein Interesse an Nachhaltigkeit und Naturschutz nachgesagt, das sich vielleicht auch in den Gesichtern zeigt. Ähnliche Zahlen der Ungeschminktheit erreichen nur die Babyboomer, also die Nachkriegsgeneration. In der Lebensphase der Rentnerinnen nehmen Selbstgestaltung und Individualität aber ganz bestimmt einen anderen Stellenwert ein als bei den Jungen. Umso erstaunlicher die Parallele.
Eine repräsentative YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2023 bestätigt ähnliche altersspezifische Unterschiede und ergänzt noch ein paar Details zu den Schminkvorlieben von US-Amerikanerinnen. Demnach spielt auch die Ausbildung eine Rolle. Frauen ohne Hochschulbildung gaben deutlich öfter an, nie Make-up zu tragen. Leider wurden die Gründe dafür nicht untersucht. Ob geringer gebildete Amerikanerinnen eher mit heimischer Sorgearbeit beschäftigt sind und sich so dem Erwartungsdruck der Aesthetic Labour entziehen? Ob gebildete Frauen eher zu Komplexen neigen und sich deshalb schminken? Ob man an amerikanischen Colleges Schönheitshandeln lernt? Ob es die Karrierejobs sind, die stärkere Masken von ihnen einfordern? Und was sagt es uns, dass das Lager der Trump-Fans bemerkenswert zerrissen ist? 28 Prozent seiner Wählerinnen schminken sich täglich, und genauso viele schminken sich nie.
Das Verwirrendste an unserer Gegenwart ist wohl die Gleichzeitigkeit von allem. Everything, everywhere, all at once. Es gibt die feinporigen Gen-Z-Marie-Sophies aus gutem Hause, die wie ihre Großmütter glauben, Schönheitsarbeit sei etwas für antifeministische Konsumopfer. Es gibt die fröhlich vor sich hinpinselnden Nikkies, die jeden Tag Karneval feiern. Und es gibt die Spa-Exorzistinnen, die sich eine gestylte Natürlichkeit herbeiexfolieren. Kann es sein, dass unsere innere Stimme immer noch den Pietismus der Vergangenheit zitiert, wenn wir den dezenten Look intuitiv mit mehr Anstand und einem höheren sozialen Status verbinden als den bunt gemalten?
Stark geschminkte Gesichter taugten außerhalb höfischer Gesellschaften noch nie als Ausdruck von Status, egal wie viel das Kosmetikarsenal gekostet haben mag. Die leicht geschminkte Frau ist gesellschaftlich erwünscht, weil sie mit Willen und Make-up verjüngende Effekte erzielt, wenn ihr Fleisch schwach geworden ist.
Wundersame Verwandlungen
Es scheint, als sei es nur ein kleiner Schritt von der Spritze zum Schnitt – vom Mittagspausen-Botox bis zum Gesichtslifting mit Skalpell, Nadel und Faden. Von der sogenannten minimalinvasiven Behandlung zum chirurgischen Eingriff. Dazwischen verläuft aber eine moralische Schwelle, die viele Menschen nicht überschritten wissen wollen: die bewusste Verletzung der körperlichen Unversehrtheit. Für eine wachsende Zahl an Personen auf der ganzen Welt sinkt diese Schwelle allerdings. Die Statistiken der Chirurgieverbände belegen einen starken Anstieg ästhetischer Eingriffe während der Pandemiejahre. Die dauernde Spiegelung in Zoom-Kameras hat wohl zu vielfachen narzisstischen Kränkungen geführt. Durch die Arbeit von zu Hause war dann auch endlich ein entspannter postoperativer Heilungsprozess möglich. In den USA erhöhte sich die Zahl der Eingriffe zwischen 2019 und 2022 um 19 Prozent. In Deutschland waren es zwischenzeitig 16 Prozent mehr. Die Zahlen gingen hier allerdings 2023 wieder auf vorpandemisches Niveau zurück. Im Land von Kant mag man es ganz allgemein etwas »natürlicher«, was den Zuwachs an Spritzenbehandlungen erklärt. Diese werden inzwischen oft von unqualifizierten Kosmetikerinnen oder in Beauty-Studio-Filialen vorgenommen und entziehen sich damit jeder medizinischen Kontrolle und Statistik.
Wie soziale Medien und der Hype um Schönheitsoperationen zusammenhängen, beschreibt der Kulturwissenschaftler Daniel Hornuff in seinem Essayband Krass!