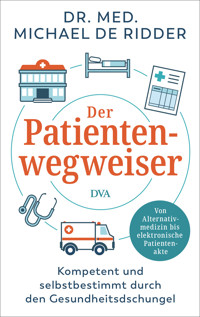Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
»Wir tun, was wir können« – Vom Auftrag der Medizin am Lebensende
Wiederbelebung – »Sie sollen das Herz massieren, nicht streicheln!«
Vom »technologischen Imperativ« in der Medizin
Aussichtslose Medizin – Sag niemals nie! Sag niemals immer!
Zerlegte Medizin – Zerlegter Patient
Sterben zulassen
Zwischen Herztod und Hirntod – Wann endet das menschliche Leben?
»Tot ist, wer nicht mehr atmet und kalt ist«
Dieter T.: Wiederbelebt und doch tot
Der Eintritt des Todes ist kein Moment, sondern ein Prozess
Der Hirntod ist der Tod des Menschen
Dieter T. – (k)ein Leben nach dem Tod
Künstliche Ernährung am Lebensende – Die Legende vom Verhungern und Verdursten
»Wollen Sie, dass Ihr Vater verhungert?«
Künstliche Ernährung am Lebensende – Was sagt die Wissenschaft?
Die PEG – Vom unterschätzten Unheil einer medizinischen Innovation
Gepflegt und doch verendet – Vom Sterben der Alten und Gebrechlichen
Verordnetes Leid – Das Fiasko der Schmerztherapie
»Wir rufen Sie an, wenn es so weit ist« – Von der Kälte des Krankenhausbetriebs
Brief einer »Querulantin«
Vermeidbares Sterben im Krankenhaus – »Wir haben doch eine gute Haftpflicht!«
»Ich liebe meinen Sohn, aber er gehört mir nicht« – Das lange Sterben des ...
Mensch ohne Selbst – Das sogenannte Wachkoma
Ursachen des vegetativen Status
Wachheit ohne Bewusstsein: Definition des vegetativen Status
Kriterien für die Diagnose des vegetativen Status
Die Bedeutung bildgebender und anderer technischer Verfahren für die Diagnose ...
Klinische Erscheinungsformen des vegetativen Status
Unterscheidung des vegetativen Status von anderen neurologischen Schäden und Erkrankungen
Der vegetative Status im zeitlichen Verlauf
Behandlung, Pflege und Fürsorge im vegetativen Status
Sicherheit der Diagnose, Fehlerquellen, Irrtümer
Ethik der gewissenhaften Diagnostik
Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen im permanenten vegetativen Status – Die ...
Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen im permanenten vegetativen Status – Eigene Position
Des Menschen Wille – Selbstbestimmung am Lebensende
»Keine Schläuche bitte«
Selbstbestimmung am Lebensende – Ein Gesetz war überfällig
Die Rechtslage nach Inkrafttreten des Dritten Gesetzes zur Änderung des ...
War ein »Patientenverfügungsgesetz« notwendig?
Selbstbestimmung – Der Kern der Menschenwürde
Zum Leben verpflichtet?
Verbindlichkeit und Reichweite der Patientenverfügung
Todesnähe – unumkehrbar tödlicher Verlauf – unheilbare tödliche Erkrankung
Selbstbestimmung – Ohne innere Auseinandersetzung, Dialog und Beratung bleibt ...
Die Patientenverfügung: Ein Recht, keine Pflicht
Patientenwille unbekannt – Entscheiden ohne Mandat?
Die Hoffnung stirbt zuletzt – Vom Wert der Palliativmedizin
Palliativmedizin – Ein verkanntes medizinisches Fachgebiet
Richard S.: Sterben wollen – sterben lassen
»Kein Abschied – das war das Schlimmste!«
Die Krankheit behandeln oder den Kranken – Vom Sündenfall der Medizin
An den Grenzen der Palliativmedizin – Wann endet der ärztliche Auftrag?
Katharina S. – »ein beatmeter Kopf«
Zwischen Lebensbejahung und Sterbewunsch
Passive und aktive Sterbehilfe – Tun und Unterlassen – Strafbarkeit
Sterben zulassen – Abbruch oder Nicht-Aufnahme einer lebenserhaltenden Behandlung
Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit
Indirekte aktive Sterbehilfe und terminale Sedierung
Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung
Vorbild Oregon?
Direkte aktive Sterbehilfe
Handeln am Lebensende – Absichten und Folgen
Sterben annehmen, Sterben gestalten? – Ein Ausblick
Sterblichkeit – Eine Krankheit?
Gleichrangigkeit von ärztlichem Heilungsauftrag und ärztlichem Auftrag zur ...
Sterben annehmen
Palliativmedizin – Die überlegene Option
Wunsch und Wille des Patienten – Sterben im Dialog
Jenseits der Palliativmedizin – Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung und direkte ...
Klare Indikation und wahrhaftige Absichten – Voraussetzungen guten ärztlichen Handelns
Danksagung
Glossar
Anmerkungen
Copyright
Meiner Frau Margret und meiner Tochter Cora in Liebe zugeeignet. Sie haben mich beim Schreiben des Buches in wundervoller Weise unterstützt.
Wer weiß schon, ob das Sterben nicht eigentlich das Leben und das Leben nicht eigentlich das Sterben ist. Unbekannter attischer Tragödiendichter
Don’t try to live for ever You will not succeed.
G. B. Shaw
Vorwort
Es war in der Frühzeit meiner ärztlichen Ausbildung: Gerade hatte ich als junger Stationsarzt einer internistischen Station die Oberarztvisite beendet, als mir der Aufnahmearzt telefonisch einen alleinstehenden 64-jährigen Patienten im Endstadium einer Tumorerkrankung ankündigte: »Tu den am besten in ein Einzelzimmer, der stirbt sowieso bald.« Der Krankentransport übergab mir einen blassen, hüstelnden und vom Tode gezeichneten Mann, der mich aus großen Augen eines ausgezehrten Gesichts anschaute. Über ein freies Einzelzimmer jedoch verfügte ich nicht und auf eine andere Station auszuweichen, war wegen fehlender Betten nicht möglich. Aber war da nicht noch ein freies Bett im einzigen Sechsbettzimmer meiner Station? Ich zögerte. Konnte ich den fünf Patienten dieses Zimmers einen zu Tode Erkrankten wirklich zumuten? Ich erschrak vor meiner eigenen Frage und begriff in diesem Moment: Das Sterben gehört ins Leben – unter Menschen! Und nicht in die Verlassenheit eines Einzelzimmers.
Eine halbe Stunde lang sprach ich mit den anderen Patienten, deren anfängliche Beklommenheit und Bedenken ich schließlich zerstreuen konnte. »Stell dir vor, du hättest Krebs im Endstadium wie er«, sagte einer von ihnen in die Runde, und zu mir gewandt: »Wir nehmen den, Herr Doktor, er kriegt einen Fensterplatz!« Die anderen nickten zustimmend. Nie wieder habe ich Ähnliches erlebt: Die Patienten des Sechsbettzimmers organisierten untereinander für den Todkranken eine 24-Stunden-Sitzwache, sie saßen an seinem Bett, fütterten und wuschen ihn und lasen ihm aus der Zeitung vor. Fünf Tage später starb er, in ihrer aller Anwesenheit. Einer seiner Mitpatienten sagte bei der Entlassung zu mir: »Diese fünf Tage meines Lebens waren wichtig, ich werde sie nie vergessen.«
Ich vergaß diese Episode bald und erinnerte mich an sie erst Jahre später wieder. Im Nachhinein will es mir scheinen, als spielte sie eine Schlüsselrolle in meinem ärztlichen Werdegang. Der war weniger davon geprägt, mir möglichst rasch eine klassische Medizinerkarriere als Internist zurechtzuzimmern, zügig die Beherrschung apparativer Verfahren, wie Gastroskopie oder Echokardiografie anzueignen, an wissenschaftlichen Studien teilzunehmen und mich nach Möglichkeit um eine Promotionsstelle bei einem ärztlichen »Meinungsbildner« mit der Aussicht zu bemühen, in Zukunft selbst auf den Bühnen der Medizin als Halbgott aufzutreten.
So wichtig es mir während meiner ersten Berufsjahre zweifellos war, die klinische Medizin sowie apparative diagnostische und therapeutische Fertigkeiten zu erlernen, so sah ich doch bald die für mich bedeutenderen und fesselnderen Herausforderungen des Arztberufs, von dem ich erst spät begriff, dass er tatsächlich zu meinem Traumberuf geworden war, im Unterholz der Medizin und auf ihren Brachflächen; mich zog es dorthin, wo die Ärzteschaft offenbar kapituliert hatte, ideenlos geblieben war und wirklicher Versorgungsmangel herrschte.
Wie konnte es sein, dass in einem zivilisierten und medizinisch hoch gerüsteten Land wie dem unsrigen, das sich gern das Etikett »Sozialstaat« anheftet, zahllose chronisch Kranke und Pflegebedürftige ärztlich und pflegerisch in einem Ausmaß unterversorgt waren (und sind), das schließlich den Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages auf den Plan rief? Wie war es möglich, dass gleichzeitig in der deutschen Kardiologie eine geradezu groteske, Milliardenbeträge verschlingende Überversorgung (Herzkatheter!) nachzuweisen war und immer noch ist?1 Welches Selbstverständnis hatte eine Ärzteschaft, die kranke Drogenabhängige in der Vor-Methadon-Ära praktisch ohne jede medizinische Versorgung ließ, weil die Medizin das Ziel ihrer Behandlung, Drogenfreiheit nämlich, zur Voraussetzung für eine Behandlung machte, ein ebenso absurdes wie inhumanes Vorgehen? Wie konnte in dem Land, das den Entdecker des Morphiums zu seinen Bürgern zählte, die Unterversorgung Schwerstkranker mit Schmerzmitteln ein so beschämendes Ausmaß annehmen? Warum überließ man eine der heikelsten Herausforderungen, der sich die Intensivmedizin regelmäßig zu stellen hat, das Gespräch mit den Angehörigen eines Hirntoten, um ihre Zustimmung zu einer Organentnahme einzuholen, so überaus häufig gerade den jüngsten und unerfahrensten Assistenten, mit dem Erfolg, dass allzu oft die Zustimmung versagt wurde? Kam es nicht einer Tortur gleich, dass die Medizin Patienten im zutreffend diagnostizierten permanenten vegetativen Status (sogenanntes Wachkoma) zu einem unter Umständen jahrzehntelangen Leben verurteilte, das sie von jeglicher Teilhabe ausschloss; ein Leben in der Verbannung? Schließlich, in welcher Verfassung befinden sich Ärzteschaft und Medizin, wenn die Zeitschrift LANCET, das international bedeutendste und geachtetste Medizinjournal, vor wenigen Jahren anlässlich der Aufdeckung der Bestechlichkeit des Herausgebers einer angesehenen medizinischen Fachzeitschrift einen Leitartikel mit den Worten überschreibt: »Just how tainted has medicine become?« (Wie verdorben eigentlich ist die Medizin geworden?)2
Hier taten sich die Fragen und Probleme auf, die mir nahegingen und mich angesichts der Zugehörigkeit zu einer Profession, die wie keine zweite die Flagge der Ethik vor sich hertrug, herausforderten. Ein Spektrum sehr unterschiedlicher Fragen zwar, die jedoch eines miteinander verbindet: Sie alle verweisen auf Grundsätzliches; sie berühren sozusagen das Mark der ärztlichen Profession, die Prinzipien und das Koordinatensystem ihres Handelns. Und eben dies, das Interesse an den ethischen Grundlagen ärztlichen Handelns war es, was ich mir neben meiner »Pflicht«, der praktischen Arbeit als Internist, Intensiv- und Notfallmediziner, zur »Kür« erkoren hatte.
Ins Fadenkreuz meines Interesses geriet mit der Zeit, unmerklich fast, das Lebensende. Sterben – in all seinen Formen und Extremen, in seiner ganzen Grausamkeit, Abgründigkeit und Unberechenbarkeit war und ist Teil meines seit Jahrzehnten zu bewältigenden Alltags. Mehr noch: Die langen Jahre, die ich als Arzt auf Intensivstationen verbrachte, die zahllosen Notarztwageneinsätze während 15 Jahren, die Leitung einer Rettungsstelle sowie die außerklinische Behandlung und Betreuung manch anderer Schwerstkranker hatten das Sterben im Lauf der Zeit zur zentralen Erfahrung meines ärztlichen Daseins werden lassen. Es schien mir eng und immer enger mit meinem Leben verbunden; ja auf gewisse Weise hatten wir, das Sterben und ich, wenn nicht Freundschaft geschlossen, so uns doch einander zugewandt, eine Erfahrung, die für mich zu einer tiefen Bereicherung dadurch wurde, dass ich am Sterben anderer teilhaben durfte.
Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar. Sie ist Herzstück und roter Faden dieses Buches.
»Wir tun, was wir können« – Vom Auftrag der Medizin am Lebensende
Wiederbelebung – »Sie sollen das Herz massieren, nicht streicheln!«
Nackt und reglos, mit ausgebreiteten Armen und gespreizten Beinen, das Haar unter einer hellgrünen Papierhaube, liegt sie da, in einem hydraulisch angehobenen Bett der Intensivstation, wie angerichtet auf einem Tablett, einer Gekreuzigten gleich: Eine 86 -jährige Greisin aus einem Seniorenheim, ohne Bewusstsein und mit nicht mehr ausreichender Atmung. Zwei Tage schon hatte Gerda L. in ihrer Wohnung gelegen, doch erst vor wenigen Stunden war sie von ihrer Enkelin gefunden worden.
Aus ihrem rechten Nasenloch sickert Blut. Vergeblich hatte ein junger Assistenzarzt unter Anleitung eines erfahrenen Intensivmediziners versucht, ihr Nasenloch mit dem Finger zu weiten, um einem durch die Nase zu legenden, an der Rachenhinterwand entlang zu führenden Beatmungstubus seinen Weg in die Luftröhre der alten Frau zu bahnen. Resigniert und mit Schweißperlen auf der Oberlippe steht der junge Arzt nun da, den blutverschmierten Tubus in der Hand, in Erwartung einer ungnädigen Bemerkung des an seiner Seite stehenden Älteren:
»Pech gehabt! Die hat sicher eine Abweichung des Nasenseptums zur rechten Seite. Nimm das andere Nasenloch! Und vorher richtig rein mit dem Finger! So ist das in der Medizin, manchmal muss man die Patienten quälen!«
Der Ältere ist genervt. Man sieht ihm an, dass er dem zögerlichen jüngeren Kollegen am liebsten den Schlauch aus der Hand nähme, um die Intubation rasch selbst zu erledigen: »Nun mach schon, die Alte wird sonst blau und nippelt uns ab!« Während der Jüngere nun beginnt, sich an ihrem linken Nasenloch zu schaffen zu machen, versucht ein dritter Arzt, in die rechte Handgelenksarterie eine kleine Kanüle einzubringen, um eine »invasive Blutdruckmessung« vorzubereiten. Kurz zuvor hatte er unterhalb des rechten Schlüsselbeins einen Venenkatheter in die unter diesem Knochen verlaufende großvolumige Vene gelegt, um eine Infusion in den Körper der Patientin einlaufen zu lassen. Den Erfolg seiner Aktion kommentierte er mit einem leise vor sich hin gemurmelten »Getroffen!«.
Unterdessen hat ein Pfleger am Brustkorb Klebeelektroden befestigt und den Herzschlag der alten Frau auf einem Monitor hör- und sichtbar gemacht. Die Oberschwester der Intensivstation hat eigenhändig einen Katheter zur künstlichen Harnableitung platziert und die Studentin des Praktischen Jahres darf jetzt unter den Augen des mit verschränkten Armen am Fußende des Bettes stehenden und die gesamte Aktion in Feldwebelmanier dirigierenden Oberarztes versuchen, in der Leiste der Greisin die Schenkelarterie zwecks Gewinnung arteriellen Blutes für eine Gasanalyse zu punktieren.
»Und denken Sie immer an IVAN, Frau Kollegin, den Schrecklichen, wenn Sie sich in der Leiste orientieren müssen. Umso höher ist Ihre Trefferquote!«, sagt er übertrieben freundlich zu der hübschen angehenden Ärztin, die jetzt sehr konzentriert die Nadel mit aufgesetzter Spritze senkrecht über der Leiste ansetzt und dabei eine krause Stirn zieht.
»Sie kennen IVAN nicht, Frau Doktor? Na, so was! Die Lage des Gefäßnervenbündels in der Leiste folgt I-V-A-N: Innen, Vene, Arterie, Nerv.« Der Stolz des Erfahrenen, der Geheimwissen an ausgesuchte Jünger gönnerhaft weitergibt, ist nicht zu überhören: »Sehr schön haben Sie das gemacht!«
In mir schrie alles auf, doch ich blieb stumm, mir stockte der Atem. Ich spürte und sah, ohne etwas von der Patientin zu wissen, dass mit ihr etwas Absurdes geschah, in jedem Fall etwas Grausames. Fast hatte ich meinen Patienten, den ich als junger Stationsarzt auf der Gastroenterologie der hiesigen Universitätsklinik wegen eines entgleisten Diabetes hier auf der Inneren Intensivstation zur Weiterbehandlung übergeben wollte, vergessen.
War das praktizierte Heilkunde? Sah so die Erfüllung des Auftrags der Medizin aus? Oder wurde dieser Auftrag hier gerade in sein Gegenteil verkehrt? War ich Zeuge von Experimenten am Menschen? Erlebte ich soeben den leibhaftigen Stand der ärztlichen Kunst in der Rettung menschlichen Lebens? Oder beobachtete ich Menschen, die nicht wissen, was sie tun, Kindern gleich, die ungerührt Frösche zu Tode quälen?
»Achtung! Herzfrequenz und Blutdruck fallen! Die Frau fängt an, uns echte Probleme zu machen! Wiederbelebung vorbereiten!«
An der Verlangsamung des Monitor-Signaltons und an den auf dem Bildschirm sichtbaren flacher werdenden Pulswellen hat der Oberarzt erkannt, dass der ohnehin danieder liegende Kreislauf der alten Frau jetzt völlig zusammenzubrechen droht. Eine halbe Minute später steht ihr Herz still und die Wiederbelebung der Greisin mittels Beatmung und Herzmassage ist in vollem Gange: »Sie machen das immer noch falsch, Herr Kollege! Viel zu zaghaft! Arme durchstrecken bei der Herzmassage! Rechtwinklig das Handgelenk aufsetzen! Und dann runter mit dem Brustbein in Richtung Wirbelsäule! Sie sollen das Herz massieren – dong! dong! dong! – und nicht streicheln! Man muss das Knacken der Rippen hören, verstanden? Hier geht’s um was, Leben oder Sterben nämlich! Kapiert?«
Leben oder Sterben? Stellte sich diese Frage hier tatsächlich noch?
»Warum tun Sie das?«, fragte ich den neben mir stehenden Oberarzt wie betäubt. Er sah mich an, als wäre ich ein Außerirdischer. »Das sehen Sie doch! Die hat einen ausgedehnten Schlaganfall mit Ateminsuffizienz und obendrein noch ein Linksherzversagen. Reicht Ihnen das nicht?«
»Aber … sie ist doch … nicht mehr zu retten … oder?«
»Nicht mehr zu retten ist sie, lieber Herr Kollege, wenn Sie auf dem Monitor anhaltend eine Nulllinie registrieren und die Pupillen lichtstarr sind. Nehmen Sie noch mal Ihr Pathologielehrbuch zur Hand!«
Er wandte sich wieder der Reanimation zu. Schweigend und emsig taten nun alle das, was sie zu tun hatten: Die beiden Ärzte am Kopfende besorgten die Beatmung; zwei Pfleger im Wechsel miteinander die Herzmassage; die Studentin injizierte nach Anweisung des Oberarztes Kreislauf stabilisierende Medikamente; mehrere Pflegekräfte bereiteten Infusionen und Perfusoren vor, die Oberschwester protokollierte akribisch alle Einzelheiten des Geschehens.
»Kammerflimmern! Defibrillation vorbereiten!«, rief der Oberarzt unvermittelt. »Beginn mit 50 Watt, alle vom Bett wegtreten!«
Er selbst nahm die Elektrodengriffe in die Hand und löste im Wechsel mit der Herzmassage der beiden Pfleger unter steigenden Wattzahlen über und seitlich der Brust der Patientin zahlreiche Elektroschocks aus. Stille. Gespanntes Warten. Vergeblich. Nulllinie im EKG. Geruch von verbrannter Haut stieg über der alten Frau auf und dort, wo die Elektroschocks in ihren Körper eingedrungen waren, zeigten sich rötliche Brandmale auf ihrer Brust. Ein letztes reflektorisches Heben des Unterkiefers, dann lag Gerda L. da, gespickt mit Kanülen, Schläuchen und Kathetern, mit weit geöffneten Augen und starren Pupillen, auf ihrem Gesicht ein Ausdruck friedlicher Entrücktheit.
Tief griff der Oberarzt jetzt in die Leiste der Toten, um sicher zu sein, dass sie keinen Puls mehr hatte. Noch einmal hielten die Anwesenden einen Augenblick inne.
»Kein Leistenpuls – Abbruch der Reanimation!«, verkündete er, streifte seine Latex-Handschuhe ab und ließ sie auf den Bauch der Toten fallen.
Eine ältere Schwester öffnete ein Fenster.
Das, was hier geschah, wurde oftmals schon angeprangert. Seit vielen Jahren steht eine Behandlung wie die oben beschriebene für eine Medizin, der Patientenwohl, Menschlichkeit und Mitgefühl, ja selbst ihre ureigene Professionalität abhandengekommen ist. Als unbefangener Leser sollte man annehmen dürfen, dass ärztliches Handeln dieser Art, weil unangemessen und unheilvoll, eben deswegen seit Langem der Vergangenheit angehört.
Doch eher das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Der Radius des »Machbaren« in der Medizin weitet sich nicht allein am Lebensende unablässig aus. Sein Nutzen für viele Kranke dagegen ist häufig nicht nur gering, sondern obendrein auch noch risikoreich und kostspielig, wie beispielsweise auch die steigende Zahl der ungerechtfertigten Herzkatheteruntersuchungen und Stentimplantationen an den Herzkranzgefäßen in unserem Land seit Jahren immer aufs Neue belegt.
Behandlungen, die auch nur die geringste Aussicht bieten, das Leben um eine noch so kurze Frist zu verlängern, gehören nach wie vor zum Alltag einer medizinischen Praxis, die unter Berufung auf kleinste Chancen oftmals gewaltiges Unheil anrichtet. Mit anderen Worten: Das Machbare und das Patientenwohl, an dem Ersteres sich immer hat messen zu lassen, driften allzu oft auseinander, weil immer noch und immer wieder eine janusköpfige und vermeintlich unabänderliche Maxime ärztliches Handeln am Lebensende dominiert: »Wir tun alles, was wir können!«
Vom »technologischen Imperativ« in der Medizin
Wann begann diese so vielversprechende, sich allerdings oftmals gerade im hohen Alter und in aussichtsloser Krankheit so unheilvoll auswirkende Entwicklung, die das Sterben ungezählter Patienten zur Tragödie machte und macht? Eine Tragödie nicht allein für sie selbst, sondern auch für ihre Angehörigen, von denen nur wenige den Mut, die Kraft und die Mittel aufzubringen in der Lage waren und sind, das unabsehbare Leiden eines ihnen nahestehenden Menschen zu ertragen oder schließlich über den Rechtsweg beenden zu lassen. Wo liegen die Wurzeln dieser ebenso naiven wie hybriden Maxime, der immer noch zahllose Ärzte hörig sind? Warum kann es also nicht ausbleiben, dass ärztliches Handeln immer noch und allzu oft im Sumpf des sogenannten »technologischen Imperativs« stecken bleibt zum Schaden oder Nachteil des Patienten?
Bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts war die Medizin weitgehend hilflos und billig, jedoch dem Kranken zugewandt. Sie hatte fast ausschließlich lindernden Charakter und begleitete den Patienten in seiner Krankheit eher, als dass sie ihn, jedenfalls nach heutigen Maßstäben, wirklich behandeln konnte. Ein Patient, der 1960 einen Herzinfarkt erlitt, wurde ins Krankenhaus aufgenommen, der Arzt verordnete ihm körperliche Schonung, Ruhe und leichte Kost und entließ ihn mit mehr oder weniger »erholtem« Herzen nach drei Wochen. Vielleicht hatte der Patient ein Rezept für den gerade zur Marktreife gelangten ersten Betablocker in der Tasche.
Möglicherweise aber erlitt der Patient während seines Klinikaufenthaltes eine bedrohliche Rhythmusstörung, wie zum Beispiel das gefürchtete Herzflimmern, eine Komplikation des Herzinfarktes, der die Medizin ebenso machtlos gegenüberstand wie einem ausgedehnten Infarkt mit nachfolgendem, noch in der Klinik zum Tode führenden Herzversagen.
Auch Patienten mit einer Erkrankung der Nieren, die nicht mehr in der Lage waren, die Endprodukte des Stoffwechsels aus dem Körper zu entfernen, starben mangels verfügbarer Eingriffsmöglichkeiten unter den Augen ohnmächtiger Ärzte im sogenannten urämischen Koma einen allmählichen und schmerzlosen »gnädigen« Tod. Arzt und Medizin verfügten also damals über ein noch äußerst begrenztes und kaum entwickeltes diagnostisches und therapeutisches Instrumentarium.
Erst mit Beginn der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts begann eine neue medizinische Epoche, die ein Feuerwerk geradezu revolutionärer hoch effektiver technischer Neuerungen entfachte und in die Therapie einführte. Seitdem verfügt die Medizin über Mittel und Möglichkeiten, den akuten Tod zu verhindern, das Leben zu verlängern und die Qualität des Lebens zahlloser Kranker entscheidend zu verbessern: Ende der 40er Jahre überlebte erstmals ein Patient mit akutem Nierenversagen dank eines von dem niederländischen Arzt Willem Kolff entwickelten funktionstüchtigen Dialyseverfahrens; 1949 entstand mithilfe der Bildröhre eines Nachtjagd-Sichtgeräts der erste Herzmonitor; anlässlich einer Polioepidemie gelang einem dänischen Arzt 1952 bei einem Kind die Intubationsbeatmung mittels eines in die Luftröhre eingebrachten Schlauchs; fußend auf der schon 1928 von den Amerikanern Philip Drinker und Charles McKhann erfundenen »Eisernen Lunge« entwickelte eine Hamburger Ärztegruppe in Zusammenarbeit mit Ingenieuren der Deutschen Werft Hamburg-Finkenwerder auf der Basis von Torpedoröhren um 1950 die ersten »Eisernen Lungen« in Deutschland, die zahlreiche dem Tode geweihte Poliopatienten mit Atemlähmung zu retten vermochten;1 die während der großen Polioepidemien zu Anfang der 50er Jahre entstandenen Poliomyelitisbehandlungsstationen wandelten sich zu den ersten Intensivstationen; 1954 gelang in den Vereinigten Staaten bei eineiigen Zwillingen zum ersten Mal eine Organtransplantation; 1957 führte der Amerikaner Lown die elektrische Defibrillation zur Behebung des Herzstillstands in die Medizin ein; ein Jahr später wurde einem Patienten in Schweden ein Herzschrittmacher eingesetzt, mit dem er elf Jahre überlebte; in den 60er Jahren folgten die Blutersatzinfusion und die künstliche Ernährung über eine Sonde.2
Diese Errungenschaften waren es, die die Medizin wie niemals zuvor in ihren Fundamenten veränderten, hatte sie doch bis dahin einen nahezu ausschließlich pflegerisch-palliativen Charakter. Nun aber war innerhalb weniger Jahre ein Fortschritt erzielt worden, der einen gewaltigen qualitativen Sprung bedeutete, weil der Arzt in die Lage versetzt war, in schwerste Krankheit, ja in den Sterbeprozess wirksam einzugreifen. Der seit Beginn der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts sich vollziehende Zuwachs an technischen und pharmakologischen Handlungsmöglichkeiten nährte ärztliche Allmachtsfantasien ebenso wie die weit verbreitete und fragwürdige Vorstellung vom Arzt als »Herr über Leben und Tod«, »hinter dem allein der Herrgott steht«. Klischees, die unbedarften Zeitgenossen immer noch Schauder über den Rücken jagen.
Gerade in Ländern wie den Vereinigten Staaten, in denen die finanzielle Seite der Bewältigung von Krankheit auch heute noch weitgehend Privatsache ist, hatten diese Errungenschaften dramatische Auswirkungen: Die Behandlung von Nierenkranken im Endstadium begann in den USA im größeren Stil 1960 und sie war zunächst nur an einem Krankenhaus in Seattle möglich. Hunderte von Patienten warteten damals auf die lebensrettende Blutwäsche. Unter denen, die für die jährlichen Behandlungskosten von 30 000 Dollar nicht selbst aufkommen konnten, sonderte ein Ärztekomitee zunächst diejenigen aus, die nach medizinischen Kriterien eine schlechte Prognose hatten. Ein zweites, aus Bürgern bestehendes Komitee, dessen Mitglieder der Öffentlichkeit unbekannt waren und welches geheim tagte, entschied über Leben und Tod der Verbliebenen nach Kriterien wie diesen: Sollte ein nierenkranker Vater von sechs oder einer von vier Kindern vorrangig in den Genuss der Behandlung kommen? War der Kandidat nach Ausbildung, Charakter, Moralvorstellungen und Religionszugehörigkeit ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft? Erst 1972 wurde ein gesetzlicher Anspruch festgeschrieben, der die Dialyse in den Vereinigten Staaten allen Bürgern unabhängig von ihrem Einkommen zugänglich machte.3
Es ist nicht übertrieben, die Einführung der neuen Techniken der Wiederbelebung, der Lebensverlängerung und Organtransplantation in die Medizin als einen Epochenwechsel zu bezeichnen. Er konfrontierte insbesondere die Ärzteschaft mit bis dahin nie gestellten und schwerwiegenden Fragen, die kaum absehbare Auswirkungen auf ihr professionelles Selbstverständnis und ihr ethisches Koordinatensystem hatten. Ganz in den Vordergrund trat nunmehr die Notwendigkeit, Entscheidungen treffen zu müssen, die sich zuvor weder dem Arzt noch dem Patienten, gerade am Lebensende, gestellt hatten, da Alternativen, zwischen denen hätte entschieden werden können oder müssen, gar nicht existiert hatten. Viele der einschneidenden und folgenreichen Entscheidungen, von denen Leben und Tod eines Kranken, ein unter Umständen quälendes oder friedliches Sterben abhingen, war vormals eben weniger im professionellen und ethischen Ermessen des Arztes als im Schicksal des Kranken selbst begründet: in der Art und Schwere seiner Erkrankung, in seiner Konstitution sowie seinen natürlichen körperlichen und seelischen Widerstandskräften und den ihn umgebenden sozialen Bedingungen.
Eine weitere Folge der Einführung neuer Technologien, der Ärzte sich nun zunehmend ausgesetzt sahen, bildete die Erfahrung der therapeutischen Aussichtslosigkeit und Niederlage. Sie wohnte zwar auch zuvor schon jeder Behandlung eines Patienten und seiner Krankheit inne, doch wegen der vergleichsweise bescheidenen Mittel, über die die Medizin bis weit ins 20. Jahrhundert verfügte, blieb diese Erfahrung über lange Zeit für den Arzt eine sehr begrenzte. Erst die Bereitstellung aussichtsreicher, um nicht zu sagen aggressiver Therapien eröffnete auch die Möglichkeit des therapeutischen Scheiterns und der Niederlage. So konnte es nicht ausbleiben, dass sich in der Medizin der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Paradox auftat: Mit ihrem sich beständig erweiternden therapeutischen Arsenal wuchs zugleich das Risiko des Misserfolgs oder Fehlschlags, zumal dann, wenn Ärzte unangemessene Entscheidungen trafen, weil sie den ganzen Patienten und sein Gesamtwohl aus den Augen verloren hatten.
So war die Wiederbelebung von Herz und Kreislauf einschließlich der Elektroschockbehandlung ursprünglich für Patienten mit akutem Herzinfarkt oder schwerer Angina pectoris entwickelt worden, die sonst gesund waren, in der Klinik oftmals aber eine tödliche Herzrhythmusstörung erlitten. Durch die Schockbehandlung war sie beherrschbar geworden: Zahlreichen Patienten rettete sie das Leben und ermöglichte ihnen ein normales Weiterleben. Ähnliches gilt für die Einführung der maschinellen Beatmung, die die für größere Operationen unverzichtbare Entspannung der Muskulatur bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Atemfunktion gewährleistete und obendrein zu mehr Narkosesicherheit führte. Zudem war es möglich geworden, Patienten mit Atemlähmung bei Vergiftungen überbrückend zu beatmen.
Diese wenigen Beispiele machen deutlich, dass die moderne Medizintechnologie ursprünglich also für höchst sinnvolle Behandlungsindikationen entwickelt worden war, die sich besonders im Rahmen der Behandlung von Akuterkrankungen schon bald als sehr wertvoll erwies. Doch erfuhren die neuen Behandlungsmethoden innerhalb weniger Jahre eine unkritische, zum Teil uferlose Ausweitung. Die Folge war, dass zum Beispiel der Anteil der nach Wiederbelebung das Krankenhaus gesund verlassenden Patienten von 50 % in den 60er Jahren auf derzeit wenige Prozent zurückging.4 Diese Ergebnisse kommen zustande, weil heute zum Beispiel auch betagte Patienten mit schwersten chronischen Erkrankungen, wie Gerda L., Wiederbelebungsmaßnahmen unterworfen werden, die praktisch nie erfolgreich enden. Auch Patienten mit Herz-Kreislaufstillstand, dessen Dauer die Wiederbelebungszeit des Gehirns (von maximal etwa acht Minuten) überschritten hat, werden sehr oft mit dem tragischen Resultat dauerhafter Bewusstlosigkeit wiederbelebt.
Wie ausgeprägt die Angst und Unsicherheit mancher Ärzte ist, das »Machbare«, selbst wenn es voraussehbar aussichtslos ist und das Lebensende des Kranken unmittelbar bevorsteht, zu unterlassen und dafür Verantwortung zu übernehmen, soll ein Beispiel verdeutlichen.
Ein 77-jähriger Mann wird in schlechtem Allgemeinzustand in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingewiesen: Nach Auskunft des Hausarztes hatte alles schon vor Tagen mit plötzlichen linksseitigen Unterbauchschmerzen begonnen, doch der alte Herr, schwer zucker-, herz- und gefäßkranker Bewohner eines Seniorenheims, weigerte sich, eine Krankenhauseinweisung zu akzeptieren. Blass, schweißig und teilnahmslos liegt der nun Schwerstkranke auf der Trage, sein Blutdruck ist abnormal niedrig, die Haut bereits marmoriert. Nach körperlicher Untersuchung, einer Sonografie des Bauchraumes und Erhalt der Laborbefunde kommt Dr. T., der diensthabende Internist, nicht nur zu einer Diagnose, sondern er weiß auch den Schweregrad der Erkrankung richtig einzuschätzen: Sepsis bei »Hohlorganperforation« mit Nierenversagen. Vermutlich war ein Divertikel (eine Aussackung) des Dickdarms durchgebrochen. Dieser Prozess hatte, weil bisher unbehandelt, zu dem erfahrungsgemäß jetzt kaum mehr erfolgreich zu behandelnden schweren Krankheitsbild geführt, dessen Prognose sich durch die Begleiterkrankungen des Patienten noch einmal verschlechterte. Dennoch erwägt Dr. T. eine Verlegung des Patienten auf die Intensivstation, lässt aber vorher noch rasch ein Röntgenbild seiner Lunge anfertigen.
Während der Röntgenaufnahme wird der Patient plötzlich bewusstlos, sein Blutdruck ist nicht mehr messbar. Sofort erscheint Dr. T. bei seinem Patienten. Soll er bei diesem aussichtslos Erkrankten Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten? Soll er das Reanimationsteam der Intensivstation anfordern? Alles in ihm sträubt sich dagegen, doch er glaubt, die Entscheidung nicht allein tragen zu können. Er bittet eine Ärztin der Intensivstation hinzu. Gemeinsam verständigen sie sich darauf, auf eine Wiederbelebung zu verzichten und den Patienten sterben zu lassen.
»Forensisch müssen wir das aber absichern …, man weiß ja nie, sicher ist sicher«, sagte Dr. T. wenig später zu seiner Kollegin. Entgegen den Tatsachen vereinbaren sie, in der Krankenakte des Patienten einen über eine Viertelstunde sich erstreckenden, jedoch erfolglosen Wiederbelebungsversuch zu dokumentieren. Und so geschah es.
Eine indizierte und für den Patienten gute Entscheidung war getroffen, doch eine, zu der zu stehen und sie potenziell zu rechtfertigen zwei Ärzte den Mut nicht aufbrachten, weil allein die nackte Angst, nicht alles getan zu haben, was möglich gewesen wäre, um den Patienten am Leben zu erhalten, ihnen ein schlechtes Gewissen machte: ein imaginäres Damoklesschwert, dessen Schrecken, so glaubten die beiden Ärzte, nur durch Fälschung der Krankenakte genommen werden konnte.
Aussichtslose Medizin – Sag niemals nie! Sag niemals immer!
Die Aussage, eine medizinische Behandlung sei aussichtslos, ist freilich mit vielen Fragen behaftet, weil die Aussichtslosigkeit oder Nutzlosigkeit medizinischer Maßnahmen grundsätzlich schwer bestimmbar und voraussehbar ist. Deswegen plädieren manche Kritiker des Konzepts der »medizinischen Aussichtslosigkeit«, das im angloamerikanischen Raum unter dem Schlagwort »Medical Futility«5 verhandelt wird, dafür, diesen Begriff und die mit ihm verbundene Debatte aufzugeben. Gleichwohl haben sie nichts anzubieten, was an seine Stelle treten könnte, vielmehr verteidigen sie eine Vorgehensweise, die medizinische Behandlungsentscheidungen letztlich undurchsichtigen und subjektiven Vorgaben überlässt.
Es ist jedoch offensichtlich, fast möchte ich sagen, es entspricht einer Binsenweisheit, dass jedes menschliche Individuum auf einen Zeitpunkt hinlebt, an dem die Übermacht des Sterbeprozesses jede noch so wirksame und gezielte Behandlung zunichtemacht. Und dies bedeutet, dass der Zeitpunkt der Entscheidung, die dem Patienten, im Falle seiner Nicht-Einsichtsfähigkeit dem Arzt und den Angehörigen ein »genug ist genug« signalisiert, in irgendeiner Weise zu operationalisieren ist.
Ganz allgemein gilt eine Behandlung als aussichtslos, wenn sie dem Bemühen der Medizin und ihren Zielen der Wiederherstellung der Gesundheit, der Linderung von Symptomen, der Lebensverlängerung, der Aufrechterhaltung von Organfunktionen und der Vermeidung von Schaden während einer Behandlung zuwiderläuft. Als nicht aussichtslos darf umgekehrt also eine Behandlung gelten, die mit einem Höchstmaß medizinisch begründbarer Wahrscheinlichkeit heilen, bessern, lindern oder dem Patienten zumindest ein nach seinem eigenen Urteil annehmbares Weiterleben ermöglichen kann. Schon im Corpus hippocraticum, einer vorchristlichen Sammlung antiker medizinischer Texte, heißt es deswegen: »Wann immer sich die Krankheit für die verfügbaren Heilmittel als zu stark erweist, darf der Arzt nicht erwarten, sie mit Mitteln der Medizin niederringen zu können … eine aussichtslose Behandlung zu beginnen ist der Beschränktheit gleichzusetzen, die dem Wahnsinn verwandt ist.«6
Versucht man eine Annäherung an das, was »Medizinische Aussichtslosigkeit« bedeutet, so erscheint mir besonders das von Lawrence J. Schneiderman, einem an der Universität von San Diego lehrenden und international hochgeachteten Medizinethiker, erarbeitete Konzept von hohem Wert. Es bietet dem Arzt, der allzu oft einer Situation ausgesetzt ist, die von Unsicherheit, mangelnder Kompetenz, unstrukturierten Entscheidungsabläufen und nicht zuletzt von fehlenden Vorbildern gekennzeichnet ist, einen Orientierungsrahmen medizinischen Handelns, der ihn entlastet und dazu beiträgt, zu guten Entscheidungen im Sinne des Wohls des ganzen Patienten zu finden. Keineswegs presst dieses Konzept, wie zuweilen eingewandt, ärztliche Entscheidungen in kritischen Lebens- oder Sterbesituationen in ein Prokrustesbett.
Nach Schneiderman lassen sich in der Behandlung Schwerstkranker und Sterbender drei Varianten aussichtsloser ärztlicher Vorgehensweisen unterscheiden7:
Physiologisch aussichtslos ist beispielsweise der Versuch, einen Patienten im kardiogenen Schock, etwa nach einem ausgedehnten Herzinfarkt, oder einen Kranken im septischen Schock, etwa im Verlauf einer den Körper überbordenden Infektion, wiederzubeleben. Vollkommen sinnlos und ohne jede Aussicht wäre stets auch der Versuch, einen Patienten zu beatmen, dessen Herz, Kreislauf sowie andere Organe und Körperfunktionen zwar noch intakt sind, dessen Hirntod jedoch eindeutig diagnostiziert ist. In den genannten Fällen fehlen dem Körper aufgrund der Schwere der Erkrankung dauerhaft die physiologischen Voraussetzungen, das gewünschte Therapieziel zu erreichen.
Eine zweite Variante unnützer ärztlicher Vorgehensweisen lässt sich als quantitativ aussichtslos beschreiben. Der Praxis der Medizin wohnt eine grundsätzliche Unsicherheit inne, da sie es mit dem lebenden »System Mensch« und nicht mit einem mathematischen oder ausschließlich physikalisch-chemischen System zu tun hat. Jeder Medizinstudent prägt sich frühzeitig die Maxime »sag niemals nie« ein und man muss nicht die Philosophie bemühen, um darzulegen, dass, wenn in tausend Fällen B auf A folgt, man dennoch nie sicher sein kann, dass B auch im tausendundersten Fall wieder auf A folgen wird. Und umgekehrt gilt: Wenn B nach vielen beobachteten Ereignissen niemals auf A folgte, beginnen wir am Sinn von A zu zweifeln, wenn B mit A erreicht werden soll. Zu Recht schlussfolgern wir: Das Vorgehen A ist aussichtslos, um B zu erreichen. Diese Weise, aus unseren Erfahrungen Folgerungen zu ziehen, bestimmt weite Bereiche unserer Alltagsaktivitäten. Sie bildet auch das Fundament der klinischen Medizin, was ein Beispiel verdeutlichen soll: Die Beobachtung, dass die Verordnung und Einnahme von Penicillin bei einer eitrigen Hals- oder Mandelentzündung der Entstehung eines rheumatischen Fiebers vorbeugen kann, gründet auf der Erfahrung vieler Tausend solcher Verläufe, die diesen Zusammenhang bestätigen. Und trotzdem: Wenn mich heute ein Patient fragt: »Sind Sie absolut sicher, dass Penicillin auch bei mir in der gleichen Weise wirkt?«, hätte ich zu antworten: »Nein.« Und wenn diese Frage und ihre zugehörige Antwort zur Grundlage einer therapeutischen Entscheidung gemacht würden, müsste die Entscheidung absurderweise gegen die Verordnung von Penicillin ausfallen. Rasch leuchtet ein, dass die Frage falsch gestellt ist. Richtig müsste sie lauten: Wie oft und in welchem Ausmaß muss eine Therapie fehlschlagen, um sie als aussichtslos charakterisieren zu dürfen?
Wie die Lebenspraxis der Menschen, so sind auch die Vorgehensweisen der Medizin nach den Kriterien der empirischen Evidenz organisiert. Und um die diffizilen Entscheidungen, mit denen Ärzte oftmals konfrontiert sind, zu treffen – etwa: soll eine im höchsten Maße aussichtslose Therapie entgegen dieser Evidenz begonnen oder fortgeführt werden? -, schlagen Schneiderman und andere Medizinethiker vor, der empirischen Evidenz, die man durchaus auch als »gesunden Menschenverstand« bezeichnen darf, eine Leitlinienfunktion zuzubilligen. Vermutlich würden die meisten Leser der Auffassung zustimmen, dass, wenn eine Behandlung während der letzten einhundert Male nicht zielführend war, sie beim einhundertundersten Mal nicht mehr eingesetzt werden sollte. Dieses Vorgehen beansprucht keineswegs »Objektivität« oder »Wertfreiheit«, um bestimmte therapeutische Entscheidungen rechtfertigen zu können. Aber es ebnet den Weg zum Konsens da, wo die völlige Sicherheit einer Entscheidung illusionär und das Wohl des Patienten das Therapieziel ist. Wenn also Einigkeit darüber zu erzielen wäre, dass ein Vorgehen, das einhundert Mal scheitert, als aussichtslos zu klassifizieren ist, dann bedeutete dies, dass der Arzt nicht verpflichtet wäre, es anzubieten.
Noch eine weitere Perspektive erweist sich für die Akzeptanz dieses Konzepts als hilfreich. Das oberste ärztliche Bekenntnis und Behandlungsgebot lautet: »Zu allererst nicht schaden.« Wenn es aber in der Behandlung einer bestimmten Erkrankung empirisch wahrscheinlich ist, dass ein Arzt in Anlehnung an das soeben Gesagte einhundert Patienten, die letztlich doch sterben, Qualen und Leid zufügt, um vielleicht einen Patienten überleben zu lassen, wie wollte ein Arzt sein Vorgehen gegenüber all denen rechtfertigen, die nicht überleben?
»Sag niemals immer« wäre also eine Maxime, die Medizinstudenten ebenso »einzutrichtern« wäre, wie das so sattsam bekannte »Sag niemals nie«, das schon so viel Unheil nach sich gezogen hat.
Eine letzte Variante aussichtsloser ärztlicher Therapie lässt sich als qualitativ aussichtslos umschreiben. Es sollte zu den Grundsätzen ärztlicher Behandlung gehören, dass ihr Ziel nicht darin besteht, allein körperliche Effekte auszulösen, vielmehr haben diese Effekte zum Patientenwohl in dem Sinne beizutragen, dass sie Teil eines ganzheitlichen und dem Patienten erfahrbaren Genesungs- oder Heilungsprozesses sind. So sind nach Schneidermans wie auch meinem Dafürhalten alle lebensverlängernden Maßnahmen bei Patienten im Zustand gesicherter und unumkehrbarer Bewusstlosigkeit aussichtslos, weil diese hoffnungslos Kranken unwiderruflich der Fähigkeit beraubt sind, sich dieser Effekte überhaupt bewusst zu werden. Auch eine »Therapie«, deren Erfolg allein darin besteht, den Patienten als dauerhaft »Gefangenen« an eine Intensivstation zu ketten, die die Verwirklichung anderer Lebensziele des Kranken vollkommen ausschließt, darf und sollte als aussichtslos klassifiziert werden. Zahlreiche Autoren großer Untersuchungen zu Therapien am Lebensende sprechen sich dafür aus, dass dann, wenn eine lebenserhaltende Therapie wie beispielsweise die Anwendung von Cortison bei Hirnblutungen, die Wiederbelebung von Frühgeborenen oder von Patienten mit metastasierenden Tumoren nach mehrfachen Versuchen oder Bemühen nicht zu einer Krankenhausentlassung des Patienten führt, eine solche Behandlung aussichtlos genannt werden darf. In diesem Sinne war auch die Wiederbelebung von Gerda L. ein von vorneherein aussichtsloses Unterfangen.
Warum stehen viele Ärzte dennoch einem Konzept, das die Aussichtslosigkeit ihres Handelns in manchen Situationen am Lebensende jenseits ihrer eigenen subjektiven Einschätzung gewissen »gesetzmäßig« wiederkehrenden unheilvollen Behandlungsresultaten zuordnet, um damit einen Orientierungsrahmen für ärztliche Entscheidungen bereitzustellen, so ablehnend gegenüber?
In einer Zeit, in der Medizin und Öffentlichkeit nahezu täglich mit neuen diagnostischen und therapeutischen Errungenschaften beglückt werden, von den Medien oftmals gar als Wunder deklariert, scheint es vielen Ärzten störend und deplatziert, manchem sogar als ein Zeichen von Schwäche oder Inkompetenz, Scheitern und Aussichtslosigkeit ärztlichen Handelns überhaupt zu thematisieren. Höchst ungern spricht ein Arzt davon, einen Patienten aufgegeben zu haben. Aber was umfasst die Bedeutung all dieser Begriffe? Die Heilung (cure) einer Krankheit mag dem Arzt ab einem gewissen Krankheitsstadium versagt sein, ärztliche Zuwendung, Sorge und Pflege (care) aber sind es nie!
Manche Ärzte glauben zudem einen Widerspruch zwischen der gerade erst in Deutschland durch das neue »Patientenverfügungsgesetz« gestärkten Selbstbestimmung des Patienten und der sehr einseitig allein von der Ärzteschaft festzusetzenden und zu verantwortenden Aussichtslosigkeit einer Therapie zu erkennen. Zwar können Patienten, wie später noch näher zu erläutern sein wird, ausnahmslos jede medizinische Behandlung im Zustand der Einsichtsfähigkeit ablehnen, doch können sie keineswegs jede medizinische Behandlung fordern (was manche Ärzte nun befürchten!). Fordern können sie vom Arzt nur das, was mit seinen professionellen Standards übereinstimmt! Niemand kann einen Arzt dazu nötigen, einen Patienten einer Bauchoperation zu unterziehen, die er begründet für »inoperabel« hält, und niemand, der in einem Sportstudio Bodybuilding betreibt, kann ein Recht auf ein ärztliches Rezept für Hormone, die den Muskelaufbau beschleunigen, einfordern. In beiden Fällen würde sich der Arzt eines Vergehens gegen seine professionellen Standards schuldig machen. Und so ist auch die Forderung von Angehörigen eines todkranken Patienten, ihn wiederzubeleben, wenn dies nach ärztlicher Einschätzung aussichtslos ist, nicht zu rechtfertigen.
Gerade bei der Wiederbelebung aussichtslos kranker Patienten ist einseitiges ärztliches Entscheiden oftmals unumgänglich. Ein Beispiel: In einer Situation, in der eine Wiederbelebung voraussagbar aussichtslos ist, etwa bei einem 86-jährigen Patienten mit einem metastasierenden Tumorleiden, besteht der Arzt darauf, sie zu unterlassen. Die Angehörigen akzeptieren diese einseitige Entscheidung nicht und fordern vom Arzt, die Wiederbelebung zu beginnen, weil seine Entscheidung, die Wiederbelebung zu unterlassen, in ihren Augen auch eine Wertentscheidung darstellt, mit der sie nicht übereinstimmen. Der Arzt folgt der Auffassung der Angehörigen und beginnt die Wiederbelebung. Über eine halbe Stunde hält er sie aufrecht, dann bricht er sie ab, ohne dass einer der Angehörigen widerspricht. Er hätte sie auch schon nach 15 Minuten oder erst nach drei oder zwölf Stunden aufgeben können. Die Angehörigen akzeptierten also die Entscheidung des Arztes, die Wiederbelebung nach eigenem Gutdünken abzubrechen, nicht aber seine einseitige Entscheidung, sie nicht zu beginnen! Logischerweise können sie aber nicht den Beginn einer Wiederbelebung fordern und sich der Entscheidung, wann diese abzubrechen sei, enthalten. Denn der Beginn einer Wiederbelebung beinhaltet ebenso eine Wertentscheidung wie ihr Abbruch, der also auch nicht einseitig vom Arzt getroffen werde dürfte. Ganz anders die Realität in der Notfallmedizin: Der einseitigen ärztlichen Entscheidung, eine Wiederbelebung abzubrechen, ist niemals widersprochen worden und Konflikte über ein solches Vorgehen sind nie bekannt geworden.
Das zuletzt genannte Beispiel bietet Anlass zu einem weiteren Missverständnis, weswegen manche Ärzte dem Konzept aussichtsloser medizinischer Vorgehensweisen nicht folgen mögen. Denn in einer Zeit, in der längst auch Ärzte in die Gefahr geraten sind, medizinische Entscheidungen selten offen, zumeist verdeckt auch unter Kostengesichtspunkten zu treffen, liegt das Argument nicht fern, dass hinter dem, was Aussichtslosigkeit meint, sich tatsächlich etwas anderes verbirgt, die heimliche Rationierung medizinischer Leistungen nämlich. Eine aussichtslose ärztliche Vorgehensweise, die ebenso teuer wie billig sein kann, ist jedoch von Rationierungsentscheidungen klar und unmissverständlich abzugrenzen: Es wäre ein schwerer Verstoß gegen die Ethik ärztlichen Handelns, wenn eine medizinisch zielführende oder sinnvoll erscheinende Maßnahme aus Rationierungsgründen für aussichtslos erklärt werden und dem Patienten vorenthalten würde. Keineswegs aber will ich in Abrede stellen, dass aufgrund der zunehmenden Ressourcenknappheit in der Medizin die Gefahr gegeben ist, dass künftig Rationierung auch unter dem betrügerischen Vorwand der Aussichtslosigkeit einer Behandlung in ärztliche Therapieentscheidungen mit einfließt.
Zerlegte Medizin – Zerlegter Patient
Vielleicht aber liegt die eigentliche Ursache dafür, dass sich die Ärzteschaft gegen das Konzept der Aussichtslosigkeit medizinischen Handelns sperrt, im professionellen ärztlichen Selbstverständnis selbst begründet. In der Ausbildung der Medizinstudenten sowie in der alltäglichen Medizin des niedergelassenen Arztes und der Kliniken liegt der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit darauf, einzelne Organe oder Organsysteme in ihrer Funktion wiederherzustellen: Es geht um die Implantation eines Herzschrittmachers, die Lungenfunktion, die Nierendialyse, die Gallensteine und so fort. Das Wohl des »ganzen« Patienten ist nachgeordnet, wenn nicht gar gänzlich dem ärztlichen Blick entrückt. Selbst wenn der Patient permanent bewusstlos ist, bilden Beatmung, künstliche Ernährung und Infektionsprophylaxe das Zentrum ärztlicher Aufmerksamkeit, nicht aber die Frage nach dem Schicksal des Patienten. Dieses wird vielmehr in Umkehrung der wirklichen Prioritäten von zweitrangigen Entscheidungen, wie die zur Beatmung und künstlichen Ernährung es sind, abhängig gemacht. Kurz gefasst: Nicht der Patient steht im Zentrum des ärztlichen Interesses, sondern die Technologie, die für die Behandlung seiner Organe und Körperfunktionen geeignet erscheint. Und weil das so ist, lehnen manche Ärzte es ab, über so etwas wie Aussichtslosigkeit auch nur zu sprechen, solange wertneutral und vorurteilsfrei der Herzschlag erhalten, die Niere dialysiert und die Lunge beatmet werden kann selbst im Sterbeprozess oder im Zustand andauernder Bewusstlosigkeit.
Wertneutral und vorurteilsfrei? Bei genauem Hinsehen trifft nach meiner Auffassung das Gegenteil zu. Denn die Ziele ärztlichen Handelns sind keineswegs wertneutral; sie unterliegen vielmehr einer Wertentscheidung, die den ganzen Patienten und sein Gesamtwohl immer im Blick zu haben hat. Doch die Medizin, die heute an manchem Intensivpatienten experimentelle Physiologie betreibt, hat sich selbst in Spezialitäten (z. B. Kardiologe) und Subspezialitäten (z. B. Rhythmologie als Subspezialität der Kardiologie) zerlegt, wie sie auch den Patienten in Organe und Funktionssysteme zerlegt hat. Doch kaum ein Arzt ist in der Lage, ihn wieder zusammenzusetzen! So konnte es nicht ausbleiben, dass der starre Blick auf Organe und Teilsysteme des Körpers den ärztlichen Auftrag, auch für ein friedliches Lebensende zu sorgen, in sein Gegenteil verkehrte: ein für viele Patienten grausames und qualvolles Sterben.
Das wird noch dadurch vertieft, dass ohne Zweifel auch Erlöskriterien der Klinik heute eine beachtliche Rolle spielen dürften, auch wenn dies nur schwer nachzuweisen ist. Im Klartext heißt dies: Kliniken erhalten heute nicht mehr, wie noch vor einigen Jahren, für ihre Patienten Tagespflegesätze, sondern sie werden nach Fallpauschalen vergütet. Für eine komplikationslose Blinddarmoperation beispielsweise erhält sie 1780 Euro, unabhängig davon, wie lange der Patient im Krankenhaus bleibt. Damit geraten die Kliniken unter hohen Druck, denn je früher sie ihre Patienten entlassen, desto mehr Patienten können sie behandeln und desto höher ist ihr Gewinn. Unangemessen frühe Entlassungen aus dem Krankenhaus, klinikintern nicht selten »englische Entlassung« (ist ein Steak »englisch« zubereitet, so ist es noch blutig) genannt, häufen sich deshalb. Für Intensivpatienten – es liegt im ärztlichen Ermessen zu entscheiden, wer als solcher zu klassifizieren ist – erhalten die Kliniken zusätzlich noch einmal eine aufwandsabhängige Vergütung, die beispielsweise auch die Dauer der notwendigen Beatmung eines Patienten mit einbezieht. Zurückhaltend formuliert, besteht hier zumindest die Gefahr, dass nicht allein streng medizinische Kriterien die Intensität und Dauer der Behandlung eines Patienten festlegen, sondern, zum Beispiel in Zeiten schlechter Auslastung einer Intensivstation, auch die Erlössituation der Klinik oder Abteilung zu einem Kriterium für die Übernahme auf die Intensivstation werden kann. Was dies für einen Intensivpatienten bedeutet, mag der Leser selbst ermessen.
Sterben zulassen
Seit ich Zeuge des qualvollen und letztlich aussichtslosen Wiederbelebungsversuchs Gerda L.s geworden bin, sind 15 Jahre vergangen. Wir befinden uns im Schockraum der Notaufnahme eines großstädtischen Krankenhauses. Eine junge Notärztin, die ihren Beruf als klinisch tätige Internistin seit einigen Jahren ausübt, bringt aus einem Pflegeheim einen 88-jährigen Patienten, der seit vier Jahren bettlägerig ist und mit dem man seit sechs Monaten kaum mehr Kontakt aufnehmen kann. Der alte Herr reagiert nicht auf Ansprache, hat Fieber und stöhnt leise vor sich hin. Er hat kaum noch Muskeln, am Kreuzbein findet sich ein großes Druckgeschwür, er wiegt allenfalls noch 40 Kilogramm. Die Notärztin hat den Patienten wegen seines schlechten Blutdrucks an beiden Armen mit zwei Infusionen versorgt, in der Nase liegt eine Sauerstoffsonde, in seiner Blase ein Katheter, die Brust ist mit Elektroden beklebt und ein Herzmonitor, den sie in der Hand hält, signalisiert, dass sein Herz noch schlägt.
Freundlich besorgt fragt sie mich, den zuständigen Arzt der Rettungsstation: »Soll ich ihn gleich auf die Intensivstation bringen oder wollen Sie hier erst noch eine Blutgasanalyse abnehmen, den Thorax röntgen und ein EKG schreiben?«
Ich übergehe ihre Frage, bedanke mich für die Übergabe des Patienten und will sie gerade verabschieden, als der alte Mann aufhört zu atmen. Der Herzmonitor zeigt eine Nulllinie.
»Schnell, einen Tubus oder eine Maske mit Beutel, bitte, der schnauft nicht mehr«, sagt die Notärztin zu einer der anwesenden Schwestern.
»Sachte bitte, Frau Kollegin, sachte«, unterbreche ich sie. Langsam, aber bestimmt – sie will dem Patienten gerade die Beatmungsmaske aufs Gesicht drücken – schiebe ich ihre Hand beiseite. »Der alte Herr stirbt gerade, und das gestatten wir ihm jetzt, einverstanden?«
Verstört blickt sie mich an: »Aber deswegen hab ich ihn doch nicht hierhergebracht! Doch vielleicht … wenn ich ihn mir so anschaue … vielleicht haben Sie ja recht!«
»Nehmen wir an, er wäre Ihr Vater, würden Sie ihn jetzt beatmen und in die Intensivstation einweisen?«
Sie kommt nicht mehr dazu, mir zu antworten, denn über Funk erhält sie einen neuen Notfalleinsatz. Irritiert und überstürzt verlässt sie die Notaufnahme.
Wenige Wochen später besucht mein Kollege und Freund, der schon erwähnte amerikanische Medizinethiker Lawrence Schneiderman, Deutschland und Berlin. Er ist deutsch-jüdischer Herkunft und hat ein Forschungsfreisemester, das er hier verbringen will. Ich schlage ihm vor, vor Intensivmedizinern einen Vortrag mit Diskussion über »Ethische Fragen der Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen in der Intensivmedizin« zu halten. Begeistert stimmt er zu. Ich nehme Kontakt zum Leitenden Arzt der Klinik für Innere Medizin auf, der auch eine große Intensivstation führt, und trage ihm mein Anliegen vor. Er schaut vor sich hin, wiegt seinen Kopf, dann antwortet er mir: »Schön, dass Sie eine Idee für einen Vortrag haben; aber ich halte ihn für entbehrlich. Ethik? Lieber Herr Kollege! Da kennen wir uns schließlich aus, das machen wir doch jeden Tag hier!«
Eine überforderte Notärztin und ein an der Erörterung ethischer Fragen desinteressierter Leitender Intensivmediziner. Beide Episoden werfen ein charakteristisches, wenig schmeichelhaftes Schlaglicht auf ärztliches Handeln am Lebensende. Es in der Anschauung von Fallgeschichten und sie begleitenden Reflexionen weiter auszuleuchten und dem Leser die Möglichkeit zu eröffnen, sein eigenes unausweichliches Sterben zu ihm in Beziehung zu setzen, wollen die nun folgenden Kapitel versuchen.
Zwischen Herztod und Hirntod – Wann endet das menschliche Leben?