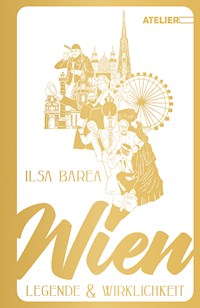
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In ihrer großen Kultur- und Stadtgeschichte beleuchtet Ilsa Barea Wien von allen Zeiten und Himmelsrichtungen. Liebevoll, aber auch kritisch schreibt sie über die großen und kleinen Momente der lebenswertesten Stadt der Welt, über Kunst und Kultur, architektonische und intellektuelle Höchstleistungen, über den Glanz und Verfall der Epochen und immer wieder über die Menschen, die Wien so einmalig gemacht haben. Ilsa Barea war als österreichische Journalistin im Spanischen Bürgerkrieg, emigrierte nach Frankreich und schließlich nach England. In ihrem Herzen ist sie aber immer eine leidenschaftliche Wienerin geblieben. Begleiten Sie Ilsa Barea auf einer unterhaltsamen wie lehrreichen Zeitreise durch Wien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 795
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ilsa Barea
Wien
Legende & Wirklichkeit
Übersetzt und herausgegeben vonJulia Brandstätter und Gernot Trausmuth
Mit einem Nachwort von Georg Pichler
In Erinnerung an meine ElternDr. Valentin PollakundAlice von Zieglmayer
Inhalt
Vorwort der HerausgeberInnen
Vorwort
I. Die Anfänge Wiens
Die Hügel im Westen der Stadt • der Leopoldsberg • der Cobenzl • der Kahlenberg • die Berge im Süden • die Ebenen im Osten • das Marchfeld • die Donau • der Wienerwald • die Stadt und die Vorstädte • die Blumen • die Lieder und ihr Beitrag zur Herausbildung einer Legende • die Bedeutung von Wein in Alltag und Ökonomie • ein berühmtes Gemälde und ein berühmtes Gedicht • Stifter • Schubert • Schnitzler • der Charme von Wien • die Legende von der Wiener Gemütlichkeit • Wien als Schmelztiegel • als westliche Grenzbefestigung • als Sitz der Habsburger und Hauptstadt • humanistische Blüte im 16. Jahrhundert • Aufstieg und Fall des Bürgertums • Wachstum des Beamtentums • Reformation und Konterreformation in Wien • der Dreißigjährige Krieg • Triumph des Katholizismus • Protestantische Exilanten • Aufstieg der Aristokratie • die führende Rolle der Jesuiten • geheime Protestanten • Abraham a Sancta Clara • Wiener Hedonismus • Misstrauen gegenüber Autorität und Heldentum
II. Das Erbe des Barock
Eine britische Mission in Wien 1716 • Lady Mary Wortley Montagus Briefe • eine Stadt der Paläste • Burneys Beobachtungen • unterschiedliche soziale Klassen unter einem Dach • enge Gassen, hohe Wohnhäuser • Lady Mary als Kritikerin der Wiener Salons • und von Prinz Eugen • Leben und Architektur von J. B. Fischer von Erlach • ein neuer Wiener Stil • die Karlskirche • Eigenarten des Wiener Barock • Lucas von Hildebrandts Architektur • aufstrebende Kaufleute und Finanziers • Der Rosenkavalier • Innungen und Gesellen • die Lohnkämpfe der Schuster • der Aufstieg der Seidenindustrie • Porzellanmanufaktur • die Bedeutung der Verbindungen zum kaiserlichen Hof • aufkommende Bürokratie • Zwei Familien • das Freihaus • das Freihaustheater • Die Zauberflöte • seine politischen Zwischentöne • im Gegensatz zu Figaro • Mozarts Tod und Begräbnis • die Mozart-Legende • Haltungen zum Tod • josephinische Reform der Bestattungsordnung • Lady Mary in der Oper • und bei einer Volkskomödie • das Theater als Ventil für Kritik • das Erbe des Barock für spätere Generationen • das Belvedere • Kindheitserinnerungen an das barocke Wien • der Wiener Dialekt
III. Biedermeier
1. Vor dem Kongress
Die Biedermeier-Ära: Stagnation oder goldenes Zeitalter? • vier repräsentative Figuren • die Napoleonischen Kriege und Nachkriegsstimmung • Emanuel Schikaneder und das neue Theater an der Wien • ein glanzvolles Repertoire • Französische Besetzung 1805 und 1809 • Unmut im Verborgenen • soziale Funktion von Musik und Theater • die Jugendjahre des Dichters Franz Grillparzer • das Fortleben josephinischer Ideale und der Einfluss Napoleons • ein Sensationserfolg am Leopoldstädter Theater • Ernüchterung und Kriegsmüdigkeit • skeptischer Patriotismus • Beethovens große Jahre • Uraufführung von Fidelio • der Erste Pariser Frieden und der Wiener Kongress
2. Ruhe in Wien
Metternich nach dem Kongress • sein Mitarbeiter Friedrich von Gentz • Zensur • Paumgarttens Aquarelle • seine Erinnerung an die Baumanns • Weihnachten, Silvester, Familienausflüge • Schubert und sein Kreis • andere Musikkreise • die Fröhlich-Schwestern • Grillparzer und Katty Fröhlich • eine brillante Gruppe • Schuberts Antiklerikalismus • seine intellektuelle Neugier und Courage • Krankheit, Tod, Begräbnis • Vergleich mit Mozarts Begräbnis • Bevölkerungswachstum und soziale Unruhen • die Rolle des Theaters • das tragische Leben des großen Dramatikers und Schauspielers Ferdinand Raimund • und der großen Schauspielerin Therese Krones • Überwachung durch die Polizei • die politischen Gedichte des »Anastasius Grün«
3. Den Iden des März entgegen
Reiseberichte über das heitere Wien • Frances Trollope und Peter Evan Turnbull • die Kehrseite der Medaille • Bevölkerungsexplosion, harte Gesetze, lange Arbeitsstunden • die Rivalität zwischen Lanner und Strauss • die Rivalität zwischen Raimund und Nestroy • Raimund und das Zaubermärchen • Der Verschwender • der Satiriker Nestroy und seine ersten Komödien • Missbrauch des Adelspartikels »von« • Fanny Elßler, Gentz’ Liebhaberin und geniale Tänzerin • der große Dramaturg Joseph Schreyvogel • König Lears Einfluss auf den jungen Stifter • Grillparzers Stücke • ein Theaterskandal • der Aufstieg der neuen Bourgeoisie und der freien Berufe • Aufschwung der wissenschaftlichen Forschung • politische Stagnation und wirtschaftliche Entwicklung • Bauernfeld als Sprachrohr der aufstrebenden bürgerlichen Gesellschaft • seine Satire auf Metternichs System • wie die Zensur überlistet wurde • ein prophetisches Gedicht von Grillparzer
IV. Revolution und Konterrevolution
Das Revolutionsjahr 1848 • nationale Befreiungsbewegungen in Polen und Italien • Unruhen in Tschechien • Wien rüttelt die Welt auf • die Märzrevolution • Metternich tritt zurück • Maiaufstand • die Oktoberereignisse • das aufständische Wien hält dem aufständischen Ungarn die Treue • Hof und Regierung fliehen • kurzlebiger Triumph • Vergeltung • ein Echo von 1848 in den 1920ern • 1848 als Wendepunkt • der Konflikt zwischen Johann Strauss Vater und Sohn • Zwischentöne in Strauss’ Operetten Die Fledermaus und Der Zigeunerbaron • Gedichte und Pamphlete aus dem Jahr 1848 • Ferdinand Sauter • Bauernfeld und die Forderung nach einer Verfassung • ein naives Plakat • seine Rolle als Unterhalter der »guten Gesellschaft« • der komplexe Fall Grillparzer • wachsender Einfluss des Katholizismus nach 1848 • eine Revolution ohne Führung • die Legende vom guten Kaiser Joseph • Nestroy verkörpert den Geist von 1848 • Freiheit in Krähwinkel • sein Mut in der Zeit der Reaktion • Judith und Holofernes, eine freche Satire • der junge Kaiser Franz Joseph • allmähliche Lockerung der Repression • neue Festung oder neues Wien?
V. Die Kaiserstadt
1. Das neue Gesicht der Stadt Wien
Ein Zeitalter des Umbaus • die Ringstraße • Oper, Parlament, Rathaus, Burgtheater, Universität • nachahmende Stile • Glanz und Gloria • eine Ära der Verfassungskonflikte • politische Spannungen • der Krieg von 1866 • der »Ausgleich« mit Ungarn • liberale Reformen von 1868 • Einführung der Schulpflicht bis zum 14. Lebensjahr • Zuwanderung • der junge Masaryk in Wien • die Liberalen • Börsenkrach • unsichere Wirtschaftslage • schlechte Arbeitsbedingungen • die Arbeiterbewegung macht Druck • Taaffe verhängt den Ausnahmezustand • Adolf Loos und die Jubiläumsausstellung in Wien
2. Das Kaiserhaus
Die Rolle des Kaisers • Hermann Brochs Vision von Wiens »fröhlicher Apokalypse« um 1880 • das vorherrschende Bild von Franz Joseph als unnahbarer, unflexibler Philister • Eheprobleme • Kaiserin Elisabeth und Erzherzogin Sophie • Kronprinz Rudolf und seine politischen Verwicklungen • sein neurotisches Verhalten und der doppelte Selbstmord • der Baltazzi-Vetsera-Clan • Auswirkungen der Tragödie von Mayerling • Franz Joseph wird der »alte Herr« • der Mensch hinter der Maske • seine amitié amoureuse mit Katharina Schratt • Elisabeths bemerkenswerte Rolle in dieser Beziehung • ihre Ermordung
3. Die neue Bourgeoisie und das alte Bürgertum
Palais für die nouveaux riches • Finanzbarone als Kunstmäzene • Niedergang der alten Maler • der Fall Ferdinand Waldmüller • Hans Makart, die Apotheose eines Zeitalters des Dekors • sein Einfluss auf die Innenausstattung • die andere Strömung: stolze Handwerkskunst • die Lobmeyrs und ihre Glaswaren • Bösendorfer und seine Klaviere • sein Konzertsaal • der Salon in der Villa Wertheimstein • der junge Hofmannsthal • der zunehmende Antisemitismus • Schönerers Deutschnationalismus • die deutschnationalen Burschenschaften • Freuds akademische Karriere • Verbindungen zwischen Freud und dem Wertheimstein-Zirkel • der Historiker und Philosoph Theodor Gomperz • der Neo-Aristoteliker Franz Brentano • der Wissenschaftler, Stoiker und Witzbold Ernst von Fleischl • der Psychiater Theodor Meynert • der Sozialist und Arzt Victor Adler • Karl Renner, der künftige Präsident Österreichs, über den Ersten Mai in Wien • offizielle Panik • die Karriere Karl Luegers, Bürgermeister von Wien, bewundert von Hitler • das Entstehen einer Partei des Kleinbürgertums, die Christlichsozialen • die mehrdeutige Rolle der Zugewanderten in Wien • der Kult um die Gemütlichkeit und die Vermarktung der Legende • der Komödiant Girardi • Wien um die Jahrhundertwende • Art nouveau • der Maler Gustav Klimt • die Schriften von Hermann Bahr • das Genie Arthur Schnitzler: psychologische Diagnose • der Mythos vom »süßen Mädel« • die Offiziersmentalität in Leutnant Gustl • der spannungsgeladene Umgang mit Antisemitismus in Der Weg ins Freie
VI. Das Bauvolk der kommenden Welt
Rapides Bevölkerungswachstum • Übergewicht der kleinen Werkstätten • migrantische Arbeiter • Proletarische Elendsviertel in Ottakring • ein Gedicht von Weinheber • die Karriere von Franz Schuhmeier • ein Pionier der Arbeiterbildung • und der Sozialdemokratie • eine Demonstration, die das allgemeine Wahlrecht bringt • Ermordung Schuhmeiers • Adelheid Popp • ihre Kindheit in Armut, Arbeit und Krankheit • die Autodidaktin • ihre schillernde Karriere als Sozialreformerin und Agitatorin • die politischen Tagebücher Josef Redlichs • Niedergang des Kaiserreichs • ein Zeitalter der Intrigen • eine Abfolge von Krisen • Krise der Christlichsozialen • Wandel in der Kunst • Oskar Kokoschka und Egon Schiele • Peter Altenberg und Karl Kraus • Wien am Vorabend des Krieges • Fäulnisprozess • und die Kraft für Erneuerung • die anhaltende Verschmelzung von Altem und Neuem
Nachwort
Anmerkungen
Biografien
Impressum
JULIA BRANDSTÄTTER, GERNOT TRAUSMUTH
Vorwort der HerausgeberInnen
Wenn wir das vorliegende, von der Journalistin und Schriftstellerin Ilsa Barea-Kulcsar verfasste Buch über die Wiener Kulturgeschichte der deutschsprachigen Öffentlichkeit übergeben, bedarf es kaum einer Begründung, eher einer Rechtfertigung, dass es erst so spät geschieht. Immerhin wurde die 1966 bei Secker & Warburg erschienene Kulturgeschichte »Vienna – Legend and Reality« äußerst positiv aufgenommen und bereits ins Dänische und Spanische übersetzt. Barea-Kulcsar selbst beabsichtigte, ihr Buch ins Deutsche zu übertragen. Dieses Vorhaben konnte sie krankheitsbedingt nicht mehr verwirklichen.
Auf die Autorin stießen wir im Zuge unserer Recherchen über die Geschichte der illegalen Arbeiterbewegung nach dem Bürgerkrieg im Februar 1934. Als Mitbegründerin der marxistischen Funke-Gruppe leistete sie einen wichtigen Beitrag zur politischen Neuausrichtung der klandestinen Nachfolgeorganisation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschösterreichs (SDAP). Während ihrer aktiven Zeit in der sozialistischen Jugendbewegung und als Bildungsfunktionärin der SDAP eignete sie sich die historisch-materialistische Geschichtsauffassung an, die das methodische Fundament ihres kulturgeschichtlichen Werkes bildet. Vor diesem Hintergrund hebt sich die Arbeit von jener Kulturgeschichtsschreibung ab, die seit einiger Zeit in eine symbolisch-diskursive Vereinseitigung abzugleiten droht.
Ilsa Barea-Kulcsar spürt den Legenden nach, die sich um die Geschichte Wiens ranken und die teilweise – nicht zuletzt durch die Vermarktungsstrategie der Kulturindustrie – bis heute lebendig sind. Diese Legenden will sie nicht als Lügen entlarven und einer wissenschaftlich belegbaren Wirklichkeit entgegenstellen; vielmehr erkennt sie die Gemütlichkeit des Biedermeier, die Walzer- und Weinseligkeit, die »gute alte Zeit« unter Kaiser Franz Joseph usw. in ihrer Entstehungsgeschichte, in den sozialen Triebkräften, die ihnen zugrunde liegen, und in den intellektuellen und politischen Traditionen, die sie verkörpern. Porträts namhafter Persönlichkeiten dienen nicht allein der Würdigung des Individuums und seiner Leistung, vielmehr sollen die sozialen Träger des kulturellen Wandels sichtbar gemacht werden. Damit ist Ilsa Barea-Kulcsars Kulturgeschichte keine bloße Aufzählung kultureller Phänomene, verengt den Blick nicht auf große historische Persönlichkeiten und deren Werke, sondern gräbt sich zu den ökonomischen, sozialen und geistigen Wurzeln des kulturellen Lebens der Stadt Wien durch.
Dieses Buch wendet sich nicht in erster Linie an ein akademisches Publikum, sondern an alle, die daran interessiert sind, die Entfaltung des Wiener Kulturlebens in seiner geschichtlichen Tiefe zu verstehen. Abgesehen von dem historischen Interesse, das, so hoffen wir, auch ein halbes Jahrhundert nach Erscheinen der Originalausgabe eine freundliche Aufnahme dieses Buches rechtfertigt, liefert Ilsa Barea-Kulcsar wichtige Anstöße für die Analyse gegenwärtiger gesellschaftlicher und kultureller Prozesse. Sie begreift Kunst und Kultur als immer vorläufiges Ergebnis des historischen Kräfteringens zwischen sozialen Klassen, politischen Strömungen und Weltanschauungen, als Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse und als Protest gegen die Wirklichkeit. Dadurch ermöglicht sie der Leserin und dem Leser, widerständige, ja revolutionäre Traditionen zu entdecken.
Bei der Übersetzung verfolgten wir das Prinzip: so nah wie möglich am Wortsinn, so frei wie nötig. Vor diesem Hintergrund war auch das eingehende Studium des Quellenmaterials erforderlich, das die Grundlage des Buches bildet. Die Tagebuchauszüge, Verszeilen, Ausschnitte aus Romanen, Libretti und Textbüchern sind den deutschen Originalwerken entnommen. Die englischen Zitate wurden von uns ins Deutsche übertragen, wenn sie nicht ohnehin in deutscher Sprache verfügbar waren. Der Text wurde stellenweise gestrafft, wo es dem Lesefluss ohne inhaltliche Verluste dienlich war. Die Pandemie und die damit verbundenen Restriktionen bei der Literatursuche in Archiven und Bibliotheken erschwerten unser Unterfangen; umso größer war die Freude, endlich in der von Ilsa herangezogenen Literatur im Lesesaal der Wienbibliothek, wo sie einst selbst recherchierte, blättern zu können.
»Wien – Legende und Wirklichkeit« endet mit der Zäsur des Ersten Weltkriegs, aber viele der in diesem Buch offengelegten geistigen Traditionen haben ihre Wirkmacht auch über hundert Jahre später noch nicht verloren. Heute gehen wir mit anderen Augen durch die Wiener Innenstadt und die einstigen Vorstädte, betrachten das steingewordene kulturelle Erbe und die lebendigen Traditionen im Spiegel der Zeit. Bei einem Radausflug auf den Kahlenberg erkennen auch wir die blassblaue Linie der Kleinen Karpaten, entdecken die Blumen im Wienerwald und die Stadtpalais, die Ilsa beschreibt. Sicherlich werden die aufmerksamen Leserinnen und Leser beim Flanieren oder bei der Fahrt mit der Bim ähnliche Déjà-vus erleben.
ILSA BAREA
Vorwort
Es ist einfacher zu sagen, was dieses Buch nicht ist, als was es sein soll. Auch wenn es sich um eine historische Abhandlung handelt, die sich auf meine, aber vor allem auf die wissenschaftliche Forschung anderer stützt, ist es doch keine bloße Geschichte oder Kulturgeschichte Wiens. Ich habe den Versuch unternommen, die Elemente, die zur Herausbildung der Wiener Gesellschaft und der Einstellungen beigetragen haben, sowie die Einflüsse, die die Architektur, die kulturelle Atmosphäre und die Sprache in meiner Geburtsstadt geformt haben, herauszuarbeiten. Damit, so hoffte ich, würden die vielen Linien, die ich zeitlich nach hinten und nach vorne sowie in der jeweiligen Periode nach oben und nach unten nachzeichnete, schließlich zusammenlaufen und ein Porträt von Wien ergeben, das auf jeder Ebene aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden kann.
Vor Jahren schrieb ich für das Times Literary Supplement einen Artikel über Arthur Schnitzlers Prosa mit dem Titel Viennese Mirage, weil mich schon damals faszinierte, wie die erzählten und erdichteten Legenden die Wirklichkeit überlagerten und wie die Wirklichkeit umgekehrt die Legenden in der Geschichte Wiens zugleich hervorbrachte und nachahmte. Dieser Artikel gab mir den ersten Anstoß, ein Buch über Wien zu schreiben – ein Anstoß, den mein Freund A. G. Weidenfeld noch verstärkte, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Zu diesem Zeitpunkt schwebte mir ein Buch vor, das sich auf das letzte Viertel des 19. und das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts beschränken sollte, eine Periode, in der sich der Gegensatz zwischen Wiens intellektueller Lebenskraft und dem Verfall seiner herrschenden Gesellschaftsordnung zuspitzte. In dieser Zerrissenheit konnten nur mehr der volkstümliche Mythos von der heiteren Kaiserstadt und das internationale Märchen vom Wiener Schlaraffenland die Kluft überbrücken. Doch bald bemerkte ich, dass ich nicht mehr als eine glorifizierende Arbeit schreiben konnte, solange ich nicht versuchte, die Ursprünge von zentralen Aspekten des Wiener Gesellschafts- und Kulturlebens zurückzuverfolgen, deren Existenz als selbstverständlich vorausgesetzt wird, als ob sie unveränderlich oder das logische Produkt irgendeines Genius loci wären. Ich bin davon ausgegangen, dass ich umfassende, auf den Erkenntnissen moderner Forschung beruhende Studien finden würde. Tatsächlich existiert aber nur eine Vielzahl von Chroniken, fachspezifischen Monografien sowie populärwissenschaftlichen Darstellungen der Stadtgeschichte. Davon erwiesen sich nur die jüngst erschienenen Monografien und eine Handvoll historischer Studien, nicht aber die Chroniken, als verlässliche Quellen; bestimmte Fehlangaben und Falschaussagen wurden immer aufs Neue wiedergegeben. Kurzum, ich musste eine eigene Methode entwickeln, um das vorliegende Material zu überprüfen, und mich auf Erinnerungsliteratur und literarische Werke stützen, um meine Aussagen zu untermauern.
Geologen bestimmen das Alter von Gesteinsschichten anhand der darin eingeschlossenen Fossilien, die für eine gewisse Epoche typisch waren und Anhaltspunkte liefern können. Auf vergleichbare Weise habe ich bestimmte »Arten« der Kunst und Literatur, Musik und Architektur, der Politik sowie statistisches Material herangezogen, um den Charakter verschiedener Phasen und Facetten des Wiener Kulturlebens sichtbar zu machen. Das Leben und Werk einzelner Persönlichkeiten, die entweder ihre eigenen Erinnerungen der Nachwelt hinterließen oder deren Leben in ausreichendem Maße dokumentiert ist, sollte die jeweilige Periode veranschaulichen: Franz Schubert, Johann Strauss Vater und Sohn, der Dichter Franz Grillparzer, der junge Hofmannsthal, Sigmund Freud am Beginn seiner Karriere, Franz Joseph I. und verschiedene Politikerinnen und Politiker, um nur einige Beispiele zu nennen. Ich hoffe, dass ich ihren Persönlichkeiten gerecht werden konnte. Zudem habe ich versucht, die harten wirtschaftlichen und sozialen Daten und Fakten, das Knochengerüst einer jeden Epoche, darzulegen, das in das weiche – und gelegentlich schlaffe – Gewebe des kulturellen Lebens gehüllt wird.
In Ergänzung der Quellen finden sich auch persönliche Eindrücke und Erfahrungen sowie Geschichten, die in meiner Familie väterlicherseits und mütterlicherseits weitergegeben wurden. Das erschien mir gerechtfertigt, weil ich schließlich darauf abzielte, das Ineinanderlaufen verschiedener Traditionslinien, den Einfluss weit zurückliegender Epochen auf spätere Generationen und die Art und Weise, wie Legende und Wirklichkeit auf die individuelle und kollektive Wahrnehmung wirken, zu untersuchen. Ich kann nicht leugnen, dass mir dieses Buch in gewisser Weise auch geholfen hat, meine persönliche Entwicklung besser zu verstehen. Bei dem Versuch, die Wurzeln sowohl positiver als auch negativer Wiener Eigenheiten freizulegen und unser gemeinsames Erbe zu beurteilen, stieß ich zwangsläufig auf meine eigenen Wurzeln und erkannte, was ich meinem Erbe verdanke. In diesem Sinne gibt es in meinem Buch ein autobiografisches Element. Ich habe auch meine Ansichten und Überzeugungen zum Ausdruck gebracht, aber gleichzeitig versucht, sie kenntlich zu machen, sodass die Leserin oder der Leser sie berücksichtigen kann. Es war meine feste Absicht, mich bei der Forschungsarbeit nicht von vorgefassten Meinungen leiten zu lassen; dass der eigene Zugang die Auswahl des Materials beeinflusst, ist unvermeidlich, aber auch hierbei habe ich meine Parteilichkeit hinterfragt und überprüft.
Etliche Personen haben mir mit Ratschlägen und Kritik geholfen, die ich hier gar nicht aufzuzählen versuche. Wenn ich einen Rat auch nicht immer befolgt habe, so habe ich ihn doch nie außer Acht gelassen. Letztlich liegt die Verantwortung für eventuelle Fehler ganz bei mir und ich möchte die Schuld freilich nicht auf die von mir sehr geschätzten Menschen abwälzen. Ich kann diesen Freundinnen und Freunden nur danken. Sie werden es mir hoffentlich nicht übel nehmen, wenn ich sie nicht einzeln erwähne, auch wenn sie es eigentlich verdienen würden. Es gibt eine Ausnahme: Professor Otto Erich Deutsch, der sich trotz seiner umfangreichen Tätigkeit freundlicherweise meinen Abschnitt über Schubert durchgesehen hat, möchte ich meinen aufrichtigen Dank aussprechen, da ich mich in einem solchen Ausmaß auf seine Forschungsarbeiten bezog, dass ich keine sachlichen Fehler riskieren konnte; das Risiko einer Fehlinterpretation trage ich natürlich selbst. In zwei weiteren Fällen, in denen ich direkte Hinweise von Forschern erhalten habe, ist dies im entsprechenden Abschnitt vermerkt.
Von den vielen Institutionen und Bibliotheken, die ich im Laufe der Jahre besucht habe, möchte ich dem Wiener Stadt- und Landesarchiv und der Wienbibliothek sowie dem Austrian Institute in London besonderen Dank aussprechen. Ohne ihre Hilfe wäre meine Arbeit unendlich erschwert worden. Im Stadtarchiv wurde mir Zugang zu unveröffentlichten Manuskripten und Dokumenten gewährt. Auch bei der Auswahl der Abbildungen wurde ich im Historischen Museum der Stadt Wien (dem heutigen Wien Museum, Anm. d. Hg.) fachkundig beraten. Entgegen den Gepflogenheiten möchte ich in erster Linie den Institutionen, nicht den Individuen Anerkennung ausdrücken, was aber meine persönliche Dankesschuld gegenüber all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mich tatkräftig unterstützt haben, in keiner Weise schmälern soll.
Dieses Buch, so umfangreich es auch ist, stützt sich auf eine überwältigende Fülle von Material. Viele Auszüge aus Tagebüchern oder Memoiren, viele Erlebnisberichte und nicht zuletzt längere Exkurse in die Geschichte des Habsburgerreichs, ohne die die Rolle und die Probleme Wiens so schwer zu fassen sind, mussten aus Platzgründen gestrichen werden. Zweifellos wird mich das Bewusstsein plagen, dass ich hie und da wichtige Persönlichkeiten unerwähnt gelassen habe. Andererseits ist die Tatsache, dass ich ihre schriftstellerischen Karrieren vom Anfang bis zum Ende nicht verfolgt habe, kein Ausdruck übermäßiger Verkürzung: Es war nie meine Absicht, eine Literaturgeschichte zu schreiben. Vielmehr wollte ich den Nährboden, das Milieu und die sozialen Verhältnisse aufdecken, die den Beitrag Wiens zur europäischen Kultur im Laufe der Geschichte ermöglicht haben.
Letztlich bietet das Buch nicht mehr als einen Abriss einer unendlich reichen Kulturgeschichte der Stadt Wien. Ich hoffe, es ist nicht meine unheilbare Liebe zu meiner Heimatstadt, die mich glauben lässt, dass Wien durch all das, was aus seiner Vergangenheit lebendig ist und auch in Zukunft lebendig bleiben wird, in der Welt von heute immer noch bedeutsam ist.
KAPITEL I
Die Anfänge Wiens
Der einfachste Weg, ein Verständnis für Wien zu entwickeln, besteht darin, von einem der westlich der Stadt gelegenen Hügel aus den Blick über das Donautal schweifen zu lassen und den so gewonnenen Eindruck der Landschaft in geschichtliche Begriffe zu übersetzen.
Der Leopoldsberg eignet sich als Aussichtspunkt. Er ist das letzte Glied der Hügelkette und für seinen steilen, zum Fluss abfallenden Hang, die große Kirche und seine Weinberge bekannt. Auf dem Gipfel erbaute Leopold III., Markgraf aus dem Haus der Babenberger und Herrscher über die Mark Österreich, zu Beginn des 12. Jahrhunderts eine Burg. Wien – einst ein kleiner römischer Außenposten namens Vindobona – war damals nicht mehr als ein Fischer- und Winzerdorf, aber innerhalb von vierzig Jahren verwandelten die Babenberger die Siedlung in eine Grenzfestung und ihren herzoglichen Sitz. So entstand die Stadt Wien. Fünfhundert Jahre später bildete Wien das unüberwindliche Hindernis auf dem Weg der türkischen Invasoren durch Europa. Am 12. September 1683 feierten dreiunddreißig Fürsten und Generäle, die eine internationale Armee befehligten, die Messe vor der Burgruine Leopoldsberg, bevor sie ihre bunt zusammengewürfelten Truppen den Hang hinunterführten und die türkische Belagerung durchbrachen. Die Türken zogen sich nach dieser Niederlage für alle Zeit in Richtung Osten zurück.
Wer den Cobenzl besteigt, wird ebenfalls mit einem herrlichen Blick über Wien belohnt. Der Cobenzl ist eine kleinere Erhebung am Hügelrücken und benannt nach Philipp Graf Cobenzl, einem wichtigen Förderer Mozarts. Der Graf kaufte das Anwesen am Cobenzl von den Jesuiten kurz vor der Auflösung ihres Ordens, baute eines ihrer Häuser in ein Château um und legte einen modischen »englischen« Park an. Dort oben verbrachte Mozart seine letzten sorgenfreien Tage im Sommer 1781, nachdem er seine Dienstbarkeit am Hof des Erzbischofs von Salzburg aufgekündigt hatte und sich in das abenteuerliche und glanzvolle Getümmel Wiens stürzen wollte. Viel später wurde das kleine Schloss in ein nicht wiederzuerkennendes Touristenparadies umgebaut. Nur die Hotelterrassen zeugten weiterhin von dem verblichenen Glanz. Unter ihnen breitete sich die Stadt wie ein Teppich aus.1
Kahlenberg und Leopoldsberg im 17. Jahrhundert, Matthäus Merian der Ältere
Als weiterer Aussichtspunkt bietet sich der Kahlenberg an, der Hausberg von Wien, ein beinahe so fixer Bestandteil der Wiener Tradition wie der »Stephansturm«, wie ihn Rosa Mayreder in ihrer typisch wienerischen Autobiografie nennt. Der Kahlenberg trägt seinen eigenen zusammengeflickten Mantel der Lokalgeschichte. Das auf seiner Kuppe thronende Kloster wurde 1683 von den Türken niedergebrannt; es wurde restauriert, nur um hundert Jahre später von Kaiser Joseph II. geschlossen und versteigert zu werden. Ein Unternehmer verwandelte die Zellen der kamaldulensischen Mönche in Gästezimmer für Leute von Rang, die ihren Lebensabend in einer gemütlichen Eremitage verbringen und das traditionelle Wiener Picknick unter Buchen genießen wollten. Im Jahr 1795 bezog Madame Vigée-LeBrun ein Zimmer, eine Malerin, die vor der Französischen Revolution und den folgenden Kriegen geflohen war. Sie bewunderte nicht nur die schöne Aussicht auf die Donau, »die von Inseln, deren reicher Pflanzenwuchs sie noch um vieles verschönerte, unterbrochen war«2, sondern war auch entzückt von der »Klugheit« der alten Mönche, »sich stets hochgelegene Wohnsitze auszusuchen«3. Der Kavalier, der ihr diesen idyllischen Rückzugsort empfohlen hatte, war Fürst de Ligne, ein belgischer Wahlwiener und erfolgloser General dreier Generationen von Habsburgern, der all seine Kraft bis zum Vorabend seines Todes darauf verwendete, Bonmots zu prägen, darunter das vielfach zitierte Epigramm des Wiener Kongresses: Le congrès danse, mais il ne marche pas (Der Kongress tanzt, aber er geht nicht weiter). Der Fürst fristete seinen ärmlichen, spröden Lebensabend nahe dem Zentrum des gesellschaftlichen Lebens und Treibens in einem rosafarbenen Rokoko-Bürgerhaus mit Blick über die westlichen Stadtmauern Wiens. Er besaß auch einen kleinen Landstrich – am Hang des Kahlenbergs, war er doch ein wahrer Connaisseur.
Eine Generation später schrieb der bedeutendste österreichische Dichter, Franz Grillparzer, einen mittelmäßigen Zweizeiler in das Album eines Freundes, an dem kein Buch über Wien vorbeikommt:
»Hast du vom Kahlenberg das Land dir rings besehn,
So wirst du, was ich schrieb und was ich bin, verstehn.«
Diese Zeilen sind nicht nur die kondensierte Form einer banalen Empfindung oder einer persönlichen Halbwahrheit. Sie erzählen etwas über Wien und die Wiener, das nicht sehr einfach zu vermitteln ist. Niemand war sich der widersprüchlichen Elemente in seiner Stadt und seinem Land schmerzhafter bewusst als Grillparzer. Das zeigen seine verbitterten Tagebucheinträge, die zu seinen Lebzeiten unveröffentlicht blieben, und das zeigen seine Stücke, die er in seiner Schreibtischlade unter Verschluss hielt. Er erkannte die Konflikte in seiner eigenen gespaltenen Persönlichkeit, diagnostizierte sie in den Spannungen unter der glatten Oberfläche der Bürokratie und des bürgerlichen Komforts, an dem er selbst Anteil hatte; und er sah, wie sich die Gegensätze in Harmonie auflösten, nach der er sich sehnte, wenn er auf die liebgewonnene Landschaft hinabblickte.
Im Süden, am äußersten Rand des flachen Beckens, ragen die Gipfel der letzten Ausläufer der Alpen empor. Sie sind so weit entfernt, dass ihr grauer Kalkstein in rauchblauem Farbton erscheint, und so nah, dass das Glitzern der Sonne in den ewigen Schneefeldern an trockenen, klaren Tagen sichtbar ist. Die antiken Straßen in Richtung Steiermark, Kärnten und Italien führen in diese Richtung. Von dort aus wurde der Sauerteig der mediterranen Zivilisation von italienischen Zuwanderern nach Wien gebracht, der das träge Tempo der Stadt beschleunigte. Doch es gibt noch eine andere, trügerische Botschaft, die der südliche Horizont überbringt: Die hohen, in Sichtweite liegenden Berge erinnern an Abgeschiedenheit und Größe. Ein Blick auf die fernen Alpen hatte die Kraft, die behagliche, selbstgefällige Eingrenzung des Alt-Wien aufzubrechen.
In Adalbert Stifters Roman Der Nachsommer, dessen Schauplatz das Wien der 1830er Jahre am Höhepunkt der bürgerlichen Häuslichkeit ist, lässt der junge Held das Bild der fernen Berge auf sich einwirken, lange bevor er sich auf den Weg macht, die Felsen und schneebedeckten Gipfel zu erobern:
»Auf einer Stelle der Basteien unserer Stadt kann man zwischen Häusern und Bäumen ein Fleckchen Blau von diesem Gebirge sehen. Ich ging oft auf jene Bastei, sah oft dieses kleine blaue Fleckchen«4.
Viele Generationen von Wiener Kindern bekamen während eines wenig aufregenden Familienausflugs am Kahlenberg ein erstes Gefühl von den großen Bergen – die mehr als »ein Fleckchen Blau« waren! – und verloren nie ihre Sehnsucht nach ihnen.
Östlich der Stadt breitet sich eine weite Ebene aus. Jenseits der Donau, ihren Inseln und verschlungenen Uferwäldern, erstreckt sich das Tiefland bis Ungarn und verschwindet in einem Nebel, der sich nie lichtet. Aus diesem strömten Invasoren aus Asien, Hunnen, Awaren, Magyaren, Türken, bis sich die Magyaren in den reichen Ebenen niederließen und die Türken vor den Mauern Wiens zurückgeworfen wurden. Aus Ungarn kamen später fettes Vieh, das weißeste Mehl, starke Weine und unbekannte Fische, roter Paprika, synkopische Rhythmen und östliche Musikinstrumente, edle Pferde und ganze Sippen von magyarischen Adeligen, die den Habsburgern am Hof, in der Armee und in der Verwaltung dienten, aber keine österreichische Identität entwickelten; sie bauten barocke Häuser in Wien und dominierten die feine Gesellschaft, ohne »echte Wiener« zu werden. Die Donau ist Europas traditionelle Handels- und Kriegsroute in den Nahen Osten. Zu Zeiten Metternichs wurde immer noch scherzhaft gesagt, der Orient beginne hinter der letzten Mautstelle Wiens.
Nordöstlich der Donau, die sich nach Südosten geradlinig durch die Landschaft gräbt, liegt das Marchfeld, ein landwirtschaftliches Anbaugebiet, das durch die blassblaue Linie der Kleinen Karpaten und der Hügel Mährens begrenzt wird. Graf Rudolf von Habsburg, der von den deutschen Fürsten zum König des Römisch-Deutschen Reiches gewählt worden war, besiegte 1278 am Marchfeld den großen König der Tschechen, Přemysl Ottokar II. von Böhmen. Diese Schlacht war von europäischer Bedeutung, denn sie entschied über die Zukunft des Heiligen Römischen Reiches und über die Zugehörigkeit Wiens zum Hause Habsburg. (König Ottokars Glück und Ende war das erste kontroversielle »patriotische« Stück von Grillparzer, mit dem er am Hof in Ungnade fiel.) Bauern und Handwerker kamen in der Folge tröpferlweise von Böhmen und Mähren nach Wien, bis die Industrielle Revolution das kleine Rinnsal in einen kräftigen Strom verwandelte. Die Zuwanderer aus dem slawischen Norden brachten ihren gerissenen Sinn für Humor, ihre Geigen, Lieder in Molltonart, ihre Fähigkeit zur harten Arbeit, eine Vorliebe für Bier und schwer im Magen liegende, mehlige Gerichte, ihre Sprachen und ihre Namen.
Am Fuße des Leopoldsbergs macht der Fluss eine Biegung, teilt sich in mehrere verzweigte Flussarme und tritt in das Wiener Becken ein. Vieles, was zur Entstehung der Stadt beitrug – Menschen, Güter und Ideen – kam auf dem Flussweg von Westen her. Es war die Wasserstraße der sagenumwobenen Nibelungen und ihrer historischen Entsprechung, den kolonisierenden und plündernden Feudalherren und deren Gefolgschaft, gelehrten Priestern und Mönchen aus reichen Abteien flussaufwärts sowie Kaufleuten und Handwerksgesellen aus bayerischen oder fränkischen Städten, die die Anfänge des städtischen Wien prägten. Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kamen die meisten Studenten aus österreichischen Städten auf der Suche nach einer Anstellung im Staatsdienst und nahmen in Linz das Ordinarischiff5 nach Wien. Auf diese Weise reiste auch Leopold Mozart mit seinen zwei Kindern und einem Klavier im Jahr 1762 nach Wien. Die musikalischen Wunderkinder sollten am Wiener Hof groß herauskommen. Der kleine Wolfgang bezauberte den Mautner am Kai des Donaukanals mit einem Menuett auf der Geige so sehr, dass der Mann das Klavier durch die Mautstelle winkte. Eine völlig andere Musikrichtung wurde von den Bootsleuten in die Hauptstadt gebracht, die auf riesigen Flößen die alpinen Nebenflüsse und die Donau hinunterfuhren und Holz für den Hausbau sowie Brennholz für die Haushalte Wiens transportierten. Aus ihren Dörfern brachten sie die Rundtänze, aus denen sich auf Wiener Boden der Walzer entwickelte.
Die Hügel, die den Blick auf das Flusstal stromaufwärts versperren, schützen zwar vor dem Nordwind, blockieren aber den Verkehr. Die alten Packstraßen mussten sich auf beiden Seiten der Hügel vorbeiwinden, und nur kleine Häuschen und Dörfer lagen verstreut in den ruhigen Tälern zwischen den endlosen Wäldern. Am spitz zulaufenden Gebirgsrücken des Leopoldsbergs und des Kahlenbergs fächern sich Buchenkämme auf, die sich südwestlich entlang einer flachen Ebene fortsetzen, bis sie auf die Alpenkette treffen, deren letzte östliche Ausläufer sie sind. Dieses ganze Gebiet ist der Wienerwald. Kein anderer Teil der landschaftlichen Umgebung hatte so großen Einfluss auf die Vorstellungskraft der Wiener wie der Wienerwald, der unmittelbar vor ihrer Haustüre liegt.
Die Stadt, zumindest der ältere Stadtkern, liegt zwischen den Hängen des Wienerwaldes und der Donau. Die modernen Industriebezirke haben sich über den Fluss in das staubige, windgepeitschte Flachland im Nordosten ausgebreitet. Dort liegt auch die Ebene, wo Napoleon 1809 bei Aspern seine erste Schlacht gegen die österreichische Armee unter der Führung des ruhmvollen Erzherzog Karl verlor. Daraufhin kehrte er in das von seinen Truppen bereits besetzte Wien zurück, gewann den Feldzug und den Frieden und heiratete schließlich die fügsame Tochter des österreichischen Kaisers, Marie-Louise.
Die Donau prägte die strategische und wirtschaftliche Lage der Stadt und ihre Beziehungen nach West und Ost. Sie erhielt einen völlig neuen Stellenwert, als die Wiener Legende um die Kaiserstadt an der Donau entstand, ganz besonders, nachdem Johann Strauss der Jüngere mit dem einprägsamen Titel seines Donauwalzers das gelb-grüne Wasser in ein magisches Blau verwandelt hatte; das Blau, das uns an verzauberten Herbstnachmittagen in seltenen Lichtblitzen entgegenfunkelt. Aber die Donau war für Wien nie, was die Themse für London, die Seine für Paris, der Tiber für Rom oder die Donau selbst für Budapest ist. Sie fließt nicht durch den Stadtkern. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, die Häuser der Mächtigen an ihren Ufern zu bauen. Das alte Wien entwickelte sich südlich des südlichsten Flussarms (des späteren Donaukanals) an einer nützlichen Wasserstraße, aber weit genug entfernt von den verheerenden Fluten des Hauptstroms. Fischer legten ihre Boote bei einer steilen Treppe an, die von den Stadtmauern zum Wasser hinabführte; ihre begehrten Süßwasserfische wurden zu den Märkten innerhalb des Festungswalls gebracht. Größere Boote konnten den engen Kanal nicht befahren. Ihre Passagiere mussten an einer weiter flussaufwärts gelegenen Stelle aussteigen und den Sicherheitskordon passieren, bevor sie die Stadt wirklich erreichen konnten. So war es über die Jahrhunderte, in denen Wien heranwuchs, und selbst noch unter dem Regime von Fürst Metternich; jedenfalls lange genug für die Herausbildung eines eigentümlichen Inseldaseins der Wiener Bevölkerung, ihrer konservativen Selbstgenügsamkeit und ihrer Vorliebe für die Hügel, die man den Ebenen jenseits der Donau vorzog, ganz egal, aus welcher Gegend man ursprünglich stammte.
KAPITEL II
Das Erbe des Barock
Im September 1716 unterbrach Edward Wortley Montagu, Gesandter seiner Majestät König Georg I. von Großbritannien an der Hohen Pforte1, seine transkontinentale Reise nach Konstantinopel in Wien, wo er knifflige diplomatische Geschäfte zu erledigen hatte. Der Habsburger Kaiser Karl VI. befand sich erneut im Krieg mit den Türken, die sein General Prinz Eugen von Savoyen zwanzig Jahre zuvor aus Teilen Ungarns zurückgeschlagen hatte.
Großbritannien war indes an der Wiederherstellung des regulären Handelsverkehrs im Nahen Osten interessiert – der Botschafter war zugleich Vertreter der Levant Company, einer britischen Handelskompanie. Eine weitere Expansion des Habsburgerreiches, die das europäische Mächtegleichgewicht stören würde, war nicht im Interesse Londons. Umgekehrt wollte man aber auch nicht, dass die österreichische Armee eine Niederlage erleidet, die dem französischen und spanischen Block einen größeren Handlungsspielraum einräumen würde. Wortley Montagu war damit beauftragt worden, den Ausbruch des Krieges zwischen Österreich und der Türkei mit diplomatischen Mitteln zu verhindern. Nun, da der Kriegsfall eingetreten war, sollte er sich um diskrete Vermittlungen bemühen.
Er verbrachte undankbare Monate in Wien. Nicht nur nahm der türkische Feldzug für die österreichischen Streitkräfte ein gutes Ende (der Krieg sollte 1718 mit einem Friedensvertrag enden, der das Habsburgerreich durch Gebietsabtretungen für kurze Zeit bis auf den Balkan ausdehnte), auch seine Friedensmission war aufgrund der Haltung des Kaisers zum Scheitern verurteilt. In diesen Jahren reifte im Umfeld des Kaisers die Überzeugung, dass die Macht der Habsburger wieder im Aufstieg begriffen sei. Man hatte sich im Optimismus noch nicht übernommen. Prinz Eugen verfolgte die ambitioniertesten Pläne für die Zukunft des Habsburgerreiches in Südosteuropa. Als Vertreter der Levant Company stand der britische Gesandte sofort unter Verdacht, protürkisch eingestellt zu sein. Außerdem war Karl VI. aufgrund der Erfahrung aus den Friedensverträgen von 1713/14, mit denen zwei Jahre zuvor der Spanische Erbfolgekrieg beendet worden war, auf die britische Diplomatie nicht gut zu sprechen. Zwar wurde den Habsburgern damals eine reiche Beute in Form der ehemaligen spanischen Besitzungen in den Niederlanden zugesprochen, aber Karl verlor aufgrund der Verträge die spanische Krone, auch wenn er nie aufhörte, sich als legitimer Herrscher Spaniens zu betrachten. Diese Haltung stieß bei seinen Untertanen in Wien auf wenig Sympathie. Sie empfanden eine tiefe Abneigung gegen die Männer und deren Gepflogenheiten, die dem Kaiser nach diesem Krieg von Spanien nach Wien gefolgt waren.
Als Karl nach dem frühen Tod seines Bruders, Kaiser Joseph I., die österreichischen Erblande zufielen und er zum deutschen Kaiser gewählt werden sollte, stellten sich seine britischen Verbündeten gegen ihn, als er seinen Anspruch auf den spanischen Thron nicht aufgab. Sie zogen eher vor, dass Spanien an einen Zweig der Bourbonen ging, als dass sie Zeugen einer Wiederauferstehung eines europäisch-transatlantischen Reiches würden, das noch mächtiger gewesen wäre als jenes von Karl V. Während die britische Außenpolitik die Aufrechterhaltung des Kräftegleichgewichts auf dem europäischen Kontinent anstrebte, verfolgte Karl VI. den Traum, den Universalanspruch des Römischen Reichs unter der Führung der Habsburger zu erneuern. Nachdem er im Westen aufgehalten worden war, wollte er im Osten vorstoßen. Gleichzeitig versuchte er, seine Stellung unter den deutschen Fürsten zu stärken. Bereits lange vor seinem Tod lag sein Traum in Trümmern. Einige der Territorialgewinne aus den Jahren 1713 und 1718 waren wieder verloren gegangen und die österreichische Monarchie war vor allem wegen ihrer eigenen Erbfolgeordnung in die Defensive geraten. Im Jahr 1716 erschien das Großmachtstreben von Karl VI. aber durchaus erfolgsversprechend. Wortley Montagu kam unter schlechten Vorzeichen nach Wien. Er konnte schwerlich die Hoffnung hegen, dass der Wiener Hof in seiner Gesamtheit ein rasches Kriegsende ohne entscheidende Zugewinne befürworten würde. Ihm blieb nicht viel mehr übrig, als Kontakte zu wichtigen Persönlichkeiten zu etablieren, die Prinz Eugen und seiner Strategie ablehnend gegenüberstanden.
Diese Entwicklung sorgte auch dafür, dass sich die junge geistreiche Frau des Botschafters, Lady Mary, in einem ganz bestimmten Kreis bewegte. Aus der umfangreichen Korrespondenz und dem Tagebuch aus ihrer Zeit an der Botschaft in Konstantinopel fertigte Lady Mary später ein Manuskript an, die sogenannten Embassy Letters, die posthum publiziert wurden. Auch wenn sie später editiert wurden, bewahren diese zum Teil fiktiven Briefe Lady Marys erfrischende, originelle, manchmal zwar ein wenig unzuverlässige, aber stets erhellende Eindrücke, die sie während der kurzen Blütezeit des Barock in Wien gesammelt hatte. Sie beschreibt in erster Linie das internationale Umfeld, in dem sie sich bewegte, und das offizielle Gesicht der Stadt. In England galt sie als unkonventioneller Geist, war eine nicht allzu bedeutende Satirikerin und stand gleichermaßen in Kontakt mit führenden Gelehrten und der Whigs-Aristokratie2, der sie von Geburt an angehörte.3 In Wien zeigte sie kein Interesse an den Menschen außerhalb der beau monde, auch nicht an den schönen Künsten, solange sie ihrem eleganten Leben nicht noch mehr Glanz verliehen. Dass sie in Wien, abgesehen von dem Franzosen Jean Baptiste Rousseau, einem Mitglied von Prinz Eugens Hofgesellschaft, keine Dichter kennenlernte, war nicht ihre Schuld; Wiener Schriftsteller waren kaum anzutreffen, auch wenn ihr adeliger Freundeskreis weniger exklusiv gewesen wäre. Lady Mary lässt in ihren Briefen keinerlei Anzeichen von Neugierde für die großen Architekten der Palais erkennen, die sie so bewunderte. Sie betrachtete diese Prunkhäuser kurz nach ihrer Fertigstellung und kannte ihre Bewohner. Durch ihre Augen gewinnen wir einzigartige Einblicke in das adelige Wien.
Lady Mary und Edward Wortley Montagu auf zeitgenössischen Ölgemälden
Lady Marys erster Eindruck von Wien war die Enge der Stadt:
»Diese Stadt, die die Ehre hat, des Kaisers Residenz zu sein, entsprach gar nicht meinen Vorstellungen; sie ist viel kleiner, als ich erwartet habe. Die Straßen sind sehr schmal und so eng, daß man die schönen Fassaden der Paläste nicht sehen kann, obwohl viele von ihnen wegen ihrer wahrhaften Pracht Aufmerksamkeit verdienten; sie sind alle aus herrlichem weißen Stein [sic!] gebaut und ungemein hoch. Da die Stadt für die Menge der Menschen, die in ihr zu leben wünscht, viel zu klein ist, scheinen die Baumeister diesem Mißgeschick dadurch abzuhelfen, daß sie eine Stadt über die andere türmen, die meisten Häuser haben fünf, manche sogar sechs Stockwerke. Sie können sich leicht vorstellen, daß durch die große Enge der Straßen die oberen Räume extrem dunkel sind, und was meiner Meinung nach eine noch unerträglichere Unzulänglichkeit ist, es gibt kein Haus, in welchem nicht fünf oder sechs Familien leben. Die Wohnungen der vornehmsten Damen und sogar die der Staatsminister sind nur durch eine dünne Wand von denen eines Schneiders oder Schusters getrennt und ich kenne niemanden, der in einem Haus mehr als zwei Stockwerke besitzt, eines für den Eigenbedarf und eines darüber für die Dienerschaft. Jene, die ein eigenes Haus besitzen, vermieten den nicht beanspruchten Teil an wen immer, so daß die großen Treppen (die alle aus Stein sind) ebenso gemeinschaftlich und schmutzig sind wie die Straße.«4
Unabhängig davon, ob es sich um eine gedankenlose Verallgemeinerung, eine scharfsinnige Beobachtung oder einen einfachen Irrtum handelt, ist diese Beschreibung relevant, da sie den unmittelbaren Eindruck wiedergibt, den die Stadt auf eine intelligente Außenstehende machte.
Es stimmt nicht, dass die »meisten« Wiener Stadthäuser fünf Geschoße hatten. Aufzeichnungen der Stadtgemeinde und die pedantischen Stiche jener Zeit zeigen, dass der Großteil der Stadt aus drei- oder viergeschoßigen Gebäuden bestand, während viele ältere Wohnhäuser mit nur zwei Geschoßen und einem Giebel im Schatten der höheren Nachbarsgebäude standen. Wahr ist, dass die Menschen in Wien lange Zeit nicht in eigenen Häusern, sondern in Wohnungen lebten. Das traf selbst auf diejenigen Hauseigentümer zu, die nur ein Geschoß bewohnten oder nur in einer Wohnung lebten und den Rest des Hauses vermieteten. Und es ist ebenfalls wahr, dass die neu bebauten Straßen den Eindruck erweckten, als würden die Dächer benachbarter Häuser in gleicher Höhe aneinander anschließen – eine Illusion, die dazu verleitete, die Altstadt als reine Ansammlung von Palais darzustellen.
Lady Mary behauptet, die Räume in den Obergeschoßen der hohen Gebäude, die sich in den engen Gassen gegenüberstehen, wären besonders dunkel gewesen. Durch die hohen Fenster im ersten Stock, dem piano nobile, mit seinem kunstvollen Balkon, oder im zweiten Stock mit einer nicht geringeren Deckenhöhe drang aber weniger Sonnenlicht als durch die niedrigen Fenster in den oberen Geschoßen. Und doch lag Lady Mary mit ihrer Feststellung nicht ganz falsch. Die engen kleinen Räume unter dem Dachgesims boten einen guten Ausblick vom Fenster, die hinteren Teile des Raumes waren aber düster und dunkel. Im Grunde genommen wurden sie oben auf das Gebäude »draufgeklatscht«, weil der Hauseigentümer noch für das kleinste Loch irgendwelche Mieter finden würde. Joseph Haydn lebte als junger Mann in einer solchen engen, unbeheizten Dachkammer. Er gab dem spanischen Mündel des Hofdichters Metastasio Klavierunterricht, um Essen und Miete bezahlen zu können. Das Gebäude steht noch und aus den zeitlich aufeinander folgenden Stichen geht hervor, welches Geschoß zu welcher Zeit aufgestockt wurde – und wie der katholische Orden, dem das Große Michaelerhaus gehörte, aus dem wertvollen Grundstück wirtschaftlichen Nutzen zog.
Lady Mary bewunderte den schönen »weißen Stein« der neuen Palais. In Wirklichkeit wurden die Ziegelmauern mit feinem Stuck überzogen, der damals noch weiß gefärbelt war. Erst im Zeitalter der Vernunft unter Joseph II. setzte sich das zweckmäßigere Grau durch, noch später ein starkes Gelb. Womit Lady Mary aber zweifelsohne richtig lag: Das barocke Wien war eine »weiße« Stadt, in der helle Farben dominierten. Fünfundfünfzig Jahre später, lange nach dem großen Bauboom, als die Euphorie der kaiserlichen Erfolge wieder abgeklungen war, beschrieb der vielgerühmte Musikhistoriker Charles Burney diese Tatsache auch in seinem Tagebuch.
Burney, der sich sonst nur wenig um nicht-musikalische Belange kümmerte, verlor ausnahmsweise ein paar Worte über »Wien an und für sich selbst«, denn: »Diese Hauptstadt des Reichs […] ist so weit von England entfernt, ist von Reisebeschreibern so unvollkommen beschrieben, und wird so selten von Engländern besucht«5. Er hätte auch einfach sagen können, dass Wien nicht Teil der Grand Tour war. Hier ist ein Auszug aus Burneys Tagebuch:
»Die Gassen sind so enge, und die Häuser so hoch, daß sie dadurch beydes sehr finster und kothig werden. Da die Häuser aber grössesten Theils von weissen Steinen [hier wiederholt sich Lady Marys Fehler, Anm. I. B.], von gleichförmiger und zierlicher Bauart sind, in welcher sowohl als in der Musik hier, der italiänische Geschmack hervorsticht: so haben sie etwas Grosses und Prächtiges von Ansehn, und fallen schön in die Augen. Selbst viele von den Häusern, welche an der Erde Kramläden haben, scheinen von oben Palläste zu seyn. In der That scheint die ganze Stadt, mit den Vorstädten, beym ersten Anblick, mehr aus Pallästen, als aus ordentlichen Wohnhäusern zu bestehen.«6
Die Legende von Wien als Stadt der Palais und des Adels ersetzte bald schon die Wirklichkeit des 18. Jahrhunderts. Sie wurde durch die visuelle Wirkung der Fassade Wiens untermauert und hat tatsächlich einen wahren Kern. Prachtvoll, majestätisch, elegant – eine Stadt der Palais, ungeachtet der dunklen, engen Gassen und der Geschäfte im Erdgeschoß: So haben sich die Baumeister der Ära Karls VI. in die Architektur der Stadt eingeschrieben. Da Wien aber dicht besiedelt und bebaut war und – zumindest innerhalb der Festungsmauern – kaum Platz zur Verfügung stand, mussten sie architektonische Lösungen entwickeln, die trotz der bescheidenen Dimensionen den Eindruck ehrwürdigen Prunks erweckten.
Diese Einschränkung drängte sie dazu, ornamentale Bauteile nur sparsam einzusetzen und auf den extravaganten Churriguerismus des spanischen Spätbarocks zu verzichten. Nur wenige Baumeister konnten den repräsentativen Stil der Außenfassaden (und gelegentlich der Treppen) zur Anwendung bringen. Die treibende Kraft hinter der großen Bau- und Umbautätigkeit war die enorme Zuwanderung, die auf dem Wohnungsmarkt Druck erzeugte. Die Stadt war »für die Menge der Menschen, die in ihr zu leben wünscht, viel zu klein«7.
Die materiellen Bedingungen – nicht der Genius loci – erzwangen eine Entwicklung, die dem Wiener Barock ungeachtet seiner italienischen Ursprünge und französischen Einflüsse einen unverkennbaren lokalen Anstrich verlieh.
Auf engstem Raum schufen die Architekten raffiniert gewölbte und gewendete Treppen, die sich für die prächtigsten Empfänge eigneten. Aber nur in wenigen Palais waren sie für die Eigentümer und deren Gäste allein reserviert. Nur wenige Stadthäuser in adeligem Besitz waren von der lästigen Pflicht ausgenommen, der zufolge ganze Geschoße für die Einquartierung des Hofpersonals zur Verfügung gestellt werden mussten; viele junge Herren aus dem Ausland und Angehörige von erfolgreichen Höflingen suchten eine Wohnung, die ihren sozialen Ansprüchen genügten, und fanden diese in den Häusern ihresgleichen, die froh waren, mit den Mieteinnahmen die Baukosten wieder hereinbringen zu können. Die einfacheren Neuankömmlinge zahlten gutes Geld für eine Unterkunft mit Ausblick in den Hinterhof, ein Kellerzimmer oder eine Dachkammer. Der Wohnungsmarkt, der von Klassenlinien durchzogen war, ermöglichte ein gewinnbringendes Geschäft. Wie in vielen Pariser hôtels oder italienischen palazzi lebten Adelige und Bürgerliche, Vornehme und Handwerker Tür an Tür unter einem Dach.
Im Adelsviertel nahe der kaiserlichen Hofburg lag die vornehmste Gasse, die Herrengasse, in der sich auf beiden Seiten ein Palais an das nächste reihte. Im Jahr 1649, während der ersten Welle des großen Baubooms, landete ein deutscher Bildhauergeselle in Wien und arbeitete vierundvierzig Wochen in der Werkstatt eines Wiener Bürgers und Bildhauermeisters, der mit seinen Gesellen in der Herrengasse lebte. Die anderen fünf Gesellen kamen aus Oberösterreich, Tirol, Schwaben, Bayern und Böhmen. Kein einziger war gebürtiger Wiener! Der junge Wanderbursche, der all das in seinem Tagebuch vermerkte, zog bald darauf weiter, aber der eine oder andere seiner Kameraden ließ sich wohl, wie so viele andere fremde Handwerker, in Wien nieder. Innerhalb und außerhalb der Stadtmauern wurde ein neues Palais nach dem anderen hochgezogen. Die Nachfrage nach Skulpturen für die Dächer, Balkone und Treppenhäuser und nach Figuren, die die Eingänge flankierten, stieg. Wo sollten die nachgefragten Handwerker untergebracht werden, wenn nicht in den Nebengebäuden im Hinterhof oder in den Dachkammern der Herrenhäuser, die sie ausschmückten?
Die soziale Durchmischung wurde dem Adel zu einer Zeit aufgezwungen, als die gesellschaftliche Rangordnung noch nicht in Stein gemeißelt war, wie es später der Fall sein sollte. Vielen Familien gelang der soziale Aufstieg und dazu kamen die vielen neu in den Adelsstand erhobenen Favoriten des Hofes. Die soziale Differenzierung der einzelnen Stände musste aber irgendwie zum Ausdruck gebracht werden. Daher suchten die Eigentümer großer Stadthäuser bei den Behörden um eine Genehmigung an, die engen Gassen mittels schwerer Eisenketten, die vor dem Gebäude zwischen steinernen Pollern gespannt wurden, noch enger zu machen. Eine hochrangige Stellung musste sich in der Größe und Einrichtung der Wohnung widerspiegeln (vor allem, wenn Mieter verschiedenen Standes unter einem Dach lebten). Einmal mehr können wir Lady Mary als Zeugin heranziehen. Sie ist beinahe die einzige, die dieses Phänomen im Detail beschreibt:
»Wahr ist, hat man die Treppen einmal hinter sich, kann nichts von überraschenderer Pracht sein als die Wohnungen. Sie bestehen meistens aus einer Suite von acht bis zehn großen Räumen, alle mit eingelegten Parkettböden, die Türen und Fenster sind reich geschnitzt und vergoldet, die Einrichtung so wie man sie nur selten in den Palästen regierender Fürsten in anderen Ländern antrifft: Die Tapeten, die schönsten Tapisserien aus Brüssel, ungeheuer große Spiegel in Silberrahmen, schöne japanische Tische, die Betten, Stühle, Baldachine und Vorhänge aus reichstem Genueser Damast oder Samt, beinahe ganz mit goldener Spitze oder Stickerei bedeckt«.8
Das ist die erste persönliche Beschreibung, die wir über den Lebensstil des in Wien ansässigen Hochadels haben, wobei er unmöglich als »Wiener Adel« bezeichnet werden kann, da die meisten Adelsfamilien Anfang des 18. Jahrhunderts noch nicht lange in der Stadt lebten und ihre Wurzeln anderswo lagen. Lady Mary, eine geborene Pierrepoint, Tochter des fünften Earl of Kingston, schätzte dieses weltoffene Umfeld, sparte aber auch nicht mit Kritik:
»Es ist wahr, die Österreicher sind im allgemeinen weder das höflichste, noch das angenehmste Volk der Welt, aber Wien wird von allen Nationen bewohnt und ich hatte mir selbst eine kleine Gesellschaft gebildet, die meinem Geschmack vollkommen entsprach, und obwohl ihre Zahl nicht sehr groß war, hätte ich an keinem anderen Ort so viele vernünftige und angenehme Menschen finden können.«9
Der erste Prominente, den sie in ihren Embassy Letters erwähnt (und dessen Namen sie falsch schreibt) ist ein gutes Beispiel für diese kosmopolitische Aristokratie. Es handelt sich um einen Wahlwiener, der am Ende seines Lebens wieder ins Ausland ging, aber seine Spuren im kulturellen Leben der Stadt und in ihrer Architektur hinterließ: der kaiserliche Reichsvizekanzler Friedrich Karl Graf von Schönborn. Er war der jüngere Sohn aus einem der wichtigsten katholischen Häuser in Westdeutschland, einer Familie von Herrschern, Diplomaten, Baumeistern, Kunstkennern und zumindest einem kirchlichen Kurfürsten und einem Mitglied im Dienst des Kaisers. Dieses Geschlecht konnte in der Tat auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken. Graf Friedrich Karl war außerdem Fürstbischof zweier fränkischer Diözesen, pflegte aber einen äußerst weltlichen Lebensstil. Sein Nachkomme Sir Georg Franckenstein schreibt in seinen Memoiren, dass sein Vorfahre in Wien mehrere Palais erbauen ließ, in denen er prächtige Feste gab; »seine Maskenbälle galten als die schönsten in Wien«10. Nach seiner Pensionierung zog der Graf in seine berühmte fürstbischöfliche Würzburger Residenz, von wo er seinem Bruder klagte: »Ich kann mich an meinen Fürstenkäfig noch nicht gewöhnen und eine große Traurigkeit hängt mir von Wien an.«11
Als der Graf erstmals an den Hof von Kaiser Leopold I. kam, um als Diplomat zwischen der Krone und den deutschen Landständen zu vermitteln, brachte er reiche Kultur und einen edlen Geschmack mit nach Wien, das damals noch eine rückständige Grenzstadt war. Das Stadthaus, das er schon eine Zeit lang bewohnte, bevor er es von der Gräfin Batthyány erstand, war nicht sonderlich groß. Um 1700 modernisierte Fischer von Erlach das Haus in der schlichtesten, nahezu klassizistischen Version des Barock, und Schönborn ließ es später nicht mehr den neuen Moden gemäß umgestalten. Und so steht es heute noch: klein und tief, einigermaßen geduckt, mit Rustika bedeckte Außenmauern, einfache Säulen, die das leicht gewölbte Portal flankieren, vier Relieffelder über dem Fenster des großen Empfangsraums und, als eine Art künstlerisches Gegenstück, prunkvolle Arabesken, die die Kapitellen der sechs Pilaster umranken. Es ist vielleicht das dezenteste und zeitloseste unter den Wiener Stadtpalais.
Bedeutsamer für die Herausbildung des in Wien üblichen Stils war Schönborns Sommerresidenz. 1706 kaufte er in der Vorstadt ein altes Landhaus samt Garten, das sein Lieblingsarchitekt, Lucas von Hildebrandt, in ein reizendes, fast schon trautes Gartenpalais umwandelte. Selbst zwischen den beiden Weltkriegen versprühte es mit seinem grauen, abblätternden Stuck eine schwerelose Eleganz. Als es noch strahlend weiß war, repräsentierte es einen völlig neuen Stil. 1716 dinierte Lady Mary Wortley Montagu dort:
»Gestern war ich im Park des Vizekanzlers Grafen Schönbrunn [sic!], bei dem ich zum Dinner eingeladen war und ich muß gestehen, daß ich noch niemals etwas so vollendet Entzückendes gesehen habe wie die Vorstädte Wiens. Sie sind sehr weitläufig und bestehen beinahe gänzlich aus schönen Palästen; fände es der Kaiser richtig, die Stadttore zu schleifen und die Vorstädte mit der Stadt zu vereinigen, so hätte er eine der größten und schönst gebauten Städte Europas. Graf Schönbrunns [sic!] Landsitz ist einer der prächtigsten«.12
In den Vorstädten rund um Wien standen damals etwa zweihundert Sommerpalais und »Villen«. Lady Mary sah sie in besonders konzentrierter Dichte von einem Aussichtspunkt aus. Nachdem sie die Felder des Glacis, die unbebauten Flächen vor der Festungsmauer, überquert hatte, muss sie an Fürst Trautsons Sommerresidenz vorbeigefahren sein. Wahrscheinlich ging es dann weiter an der Paarschen Reitschule vorbei; auf einem nicht sehr schönen Stich aus dieser Zeit ist der formale Repräsentationsgarten abgebildet, in dem Damen mit steifen Reifröcken und Herren mit Perücken zu sehen sind, die sich die spanischen Rösser anschauen, während sich ein kleiner schwarzer Sklave bückt, um einer Dame das Taschentuch aufzuheben – er könnte Modell gestanden haben für den kleinen »Mohren«, der in der Schlussszene des Rosenkavaliers auf die Bühne kommt, ein Taschentuch aufhebt und wieder hinaustrippelt. Das Sommerpalais der Rofranos, das später nach einem Umbau als Palais Auersperg bekannt wurde, stand nicht weit von hier. Lady Mary hat wohl einen Blick auf den formalen Garten geworfen, der voll farbenfroher Blumen und in Brokat gefasster Herrenröcke und Reifröcke war, die sich im weichen Licht der blau-goldenen Septemberluft bewegten. Die kleineren glanzvollen Gartenpalais und Villen, die zwischen juwelenbesetzten Blumenbeeten, Goldfischteichen, sinnlichen Statuen und Spazierwegen lagen, die von gestutzten Eiben, Ahornbäumen, Hainbuchen oder Linden gesäumt und beschattet wurden und hinauf zu einem niedlichen Pavillon oder hinunter zu einem gastlichen Haus führten, sorgten für eine ideale Kulisse. In der Stadt war das Leben vornehmer, mit Ausnahme der hektischen Wochen in der Faschingszeit aber auch langweiliger. Nur die Gräfin Rabutin und die Gräfin Althan versuchten nach Pariser Vorbild Unterhaltung für die gehobene Gesellschaft zu bieten, aber diesen assemblées mangelte es an Intellekt und Interessen. Lady Marys ungezwungene Kommentare bezüglich ihrer Besuche in den beiden Salons vermitteln ein Gefühl der Leere, das durch Eiscreme, Kartenspiele und seichte Konversationen, in denen die Alchemie noch das hochtrabendste Gesprächsthema bildete, abgeschwächt wurde. Auch vor den Kleidern der Damen machte Lady Marys spöttischer Tadel nicht halt. Niemals in ihrem Leben sah sie »so viele kostbare geschmacklose Kleider.«13
Man kann diese Aussagen nicht für bare Münze nehmen. Die Wiener Hofgesellschaft orientierte sich an der steifen Mode Spaniens und noch nicht an jener aus Frankreich, geschweige denn aus England. Lady Marys Bemerkungen blieben, wie es scheint, nicht unbeantwortet. Kurz vor der Abreise der Wortley Montagus berichtete der britische Botschafter in Wien, Abraham Stanyan, in einem Brief:
»Lady Mary ist ständig in aller Munde. Sie hält an ihrer englischen Mode und ihren Umgangsformen fest, womit sie sich ein wenig dem Gespött der Wiener Damenwelt aussetzt. Sie antwortet darauf mit einer guten Portion Humor und führt eine Art Kleinkrieg; aber die anderen Damen räumen ein, dass sie, wenngleich keine gut gekleidete, so doch eine geistreiche Frau ist.«14 (Übers. d. Hg.)
Wenn Stanyan mit dem »Kleinkrieg« unter den Damen richtig lag, müssen einige der von Lady Mary aufgezeichneten Beobachtungen – über die Hässlichkeit der Wienerinnen, deren erotischen »Marktwert« im fortgeschrittenen Alter, die dirnenhaften Liebesaffären der Ehefrauen, die Jagd nach einem Verlobten mit ehrwürdigem Stammbaum, der überzogene Standesdünkel usw. – mit entsprechender Vorsicht genossen werden. Jedenfalls war ihre Wahrnehmung von ihren Bedürfnissen nach Selbstbehauptung geprägt: Lady Mary war mit ihrer Ehe unzufrieden, ihr Verstand und ihre Leidenschaft standen in Konflikt zueinander und in Wien wurde sie unter dem Eindruck dieser Spannungen überhaupt sehr streitlustig. Das ist natürlich eine Vermutung. Aber ich glaube, auf recht sicherem Boden zu stehen, wenn ich annehme, dass eine Ursache sowohl für diesen »Kleinkrieg« als auch für die mangelnde Zuverlässigkeit ihrer kritischen Kommentare über die Wiener Gesellschaft im Scheitern der Mission ihres Ehemanns zu suchen ist. Sie war enttäuscht; sein Scheitern kostete beide die Verlängerung ihres Aufenthalts und die Arbeit in der Türkei. Nichtsdestotrotz bleibt sie die wichtigste Augenzeugin jener Epoche, die das Gesicht der Stadt Wien nachhaltiger prägte als spätere Epochen, die stärker zur Legendenbildung beitragen sollten.
In ihren Embassy Letters finden sich Namen, die politische Cliquen und Strömungen repräsentierten. Die Althans, Gastgeber jener »Galatage«, die Lady Mary in ihren Briefen kritisierte, waren eine wichtige Familie, die mit mehreren böhmischen Fürstenhäusern verbunden war. Graf Michael III. stammte aus einer Familie großer Feudalherren in Mähren, war Oberstallmeister und ein Favorit des Kaisers. Seine in Spanien geborene Frau soll die Geliebte des Kaisers gewesen sein. Die böhmischen Adeligen wurde in Wien immer einflussreicher – was sich nicht zuletzt in einer wachsenden Zahl an Palais in ihrem Eigentum ausdrückte, die rund um die Jahrhundertwende erbaut wurden – und stand in Opposition zum politischen Kurs von Prinz Eugen von Savoyen. Da Karl VI. selbst auch nicht sonderlich angetan war von einem Mann, der ihn überstrahlte und so seine Würde als neuer Cäsar verletzte, wurden die Ränkespiele bei Hof zusehends erfolgreicher. Für die Durchsetzung von Wortley Montagus diplomatischen Zielen reichte es dennoch nicht. Es lag auf der Hand, dass er und seine Gattin hofften, mit derjenigen Gesellschaft eine gemeinsame Basis zu finden, die sich im Salon der »spanischen Althan« – wie die Gräfin von den Wienern mit demselben abschätzigen Unterton bezeichnet wurde wie die spanische Entourage des Kaisers – versammelte.
Alle Minister, die zu Prinz Eugens Gegenspielern gezählt werden konnten, finden bei Lady Mary lobende Erwähnung. Sie hätten mit ihrem Einfluss im Hofkriegsrat die Oberhand gewinnen und die Militäroffensive gegen Belgrad, die Wortley Montagus Friedensinitiative so unzeitgemäß erscheinen ließ, doch noch stoppen können. In der Praxis setzten sie sich aber nicht durch. Sofern die Briefe, die Lady Mary von Wien nach London sandte, überhaupt eine Ähnlichkeit mit der editierten Version hatten, verfolgte sie mit den scheinbar arglosen Porträts sehr wohl einen politischen Plan; die gegen Prinz Eugen gerichtete Fraktion sollte unterstützt werden. (Eine Ausnahme stellte ihre neckische Beschreibung des jungen charmanten Portugiesen Graf Tarouca dar, der dem Klatsch und Tratsch zufolge ihr Liebhaber gewesen sein soll – und den sie Tarroco nannte.)
Eine Frau, die in Wien genauso einflussreich war wie die Gräfin Althan, wurde als Freundin des Prinzen Eugen von Lady Mary mit keinem Wort erwähnt: Eleonora Magdalena Gräfin Batthyány, die »schöne Lori«, Tochter und Erbin von Graf Strattmann, dem Kanzler von Leopold I., Witwe und Erbin von General Adam Graf Batthyány, einem ungarischen Magnaten und Ban von Kroatien, Dalmatien und Slawonien. Lady Mary dürfte aber in einem Brief, in dem sie auf Prinz Eugen eingeht, eine Anspielung gemacht haben:
»Ich bin ebenso wenig gewillt in Wien über ihn zu sprechen, als ich hätte über Herkules sprechen mögen, wenn ich ihn am Hofe der Omphale getroffen hätte. Ich weiß nicht, welchen Trost andere Menschen in der Betrachtung der Schwachheit großer Männer finden, weil sie dieselben auf das gleiche Niveau mit sich bringen; mir ist es allemal eine Kränkung, wenn ich merke, daß nichts Vollkommenes in der menschlichen Natur ist.«15
Als Meisterin im Verfassen von Schmähschriften desavouierte sie den Prinzen in jeder noch so kleinen Bemerkung. Während ihres Aufenthalts in Wien besuchte sie seine Bibliothek, deren gekünstelten und »geckenhaften« Geschmack sie in einem Brief verurteilt. Auch wenn die Sammlung »nicht sehr umfangreich« sei, beschreibt sie die in Maroquin gebundenen Bände als »prunkvoll«.16 Indirekt zollt sie ihm, wenn auch widerwillig, Respekt, womit sie ihm eine Art schwefeligen Nimbus verleiht. Er war eine einsame Gestalt abseits der Kriege, ein eigenartiger, ernster Mensch, ein Machtmensch, der Spannungen erzeugte, in einer Stadt und Gesellschaft, die die Entspannung vorzog.
Auf dem Gebiet der Förderung der Architektur gehören all die von Lady Mary genannten Namen zur Geschichte des barocken Wien. Das Auf und Ab im wirtschaftlichen und politischen Geschick der Adelsfamilien führte zu ständigen Verschiebungen des Immobilieneigentums. Und jeder Eigentümerwechsel ging einher mit neuen Aufträgen für Künstler und Handwerker.
Als der dreißigjährige gebürtige Grazer Johann Bernhard Fischer, der in Rom bei Meister Bernini in Ausbildung war, 1678 nach Wien kam, waren seine ersten bedeutenden Bauherren die Liechtensteins, die Althans und der Hofkanzler Graf Strattmann – also die großen Namen am Hof von Leopold I.17
Johann Bernhard Fischer von Erlach, ca. 1723
Johann Michael II. Graf Althan machte Fischer ausfindig (»Er ist der Bursche, der 16 Jahre in Rom bei dem Cavaglier Bernini war?«, fragte er in einem Brief), als dieser bei einem Bildhauer im ältesten und dunkelsten Teil von Wien wohnte. Einige Jahre später beauftragte ihn Althan mit dem Umbau seines Stammschlosses in Mähren, das einen riesigen Ahnensaal mit ovalem Grundriss und eine Kuppel erhielt, die die Pracht des Hauses zur Geltung bringen sollten. Ungefähr zur selben Zeit gab ein anderer Althan, Christian Joseph, Fischer die Gelegenheit, außerhalb der Ringmauer in den niedrigen Hügeln der westlichen Vorstadt Althangrund ein Gartenpalais von Grund auf neu zu errichten.18 Fischer plante ein kleines Traumschloss mit einem italienischen Flachdach, einem ovalen Mittelteil und vier windmühlenartig angeordneten Flügeln. Das Gebäude stand wie ein Fremdkörper in der Landschaft und bald schon war es aufgrund des vielen Regens und Schnees notwendig geworden, ein Schrägdach anzubringen, das sich befremdlich von der klassizistischen Balustrade und Bildhauerkunst abhob. Trotzdem war es eines der ersten Gartenpalais, das einen Trend setzte, der anhalten sollte, bis sich Lucas von Hildebrandt, der Schützling des Grafen Schönborn, der Aufgabe widmete, einen in seinen Proportionen leichteren, besser zu Wien passenden Stil zu entwickeln. Vielleicht waren es die vielen nach italienischem Vorbild erbauten Barockpalais, die den venezianischen Arzt und Reiseschriftsteller Niccolò Madrisio 1718 glauben ließ, »mitten in Österreich ein wenig italienische Luft zu atmen. Ein gewisser nordischer Einschlag, der in der Architektur bemerkbar ist, vermindert nicht ihren Reiz, sondern vermehrt ihn.«19





























